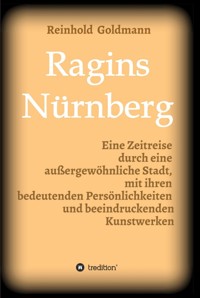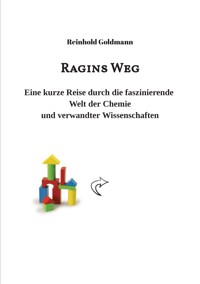
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein kleiner Junge träumt von großer Wissenschaft. Über Umwege gelingt es ihm Naturwissenschaften zu studieren. Auf dem Weg zu seinem Ziel begegnen ihm einige seiner historischen Vorbilder, die er befragt und deren Lebenswege er kennenlernt. Ausgewählte wissenschaftliche Arbeiten werden von ihm erklärt, aber auch kritisch hinterfragt. Seine eigenen Arbeiten und Erkenntnisse ergänzen dieses Werk. "Ragins Weg" ist ein Buch auch für diejenigen, welche bisher wenig Vernünftiges über Chemie und andere Naturwissenschaften gehört oder diese nie so recht verstanden haben. Es handelt sich um kein Lehrbuch. Doch der Autor versucht mit ausgewählten Themen Interesse zu wecken und zu weiterer Beschäftigung mit den Inhalten anzuregen. Das Buch soll aufzeigen, dass die Naturwissenschaften verständlich sein und große Freude bereiten können. Es war und ist für Ragin sehr ärgerlich, wenn Prominente sich damit brüsten Mathematik oder naturwissenschaftliche Themen nie verstanden zu haben. Etwas verstehen zu wollen, erfordert natürlich auch ein bisschen Denkarbeit. Bequemlichkeit kann geistige Beweglichkeit abtöten. Aber neben körperlicher Fitness gehört auch geistige Übung zu einem gesunden Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ragins Weg
Eine kurze Reise durch die faszinierende Welt der Chemie und verwandter Wissenschaften
2. Auflage
Inhalt
Einleitung
Ragins Jugend
Einflüsse durch Eroberungen und Kriege
Alexander der Große
Die Hunnen
Die Mongolen
Ausrottung indigener Völker
Kriege im Geschichtsunterricht
Deutsche gegen Deutsche
Chemophysikalische Waffen
Phosphorbomben
Die Entwicklung der Atombombe
Konstruktion atomarer Waffen
Reaktionen auf die Kernwaffeneinsätze
Die Wasserstoffbombe
Die Kernfusion
Erstaunliche Technik
Radiowellen
Strahlungsbelastung
Weiterbildung als Herausforderung
Schulische Bildung
Schulen in Mesopotamien
Unterricht im früheren Ägypten
Bildung im antiken Griechenland
Schulen im Römischen Reich
Deutsche Schulen
Entwicklung der Naturwissenschaften
Ägypten und die Mathematik
Imhotep
Ursprung der Schrift
Die Bibliothek von Alexandria
Aktueller Datenklau
Das antike Griechenland
Archimedes
Das archimedische Prinzip
Die Kreiszahl ?
Die archimedische Schraube
Der Kampf um Syrakus und Archimedes Tod
Aristoteles
Die aristotelische Logik
Aristotelische Ideen zur Form der Erde
Eratosthenes und der Erdradius
Das Sieb des Eratosthenes
Eratosthenes als Philologe
Euklid
Schritte zum atomistischen Denken
Leukipp
Demokrit
Dalton
Wege zur modernen Astronomie
Kopernikus
Kepler
Galileo Galilei
Newton
Alchemie
Begrifflichkeiten
Der Stein der Weisen
Hennig Brand
Johann Friedrich Böttger
Die Urelemente
Weitere Elemente der Alchemie
Phlogiston
Alchymey teuczsch
Paracelsus und die Gifte der Natur
Die Alchemisten
Schwarzpulver
Peroxide
Lavoisier
Kenntnisse der Alchemisten
Periodensystem der Elemente
Mendelejew und Lothar Mayer
Das Bohrsche Schalenmodell
Das Orbitalmodell
Stabilität der Atomkerne
Das Innere der Atome
Die Radioaktivität
Beta-Zerfälle
Alpha-Zerfälle
Gamma-Strahlung
Atomhülle
Chemische Reaktionen
Molmasse und Molvolumen
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen
Die Schrödinger-Gleichung
Quantenchemisch berechnete Atomorbitale
Orbitalbezeichnungen
Atome, Moleküle, Verbindungen
Atomaufbau
Isotope
Alkalimetalle
Halogene
Salze
Erdalkalimetalle
Chalkogene
Atombindungen
Die metallische Bindung
Legierungen
Metalle
Halbmetalle
Verwendung der Halbmetalle
Halbleiter
Dioden
Übergangsmetalle
Nebengruppen-Elemente
Orbitale der Nebengruppenelemente
Lanthanoide und Actinoide
Obitalverteilungen
Überschwere Elemente
Kernchemie
Allgemeines
Ragins radiochemische Versuche
Risiken radioaktiver Strahlung
Tansurane
Magische Zahlen
Fehlende Elemente und Außerirdische
Herstellung von Gold
Grundlegendes zur Chemie
Seltene Erden
Nützlichkeit des Periodensystems der Elemente
Räumliche Strukturen
Einfach- und Mehrfachbindungen
Bedeutung freier Elektronenpaare
Organische Chemie
Der Kohlenstoff
Wöhlersche Harnstoffsynthese
Oxalsäuresynthese von Wöhler
Vielseitiger Kohlenstoff
Kohlenwasserstoffe
Stereo-Isomerie
Kohlenwasserstoffringe
Hybridisierungen
Isomere mit ungesättigten Kohlenwasserstoffen
Strukturen hybridisierter Kohlenstoffatome
cis-trans-Isomerie
Benzol
Wissenswertes über Nobelpreise
MO-Theorie
Vom Nitroglycerin zum Nobelpreis
Alfred Nobel
Ragins Einstieg in die angewandte Chemie
Ragins Praktika
Erfahrungen mit der angewandten Chemie
Supraleiter
Die metallorganische Chemie
Das wenig bekannte Kakodyl
Metallocene
Komplexbindungen
Die koordinative Bindung
Hämoglobin
Chlorophyll
Hämocyanin
Professor Ernst Otto Fischer
Ragins Synthesen
Komplexverbindungen
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Schwefelsubstituierte Komplexe
Gold-Komplexe
Triphenylphosphangold-Komplexe
Ein ungewöhnliches Verfahren
Zufällige Entdeckungen der Wissenschaft
Röntgen
Alexander Fleming
Newton
Kary Mullis
Weitere Experimente von Ragin
Schwierige Beschaffung von Lithium
Kernfusionsreaktoren
Kernfusion in Sternen
Grenzen der Chemie
Vielzahl chemischer Verbindungen
Arzneimittelrisiken
Der Contergan-Skandal
Spiegelbild-Isomerie
Gezielte Synthesen
Kunststoffe
Gummi
Nitrozellulose und Zelluloid
Kollagen
Galalith
Polyvinylchlorid
Bakelit
Arzneimittel
Synthetische Medikamente
Edelmetallkomplexe mit Aminosäuren
Beispiele goldhaltiger Medikamente
Platin- und Palladiumkomplexe
Cisplatin
Symmetriebetrachtungen
Darstellung von Platinblau
Cisplatin als Heilmittel
Biochemie als Grundlage des Lebens
Ribonukleinsäure (RNA)
Schwer heilbare Krankheiten
Viren
Ein Virus verbreitet Angst
Chemie in Entfaltung
Weitere Entwicklung der Chemie
Der missbrauchte PCR-Test
Der überschätzte Lithium-Ionen-Akkumulator
Ein Natrium-Schwefel-Akkumulator
Alternative Treibstoffe
Die Wasserstofftechnologie
Wasserstoff durch cracken von Erdgas
Das Bergius-Verfahren
Das Fischer-Tropsch-Verfahren
Klimaneutrale Erzeugung flüssiger Kraftstoffe
Kohlenstoff-Modifikationen
Grafit und Diamant
Fullerene
Nano-Röhren
Graphen
Graphenoxid
Q-Carbon
Entdeckungen und ihre Vermarktung
Flüssigkristalle
Deutsche Erfindungen und der Weltmarkt
Rohstoffe der Erde
Goldgewinnung
Förderung der Seltenen Erden
Fracking
Ausblicke in die Zukunft
Laboratorien
Die chemische Industrie
Synthesen komplizierter Naturstoffe
Biogene Substanzen
Acetylsalicylsäure
Natürliche Heilstoffe
Heilpflanzen
Positive Schlagzeilen versus negatives Denken
Leben im Weltall
Der Autor
Einleitung
Ein kleiner Junge träumt von großer Wissenschaft. Über Umwege gelingt es ihm Naturwissenschaften zu studieren.
Auf dem Weg zu seinem Ziel begegnen ihm einige seiner historischen Vorbilder, die er befragt und deren Lebenswege er kennenlernt.
Ausgewählte wissenschaftliche Arbeiten werden von ihm erklärt, aber auch kritisch hinterfragt.
Seine eigenen Arbeiten und Erkenntnisse ergänzen dieses Werk.
„Ragins Weg“ ist ein Buch auch für diejenigen, welche bisher wenig Vernünftiges über Chemie und andere Naturwissenschaften gehört oder diese nie so recht verstanden haben.
Es handelt sich um kein Lehrbuch. Doch der Autor versucht mit ausgewählten Themen Interesse zu wecken und zu weiterer Beschäftigung mit den Inhalten anzuregen. Das Buch soll aufzeigen, dass die Naturwissenschaften verständlich sein und große Freude bereiten können.
Es war und ist für Ragin sehr ärgerlich, wenn Prominente sich damit brüsten Mathematik oder naturwissenschaftliche Themen nie verstanden zu haben.
Etwas verstehen zu wollen, erfordert natürlich auch ein bisschen Denkarbeit. Bequemlichkeit kann geistige Beweglichkeit abtöten. Aber neben körperlicher Fitness gehört auch geistige Übung zu einem gesunden Leben.
Wegen vieler Verlautbarungen von Politikern oder Medienvertreter, die häufig wissenschaftliche Grundkenntnisse vermissen lassen und dadurch Unsicherheiten verursachen, sah sich der Autor veranlasst, diese zweite Auflage durch einige ausgewählte biochemische und technische Grundlagen zu ergänzen.
Ragins Jugend
Bereits im Kindesalter faszinierten Ragin die damaligen Errungenschaften aller Wissenschaften.
Als kleiner Junge schlenderte er allein durch die Straßen und das mittelalterlich erhaltene Zentrum seiner Heimatstadt Nürnberg. Dabei bewunderte er die historischen Gebäude und Kunstwerke. Bei genauer Betrachtung entdeckte er auch die nicht sofort offensichtlichen architektonischen und künstlerischen Werke, die bei ihm große Wertschätzung hervorriefen.
Nach dem zweiten Weltkrieg lag der größte Teil seiner Stadt in Trümmern. Viele Kunstwerke und Gebäude waren zerstört und teilweise für immer verloren. Unzählige Männer waren im Krieg gefallen oder befanden sich in Gefangenschaft. Daher mussten meist die Frauen die Trümmer beseitigen und mit dem Wiederaufbau beginnen. Ragins Mutter beteiligte sich daran, während sein Vater sich in Kriegsgefangenschaft befand.
Ragins Lehrer behaupteten, dass es viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde, um die deutschen Städte wieder vernünftig aufzubauen. Aber der Wille und die Kraft der Bevölkerung überwand das Elend und Ragins Heimatstadt erblühte in neuem Glanz. Auch die meisten historischen Bauwerke wurden wieder nach mittelalterlichen Plänen aufgebaut, sodass Ragins Stadt heute wieder zu den 25 lebenswertesten Städten der Erde gezählt wird.
Ragins Verwandte wurden, wie viele andere, während der unmenschlichen Angriffe alliierter Flugzeuge mehrmals „ausgebombt“. Sie erzählten von diesen Katastrophen, als wären diese tägliche Normalität gewesen. Mehrmals mussten sie sich nach der Zerstörung ihrer Wohngebäude eine neue Unterkunft suchen. Dies war möglich, weil die Menschen damals zusammenhielten und den Ausgebombten in noch vorhandenen Häusern eine Wohnmöglichkeit boten.
Durch diese Erlebnisse wurde Ragins Interesse auch an historischen Ereignissen schon in frühester Jugend geweckt.
Er musste feststellen, dass es in allen Epochen kriegerische Auseinandersetzungen gab, während deren Verlauf auch gewalttätig gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen worden war und die Zerstörungen der Wohngebiete und der kulturellen Einrichtungen ständigen Wiederaufbau und allgemeinen Neubeginn erforderlich machten.
Leider werden erdumspannend noch immer Kriege geführt, von denen verstörende Bilder in Umlauf gebracht werden.
Da viele Nationen über Nuklearwaffen verfügen, besteht die Gefahr, dass in die Enge getriebene Kombattanten diese auch anwenden. Deshalb werden in diesem Buch auch die physikochemischen Grundlagen verschiedener Kriegswerkzeuge beschrieben.
Einflüsse durch Eroberungen und Kriege
Alexander der Große
Alexander von Makedonien wird von Ragin noch heute als eine herausragende Persönlichkeit der Geschichte geschätzt und bewundert.
Aber auch Alexander rückte mit seiner griechisch-makedonischen Armee im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung überaus gewalttätig vor. Der Weg seines Heeres durch das riesige Perserreich bis nach Indien brachte über die dort ansässige Bevölkerung großes Leid, auch weil die zahlreichen Soldaten und die mitgeführten Tiere versorgt werden mussten.
Nahrung, Waffen, Geräte und anderer Nachschub konnte nicht aus der weit entfernten Heimat nachgeliefert werden. Deshalb wurden die ansässigen Bauern ausgeraubt und die eroberten, meist reichen Städte geplündert. Für die Bewohner dieser Gebiete war dies der blanke Terror.
Durch Alexanders Feldzüge wurde die griechische mit der orientalischen Kultur zur „hellenistischen Epoche“ verbunden, welche für die folgenden Jahre die eurasische Entwicklung prägte.
Nachfolgende Eroberer hatten ebenfalls keine Skrupel, die Zivilbevölkerung zu drangsalieren oder sogar auszurotten.
Die Hunnen
Hunnen, die im frühen fünften Jahrhundert nach Christus zunächst die Wohngebiete der Germanen und schließlich das römische Reich überfielen, brachten Furcht und Schrecken nach Europa.
Der Begriff „Hunnen“ wurde von den antiken Autoren für alle die Völker genutzt, die sie nicht zuordnen konnten.
Im Jahre 451 n. Chr. wurden die Hunnen in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern, im heutigen Nordostfrankreich, von Römern und Westgoten besiegt.
Befehlshaber der römischen Truppen war Aëtius und die Westgoten kämpften unter König Theoderich I.
Die Hunnen waren auch in dieser Schlacht von ihrem König Attila angeführt worden. Attila ist als König Etzel eine der zentralen Gestalten im urgermanischen Nibelungenlied.
Der Name „Attila“ ist germanischen Ursprungs und bedeutet „Väterchen“.
Trotz dieser netten Bezeichnung wurden Attilas Kriegszüge, mit großer Härte durchgeführt, auch um dadurch möglichst hohe Tributzahlungen durchzusetzen.
Der Einfall der Hunnen gilt wegen deren ständiger Raubzüge als Auslöser für die sogenannte Völkerwanderung der Germanen.
Die Mongolen
Im 12. und 13. Jahrhundert eroberten die Mongolen, trotz ihrer geringen Bevölkerungszahl, eines der größten Reiche der Weltgeschichte, das große Teile Asiens und Europas umfasste.
Historiker stellten sich die Frage, wie so ein zahlenmäßig kleines Volk ein derartig riesiges Gebiet erobern und einige Jahrzehnte beherrschen konnte.
Die mongolischen Reiter ernährten sich zum großen Teil von getrocknetem Fleischpulver, das im Sattel mitgeführt wurde und nur aufgekocht werden musste. Dies ersparte Platz und konnte die Ernährung der Reiter für Monate sicherstellen. Der Begriff Tatar für das fein zerkleinerte Fleisch der Mongolen (Tataren) leitet sich davon ab.
Doch vor allem nutzten die Mongolen die Milch ihrer Stuten, auf denen sie ritten. Sie fertigten aus dieser Milch auch Käse, Quark und Ähnliches. Diese Stutenmilchprodukte dienten den mongolischen Kriegern als Ersatz für Gemüse und Brot. Neben den Reitpferden wurden daher große Stutenherden im mongolischen Heer mitgeführt.
Aus diesen Gründen war kein Nachschub von Nahrungsmitteln nötig, was die Zurücklegung riesiger Streckenlängen der mongolischen Truppeneinheiten ermöglichte.
Ein Komposit-Reflexbogen war die wichtigste Waffe der Mongolen. Hinsichtlich Durchschlagskraft und Reichweite war dieser wesentlich leistungsfähiger als die damals üblichen einfach gekrümmten Bögen. Der klassische mongolische Bogen hatte dabei eine Länge von ungefähr 120 bis 130 cm im entspannten Zustand.
Jeder Reiter führte mindestens einen Bogen und bis zu 90 Pfeile mit sich. Auch die Pfeile waren denen der Gegner überlegen. Die Mongolen verwendeten flache, aus zwei Teilen geschmiedete Pfeilspitzen, die mit einer Feile scharf geschliffen wurden.
Für den Nahkampf nutzten die Krieger Schwerter, Äxte oder Keulen.
Mongolische Reiter konnten tagelang auf ihren Pferden sitzen, darauf essen und Pfeile im Galopp zielgenau abschießen.
Ernährungsgewohnheiten, die überlegene Bewaffnung und die reiterlichen Fähigkeiten der Mongolen ermöglichten die Eroberung großflächiger Gebiete und deren Besitzerhaltung.
Dschingis Khan, der bekannteste mongolische Anführer, bezeichnete sich als „Strafe Gottes“, weil er wegen „furchtbarer Sünden“ über seine Feinde gekommen sei.
Menschen, die in den von den Mongolen eroberten Gebieten lebten, empfanden die Mongolen tatsächlich als Strafe Gottes, denn im Allgemeinen zeigten die Mongolen kein Erbarmen mit den Besiegten. Als sie im Jahre 1258 Bagdad nach längerer Belagerung eingenommen hatten, ermordeten die Mongolen fast alle Einwohner dieser Stadt.
Ausrottung indigener Völker
Auch Christen wüteten ab dem 16. Jahrhundert hemmungslos gegen indigene Völker in Amerika, Australien, Neuseeland, Afrika und in vielen anderen Gebieten der Erde.
Christoph Kolumbus entdeckte 1492 die karibischen Inseln, die er Westindien nannte, da er dachte in Indien gelandet zu sein und damit den westlichen Seeweg nach Indien (Ostasien) gefunden zu haben. Nur wenige Jahre später rotteten die ersten europäischen Siedler die indigenen Kariben innerhalb weniger Jahre aus.
Wegen dieser ehemaligen Bevölkerung wird das von Kolumbus und seinen Nachfolgern betretene Gebiet noch heute als Karibik bezeichnet, obwohl es keine Ureinwohner dieser Inseln mehr gibt. Die Kariben erlagen in großer Zahl den eingeschleppten fremden Krankheiten oder wurden von den Eindringlingen gezielt getötet.
Anfang des 16. Jahrhunderts betraten immer mehr spanische und portugiesische Eroberer das südamerikanische Festland und vernichteten die sehr fortschrittlichen Zivilisationen der Azteken, Inkas und Mayas.
Gleiches geschah mit den nordamerikanischen Ureinwohnern, die auf winzige Reservate zurückgedrängt wurden und ihre Heimat sowie ihre Traditionen aufgeben mussten.
Kriege im Geschichtsunterricht
Obwohl in den vergangenen Jahrtausenden durch die zahlreichen Kriege unzählige Menschen getötet oder schwer verletzt wurden, gibt es bis heute militärische Auseinandersetzungen, die außer Menschen auch die Umwelt belasten und diese teilweise unwiederbringlich zerstören.
Im Geschichtsunterricht spielen Kriege eine wichtige Rolle, weil durch diese die Grenzen von Staaten verändert wurden. Auch Persönlichkeiten und Heerführer werden beschrieben, welche die Entwicklung der Menschheit entscheidend beeinflusst haben.
Gewaltsame Auseinandersetzungen waren und sind leider auch heutzutage etwas Alltägliches.
Viele Herrscher definieren sich über militärische Erfolge oder Drohgebärden und Einschüchterungsversuchen.
Neben Großmachtstreben spielen in der heutigen Zeit bei militärischen Auseinandersetzungen vor allem der Kampf um Rohstoffe und Wasser eine entscheidende Rolle, Daher wird es wohl weiterhin Kriege geben, in denen auch die Zivilbevölkerung für abwegige Ziele missbraucht und getötet werden wird.
Im März des Jahres 2020 verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron einen „Krieg“, um die Verbreitung eines Virus zu bekämpfen. In einer etwa zehnminütigen Rede betonte er sechsmal den Satz „nous sommes en guerre“ (wir sind im Krieg). Daraufhin wurden auch in Deutschland die meisten Menschenrechte außer Kraft gesetzt und die öffentlichen Medien verbreiteten Ängste über die Gefährlichkeit eines angeblich neuartigen Corona-Virus. Die Coronavirus-Gruppe ist jedoch seit langem bekannt, fand früher jedoch kaum Beachtung. In späteren Kapiteln wird dieses Thema noch mehrmals aufgegriffen und beschrieben.
Deutsche gegen Deutsche
Im Jahre 1866 führten deutsche Staaten zum letzten Mal gegeneinander Krieg.
Im sogenannten „Deutschen Krieg“ kämpften der „Deutsche Bund“ unter Führung Österreichs, zusammen mit einigen kleinen deutschen Staaten, gegen Preußen und dessen verbündete deutsche Kleinstaaten.
Noch im gleichen Jahr fand am 27. Juni 1866 das letzte kriegerische Aufeinandertreffen deutscher Staaten bei Langensalza in Thüringen statt. Auf diesem Kriegsschauplatz stand Preußen mit dem verbündeten Kleinstaat Sachsen-Coburg-Gotha dem Königreich Hannover gegenüber. Wegen militärischer Erschöpfung musste Hannover ohne tatsächliche Niederlage kapitulieren und Preußen annektierte das damals großflächige Königreich Hannover.
Heute sollte ein Krieg zwischen deutschen Ländern nicht mehr befürchtet werden müssen.
Aber in Europa wurden und werden noch immer Kriege geführt.
In den 1990er-Jahren kämpften ehemalige jugoslawische Völker erbarmungslos gegeneinander.
Katholische und protestantische Iren übten jahrelang gegenseitigen Terror in Nordirland aus.
Terrorangriffe gab es auch im Baskenland durch die ETA.
Zurzeit der Überarbeitung dieses Buchs, wurde die Ukraine von russischen Truppen angegriffen. Es ist noch nicht absehbar, wie lange diese Kämpfe andauern werden.
Chemophysikalische Kriegswaffen
In allen Kriegen wurden und werden Entwicklungen der Chemie und Physik zur gezielten Vernichtung menschlichen Lebens eingesetzt.
Phosphorbomben
Bereits ein einzelnes chemisches Element kann grausam wirken. So entzündet sich weißer Phosphor an der Luft von selbst und verbrennt dann mit einer sehr heißen Flamme. Gelangt der brennende Phosphor auf die Haut, so entstehen schwer heilende Verletzungen. Zusätzlich ist das dabei entstehende Phosphorpentoxid hochgiftig und verstärkt nach Einatmen den tödlichen Effekt dieses Elements.
Für Brandbomben wird Phosphor mit einer Kautschukgelatine versetzt, wodurch die zähflüssige Masse an der bis dahin noch nicht brennenden Haut haften bleibt, was Verbrennungen bis auf die Knochen verursacht und die Opfer sehr qualvoll sterben.
Bei der Bombardierung von Hamburg durch britische und amerikanische Bomber half den Einwohnern auch kein Sprung in Gewässer, da sich nach Auftauchen die Mischung an der Luft wieder entzündete. Durch die Hitze der Brandbomben entwich die Luft nach oben und es entwickelte sich eine Sogwirkung, welche die Menschen in das flammende Inferno zog.
Der Angriff erhielt den Codenamen „Operation Gomorrha“.
1. Buch Mose, 19, 24: „Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrha“.
Mit dem Begriff Gomorrha sollte wohl dem brutalen Angriff der Charakter eines himmlischen Strafgerichts verliehen werden.
Die Entwicklung der Atombombe
Neben dieser bösartigen Phosphorwaffen, stellen vor allem die Atombombenabwürfe in Japan ein abscheuliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.
Auch diese Grausamkeiten wurden durch physiko-chemische Entdeckungen im 20. Jahrhundert ermöglicht.
Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann versuchten 1938 durch Beschuss von Uran mit Neutronen Transurane, also Elemente, die schwerer als Uran sind, herzustellen.
In den Reaktionsprodukten fanden sie Spuren des Elements Barium, das mit einer Atommasse von 137 u etwas mehr als die halbe Masse des Uran-238 aufweist. Daraufhin schlussfolgerten die drei Wissenschaftler auf ein „Zerplatzen“ des Urankerns in mittelschwere Atomkerne.
Die Kernspaltung war entdeckt.
Hahn und Straßmann stellten danach fest, dass nach dem Beschuss mit Neutronen zusätzliche Neutronen freigesetzt wurden und schlossen auf eine Kettenreaktion, bei denen immer weitere Neutronen die Kernspaltung beschleunigen.
Politische und militärische Führer erkannten rasch das Vernichtungspotenzial dieser Entdeckung, woraufhin in den Vereinigten Staaten vom Amerika die ersten Atombomben konstruiert wurden.
Auch in Deutschland wurde während des zweiten Weltkriegs an der Entwicklung einer Atombombe gearbeitet. Der Bau dieser Waffe scheiterte jedoch letztlich am Mangel an verfügbarem spaltbaren Uran.
Nach dem ersten Kernwaffeneinsatz am 6. August 1945 über Hiroshima starben durch die Druckwelle, die radioaktive Strahlung und den entstandenen Feuersturm, bis zu 90.000 Menschen. Verletzte und Überlebende litten bis zu ihrem Tod an den Spätfolgen der Strahlenbelastung. Zur Zeit des Abwurfs waren in Hiroshima 40.000 japanische Militärangehörige stationiert. Doch die meisten der etwa 250.000 Einwohner waren Zivilisten, davon ungefähr zehn Prozent koreanische und chinesische Zwangsarbeiter.
Drei Tage nach dem Einsatz der Hiroshima-Bombe zündete die US-Luftwaffe über Nagasaki eine zweite Atombombe, die Plutonium als Spaltmaterial nutzte und wesentlich stärker als die in Hiroshima verwendete Uran-Bombe war. Dennoch waren die Opferzahlen mit geschätzten 35.000 Toten geringer als in Hiroshima, da die Bombe ihren Zielpunkt um mehr als zwei Kilometer verfehlte und weil Nagasaki in einem Tal liegt.
Konstruktion atomarer Waffen
Zur Kernspaltung wird eine „kritische Masse“ benötigt.
Ist das Volumen der zu spaltenden Urankugel zu klein, so hat diese im Verhältnis zu ihrem Volumen eine zu große Oberfläche. Daher können zu viele der durch die Spaltung erzeugten Neutronen die zu geringe Masse verlassen, ohne eine weitere Spaltung auszulösen.
Bei einem größeren Volumen der Urankugel bleiben mehr Neutronen im Inneren der Kugel und können weitere Kernspaltungen starten. Dadurch steigt die Reaktionsrate an und die Kettenreaktion ist nicht mehr aufzuhalten.
Uran-235 weist ohne einen Reflektor, der aus Grafit oder Wolframcarbid bestehen kann, eine kritische Masse von 49 kg auf.
Im Gegensatz dazu ist die kritische Masse von Plutonium mit 10 kg deutlich geringer.
In der Uranbombe von Hiroshima wurden zwei unterkritische Uranmassen durch die Explosion des Sprengstoffs Trinitrotoluol (TNT) zu einer kritischen Masse zusammengeschossen, wodurch die Kettenreaktion einsetzen konnte.
Diese eine Bombe benötigte den gesamten damaligen Weltvorrat an spaltbarem Uran-235. Aus diesem Grunde konnte keine weitere Uranbombe gezündet werden.
Plutonium war dagegen in ausreichender Menge vorhanden, weshalb die Amerikaner in Nagasaki diesen Bombentyp „ausprobierten“ und weiteres Leid über die japanische Bevölkerung brachten.
Kernwaffenfähiges Plutonium-239 konnte und kann in Kernreaktoren durch Bestrahlung von nicht spaltbarem Uran-238 mit Neutronen erzeugt werden:
Dadurch wurde spaltbares Plutonium-239 aus dem nicht kernwaffenfähigen Uran-238 gewonnen. Dieses Uranisotop kommt im natürlichen Uran mit einem Anteil von über 99 % vor. Spaltbares Uran-235 muss dagegen aufwändig angereichert werden, da es in Uranerzen nur zu 0,72 % enthalten ist.
Hinweis:
Der oben angegebene Reaktionsverlauf wird mit der verwendeten Symbolik in späteren Kapiteln genauer erläutert.
Reaktionen auf die Kernwaffeneinsätze
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich Otto Hahn unter dem Eindruck der Atombombenabwürfe entschieden gegen den Einsatz der Kernenergie für militärische Zwecke ein. Er sah diese Art der Nutzung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse als Missbrauch, ja sogar als Verbrechen an.
Seinen „Wiener Appell gegen die Kernwaffen-Experimente“ von 1957 schloss Otto Hahn mit den beschwörenden Worten:
„Möge die Erkenntnis wachsen, dass bei der heute bestehenden Möglichkeit der Zerstörung alles irdischen Lebens ein großer Krieg nicht mehr die ‚Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln‘ ist.“
Trotz der unvorstellbaren Gräuel, welche die Bomben in Hiroshima und Nagasaki angerichtet hatten, wurden zahlreiche noch wirkungsvollere Vernichtungswaffen entwickelt und in verschiedenen Ländern gehortet. Ein neuer, weitaus zerstörerischer Krieg war nach dem zweiten Weltkrieg durchaus vorstellbar und ist es leider bis heute.
Im Jahre 1962 stürzte Ragins Großmutter ins Zimmer und rief entsetzt aus, dass ein neuer, wohl noch schrecklicherer Krieg bevorstehe. Zu jener Zeit transportierten Schiffe der Sowjet-Union Mittelstrecken-Raketen mit Atomwaffen nach Kuba, was die US-Amerikaner zu einer Seeblockade veranlasste.
Die ungeheuren Gefahren eines möglichen Krieges mit Kernwaffen wurden damals einer breiten Öffentlichkeit schlagartig bewusst.
Die Wasserstoffbombe
Bereits 1952 wurde auf einem kleinen Atoll im Pazifik eine Wasserstoffbombe gezündet, welche die viertausendfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe hatte. Nach der Explosion war die kleine Insel nicht mehr vorhanden.
Edward Teller war maßgeblich an der Entwicklung der Wasserstoffbombe beteiligt. Er war zeitlebens ein Mensch voller Widersprüche. Sein vehementes Eintreten für Massenvernichtungswaffen von immer größerer Sprengkraft war für ihn ein Dienst am Weltfrieden und übte großen Einfluss auf die US-Politik aus.
1995 sinnierte Teller:
„Die Zündung einer Atombombe am Abendhimmel über Tokio hätte die Stadt in grelles Licht getaucht, aber verschont und vermutlich zur Abschreckung genügt. Wenn wir den Krieg durch eine Demonstration wissenschaftlicher Macht beendet hätten, ohne einen einzigen Menschen zu töten, wären wir heute alle glücklicher, vernünftiger und in größerer Sicherheit."
Kurz vor seinem Tod schrieb er:
„Ich wurde oft gefragt, ob ich es bedauere, an Atom- und Wasserstoffbomben gearbeitet zu haben. Meine Antwort lautet nein. Ich beklage zutiefst den Tod, den die Atombomben-Abwürfe brachten. Aber die beste Erklärung, warum ich die Arbeit an Waffen nicht bedauere, ist eine Frage: Was wäre geschehen, wenn wir es nicht getan hätten?"
Otto Hahn hat den Missbrauch seiner Entdeckung verurteilt. Edward Teller dagegen versuchte das grauenvolle Ergebnis seiner Arbeiten zu rechtfertigen. Eine tödliche Nutzung ihrer Tätigkeiten konnten oder wollten beide nicht verhindern.
Immer mehr Nationen entwickeln Kernwaffen, wodurch das „Gleichgewicht des Schreckens“ aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Auch für Terroristen sind Kernwaffen interessant. Es genügt bereits eine „schmutzige Bombe“, die mit herkömmlichem Sprengstoff gezündet wird und radioaktive Materialien enthält. Dadurch könnten große Gebiete langfristig unbewohnbar werden.
Wegen seiner hohen Dichte wird Uran in panzerbrechenden Geschossen genutzt. Da dieses abgereicherte Uran aus Kernkraftwerken stammt, enthält es auch andere radioaktive Elemente, welche ebenfalls die Einsatzgebiete verseuchen. Tausende Tonnen dieser Uranmunition wurden in den kriegerischen Auseinandersetzungen der jüngeren Zeit eingesetzt. Die dort lebenden Menschen atmen die bei der Explosion freigesetzten fein verteilten Partikel ein oder nehmen sie mit der Nahrung auf. Inkorporierte Alphastrahlung schädigt die Körperzellen und kann Krebs auslösen.
Viele revolutionäre Erfindungen können dem Menschen hilfreich oder ein Schaden sein. Es kommt stets darauf an, wie eine Technik genutzt wird.
Elektrizität ist heute unersetzlich, kann aber auch tödlich wirken. Ein Messer in der Hand des Chirurgen kann Leben retten, aber in der Hand eines Mörders Leben vernichten.
Auch die in der Wasserstoffbombe verheerend wirkende Kernfusion könnte zukünftig die Energieversorgung sichern.
Die Kernfusion
Die Wasserstoffbombe entfaltet eine unvorstellbar große zerstörerische Kraft.
In den unzähligen Sternen des Universums läuft die Kernfusion jedoch ohne Schaden für die Erde ab und bleibt ungefährlich, solange man ihnen nicht zu nahe kommt.
Auch in dem uns nächstgelegenen Stern, der Sonne, findet die Fusion von Wasserstoff zu Helium unter enormer Energiefreisetzung statt. Um diese Energie in einer Bombe zu erzeugen, wird darin das Wasserstoffisotop Deuterium in der chemischen Verbindung Lithium-Deuterid verwendet.
Fusionsreaktionen werden in den kommenden Kapiteln dieses Buchs ausführlich erläutert.
Die bei der Wasserstoffbombe entstehenden Neutronen sind für die sogenannte Neutronenwaffe entscheidend. Die Bauart dieser speziellen Wasserstoffbombe wird auf eine maximale Neutronenausstrahlung optimiert. Besonders fies ist die militärische Bedeutung der Neutronenwaffe als taktische Waffe, da alle Lebewesen durch Neutronenstrahlung getötet werden, die Infrastruktur jedoch weitgehend intakt bleibt.
Wegen der vernichtenden Wirkung der energiereichen Wasserstoffbomben, hat bisher die Vorstellung an einen alles zerstörenden Krieg, den Einsatz von Atomwaffen verhindert. Man spricht immer noch zynisch vom „Gleichgewicht des Schreckens“.29
Erstaunliche Technik
Radiowellen
Ragins Mutter verstand nie, woher wohl die Sprache aus dem Rundfunkgerät komme. Das treibe sie noch in den Wahnsinn, so drückte sie sich manchmal aus.
Schon deswegen informierte sich Ragin bereits früh über die Funktionsweise der damaligen Rundfunktechnik.
Die dafür nötigen Wellen umfassten Frequenzbereiche von 30 Kilohertz (Langwelle) bis 300 Megahertz (UKW).
Hertz ist die Einheit für die Frequenz von Wellen. Sie gibt die Anzahl der sich wiederholenden Schwingungen pro Sekunde an.
Im Ersten Weltkrieg wurden Versuche mit Röhrensendern begonnen.
Eine Elektronenröhre ist ein elektrisches Bauelement mit Elektroden, die sich in einem evakuierten oder gasgefüllten Kolben befinden. Die Röhre enthält eine beheizte Kathode und eine Anode, weshalb sie Diode genannt wird. Aus der Glühkathode treten negativ geladene Elektronen aus und werden zur positiven Anode beschleunigt.
Die Existenz von Radiowellen wurde 1864 von James Clerk Maxwell auf Grund theoretischer Überlegungen vorhergesagt und 1886 von Heinrich Hertz zum ersten Mal experimentell bestätigt.
Radiowellen entstehen, wenn der Elektronenstrom in der Kathodenstrahlröhre zum Schwingen gebracht wird. Das kann durch einen Schall geschehen. Diese Schallwellen werden von einem Sendemast versandt. Mit der Empfängerantenne des Rundfunkgeräts werden diese Wellen empfangen und im Radiogerät zuerst in elektrische Signale und dann wieder in Schallwellen umgewandelt. Ein Lautsprecher des Radiogeräts sendet die Schallwellen aus. Je nach eingestelltem Sender empfängt das Gerät die entsprechenden Radiowellen.
Die erste Rundfunkübertragung fand in Massachusetts zum Weihnachtsfest 1906 statt. Die Übertragung war in 500 Metern Umkreis zu empfangen. Im Jahre 1920 wurde in Berlin das erste Konzert über Rundfunk übertragen.
Leider empfand Ragins Mutter diese Erläuterung zur Wirkungsweise des Rundfunks nicht verständlich genug. Technik und Wissenschaft erfordern vermutlich doch den Willen, sich intensiv mit der Theorie auseinanderzusetzen.
Auch über die Wärmestrahlung in der Erdatmosphäre werden Elektronenübergänge in Molekülen der Luft angeregt, wodurch „natürliche Radiowellen“ entstehen.
Blitze erzeugen starke, vorübergehende Radiowellen, die zur Ortung von Gewittern genutzt werden können.
Radiowellen der Natur werden als atmosphärische Störungen bezeichnet. Sie tragen zum elektromagnetischen Rauschen in älteren Rundfunkempfängern bei.
Strahlungsbelastung
Durch moderne Kommunikationsgeräte sind die Lebewesen heutzutage unüberschaubar vielen Strahlungen ausgesetzt.
Kann dies auf Dauer eigentlich gesund sein?
Mobiltelefone und Smartphones nutzen zur Übertragung von Daten und Sprachen hochfrequente elektromagnetische Funkwellen. Daten werden dazu digitalisiert und in Funkwellen umgewandelt. Diese Wellen werden beim Telefonieren direkt am Ohr erzeugt. Deshalb sollten Telefonate möglichst kurz und idealerweise mit Kopfhörern oder Freisprechanlage erfolgen, damit die Strahlung nicht direkt am Kopf entsteht. Bei schlechtem Empfang sollte möglichst nicht telefoniert werden, da das Mobiltelefon mit erhöhter Leistung senden muss und dadurch die Belastung durch elektromagnetische Felder erhöht wird.
Elektromagnetische Wellen werden bei Radio- und Fernsehsendern, Mobilfunknetzen, Daten- und Richtfunk, Amateur- und CB-Funk, Feuerwehr, Polizei, Taxi, Industrie, Radar, Militär, Post, Satelliten, Alarmanlagen, schnurlosen Telefonen, Computern, Tablets, Babyphonen, Spielzeugen, Verbrauchszählern, Mikrowellenherden, Fernsehern, Stereoanlagen und anderen Anwendungen genutzt.
Diesen Strahlen waren die Menschen früher nicht ausgesetzt, weshalb eine Schädlichkeit möglich sein könnte, was aber bisher noch nicht nachgewiesen werden konnte.
Das seit dem Jahre 2020 eingesetzte 5G-Mobilfunknetz kann Frequenzen von bis zu 60 Gigahertz erreichen. Bei höherer Frequenz nimmt jedoch die Reichweite ab, weshalb für das 5G-Netz sehr viele Sendemasten und teilweise versteckte Sendestationen nötig sind, deren Strahlungen man kaum mehr ausweichen kann.
Weiterbildung als Herausforderung
Auch heute noch liefern die Wissenschaften viele Herausforderungen für Gegenwart und Zukunft.
Menschen lernen in unserer schnelllebigen Zeit nie aus. Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind unerlässlich.
Die kontinuierliche Verarbeitung von neuem Wissen und täglichen Informationen gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Alle fünf Jahre verdoppelt sich mittlerweile das insgesamt verfügbare Wissen. Täglich erscheinen weltweit rund 20.000 neue wissenschaftliche Publikationen. Deren Aktualität hält durchschnittlich fünf Jahre an, dann ist dieses Wissen nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Ein Akademiker des 19. Jahrhundert konnte sich mit dem erworbenen Wissen sein Leben lang als gebildet betrachten.
Heute stellen neue Technologien und Verfahren die Berufstätigen regelmäßig vor aktuelle Herausforderungen. Das Arbeitsleben besteht in unserer Zeit im Wesentlichen darin, sich mit Neuerungen vertraut zu machen und diese vernünftig und sicher anzuwenden. Die Kenntnisse aus Schule und Ausbildung reichen dafür nicht mehr aus. Wissen muss kontinuierlich neu erlernt werden.
Schulische Bildung
Schon in frühesten Zeiten waren die meisten Menschen wissbegierig.
Ähnlich wie es Ragin wegen der Einstellung seiner Eltern erging, blieben bis vor wenigen Jahrhunderten Personen aus den unteren, damals meist bäuerlichen Ständen, von höherer Bildung ausgeschlossen. Nur den Reichen und Mächtigen bot sich die Gelegenheit, um Wissen anzueignen.
Schulen in Mesopotamien
Aus schriftlichen Aufzeichnungen der Sumerer in Mesopotamien, was in etwa das Gebiet zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris umfasst, kann erschlossen werden, dass es dort bereits Schulen seit dem vierten vorchristlichen Jahrtausend gab.
In den aufgefundenen Schriften wurden Rechnen, Zeichnen, Lesen und Schreiben als Schulfächer benannt.
Welche Personen in den Schulen der Sumerer lernen durften, ist jedoch nicht überliefert.
Unterricht im frühen Ägypten
Aus den Schriften der antiken Ägypter ist bekannt, dass dort der Schulbesuch tatsächlich nur den Wohlhabenden möglich war.
Vermutlich waren die Kinder der Bauern und Handwerker auch gezwungen, ihren Eltern bei der täglichen Arbeit zu helfen und daher war diesen Familien ein Schulbesuch grundsätzlich nicht möglich.
Wer schreiben konnte, genoss in Ägypten ein hohes Ansehen und hatte auf diese Weise die Möglichkeit, Priester oder Beamter zu werden.
Ägypter wurden üblicherweise in Tempelschulen und Verwaltungsgebäuden unterrichtet. Die Erziehung in diesen Einrichtungen war sehr streng, wobei auch körperliche Züchtigung deren fester Bestandteil war.
Geschrieben wurde auf Ostrakon (Scherben von Tongefäßen oder Muschelschalen), da Papyrus zu kostbar für einfache Schreibübungen war.
Unterrichtet wurden Lesen, Schreiben, Mathematik, Geografie, Geschichte, Astronomie, Bildhauerei, Malerei und Sport.
Bildung im antiken Griechenland
Um das dritte und zweite Jahrhundert vor Christus war im antiken Griechenland die Bildung fast allen freien Menschen zugänglich.
Lesen, Schreiben und enzyklopädisches Wissen waren von großer Bedeutung für die kosmopolitische griechische Gesellschaft, die vom Handel mit der damals bekannten Welt lebte. Aber auch Gymnastik, Wettkampf, Tanz und Dichtkunst waren sehr wichtige Lehrfächer.
Besondere Erziehungsarten fanden im griechischen Stadtstaat Sparta Anwendung. Im harten Alltag der staatlichen Erziehungshäuser wurden die Jungen frühzeitig für ein militärisches Leben gedrillt.
Körperliche Höchstleistungen in Sport und Wettkampf sowie Kampfesübungen waren neben der Erziehung zu Entbehrung und Bescheidenheit die zentralen Unterrichtsfächer.
Aber auch die spartanischen Mädchen wurden körperlich hart erzogen und gemäß einer klassischen Rollenverteilung auf das Leben als Mutter und Hauswirtschafterin vorbereitet.
Schulen im Römischen Reich
Im antiken Rom erzog der Vater seinen Sohn und bereitete ihn auf das Leben als kriegstüchtigen Staatsbürger vor.
Anschließend erhielten Heranwachsende Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen, Rechtslehre, Sport sowie Waffen- und Landwirtschaftskunde.
Der wissenschaftliche Ruf der griechischen Kultur führte im Römischen Reich dazu, dass gebildete griechische Sklaven angesehene und begehrte Lehrer waren, die in privaten Haushalten unterrichteten.
Im späteren Rom entstanden Grammatikschulen, in denen griechische Literatur, Sprache und Mathematik gelehrt wurden.
Da die römischen Zahlen für die Behandlung mathematischer Problemstellungen äußerst unhandlich waren, erwiesen sich die klugen griechischen Sklaven bei komplizierten Rechenaufgaben als besonders hilfreich.
Wie sollte man auch CXXVII mit LIX vernünftig schriftlich addieren, während dies mit den entsprechenden indischen Zahlen 127 und 59, mithilfe des algebraischen Stellensystems recht einfach möglich ist.
Deutsche Schulen
Im fünften Jahrhundert nach Christi Geburt wurde die Kirche in Europa zum Träger des Bildungswesens. Zentrum der mittelalterlichen Bildungsvermittlung waren die Klöster mit ihren kostbaren Bibliotheken.
In den sogenannten inneren Schulen wurden Jungen und Mädchen auf ein Leben als Mönch oder Nonne vorbereitet. Laienkinder, meist adeliger Herkunft, wurden in den äußeren Schulen unterrichtet.
Der Unterricht fand in lateinischer Sprache statt und bestand zunächst aus religiöser Unterweisung und Geschichte. Danach erfolgte die Unterweisung in den „Septem Artes liberales “, den „sieben freien Künsten“: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie.
Um das Jahr 800 gründete der Frankenkönig Karl der Große sogenannte Hof- und Stiftschulen. Bildung sollte zum Allgemeingut werden. Kinder des Ritterstandes wurden in Anlehnung an die Septem Artes liberales in den „Septem Probitates“, den „sieben Tüchtigkeiten“ unterwiesen: Reiten, Schwimmen, Bogenschießen, Fechten, Jagen, Schachspiel und Verseschmieden. Dazu kam noch der Minnedienst, eine Hingabe an die „reine“ Frau, die man durch eine Eroberung nicht erniedrigen durfte. Aufgabe der Frau war es, den Werbenden zurückzuweisen. Tugenden wie Ehrbarkeit, Treue und Verschwiegenheit sollten den ganzen Menschen prägen.
Ab dem Jahre 1250 entstanden städtische Schulen, da die Reichsstädte und Freien Städte durch Handel und Gewerbe immer mehr auf Bildung angewiesen waren. Die Erziehung an diesen Schulen war hart, nach heutigen Maßstaben sogar brutal. Lehrfächer waren Lesen, Schreiben und Rechnen.
Ragin erlebte Mitte des 20. Jahrhunderts noch Lehrer, die mit einem Bambusstock in der Hand unterrichteten und mit diesem nicht selten zuschlugen. Dies prägte sein Bild einer unvernünftigen und schwachen Wissensvermittlung, die er so nicht übernehmen wollte. Mit Gewalt kann keine Lernfreude vermittelt werden.
Wenn Ragin heutzutage das Gefühl hat, dass Schüler zu viel Ablenkung hätten und deshalb nicht mehr den Fleiß früherer Zeiten an den Tag legen, so ruft er sich gerne die Bemerkung des großen Philosophen Sokrates (459 – 399 v. Chr.) in Erinnerung:
„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte.
Junge Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Wohlbemerkt, diese Aussage wurde vor über 2.400 Jahren getroffen.