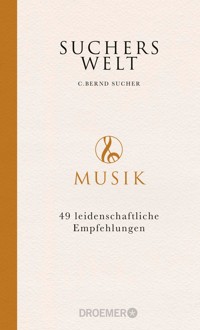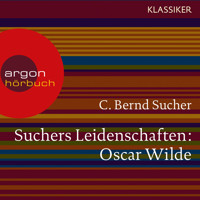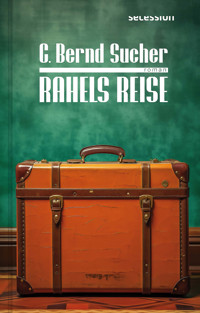
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rahels Reise ist die Geschichte einer jüdischen Großfamilie über fünf Generationen. Rahel wie auch ihr späterer Mann, Jacob Cohen, emigrierten Mitte der dreißiger Jahre als Kleinkinder in der Obhut ihrer Eltern und Großeltern aus Fürth respektive Hamburg in die USA, wo sie sich kennen und lieben lernen, eine Familie gründen und zu angesehenen Mitgliedern der amerikanischen Gesellschaft aufsteigen. Wir blicken ins Herz einer Familie, die dem Grauen des Nationalsozialismus entkommen ist, die das Leben feiert, Kunst und Musik liebt, und deren Mitglieder scheinbar alles übereinander wissen. Am Tisch der Familie wird gesprochen, diskutiert, verhandelt und mit Witz gefochten um die richtige Strategie im rechten Augenblick. Doch stimmt der Schein? Als Rahel Cohen schließlich Urgroßmutter ist, entscheidet sie sich, in ihre Geburtsstadt Fürth zu reisen – gegen den Willen ihres Mannes, der sich geschworen hat, das »Land der Mörder« nie wieder aufzusuchen. Rahel erfüllt damit den letzten Wunsch ihrer Mutter, ahnt jedoch nicht, dass sie auf ein Familiengeheimnis stoßen wird, das sie bis ins Mark erschüttert. Das Leben seiner jüdischen Familie und Großmutter hat C. Bernd Sucher zu einem Roman inspiriert, in dem er biographische und fiktionale Details zu einer Erzählung über die Liebe und die Kunst des Verzichts verwebt. Mit seiner umfassenden Familiensaga hat er einen Roman über Deutschland aus den 30er Jahren bis in die Gegenwart geschrieben, der von Witz geprägt ist, aber auch von berührenden und oftmals nachdenklich stimmenden Momenten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erste Auflage
© 2024 by Secession Verlag Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Gestaltung: Eva Mutter, Barcelona
Satz: Marco Stölk, Berlin
Herstellung: Daniel Klotz, Lettertypen Berlin
Gesetzt aus Cormorant Garamond
Printed in Germany
eISBN 978-3-96639-113-9
Die Personen
Abramowisz, Elay – Ehemann von Lisa Cohen
Blumenthal, Anne-Rose, geborene Lammfromm – Tochter von Leon und Golde Lammfromm, Ehefrau von Richard Blumenthal, Mutter von Rahel und Schlomo Blumenthal
Richard Blumenthal – Ehemann von Anne-Rose Blumenthal, Vater von Rahel und Schlomo Blumenthal
Blumenthal, Schlomo – Sohn von Richard und Anne-Rose Blumenthal
Cohen, Aaron – Sohn von Rahel und Jacob Cohen
Cohen, Asael – Sohn von Aaron und Alisah Cohen, Ehemann von Elizabeth Cohen, geborene Snider
Cohen, Alisah, geborene Sonnenschein – Ehefrau von Aaron Cohen, Mutter von Lisa Cohen
Cohen, Benjamin – Sohn von Chaim und Gili Cohen, geborene Goldmann
Cohen, Chaim – Sohn von Jacob und Rahel Cohen
Cohen, Christa, geborenen Anderson – Heinrich Cohens Ehefrau
Cohen, Deborah – Tochter von Chaim und Gili Cohen
Cohen, Elizabeth, geborene Snider – Ehefrau von Asael Cohen
Cohen, Elise – Tochter von Henri und Ruth Cohen, geborene Frankenthaler
Cohen, Esther – Tochter von Chaim und Gili Cohen, Ehefrau von Noah Weinberg
Cohen, Gili, geborene Goldman – Ehefrau von Chaim Cohen, Mutter von Deborah, Benjamin und Esther Cohen
Cohen, Heinrich – Großvater von Jacob Cohen
Cohen, Henri – Sohn von Heinrich Cohen, Vater von Jacob Cohen
Cohen, Jacob – Sohn von Henri Cohen und Ruth Cohen, geborene Frankenthaler
Cohen, Lisa – Tochter von Aaron und Alisah Cohen, Ehefrau von Elay Abramowicz
Cohen, Rahel, geborene Blumenthal – Ehefrau von Jacob Cohen, Mutter von Chaim und Aaron Cohen
Cohen, Ruth, geborene Freudenthaler – Ehefrau von Henri Cohen, Mutter von Elise und Jacob Cohen
Fränkel, Din – Rabbiner in Fürth
Fränkel, Sarah – Din Fränkels Ehefrau
Fränkel, Gabriel – Sohn von Din und Sarah Fränkel
Fränkel, Menachem – Sohn von Din und Sarah Fränkel
Fränkel, Riccardo – Sohn von Din und Sarah Fränkel
Goldman, Abraham – Ehemann von Golde Goldman, geborene Rosenthal
Goldman, Gili – Tochter von Abraham und Golde Goldman
Goldman, Golde, geborene Rosenthal – Ehefrau von Abraham Goldman, Mutter von Gili Goldman
Lämmle, Levin – Ehemann von Deborah Lämmle, geborene Cohen
Lämmle, Caspar – Sohn von Deborah und Levin Lämmle
Lämmle, Crista, geborene Schalla – 2. Ehefrau von Levin Lämmle nach dem Tod von Deborah Lämmle, geborene Cohen
Lammfromm, Anne-Rose – Ehefrau von Richard Blumenthal
Schalla, Christa – Zweite Ehefrau von Levin Lämmle
Snider, Arthur – Ehemann von Resi Snider, Vater von Elizabeth Snider
Snider, Elizabeth – Ehefrau von Asael Cohen
Snider, Resi, geborene Lechner – Mutter von Elizabeth Snider
Sonnenschein, Alisah – Tochter von Moses (Moishe) Sonnenschein und Elise Sonnenschein, geborene Rosenfeld, Ehefrau von Aaron Cohen
Sonnenschein, Cäcilie – Tochter von Moishe und Elise Sonnenschein
Sonnenschein, Clara, geborene Friedenberg – Ehefrau von Curt Sonnenschein, Mutter von Moishe Sonnenschein, Großmutter von Alisah, Cäcilie und Samuel Sonnenschein
Sonnenschein, Curt – Vater von Moishe Sonnenschein
Sonnenschein, Moses (Moishe) – Ehemann von Elise Sonnenschein, Vater von Alisah Sonnenschein
Sonnenschein, Samuel – Sohn von Moishe und Elise Sonnenschein
Soylu, Damir – Geliebter von Lisa Cohen
Weber, Adolf – Vater von Egon Weber
Weber, Dirk – Sohn von Egon und Lotte Weber, Geliebter und später Mann von Benjamin Cohen
Weber, Egbert – Vater von Horant Weber, Ururgroßvater von Dirk Weber
Weber, Egon – Vater von Dirk Weber
Weber, Eva – Tochter von Egon und Lotte Weber
Weber, Horant – Vater von Adolf Weber
Weber, Lotte, geborene Müller – Ehefrau von Egon Weber
Weber, Mathilde – Tochter von Egon und Lotte Weber
Weinberg, Elias – Sohn von Noah und Esther Weinberg, geborene Cohen
Weinberg, Esther, geborene Cohen – Ehefrau von Noah Weinberg
Weinberg, Evelyn – Tochter von Noah und Esther Weinberg
Weinberg, Noah – Ehemann von Esther Weinberg
Aimer un être, c’est accepter de vieillir avec lui.
Albert Camus: Le Mythe de Sisyphe
Für A. – und nur für ihn!
Inhalt
Frühling 2018 – Rahels Entscheidung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Sommer 2020 – Zurück in New York
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Kapitel 131
Kapitel 132
Kapitel 133
Kapitel 134
Kapitel 135
Kapitel 136
Kapitel 137
Kapitel 138
Kapitel 141
Kapitel 142
Kapitel 143
Kapitel 144
Kapitel 145
Kapitel 146
Kapitel 147
Kapitel 148
Kapitel 149
Kapitel 150
Kapitel 151
Kapitel 152
Kapitel 153
Kapitel 154
Kapitel 155
Kapitel 156
Kapitel 157
Danksagung
Frühling 2018
Rahels Entscheidung
1
Rahel Cohen hatte sich entschieden. Wie oft hatte sie gezögert. Wie oft hatte ihr Mann sie gebeten, diese Reise nicht anzutreten. Heute Abend würde sie sich durchsetzen. Heute Abend würde sie ihrem Mann, ihren beiden Söhnen, ihren Schwiegertöchtern und den fünf Enkeln ihren unverbrüchlichen Entschluss mitteilen. Heute Abend.
Während sie sich für dieses besondere Abendessen ankleidete, während sie sich wieder, wie jedes Jahr an diesem Tag, in ihrem dunkelblauen Abendkleid vor den Spiegel setzte und die Kette mit dem goldenen Davidstern umlegte, erinnerte sie sich ihres ersten Versuchs, ihren Mann und die beiden Söhne für einige Wochen zu verlassen. Sie dachte an die vielen Selbstgespräche, die sie damals mit sich geführt hatte.
Rahel Cohen lächelte in den Spiegel und überlegte: Stern oder doch lieber die Smaragdkette, die Jacob ihr zum achtzigsten Geburtstag geschenkt hatte? Sie erhob sich, ging zu ihrem Schmuckkästchen, das sie sich vor Jahren bei einem kleinen Trödler gekauft hatte und das sie immer an Goethes Faust erinnerte. Hatte der seinem Gretchen die Perlen – waren es Perlen? – nicht auch in einem Schächtelchen versteckt? Sie entschied sich für den Stern, blickte noch einmal in den Spiegel. Kein Mensch würde glauben, dass ich dreiundachtzig bin!, dachte sie.
Wenige Sekunden später betrat Rahel Cohen das Esszimmer. Alle waren sie da. Ihr Jacob – wie schön, er hatte seinen Smoking angelegt. Ihre beiden Söhne Aaron und Chaim – die Zwillinge waren mit ihren jeweiligen Familien gekommen. Rahel hatte, auch wenn sie es sich nicht eingestehen mochte, Aaron lieber als seinen Bruder. Chaim war schon als Kind eher unberechenbar und opportunistisch, während Aaron zu jeder Lüge unfähig war, seine Stimme veränderte sich, sie wurde heller, wenn er als Kind geschwindelt hatte, und das war bis heute so geblieben.
Auch bei den Frauen hatte Rahel ihre Vorliebe. Gili, Chaims Frau, war sie verfallen. Das Lachen ihrer Schwiegertochter hatte es ihr angetan. Es war so hell, so heiter, sie liebte es einfach. Alisah hingegen fand sie eher spröde. Sie sei so verkopft, hatte sie sich ihrem Mann gegenüber mehr als einmal beklagt, wenn Aarons Frau, was sie gern tat, literaturwissenschaftlich zu dozieren begann. Von ihren Enkeln liebte sie einen besonders: Benjamin, Chaims und Gilis einzigen Sohn. Er hatte gerade seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag gefeiert und lebte allein. Rahel Cohen irritierte die offensichtliche Bindungsunfähigkeit ihres Enkels. »Das wird schon!«, beschwichtigte Jacob seine Frau, wenn die sich besorgt äußerte, dass Benjamin womöglich nie eine Frau finden würde. »Er sieht gut aus, er ist klug, das wird schon!«
Benjamin hatte sich seine Jungenhaftigkeit bewahrt, kokettierte mit ihr und spielte nicht ungern den jungen Liebling aller, was ihm leichtfiel, da er mit seinen schwarzen Locken, seinen blauen Augen und den Grübchen, die sichtbar wurden, sobald er lächelte, einem hoffnungsvollen Studienanfänger glich. Dabei arbeitete er seit knapp zwei Monaten in der Kanzlei Miller & Bronfen. Zwar wäre er gern Schauspieler geworden, hatte auch während seines Jura-Studiums mehrere Workshops an der New York Film Academy absolviert und diese »genial« gefunden, wie er sich ausdrückte, während seine Lehrer ihm Talent bescheinigt und ihn unbedingt ermutigt hatten, die so lustvoll eingeschlagene Nebenstraße weiter zu verfolgen – allein Jacob Cohen, und nicht etwa Benjamins Eltern, Gili und Chaim, die gleichwohl an das künstlerische Talent ihres Sohnes glaubten, aber zu allem schwiegen und sich dem starken Vater und Schwiegervater beugten, hatte ihm diesen Spleen, wie er des Enkels schauspielerische Ambitionen abtat, ausgeredet. Zum einen gebe es nicht einen berühmten jüdischen Schauspieler, zum anderen seien die meisten, die in den off-Theatern und Low-budget-Filmen auftreten, bettelarm. Das allerdings sahen auch seine Eltern so. Benjamins Erwähnung der vielen Gegenbeispiele, die ihm spontan einfielen, Woody Allen etwa, oder Dustin Hoffman, Mel Brooks, Harrison Ford, Paul Newman, Walter Matthau, Kirk Douglas und sogar Marilyn Monroe konnten den Großvater nicht überzeugen – »im Übrigen konvertierte die Monroe zum Judentum!«, wies er seinen Enkel scharf zurecht.
Benjamin gab das Vorhaben auf. Wie es Jacob Cohen wünschte, schloss er sein Jura-Studium nicht bloß mit dem Doctor of Law ab, was äußerst bemerkenswert war, da er keinerlei Ambitionen hegte, eine Karriere an der Universität einzuschlagen, sondern erwarb zusätzlich den sogenannten ›Heckspoiler‹, die an den Namen gehängten Buchstaben LL.M., den Master of Laws, und beabsichtigte, sich zu spezialisieren. Worauf, das wusste er nicht. Rahel war stolz auf ihren ehrgeizigen Enkel. Sie hatte Jacob zwar nicht widersprochen, doch insgeheim hätte es ihr sehr gefallen, wenn Benjamin sich gegen seinen Großvater durchgesetzt hätte und Künstler geworden wäre.
»Bitte hört mir jetzt mal zu!«, begann sie.
Jacob kommentierte es nicht.
Vor vierundvierzig Jahren hatte sie einen Plan gehabt, den Jacob Cohen ihr – wahrscheinlich zu recht, vielleicht aber auch nicht – ausgeredet hatte. Sie wollte nach Deutschland reisen.
Durfte sie, so hatte sie sich damals gefragt – was war nicht alles passiert seitdem! –, durfte sie ihre Familie für vier Wochen allein lassen? Würde Jacob sie vermissen? Vielleicht? Gewiss! Denn sie liebten einander. Er würde sich, so beruhigte sie sich damals selbst in ihren Gedanken, wunderbar versorgen können, er kocht leidenschaftlich gern, für sich, für die Kinder und noch lieber für Freunde, er ist ein geselliger Mensch. Aber ganz einfach würde es für ihn nicht werden – wochenlang Urlaub, daran ist nicht zu denken – das hatte sie damals schon in ihre Überlegungen einbezogen. Die beiden Söhne, Aaron und Chaim, waren zwar keine Kinder mehr mit ihren fünfzehn Jahren, doch Jacob hätte sich um sie kümmern müssen. Andererseits, so die Gegenüberlegung in ihrem Kopf, als sie sich damals fragte, mit welchen Worten sie das Gespräch eröffnen sollte, würden die Söhne wahrscheinlich auch ein wenig froh sein, vier Wochen lang nicht bevormundet zu werden. Rahel Cohen war eine strenge Mutter. Beschwerten sich Aaron und Chaim über die in sie gesetzten Erwartungen, über die Ermahnungen, dass sie nicht fleißig genug wären und zu selten in die Synagoge gingen, konterte sie stets mit demselben Satz: »Ihr hättet bei der Wahl eurer Mutter eben etwas vorsichtiger sein sollen, jetzt habt ihr sie, die jiddische Mamme!«
Ihre zwei Jungs würden ihre Reise in die Vergangenheit akzeptieren, hatte sie gedacht, sie vielleicht sogar gutheißen. Schon oft hatten die beiden ihr nahegelegt, nach Fürth, in ihre Geburtsstadt zu reisen. Weil sie immer wieder erwähnte, ihrer Mutter versprochen zu haben, die Gräber der Familie zu besuchen. Nur Jacob Cohen, der erfolgreiche und inzwischen wohlhabende Anwalt, war stets gegen eine solche »Rückkehr«, wie er es nannte. Die deutsche Sprache schätzte er, doch nicht das Land und nicht die Menschen. Rahel hatte der Gedanke jedoch nie losgelassen, und der Wunsch, ihn wahr werden zu lassen, war sogar mächtiger geworden, je stärker sie ihn zu verdrängen suchte. Sie wollte ein Mal, ein einziges Mal nur den Ort sehen, den sie nicht kannte und von dem sie nur das Wenige wusste, was ihre Eltern ihr mitgeteilt hatten. Richard und Anne-Rose Blumenthal, die 1936 mit ihren Eltern und ihrer damals einjährigen Tochter Rahel in die USA emigrierten, hatten nie gern über Deutschland gesprochen. Weder über das Land, das sie verlassen mussten, noch über die Bundesrepublik und deren Menschen.
Rahel erinnerte sich genau: Sie hatten beim Abendessen zusammengesessen. Sie hatten mit ihren Weißweingläsern angestoßen, einander Gut Schabbes gewünscht, als sie darum bat, ihr jetzt aufmerksam zuzuhören. Jacob kannte diese Einleitung schon, seine Frau hatte ihn oft genug überrascht mit diesem Bitte, hört mir jetzt einmal zu!
An Rosh Ha-Schana, dem jüdischen Neujahrstag, hatte sich Rahel damals in der Synagoge der Reformgemeinde auf der Bennett Avenue mit ihrem Gott unterhalten und ihn gefragt, ob sie ihren Plan wahrmachen dürfte. Nach dem Fastentag Yom Kippur, den sie zusammen mit ihrem Mann und ihren Söhnen, die an diesem höchsten jüdischen Festtag vom Unterricht befreit waren, in der Synagoge zugebracht hatte, hoffend, dass der Ewige sie in das »Buch des Lebens« eingeschrieben haben würde, hatte sie sich entschieden, dass sie nach Pessach, spätestens aber im Mai aufbrechen würde. Sie hatte bereits den Flug gebucht, Business Class, zu einem Sondertarif. Denn sie war eine sparsame Frau, die den Luxus liebte.
»Ich werde im nächsten Jahr nach Deutschland fliegen!« Aaron und Chaim hatten gejubelt. Sie hatte sich nicht geirrt. So war es damals gewesen.
»Wie mutig, Mum, uns drei hier allein zu lassen! Wir werden all das machen, was wir sonst nicht dürfen!«, hatte Chaim gekräht.
»Und all das bleiben lassen, was wir sonst machen müssen!«, hatte Aaron gelacht.
Bitte, hört mir jetzt mal zu! – ja, so hatte sie auch damals begonnen, aber hatte sie da zuerst ihren Mann angesehen und dann erst ihre Söhne? Oder erst ihre Söhne? Sie hatte sich geräuspert. Und dann, nach ihrer berüchtigten Einleitung geflüstert: »Es ist gar nicht so leicht, euch zu sagen, was ich mir vorgenommen habe.«
Nur Jacob Cohen hatte damals geschwiegen. Doch später hatte er sein Schweigen gebrochen: »Hast du dir das gut überlegt, Rahel? Wohin willst du denn?«
Rahel hatte damals nur ein Reiseziel genannt: Fürth, ihre Geburtsstadt. An den folgenden Tagen wurde über die Reise nicht mehr gesprochen.
Damals hatte sie es nicht geschafft. Sie hatte kapituliert und ihrem Mann zugeraunt, dass sie die Reise doch nicht antreten würde. Sie hatte ihm sogar recht gegeben, dass die Deutschen wieder zu dem würden, was sie zuvor schon gewesen waren – Antisemiten. Sie war mit ihrem damaligen Entschluss zufrieden. Denn nach 1968 war keineswegs alles besser geworden, im Gegenteil, der Antisemitismus hatte sich ausgebreitet, in der Bundesrepublik wie auch in den Vereinigten Staaten.
2
Rahel und Jacob hatten sich in Ann Arbor kennengelernt. Er studierte zu jener Zeit schon im sechsten Semester Rechtswissenschaften; sie begann ein Studium der Kunstgeschichte. Warum sie sich in den kleinen Juden verguckt hatte? Er besaß Charme, Witz, schöne große Ohren und eine jüdische Chuzpe – und er war intelligent. Zudem, und das bedeutete ihr viel, waren sie beide ähnlich aufgewachsen oder, wie Jacob es nannte, ähnlich sozialisiert.
Jacob war der Sohn Hamburger Juden, geboren am 28. Juni 1929 im Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf. Sein Vater Henri war Bankier, seine Mutter Ruth eine passionierte Musikliebhaberin, die mindestens einmal wöchentlich Aufführungen im Opernhaus an der Dammtorstraße besuchte, oft auch mit ihren Kindern Jacob und Elise. Sie führte einen kleinen Salon, in den sie bis zur ihrer Emigration 1935 vor allem jüdische Künstler und Literaten einlud. Manchmal traute sie sich sogar, auf dem Flügel Chopin-Polonaisen zu spielen, am liebsten das Opus 53, das sie erstaunlich gut meisterte. Fanden zumindest ihre Kinder.
Die großbürgerliche Familie wohnte zusammen mit einer Köchin und einer Haushälterin in einer Villa an der Rothenbaumchaussee. In diesem Stadtteil fühlten sie sich wohl, nicht zuletzt, weil sich hier viele Juden niedergelassen hatten. Die Cohens besuchten zwar selten die Synagoge, aber an Yom Kippur, dem Versöhnungstag, waren sie meist alle vier zugegen. Nie gingen sie in die große Synagoge am Bornplatz, wo die Orthodoxen beteten, sondern stets in den Tempel der Reformbewegung. Der Weg in die Poolstraße war zwar weiter, aber sie liebten die Predigten in deutscher Sprache, sie liebten die Choräle, die dort gesungen wurden, und Ruth Cohen war es immer eine Freude, ihren Gästen zu erzählen, dass Salomon Heine, der berühmte Kaufmann und Bankier, der als der Hamburger Rothschild galt, Mitglied des Tempelvorstands war und ein großzügiger Förderer der Gemeinde. Es machte ihr Spaß, den nicht-jüdischen Freunden den Unterschied zwischen Orthodoxen und liberalen Juden mit einem Gedicht von dessen Neffen Heinrich zu erklären; sie konnte es auswendig hersagen:
Die Juden teilen sich wieder ein
In zwei verschiedne Parteien;
Die Alten gehn in die Synagog’,
Und in den Tempel die Neuen.
Die Neuen essen Schweinefleisch,
Zeigen sich widersetzig,
Sind Demokraten; die Alten sind
Vielmehr aristokrätzig.
Ich liebe die Alten, ich liebe die Neu’n –
Doch schwör ich, beim ewigen Gotte,
Ich liebe gewisse Fischchen noch mehr,
Man heißt sie geräucherte Sprotte.
Rahel Blumenthal kam am 9. Juli 1935 im mittelfränkischen Fürth zur Welt – in jenem Jahr, als die Familie Cohen bereits emigrierte. Ihr Vater, Richard Blumenthal, war Sohn eines Fabrikanten, der Blei- und Buntstifte herstellte. Als angesehener Bürger der Stadt beteiligte er sich gern an vielen kulturellen Initiativen, die er finanziell unterstützte. Die Familie Blumenthal lebte traditionelles Judentum. Rahels Mutter, Anne-Rose Blumenthal, geborene Lammfromm, Tochter eines Lehrers, der in Nürnberg unterrichtete, war indes eine lebensfrohe junge Frau, die es mit den Geboten oft nicht sehr ernst nahm und mit den Verboten schon gar nicht. Sie pflegte sich als eine Feiertagsjüdin zu bezeichnen. Ihr einziges Kind, getauft auf den Namen von Anne-Roses Mutter, Rahel, wollten beide Eltern liberal erziehen. So hatten sie schon vor deren Geburt und gut ein Jahr vor ihrer Emigration am 11. September 1936 entschieden.
3
Sie hatte es ihrer Mutter versprochen, kurz vor deren Tod. Anne-Rose Blumenthal, geborene Lammfromm, hatte ihrer Rahel ein Kuvert in die Hand gedrückt und sie mit Tränen in den Augen gebeten: »Reise nach Fürth. Dort öffne diesen Brief. Ich liebe dich!«
Eine Woche darauf war Anne-Rose Blumenthal gestorben und kurze Zeit später neben ihrem Mann Richard beerdigt worden.
Seitdem hatte Rahel das Kuvert in ihrer Schmuckkassette aufbewahrt. Sie hatte jedes Mal, wenn sie es sah, ihre Neugier gezügelt. Nein, sie hatte sich nicht hinreißen lassen, den Brief schon in New York zu lesen. Gewiss, sie hätte das Geheimnis gern gelüftet, ohne eine Reise nach Deutschland zu unternehmen, von der sie wusste, dass ihr Mann Jacob sie missbilligte.
Anne-Rose Lammfromm, spätere Blumenthal, hatte die allergrößten Schwierigkeiten, sich in Amerika einzuleben. Die Abreise – ohne Abschied von den Freundinnen und Freunden – war überstürzt vonstatten gegangen. Die Gefahr, womöglich zuvor von den Häschern gefunden und verschleppt zu werden, ängstigte sie, selbst wenn sie niemanden mit ihrer Furcht belastete. Die Geburt ihrer Tochter hatte sie geschwächt. Doch das Kind war ihr die größte Freude in jenen Tagen. Als sie endlich zu dritt in Hamburg angekommen waren, wo sie noch zwei Nächte in einem kleinen Hotel auf die Abfahrt ihres Dampfers warten mussten, stellte sich heraus, dass ein wichtiges Papier fehlte. Sie wusste damals nicht, welches, bekam nur mit, dass ihr Mann viele Stunden im amerikanischen Konsulat verbrachte, an beiden Tagen. Erst während der Überfahrt erklärte ihr Mann Richard, dass sie Rahel nicht den Amerikanern gemeldet hatten. Es habe ihn viel Überzeugungsarbeit gekostet, die Amerikaner zu einem Zugeständnis zu bewegen. Einer der Diplomaten habe gar davon gesprochen, sie nicht einreisen zu lassen: »Drei Juden statt zwei – das ist einer zu viel!«
Als Anne-Rose endlich an der Hand ihres Mannes die Gangway hinaufging, betete sie halblaut: »Gelobt seist du Ewiger, der du uns rettest.«
Die Schiffskabine war klein und roch ein wenig muffig. Sie stellten darin ihr Gepäck ab und begaben sich sofort an Deck. Sie blickten auf die Kirchtürme der Stadt.
Genau dieser Blick hatte ein Jahr zuvor, 1935, die Familie Cohen zu Tränen gerührt. Henri Cohen und Ruth Freudenthaler wussten, dass sie ihre Heimatstadt wohl nie wiedersehen würden. Auch sie hatten nur rasch ihr Gepäck in der Kabine verstaut – sie hatten sich eine mit Bullauge leisten können – und schauten voller Wehmut auf den Kirchturm von Sankt Nicolai. Ihr Sohn Jacob war damals sechs Jahre alt, die Tochter Elise zwei Jahre jünger. Die beiden Kinder verstanden nicht, warum die Eltern weinten, sie freuten sich auf die abenteuerliche Reise auf einem Schiff.
Beide Familien hatten stürmische Überfahrten erlebt. Und beide Familien hatten furchtbare Angst, da nicht nur Menschen an Bord waren, die, Juden wie sie, vor den Nationalsozialisten flüchteten, sondern auch SS-Soldaten, die einander mit »Heil Hitler« begrüßten, den rechten Arm hoben und laut über das »Judenpack« an Bord lästerten.
Bei der Ankunft auf Ellis Island hatten sie stundenlang in der Schlange gestanden, waren anschließend befragt worden, als wären sie Verbrecher gewesen. Doch hatten sie sich nicht beklagt: Sie waren gerettet.
4
Anne-Rose Lammfromm hatte nur die jüdische Mädchenschule besuchen dürfen, hatte nie studiert und keinen Beruf erlernt, mit neunzehn Jahren hatte sie Richard Blumenthal geheiratet. Sie wurde ihm nicht von einer Heiratsvermittlerin angedient, sondern er selbst bat um ihre Hand. Die Eltern kannten einander. Anne-Rose und Richard waren einander zum ersten Mal in der Synagoge begegnet. Er verliebte sich Hals über Kopf. Ihr gefiel der Junge, aber kokett, wie sie war, zündelte sie auch bei anderen Jungs. Heimlich. Der Vater durfte keinesfalls etwas mitbekommen. Ihre Mutter war weniger streng.
Diese wiederum, Golde Wiesengrund, hatte erlebt, was es heißt, einen Mann heiraten zu müssen, den sie nicht kannte; mit dem sie vor der Hochzeit kaum ein Wort gewechselt hatte. Sie hatten einander weder gesucht noch gefunden. Ihre Väter waren darin übereingekommen, die beiden zu verheiraten. Die Hochzeitsnacht war ein Martyrium – für beide. Sie wussten zwar, was sie machen sollten, aber sie konnten es nicht. Leon Meir Lammfromm hatte einmal nur in seinem Leben masturbiert – eine Todsünde. Golde Wiesengrund war zu Tode erschrocken, als sie zum ersten Mal menstruierte. Sie hasste danach die rituellen Bäder, die Besuche in der Mikwa und die obligatorischen Kontrollen, ob noch oder wieder Blut an ihr klebte. Leon verzweifelte. Das schöne Mädchen mit dem langen, glatten schwarzen Haar, welches sie tagsüber zu einem Knoten band und viel zu oft unter einem Tuch versteckte, lag auf dem Laken, rücklings, mit geöffneten Beinen, und wartete ängstlich darauf, dass ihr Mann irgendetwas tat. Sie sah traurig aus – er war es. Minuten vergingen. Endlich nahm er sein Glied in die Hand und tat, was er jetzt ja durfte. Doch vergeblich. Golde schloss die Augen – vielleicht, so dachte sie, macht es ihn nervös, wenn ich zuschaue. Sie wartete. Endlich fiel er neben ihr auf das Laken. Nicht erschöpft, tieftraurig: »Verzeih, es geht nicht.«
Für einen Augenblick dachte sie daran, ihn zu küssen, doch sie unterließ es. Sie wandten einander den Rücken zu und weinten beide – und schliefen lange nicht ein.
Am vierten Abend gelang es. Aber Golde schrie vor Schmerzen, als er in sie eindrang. Sie versuchten es nun jede Nacht, denn ihre Mutter wartete auf die erlösende Nachricht, dass die Tochter schwanger würde. Auch Leons Mutter wartete. Nach vier Monaten konnte Leon beiden Müttern verkünden, dass Golde ein Kind erwartete. Die Freude währte nur kurz. Im vierten Monat verlor sie das Kind. Leon und Golde versuchten es wieder, beobachtet von ihren beiden Müttern, die nicht müde wurden, allmonatlich zu fragen, was denn los sei.
Ein Jahr später wurde die erste Tochter von Golde und Leon geboren. Sie nannten das Mädchen, das schon bei der Geburt einen Flaum schwarzer Haare hatte, Anne-Rose. Golde wollte ihrer Tochter ein Martyrium, wie sie es hatte durchleben müssen, ersparen. Sie und ihr Mann schickten das Kind in einen städtischen Kindergarten, nicht in einen jüdischen. Danach in die städtische Mädchenschule von Fürth. Die Mutter klärte ihre Tochter auf, als diese ihren zwölften Geburtstag feierte. Anne-Rose wusste vor der Zeit, was auf sie zukommen würde, fürchtete sich also nicht, sondern war neugierig. Die Mutter erlaubte dem Kind, was ihr selbst verboten war und was ihr Vater mitnichten guthieß. Anne-Rose durfte an Schulfesten teilnehmen und mit nicht-jüdischen Freunden Ausflüge unternehmen. Golde erlaubte ihrer Tochter, Tanzstunden zu nehmen, die Leon Lammfromm, mit dem sie monatelang darüber gestritten hatte, was ihrer Tochter nun erlaubt werden dürfte und was nicht, eher widerwillig bezahlte.
Golde hatte sich in Bezug auf die Erziehung durchgesetzt. Anne-Rose sollte nicht nur mit Juden verkehren, sie durfte nicht-jüdische Freunde haben, und diese mussten nicht einmal wissen, dass sie Jüdin war. Auch der Entschluss, sich vom orthodoxen Judentum zu lösen, war Goldes ureigene Entscheidung – ihrem Mann abgetrotzt.
Zwar gab es in Fürth zu jener Zeit keine liberale jüdische Gemeinde, aber der damalige Rabbiner, Din Fränkel, hatte früh erkannt, dass es schwer werden würde, junge Menschen für den jüdischen Glauben zu begeistern, wenn man ihnen alle weltlichen Freuden verbot, und so drückte er mehr als nur einmal ein Auge zu. Manchmal auch beide. Nicht zuletzt, weil seine drei Söhne schon während ihrer Pubertät offenbarten, dass sie nicht daran dachten, in Fürth ein Leben zu leben wie in einem polnischen Ghetto. Alle drei waren sehr gescheit, erfolgreich in der Schule und entschlossen, die Rabbiner-Tradition der Familie nicht fortzusetzen.
Von den dreien – Gabriel, Riccardo und Menachem – war der Zweitgeborene der Keckste und Hübscheste, geboren im April 1913. Also knapp ein Jahr älter als Anne-Rose. Die beiden kannten einander schon als Kinder. Als Anne-Rose die Schule verließ, besuchte Riccardo die letzte Klasse des Gymnasiums. Sie half ihrer Mutter im Haushalt, lernte alles, was eine gute jüdische Mamme wissen musste. Einziger Luxus in jener Zeit war für sie die Tanzschule in Nürnberg, wohin sie immer mittwochs fuhr. Riccardo Fränkel erzählte sie, dass ihre Eltern ihr diesen Unterricht erlaubten, und dass sie es genoss, allein nach Nürnberg fahren zu dürfen und dort fremde Jungs zu treffen.
»Wissen deine Eltern, dass du so was machst?«
»Was meinst du mit ›so was‹?«
»Ich meine, du machst sie auf dich aufmerksam.«
»Das muss ich gar nicht, die meisten im Kurs sind eh schon verliebt in mich.«
Sie log nicht. Anne-Rose war der Schwarm der jungen Männer. Sie war zart, hatte eine makellose Haut, glänzende, wache Augen, kohlrabenschwarzes Haar und bewegte sich federleicht. Das Wichtigste aber: Sie konnte lächeln, sie konnte lachen. Verschmitzt, verschämt, lauthals. Ihr Lachen war ansteckend. Und ihr Witz frech.
Riccardo Fränkel sagte nicht, was er dachte – eingebildetes Huhn! –, sondern machte Anne-Rose den Hof. Ja, sie sei eines der hübschesten Mädchen von Fürth. Obwohl er gewiss nicht alle kannte. Sie überlegte, ob sie ihm schmeicheln sollte, denn er gefiel ihr durchaus, dieser große Schlacks mit den langen Wimpern und dem schwarzen, ganz glatten Haar, das auf seine Schultern fiel. Seinem Vater missfiel diese »Mädchenfrisur«, wie er es nannte, Anne-Rose mochte sie sehr. Sie mochte auch Riccardos Gang, der – nicht gemächlich, nicht schnell – andere dazu provozierte, ihn hochmütig zu nennen. Riccardo kannte seine Wirkung als schöner Flaneur. Doch im Gegensatz zu Anne-Rose brüstete er sich nicht damit.
Immerhin traute er sich, nach einem Konzert des Synagogenchors, Anne-Rose anzusprechen und sich mit ihr zu verabreden. Sie nahm die Einladung an. In einer Konditorei am Marktplatz, die bekannt war für ihre Schokoladentorte, trafen sich die beiden. Zu jener Zeit, im September 1931, konnten Juden in Fürth noch unbehelligt überall hin. Doch die Lammfromms fürchteten bereits vor der Machtübernahme, dass Hitler nicht zu stoppen sein würde. Sie dachten an Emigration. Golde und Leon waren sich einig, dass sie mit ihren beiden Kindern nicht nach Palästina auswandern wollten, sondern nach Amerika. Ihr Vermögen würde reichen für so eine Reise, die nur Leon eine »Flucht« nannte, Golde sprach lieber von einem »Umzug«, glaubte an eine mögliche Rückkehr.
Die Fränkels diskutierten ebenfalls, was zu tun wäre. Rabbiner Din Fränkel wollte weder nach Palästina noch sonst wohin. Er wollte durchhalten. »Ich lasse meine Gemeinde nicht im Stich. Solange wir hier unsere Gottesdienste abhalten können, bleibe ich – und ihr bleibt auch!«, erklärte er seiner Familie. Riccardos Hinweis, dass andere Familien, etwa die Lammfromms, auswandern wollten, kommentierte er schlecht gelaunt mit dem Hinweis, dass diese Familie sich ohnehin vom jüdischen Glauben entfernte. Ihre Tochter, Anne-Rose, so flüsterte er scharf, komme kaum noch zu den Gottesdiensten und treibe sich, so habe er gehört, in Nürnberg herum. Er wusste von ihrem Vater, dass eine Heirat mit einem Nürnberger Juden geplant war.
Es stimmte, Leon Lammfromm hatte schon einen Mann für seine Tochter im Blick: den Sohn des Nürnberger Fabrikanten Martin Blumenthal, der seine Firma bereits an seinen Sohn Richard überschrieben hatte. Richard war sechs Jahre älter als Anne-Rose.
Der Nachmittag in der Konditorei gefiel der jungen Anne-Rose. Riccardo war glücklich. Er glaubte, das Mädchen erobert zu haben. Sie war zufrieden. Sie hatte ihn im Netz. Als sie sich verabschiedeten, fragte Riccardo, ob er sie küssen dürfte. Sie erlaubte es. Er drückte seine Lippen auf ihre rechte Wange.
»Ich habe noch eine Frage: Wirst du den Nürnberger heiraten, den dein Vater für dich an der Angel hat?«
Anne-Rose war erstaunt, dass Riccardo davon wusste.
»Ja, mein Vater hat es vor. Richard ist ein netter junger Mann, aber nicht so hübsch wie du. Ich mag ihn – irgendwie. Dich mag ich mehr. Richard durfte mich auch noch nicht küssen. Bis jetzt ist nichts ausgemacht. Außerdem, du weißt es: Wir müssen entscheiden, ob wir in Fürth bleiben oder Deutschland verlassen.«
»Also, du hast einer Heirat noch nicht zugestimmt?«
»Nein!«
5
Sie saßen beim Abendessen. Rabbiner Fränkel hatte laut gebetet und danach die Challa an seine Frau und seine Söhne weitergereicht, als Riccardo vorsichtig fragte, ob er am Sonntag mit Anne-Rose wandern gehen dürfte. Sie wollten gern, so sagte er, den Jacobsweg Richtung Rothenburg laufen.
»Riccardo, ihr werdet nicht gemeinsam wandern, und ihr werdet schon gar nicht den christlichen Pilgerweg gehen. Du hast die Lammfromm-Tochter geküsst, Riccardo! Widersprich nicht. Tante Naomi hat dich gesehen. Also leugne nicht – denn so würdest du obendrein noch zum Lügner!«
»Tu ich nicht. Ja, ich hab ihr ein Küsschen gegeben, auf die Wange!«
Rabbiner Fränkel verbot seinem Sohn – und gleich den beiden anderen dazu – jeden weiteren Kontakt zu dieser Familie.
Es war ein tristes Abendessen, weil niemand sprach – außer dem Rabbiner, der sich gern dozieren hörte. Bevor sich Riccardo schlafen legte, schrieb er einen Brief, in welchem er Anne-Rose alles erklärte und ihr versprach, sich nicht an dieses Verbot halten zu wollen: … wenn du mich magst, das ist die Voraussetzung. Ich bin fast zwanzig – da kann mein Vater mich nicht behandeln wie ein Kind. Falls du mich magst, müssen wir uns heimlich treffen.
Anne-Rose hatte sich in Riccardo verguckt – und das Verbot, so ist es immer mit Unerlaubtem, schürte das Flämmchen Verliebtheit zu einer Flamme. Und diese loderte heftig.
Doch sie war bereits dem Sohn der Familie Blumenthal versprochen. Und wiewohl ihr Herz an Riccardo hing, gab es keinen Grund, sich dem Wunsch ihres Vaters zu widersetzen. Zumal sich die Blumenthals wie die Lammfromms entschieden hatten, nicht in Deutschland zu bleiben. Ob sie nach Palästina gehen würden oder nach Amerika – diese Frage war noch nicht beantwortet. Sicher war nur, dass die Fränkels auf keinen Fall emigrieren wollten. Weder der alte Fränkel wollte sich »aus dem Staub machen«, wie er es nannte, noch seine Frau. Die Söhne hatten sich bisher nie dem Wunsch des Vaters widersetzt und würden es auch in diesem Fall nicht tun. Aber Anne-Rose wollte Riccardo sehen, und bat einen ihrer Freunde, auf den sie sich verlassen konnte, Riccardo nach dem Gottesdienst einen Brief zuzuspielen. »Niemand darf etwas davon bemerken«, flüsterte sie scharf.
Riccardo war selig.
Wann sehen wir uns? Willst Du? Schreib mir! Rasch!? Auf Gabriel können wir uns verlassen – er wird unser Bote sein. Ich warte auf Antwort. Ich mag Dich – Anne-Rose.
Nach drei langen Tagen kam die Antwort. Gabriel brachte einen Brief.
Liebste Anne-Rose!
Ich muss Dich wiedersehen! Ich werde meinen Geigenunterricht schwänzen – jede zweite Woche, immer mittwochs. Der Lehrer wird mich nicht verpfeifen. Er ist Christ und findet unsere strenge Erziehung ohnehin unmenschlich. Und er erlaubt, dass wir uns in seinem Haus treffen. Magst Du? Ich hoffe so sehr, Dich bald zu sehen.
Dein Riccardo!
Anne-Rose Lammfromm und Riccardo Fränkel trafen sich von nun an jeden zweiten Mittwoch bei Wilhelm Anderson. Immer im Probenraum – Riccardo konnte seinem geliebten Ännchen, wie er sie nannte, hier sogar Ständchen spielen. Sie wurde süchtig nach den Bach-Präludien, die er ihr vorspielte. Sorgsam vermieden beide zwei Themen: Emigration und Richard Blumenthal.
6
»Ihr wisst, Jacob kann dieses Land nicht leiden. Trotzdem möchte ich nach Deutschland. Ich bin jetzt eine alte Frau.«
»Ach, Grandma, lass das fishing for compliments. Heute ist der 8. Juni,« – Benjamin schaute auf seine Uhr, auf die er stolz war, da sie ein Geschenk seines Großvaters war – »du wirst in einem Monat und einem Tag dreiundachtzig, siehst aus wie gerade mal siebzig und machst dich bei Hotelreservierungen immer zehn Jahre jünger. Alt wirst du, wenn überhaupt, erst 2026.«
»Schreckliche Vorstellung: fünfundachtzig!« Rahel musste lachen. Und Benjamin grinste.
Rahel beschloss, das Thema aufzuschieben bis zum Dessert. Sie wollte sich vergnügen mit ihren Enkeln, die nie recht zu Wort kamen, wenn Benjamin mit von der Partie war. Besonders beglückt war sie, dass an diesem Abend auch ihre Enkelin Deborah mit deren Mann Levin Lämmle gekommen war, einem orthodoxen Juden, der seine Kippa nie absetzte und mit seinen roten Schläfenlocken jeder Frau den Kopf hätte verdrehen können, wenn er es denn gewagt hätte, zu flirten. Ihm zuliebe hatte Deborah die liberale Gemeinde verlassen. Ihre Eltern, Chaim und Gili, hatten diesen Schritt befürwortet, sie nur gebeten, sich den Kopf nicht kahlrasieren zu lassen.
»Levin, verzeih, dass auch Schinken auf dem Tisch seht, aber Melone ohne geht irgendwie nicht«, begann Rahel.
»Nicht so schlimm, Rahel, ich muss ihn ja nicht essen – und die Pastrami liegt ja auf einem Extrateller.«
»Stellst du dich immer noch so an – bei dieser Frau, ein wahres Wunder! Deborah liebt Austern!«
»Die darf sie ja auch essen, solange ich nicht zusehen muss, Benjamin!«
»Na, Deborah, wie wär’s am Donnerstag mit Fruits de Mer in der Food Hall?!,« mischte sich Lisa, die Tochter von Alisah und Asael, ein. »Damir mag es nämlich auch nicht, wenn ich esse, was verboten ist.«
»Ich dachte, Moslems müssen nur auf Alkohol und Schweinefleisch verzichten, Meeresgetier aber sei erlaubt?«
»Wenn ihr’s genau wissen wollt …«
»Wollen wir, sonst hätte meine Schwester nicht gefragt, Damir!«
»Also, Benjamin, Garnelen sind den Malikiten, Schafiiten und Hanbaliten erlaubt, und verboten für Hanafiten.
Krabben, Langusten und Hummer sind für Malikiten und Hanbaliten erlaubt, für Hanafiten verboten. Schafiiten stehen dazu unentschieden. Tintenfische, Muscheln, Austern werden von Malikiten, Schafiiten und Hanbaliten erlaubt, aber von Hanafiten verboten.«
»Und was erlaubst du dir?«
»Ich mache es wie eure Großmutter: Erlaubt ist, was mir schmeckt. Muscheln mag ich nicht. Eigentlich bin ich am liebsten Vegetarier.«
Damir Soylus witzige Antwort gefiel Rahel, die, wie eigentlich alle Cohens, Lisas Wahl für einen muslimischen Mann nicht sonderlich schätzte. Sie lebte schon seit knapp drei Jahren mit Damir zusammen, der als Lektor – »immerhin«, hatte Jacob Cohen kommentiert – beim Verlag Columbia University Press arbeitete. Alle anderen in der Familie hatten ihn inzwischen akzeptiert, aber Rahel und Jacob Cohen mochten ihn nicht gern dabei haben bei ihren großen Festen. Das muss und wird sich ändern, dachte Lisa, während man in dieser großen Runde mit Champagner anstieß.
Das Klingklang der Gläser war begleitet von vielen strahlenden Lächeln, da im Grunde kein Misston die fröhliche Runde störte, und Benjamin übertrieb wieder einmal, er stieß mit seiner Großmutter gleich zweimal an. Allein Elias, der noch sehr kleine Sohn von Benjamins Schwester Esther und deren Mann, Noah Weinberg, gefiel dieses Klirren nicht. Er fing zu weinen an. Es war Benjamin, der aufstand, den Zweijährigen hochhob und mit ihm durch die Wohnung galoppierte.
Noah Weinberg war ein Jahr jünger als seine Frau. Dass die beiden so früh geheiratet hatten – bereits zu Beginn ihres Studiums – hatte sowohl die alten Cohens als auch die Weinbergs verdrießlich gestimmt. Aber die beiden »jungen Leute«, so sagten die Eltern, waren nun einmal nicht umzustimmen.
»Es ist Liebe!« Damit hatte Rahel ihren Jacob gütig gestimmt und ihn umarmt. »Und sie sind so begabt! Sie sind Künstler!« Beide studierten Musik an der Julliard School, sie Oboe, er Cello. Oft hüteten die Großeltern Cohen oder Weinberg den sehr munteren Elias, den alle Elija nannten.
Jacob und Rahel hatten sich sehr über ihren ersten Urenkel gefreut. Und sie verwöhnten ihn, was Noah nicht immer guthieß, im Gegenteil, er fand es völlig meschugge, dass Rahel dem Kleinen unbedingt einen Pullover von Burberry hatte schenken müssen.
Rahel und Jacob Cohen stimmte es froh, dass ihre beiden Söhne Jüdinnen geheiratet hatten, dass ihre Enkel jüdisch erzogen wurden, mehr oder minder streng. Eher minder. Sie waren heiter, als die Jungs ihre Bar Mitzwa gefeiert hatten und die Mädchen ihre Bat Mitzwa. Dass fast alle Enkel einen Partner gefunden hatten, mit dem sie glücklich waren – zumindest schien es so –, ließ sie zufrieden auf ihre Familie blicken. Nur Aarons Sohn, Asael, und Benjamin waren noch unverheiratet. Asael hatte eine Freundin. Sie hieß Elizabeth Snider und war katholisch erzogen. Vor allem Benjamin mochte sie, denn sie glich ihm irgendwie, sie war so schön unkonventionell und frech und sah mit ihren streichholzkurzen Haaren aus wie ein Junge.
Als Benjamin wieder zurück am Tisch war, Elias in seinem Kinderwagen schlief und Gili aus der Küche die Espressi geholt hatte, setzte Rahel von Neuem an: »Noch einmal, meine Lieben. Ich bin eine alte Frau, dabei bleib ich, und will mir diesen Wunsch, Deutschland zu bereisen, im nächsten Jahr erfüllen. Noch bin ich rüstig. Ich möchte nach Fürth. Vielleicht noch nach München, vielleicht sogar nach Berlin. Ich weiß es nicht. Ich bitte dich, Jacob, mich diesmal reisen zu lassen.«
Jacob nahm seine Frau in die Arme und sagte – nichts. Gili, deren Name die Fröhliche bedeutet, fing an zu weinen, sie war von allen Cohens die Sentimentalste. Jacobs Umarmung war die Antwort. Er war mit seinen Neunundachtzig nicht minder jung geblieben. Er ging einmal monatlich in einen Fitnessclub und trainierte eine Stunde lang, was alle, auch sein Trainer, mit großem Respekt wahrnahmen. Aber, viel wichtiger: Es verging keine Woche ohne einen Konzertbesuch oder einen Abend in der Metropolitan Opera. Nur zu den Matineen begleitete Rahel ihn – sie las lieber, allerdings selten die Bücher, die ihr Alisah empfahl. Sie fand die Auswahl ihrer Schwiegertochter extrem einseitig. Sie getraute sich allerdings nicht zu sagen, was sie dachte: zu radikal feministisch!
Rahel und Jacob hatten ihre Rituale und pflegten sie. Hatten sie sich am Morgen gestritten, dann drehte einer von beiden das Hochzeitsfoto, gerahmt in ein silbernes Herz, schlichtweg um. Am Abend aber hing es immer wieder mit seiner Schauseite da – sie konnten nicht unversöhnt zu Bett gehen. Nie. Eine Umarmung war bei ihnen immer ein Ja auf jede wichtige Frage. Als Jacob mit ihr nach Israel wollte, um dort einen ihrer Hochzeitstage zu feiern, hatte sie sich an ihn geschmiegt; als sie mit ihm St. Petersburg erkunden wollte und die Eremitage, hatte er sie fest in seine Arme gedrückt. Schickten sie einander Briefe oder später E-Mails, weil er für Mandanten reisen musste oder sie sich aufmachte zu einer Ausstellung in San Francisco oder Chicago, unterzeichneten sie ihre meist kurzen Liebesgrüße immer mit Umarmungen: Hugs and kisses – Je t’embrasse très très fort – Ti darò un sacco di abbracci e baci.
Nie aber schrieben sie diesen Gruß auf Deutsch.
Die Enkel küssten ihre Oma.
»Really cool, Grandma!«, sagte Benjamin.
»Nein, nicht cool, wonderful!«, rief Gili und wischte sich die Tränen von der Wange.
Chaim und Aaron waren stolz auf ihre Mutter und lobten ihren Vater, dass er nun endlich das Alter erreicht habe, so weise zu sein, seine Rahel ziehen zu lassen.
Weit nach Mitternacht verabschiedeten Rahel und Jacob ihre Liebsten; Elias schlief in seinem Wagen.
»You are wonderful!« – rief Benjamin seiner Großmutter noch einmal zu, die mit ihrem Mann im Türrahmen stand und allen herzlich zuwinkte.
Vor dem Einschlafen kuschelte sich Jacob an seine Rahel: »Ich hoffe nur, dass du nicht enttäuscht zurückkehren wirst.«
Sie antwortete nicht, sondern schlang die Arme um ihren Mann – er war kein Greis – und küsste ihn. Nicht wie man das von alten Leuten meinen möchte, nein. Ihre Lippen öffneten sich.
Einige Tage nach Gilis Geburtstag, den die ganze Familie in einem einfachen Restaurant in der Houston Street gefeiert hatte – dort gab es die beste Pastrami der Stadt, behauptete Benjamin –, fuhr Jacob seine Frau zum Flughafen John F. Kennedy. Vor dem Check-in-Schalter warteten bereits alle anderen Cohens. Lisa hatte ihren Damir mitgebracht, was Rahel und Jacob durchaus auffiel. Wir sollten ihn nach meiner Rückkehr immer zu uns einladen – an allen Tagen, selbst an den Hohen Feiertagen, dachte Rahel Cohen plötzlich und nahm den großen Mann in die Arme, was diesen nicht wenig verblüffte, denn es geschah zum ersten Mal.
Noch neunzig Minuten bis zum Abflug.
Umarmungen, Küsse, Tränen.
»Ich werde – so Gott will – bald wieder zurück sein. Ich erwarte euch in der Ankunftshalle, aber ich weiß noch nicht, wann. Mein Rückflug ist umbuchbar«, lächelte Rahel und gab jedem ein kleines Präsent. So hatte sie es stets gehalten, seit die Enkel auf der Welt waren. Jedes Mädchen – auch die Schwiegertöchter – bekam ein Schokoladenherz aus Rahels Lieblingslädchen, einem kleinen Feinkosthändler, gleich bei ihr um die Ecke. Sie kaufte gern dort ein, um in die Fenster der Luxusläden nebenan zu gucken. Manchmal wagte sie sich auch in den einen oder anderen Shop. Und seit ihrer Eröffnung besuchte sie gern eine Lederboutique, die handgenähte Luxusartikel feilbot. Und kaufte ein. Sie stand weniger auf Schuhe als auf Taschen. Zu oft, fand Jacob, der der Ansicht war, dass eine Flechttasche genug sein müsste. Rahel besaß drei: in Schwarz, Dunkelblau und Rot. Zwei hatte sie eingepackt, die schwarze wollte sie mit in die Kabine nehmen. Die Jungen bekamen keine süßen Herzen, sondern jeder ein paar bunte Socken. Eine Rahel-Cohen-Marotte.
Vor der Kontrolle winkte sie noch einmal, und alle winkten ihr zurück. Sie blickte in strahlende Gesicht, die ihr Mut machten. Tränen sah sie nur auf den Wangen von Esther, Gili – und Jacob.
Wie schön, dass er weint! Er liebt mich! Rahel beglückten die Tränen ihres Mannes. Von all den Männern, in die sie sich verliebt hatte – vor ihrer Hochzeit und während ihrer Ehe –, war Jacob wohl derjenige, dem die seltsamsten Dinge zu Herzen gingen. Er weinte in der Oper, aber das verstand sie noch, wenngleich ihr Mimis Lungenkrankheit eigentlich egal war. Aber dass Jacob bei den schnulzigsten Liebesfilmen heulte, nein, das konnte sie nicht nachvollziehen. Manchmal lachte sie ihn aus.
Jacob Cohen liebte seine Frau; seit zweiundsechzig Jahren waren die beiden verheiratet. Es waren nicht immer leichte Jahre gewesen. Nach der Geburt der beiden Söhne hatte Rahel ihre Ambitionen aufgegeben. Dass sie je promovieren und ein Buch über den jüdisch-russischen Maler Chaim Soutine schreiben würde, glaubte sie damals längst nicht mehr. Obwohl Jacob sie ermutigte. Sobald die Söhne studieren, könnte sie sich doch wieder an einer Universität einschreiben. Sie murrte nicht, doch Jacob hatte bemerkt, dass seine Frau nicht mehr so heiter war wie zu Beginn ihrer Ehe. Es betrübte ihn, dass seine Rahel oft aggressiv reagierte, wenn er zu spät aus der Kanzlei kam, wenn er zu viel reiste und sie mit all den Aufgaben im Haus allein ließ. Es stimmte: Er kümmerte sich viel zu wenig um die Erziehung seiner Söhne. Nie fand er Zeit, mit ihnen Schulaufgaben zu machen. Er forderte gute Noten, bessere Noten, aber er half seinen Kindern nicht, dieses Ziel zu erreichen. Dabei hatte er ihre Zukunft schon bestimmt. Einer sollte Arzt werden, der andere Anwalt, wie er. Rahel Cohen führte den Haushalt und sorgte für die Erziehung der Knaben. Wenn sie sich überfordert fühlte, beklagte sie sich nicht bei ihrem Mann, der aus allen Diskussionen als Sieger hervorging, weil er auch zuhause wie in den Gerichten recht behalten wollte – und behielt, nein, sie suchte anderswo Rat. Bald schon vermied sie alle Diskussionen mit ihrem Mann. Stattdessen besuchte sie ihre Mutter Anne-Rose, bei der sie Trost fand. So wie Jacob seien alle Männer, auch ihr Richard habe sich nicht anders verhalten, erklärte Anne-Rose ihrer Tochter. Auch ihm sei seine Fabrik wichtiger gewesen als die Familie. »Der Unterschied ist, dass dein Mann offensichtlich die Lebenswege eurer Kinder bestimmen will, Richard war da zurückhaltender. Du durftest studieren, wozu du Lust hattest.« Es stimmte, auch ihr Bruder Schlomo, zwei Jahre jünger als Rahel, hatte nicht Betriebswirtschaft studieren müssen, was dem Vater angenehm gewesen wäre, sondern sich eingeschrieben für Sport und Geografie – mit dem Ziel, Lehrer zu werden.
7
An Trennung hatte Rahel Cohen nie gedacht, selbst nicht, als sie sich vier Jahre nach der Geburt von Chaim und Aaron in einen Kollegen ihres Mannes verliebte. Das war die erste und heftigste Krise in ihrem Eheleben. Rahel war Daniel Schlesinger und dessen Frau bei einer gemeinsamen Freundin begegnet, anlässlich eines Geburtstagsfestes. In den Monaten, in denen Rahel sich mit diesem Mann traf, versicherten sie einander immer wieder, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Daniel war ein schlanker Mann, groß gewachsen, und also größer als ihr Jacob. Er war blond, was Rahel Cohen vor allem deshalb gefiel, weil dieses helle Haar so gar nicht zu seinen braunen Augen passte. Er imponierte an jenem Abend mit seinem Charme und seinem Aussehen. Rahel und Daniel plauderten – Smalltalk über die Guggenheim-Ausstellung, über einen Artikel im New Yorker, in dem eine bisher unbekannte Lyrikerin gefeiert wurde, als wäre sie die Nachfahrin von Walt Whitman, und über eine Musical-Aufführung, die sie beide gesehen hatten und absolut dumm fanden. Während Jacob Cohen den groß gewachsenen schlanken Mann gar nicht bemerkt und also auch nicht registriert hatte, dass seine Frau sehr lange mit ihm sprach und lachte, ärgerte sich Daniel Schlesingers Frau über Rahel Cohen, die, so ihr unausgesprochenes, aber hellsichtiges Urteil, ihren Mann gar nicht mehr »aus ihren Klauen« ließ, weshalb sie sich kurzerhand entschloss, zu handeln: »Wollen wir denn nicht mal nach Hause, Daniel?« Sie stellte sich vor und entschuldigte sich dafür, das Gespräch unterbrochen zu haben.
»Wir reden schon viel zu lange, wahrscheinlich langweile ich Ihren Mann bereits.«
Daniel Schlesinger lächelte.
»Wir müssen heim zu unseren Kindern«, insistierte sie.
»Es war schön, Sie getroffen zu haben«, sagte er.
Rahel Cohen lächelte: »Finde ich auch!«
Sie erinnerte sich nicht, jemals einen Mann so attraktiv gefunden zu haben. Sie stellte sich ihn nackt vor – und erschrak über sich selbst. Warum schlich sich Freude ein bei diesem Bild? Sie war nicht unzufrieden mit ihrem Jacob – in keinerlei Hinsicht. Und dennoch …
Am nächsten Tag erkundigte sich Rahel Cohen bei einer Freundin nach dem großen blonden Mann. Sie erfuhr, dass auch er als Anwalt arbeitete, dass er verheiratet war und zwei entzückende Kinder hatte.
»Mehr kann ich dir auch nicht sagen – ich kannte vor der Party nur seine Frau. Aber er sieht gut aus: ein blonder Hüne mit bernsteinfarbenen Augen und noch dazu Jude. Das gibt’s selten.«
Rahel Cohen fragte nicht weiter.
Daniel Schlesinger kannte Jacob Cohen, sie waren schon einmal juristische Gegner gewesen, wobei Schlesinger zugeben musste, dass Cohen ihm juristisch in nichts nachstand. Aber – das ärgerte ihn ein wenig – er hatte eine extrem hübsche Frau, schlanker als seine eigene und zudem außergewöhnlich amüsant. Tagelang dachte er an dieses schöne Geschöpf, unternahm aber nichts. So wenig wie Rahel, gleichwohl auch sie an diesen Mann immer wieder dachte, denken musste. Sie hoffte, er würde sich melden, kannte er doch ihren Namen. Es vergingen Tage, schließlich Wochen. Sie hörten nichts voneinander. Wir sind beide verheiratet, wir haben beide Kinder, dachte Rahel Cohen. Basta.
Keine anderen Gedanken schwirrten im Kopf von Daniel Schlesinger. Und doch hoffte er, sie wiederzusehen. Er wollte ein zweites Treffen aber nicht herbeiführen, er wollte nicht anrufen, nicht den Kollegen mit seiner Frau zu sich einladen. Er hoffte auf den Zufall.
Vier Monate nach besagter Party erhielt die Kanzlei von Daniel Schlesinger eine Einladung. Jacob Cohen und seine Partner luden ein zur alljährlichen Ausstellung in den Räumen der Sozietät. An einem Donnerstag. Eine Sekunde lang dachte Daniel Schlesinger daran, allein dort aufzukreuzen, in der zweiten entschied er anders. Er würde mit seiner Frau zusagen, trotz der Aussicht, dass Rahel Cohen sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen würde – sie war doch, erinnerte er sich, Kunsthistorikerin, oder?
»Wen habt ihr eingeladen, Jacob?«, fragte Rahel, als sie die Einladungskarte betrachtete.
»Kollegen aus anderen Kanzleien und ein paar Kunstkritiker.«
Sie fragte nicht, welche Kollegen. Sie freute sich auf den Abend, auf die Cocktails, auf die Gespräche und hoffte, Daniel Schlesinger wiederzusehen. Als sie das Atrium der Sozietät betrat, standen schon zahlreiche Gäste an den Stehtischen oder vor den großformatigen Acrylbildern, die, so befand Rahel Cohen, viel zu bunt waren. Daniel Schlesinger entdeckte sie nicht. Ich müsste ihn sehen, so groß wie er ist.
Sie ging durch die angrenzenden Räume, gab ihrem Mann einen flüchtigen Kuss – ihm schien er nur hingeworfen, nicht geschenkt – und suchte den anderen.
Schließlich stellte sie sich mit ihrem Weinglas neben eine Kollegin ihres Mannes, die sie mochte.
»Wie finden Sie die Bilder, Rahel?«
»Einfach nur bunt.«
»Die Malerin wird grad gehypt – ich finde sie überbewertet. Aber Kollege Friedman schätzt sie, wahrscheinlich schätzt er die Frau mehr als ihre Bilder.«
Beide lächelten.
»Passiert hier noch was?«, fragte Rahel.
Der Seniorpartner würde noch begrüßen und ein Kurator – »eher eine kleine Funzel« – würde etwas zu den Exponaten sagen. Rahel Cohen entschloss sich zu warten. Vielleicht würde Daniel Schlesinger noch auftauchen.
Die Begrüßung war fad, die Rede des Kurators unsäglich. Er schmiss mit Fremdworten um sich, bemühte für die Buntheit dieser Bilder erst Warhol, dann für die Porträts Frida Kahlo und wollte auch noch Picasso in den abstrakten Formen entdecken.
»Jetzt reicht’s, ich gehe«, sagte Rahel Cohen, setzte ihr Glas ab, verabschiedete sich von der Anwältin, winkte ihrem Mann und ging zur Garderobe.
»Sie gehen schon, Frau Cohen?« Neben ihr stand Frau Schlesinger.
Rahel erklärte sich umständlich und fragte nicht, was sie zu gern gefragt hätte.
»Wir sind spät dran, mein Mann parkt gerade. Schade, dass Sie schon gehen müssen!«
Rahel pflichtete dem bei, gerade weil sie einen spöttischen Unterton rauszuhören glaubte, packte ihre Handtasche, wünschte noch viel Vergnügen und eilte zum Lift. Als dieser in der Lobby hielt und sich seine Türen öffneten, stand Daniel Schlesinger vor ihr.
»Sie gehen?«
»Ja, die Bilder sind unerträglich, die Reden sind es auch, und Champagner allein ist für mich kein Grund, zu bleiben.«
»Schade! Ein Glas zu zweit wäre schön gewesen!«
»Das mag sein, Ihre Frau wartet ja oben auf Sie!«
Auf der Straße ärgerte sich Rahel Cohen über ihr Benehmen. Zurückgehen – wie sähe das aus? Den Zufall ignorieren? Das kam nicht infrage. Sie dachte nach, ihr fiel etwas ein: Sie rief beim Empfang der Kanzlei an und bat, ihrem Mann auszurichten, einer der Gäste, ein großer blonder Mann, dessen Name, so glaube sie, Schlesinger sei, werde vom Concierge gesucht, da man sein Auto gleich abschleppe. Daniel Schlesinger wunderte sich, hatte er seinen Wagen doch in der öffentlichen Parkgarage gleich um die Ecke abgestellt. Er eilte zum Lift, und er hoffte.
Rahel Cohen wartete keine drei Minuten im Foyer. Da hielt der Aufzug, aus dem heraus Daniel Schlesinger trat.
»Das war eine Lüge!«
»Ich weiß!«
Rahel Cohen stutzte. Sie wurde rot. Immer wenn sie aufgeregt war, bekam sie Flecken am Hals, immer auf der linken Seite. Sie gab ihm ihre Karte und rannte weg. Ihr war heiß, ihre Wangen glühten.
Daniel Schlesinger trat vor die Tür, wartete ein wenig und fuhr schließlich zurück, hoch in den 21. Stock. »Gerade noch mal gutgegangen«, flüsterte er seiner Frau zu und nahm sie in den Arm, »habe umgeparkt in eine Garage. Es ist eben Quatsch, so Geld sparen zu wollen. Und jetzt schauen wir uns diese Fürchterlichkeiten mal genauer an.«
Rahel Cohen wunderte sich über sich selbst. So etwas hatte sie nie zuvor getan. Es hatte Affären gegeben, das schon, glückliche, überflüssige, kurze. Nur eine, mit einem viel jüngeren Mann, einem Studenten, den sie in einem Supermarkt, wo er jobbte, angesprochen hatte, war ähnlich verlaufen in ihrem Anfang. Sie hatte ihn an der Kasse gesehen, hatte ihm ein Kompliment zu seinen Augen gemacht. Bei ihrem nächsten Einkauf dann fragte er, ob sie seinetwegen in den Laden gekommen sei. Sie hatte genickt. In seiner Mittagspause nahmen sie in einem billigen Pub einen Drink zu sich, bevor er sie dann abschleppte – in den Lagerraum des Supermarkts. Das zweite Mal hatte sie mit ihm Sex in seinem eher schmuddeligen Appartement. Es endete schrecklich. Nach dem dritten Mal – wieder zwischen leeren Mineralwasserkisten und gestapelten Kartons voller Dosen mit geschälten Tomaten – servierte er sie ab. So war sie nie zuvor verletzt worden: »Du machst das schon ganz gut, aber wir müssen das nicht wiederholen. Vielleicht bist du nur an die falschen Liebhaber geraten, die nichts mit dir ausprobiert haben. Jedenfalls bist du erbärmlich schlecht beim Blowjob!« Sie war zu perplex, um ihn zu ohrfeigen. Sie fühlte sich erniedrigt, elend und schmutzig. Heulend war sie nach Hause gefahren, hatte sich geschworen, nie wieder eine Affäre zu beginnen.
Und nun? Daniel! Ein Mann mit Weizenhaaren und Bernsteinaugen. Und sein Gang! Er schritt, als wäre er Tänzer und nicht Anwalt.
Schon am nächsten Tag hatte Daniel Schlesinger sie angerufen. Er machte keinerlei Bemerkung zu ihrer Forschheit – was sie befürchtet hatte. Stattdessen fragte er, ob sie Lust hätte, ihn zu begleiten zu einem Konzert am nächsten Abend.
»Und deine Frau?«
»Sie hat ihren Yogaabend. Und dein Mann?«
»Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber er ist nicht eifersüchtig.«
»Das sollte er aber!«
Rahel Cohen log, sie gehe mit ihrer Freundin Clara in ein Konzert; »irgendetwas Barockiges«, hatte sie gesagt. Es war wirklich ein Konzert mit Händel-Arien, gesungen von einer fulminanten Italienerin, von der sie zuvor noch nie gehört hatte. Später dann lud Daniel Schlesinger sie in eine Bar ein. Zum Abschied küssten sie einander. Nicht auf die Wange. Sie fuhren jeder zu sich nach Hause. Eine Woche später trafen sie sich in der Galerie eines Freundes, den Daniel aus Studienzeiten kannte, in Greenwich. Ein kleines Backsteinhaus. Claus Bridgeday hatte seinem Freund den Schlüssel überlassen und im Kühlschrank eine Flasche Wein bereitgestellt. Erst sahen sie sich die Bilder an, Fotografien aus dem Paris der fünfziger Jahre. Dann öffnete Daniel die Flasche. Sie sprachen nicht. Sie liebkosten einander. Vorsichtig. Langsam näherten sich ihre Gesichter, ihre Körper. Bevor er ihre Bluse aufknöpfte, fragte er leise, ob ihr das recht wäre. Sie antwortete, indem sie an seinem Hemd zu nesteln begann.
Als sie auseinandergingen, wussten sie, dass sie sich wiedersehen wollten. Wieder beim Galeristen. Sie waren sich einig, dass sie ihre Familie nicht aufs Spiel setzen würden, dass sie eigentlich nicht viel voneinander wussten. Dass sie sich begehrten – körperlich, nicht seelisch. Sie tauschten nie Liebesworte. Sie fielen übereinander her – und genossen sinnliche Freuden, wie sie Rahel bislang nicht erlebt hatte.
Wir lieben einander nicht, dachte sie erschöpft in Daniels Armen liegend. Wir erregen einander. Mehr nicht. Ich fühle ihn. Aber auf dem Weg nach Hause denke ich an Jacob, nicht an ihn. Doch ich will ihn – mit Haut und Haar. Wieder erschrak sie über sich. Und doch überkam sie ein wohliges Gefühl.
Rahel war im Gegensatz zu ihrer Mutter konsequent, sie hatte sich auf den Betrug eingelassen und ihn auch nie in ihrem Leben bereut. Daniel offenbarte ihr, wie verspielt und lustvoll Sex sein kann, sie verstand, was körperliche Begierde, tabuloses Begehren ist, und hat Orgasmen erlebt, wie sie es nicht für möglich gehalten hätte. Für Daniel war ihr Körper das Wunder einer Landschaft, in die er eintauchte und die er erbeben ließ. Jacob, so flüsterte Rahel sich ein, um den eigenen Betrug schönzureden, habe sich an sie gewöhnt – was in einem gewissen Maß auch stimmte, seine Küsse hatten an Intensität verloren, sein Begehren entsprach einer Pflichtübung, erotische Fantasien schien er keine zu haben.
Das änderte sich erst nach Daniel Schlesingers Abreise. Jacob Cohen, der bekümmert hatte feststellen müssen, dass seine Frau plötzlich immer häufiger Freundinnen besuchen wollte – und zwar stets ohne die Kinder, was als Lüge leicht durchschaubar war; den es sorgte, dass sie sich abwandte, wenn er des nachts unter ihre Bettdecke schlüpfen wollte –, Jacob wurde von einem Tag auf den anderen wieder eingelassen. Rahel Cohen küsste ihn, als habe sie sich neu in ihn verliebt. Und er? Er ließ sich anfeuern. Er entdeckte ihren Körper. Sie half ihm dabei nicht, regierte nur sehr deutlich auf seine Wagnisse. Immer mit einem Wort nur: Ja! Ihm bereitete diese Reise in bisher Unerkundetes Lust und er genoss es, seine Rahel nicht verloren, sondern wieder- und neugewonnen zu haben.
Daniel Schlesinger war Rahel Cohens letzte Affäre. Und Jacob Cohen? Vieles konnte er sich vorstellen, ein Leben ohne Rahel indes nicht. Je älter die beiden wurden, desto intensiver wurde ihre Beziehung, sie erfuhren sich gegenseitig im gemeinsamen Erkunden und Erleben ihrer Sexualität, sie lernten, jede Nacht, und sie blieben neugierig.
8
Am Ende aller Mutter-Tochter-Gespräche stand der Satz von Anne-Rose Blumemthal: »Sorge dich nicht, Rahel. Manchmal ist jede Ehe ein Schlamassel.« Rahels Mutter hatte sich in ihr Los gefügt, erst in Deutschland vor der Emigration, dann in den Staaten, so sollte es auch ihre Tochter handhaben: »Richard kümmerte sich um unser finanzielles Wohlergehen und um die religiöse Erziehung der Kinder. Und ich war für alles andere zuständig.« Ohne Murren hatte Anne-Rose neben ihrem Mann gelebt und war nicht unzufrieden dabei. Aber dies war nicht alles. Ein einziges Mal nur, in einem vielleicht von Wehmut geprägten Augenblick, hob sie an, ihrer Tochter davon zu erzählen: »Es gab nur eine kurze Zeit nach unserer Flucht hierher, es gab einige Tage, an denen ich an eine Trennung dachte. Nicht, weil ich glaubte, dein Vater würde mir zu viele Pflichten aufbürden und egoistisch nur an seiner Karriere arbeiten, nein: Weil sich Richard von mir abwandte und eine Freundin hatte.« Dann besann sich Anne-Rose Blumenthal, hielt inne und das Thema war beendet – ein für allemal.
9
Rahels Sitznachbar im Flugzeug war ein jüngerer Mann. Sie schätzte ihn auf Ende vierzig. Gut erzogen, wie es schien, denn er stellte sich ihr gleich vor. Er hieß Alexander und war Anwalt, er flog zurück nach München, wo er lebte. Ich entkomme den Anwälten nicht, schoss es Rahel durch den Kopf, und sie hakte ein: »Da möchte ich auch hin und nach Fürth. Zuerst nach Fürth, ich habe es meiner Mutter auf ihrem Sterbebett versprochen.« Nach einer Pause fuhr sie fort: »Übrigens, mein Mann ist auch Anwalt, und einer meiner Enkel hat vor zwei Jahren in einer New Yorker Kanzlei begonnen.«
Fürth als Reiseziel verwunderte ihren Sitznachbarn. Rahel erklärte ihm, dass sie als Baby mit ihren Eltern aus Deutschland geflohen sei, gerade noch rechtzeitig; dass viele andere Fürther Juden in den Konzentrationslagern umgekommen seien: »Fürth war vor der Shoa eine sehr jüdische Stadt. Ich möchte sie mir ansehen und durch das Land meiner Väter reisen«, fügte sie ein wenig pathetisch hinzu, »und Deutschen begegnen; Juden und Nichtjuden. Vielleicht«.
Der Steward nahm ihnen die Gläser ab: Start. Pünktlicher Abflug. Alexanders Nachnamen erfuhr Rahel erst Stunden später beim Aussteigen, als er ihr seine Visitenkarte überreichte. Auf japanische Art; er hielt sie in beiden Händen.