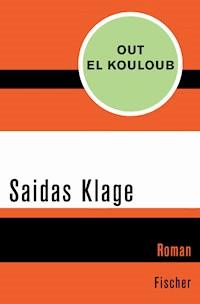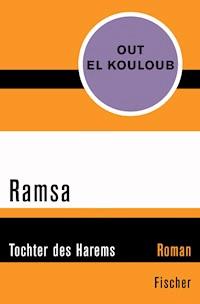
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ramsa» erzählt die bewegende Geschichte einer verbotenen Liebe im Ägypten um die Jahrhundertwende – und einer ungewöhnlichen, mutigen Befreiung. Ramsa, Tochter aus gebildetem und wohlhabendem Elternhaus, wächst behütet unter den Frauen im Harem ihres Vaters Farid Pascha auf. Obwohl es ihr an nichts fehlt, spürt sie früh die Beschränkungen eines Frauenlebens im Islam. Gegen alle Regeln der Gesellschaft geht sie ihren eigenen Weg und trifft – auch in der Liebe – ihre eigene Wahl. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Out el Kouloub
Ramsa
Tochter des Harems
Aus dem Französischen von Anne Büchel
FISCHER Digital
Inhalt
Prolog
Wir saßen zu zweit in unserer gewohnten Ecke auf der Hotelterrasse. Unter uns glitt der Nil zwischen den schwarzglänzenden Felsen rasch dahin. Nahe der Spitze der Insel Elephantine warfen einige Touristen Münzen in den Strom und schauten lachend zu, wie nackte dunkelhäutige Kinder danach tauchten.
Meine Gefährtin schenkte diesem Treiben keine Beachtung. Ich folgte ihrem Blick und bemerkte zwischen dem Grün und den Blumen der Königsinsel die hellen Kleider einer Gruppe junger Leute. In der trockenen Abendluft drangen ihre Worte und ihr Lachen bis zu uns herauf. Kurz darauf sah ich sie aus einer Allee kommen und zum Ufer hinabgehen. Sie waren zu fünft: zwei Jungen, drei Mädchen. Sie sprangen in das Boot, das dort vertäut lag, und hißten das Segel.
Bei ihrem Anblick wirkte meine Gefährtin wie verwandelt. Ihr eingefallener Körper, der Körper einer alten Frau, hatte sich aufgerichtet; die Runzeln auf ihrem feinen, entspannten Gesicht waren wie weggewischt; ihre Augen leuchteten, ihr Atem ging schneller. Sie schien die Farben und die Lebhaftigkeit der Jugend wiedergewonnen zu haben. Ich dachte, daß sie einmal sehr schön gewesen sein mußte.
Ihr Name war berühmt. Wir hatten zwar erst vor wenigen Tagen Bekanntschaft geschlossen, waren einander, da wir uns beide einsam fühlten, jedoch rasch nähergekommen.
Sie griff nach der blutroten Rose, die im Knopfloch ihres schwarzen Tuchmantels steckte, und sog genießerisch den Duft ein. Sie liebte Wohlgerüche, das war mir bereits aufgefallen, vor allem Blumendüfte: Rose, Jasmin, Heliotrop.
Mein Blick fiel auf die Hand, die die Rose hielt. Die Jahre hatten ihre unbarmherzigen Spuren hinterlassen; die hart hervortretenden Adern und die braunen Flecke ließen keine Zweifel zu. Wieder einmal versuchte ich das Alter dieser Frau mit dem schlohweißen Haar zu schätzen: siebzig Jahre, vielleicht auch mehr.
Sie schien meine Gedanken zu erraten.
«Ich bin eine alte Frau!»
Sie lächelte, aber die jugendliche Lebhaftigkeit, die eben noch ihr Gesicht verklärt hatte, verschwand; ein Anflug von Bitterkeit zog ihre Mundwinkel herab, und das Licht in ihren Augen erlosch.
Ich nahm ihre Hand und hielt sie in der meinen. Sie seufzte und wies mit einer Kopfbewegung auf das Boot und die jungen Menschen.
«Ich wollte, ich wäre so jung wie diese dort», sagte sie.
Dann verstummte sie. Auch ich schwieg, denn ich spürte, daß sie mir etwas anvertrauen wollte. Schließlich, als spräche sie nur zu sich selbst, fuhr sie fort:
«Ich kenne sie alle. Jeden Tag, zu jeder Tageszeit schaue ich zu, wie sie leben. Ich sehe, wo sie hingehen, was sie unternehmen. Ich versuche mir kein Lachen, keines ihrer Lieder entgehen zu lassen. Ich lese in ihren Herzen. Ich weiß, daß Soliman, der großgewachsene junge Mann, der am Mast lehnt, von Omrijja geliebt wird, der Kleinen, die im Heck sitzt und ihn nicht aus den Augen läßt; er aber liebt seine Kusine Fausijja, die Blonde, die uns den Rücken zukehrt und deren helles Gelächter man hören kann. Mustafa und Sakijja dagegen, die Seite an Seite hinter Soliman sitzen, sind sich bereits einig und werden heute abend ihren Familien eröffnen, daß sie heiraten wollen. Deshalb machen sie auch so ernste Gesichter. Sie haben eine Entscheidung fürs Leben getroffen.»
«Diese jungen Menschen», meinte ich, «haben eine Chance, die wir nicht hatten: Sie dürfen einander kennenlernen, erwählen, lieben. Noch vor dreißig Jahren hätte ich es nicht glauben können, wenn mir jemand gesagt hätte, daß bei uns in Ägypten eines Tages junge Mohammedanerinnen unverschleiert mit jungen Männern ausgehen und frei über ihr Herz verfügen dürften.»
«Es ist die erste Generation, die nun wirklich die Früchte unserer Kämpfe und Leiden ernten kann. Ihre Freiheit ist unser Werk, mein Werk.»
In diesen Worten lag eine solche Leidenschaft, daß ich meine Gefährtin verwundert anblickte.
«Was glauben Sie», sprach sie weiter, «was glauben Sie, warum ich meine letzten Lebensjahre in Salons verbringe, in Clubs, Hotels, Badeorten – lauter Orten, die mir Gelegenheit zur Begegnung mit diesen jungen Mädchen bieten? Warum, wenn nicht, um die Saat keimen und wachsen zu sehen, die ich gesät habe?»
Ich wußte, daß der aufsehenerregende Prozeß, in den sie verwickelt gewesen war, vor einem halben Jahrhundert die Haremsmauern im ganzen Orient erschüttert hatte. Sie hatte sich gegen jahrhundertealte Sitten und gegen die Mißbräuche der Sippenmacht aufgelehnt und damit sowohl der öffentlichen Meinung als auch den Richtern die Frage nach der Freiheit und den Rechten der Frau gestellt. Im Krieg zwischen den Hütern der Tradition und den Verfechtern neuer Ideen, der ihretwegen entbrannt war, hatte sie in der Öffentlichkeit gekämpft wie ein Mann. Und sie mußte auch gelitten haben, im geheimen, wie eine Frau.
I Der Harem
1 Indsche
Zur Welt gekommen bin ich, begann Ramsa, im Harem einer reichen Familie. Ich bin dort unter Sklavinnen aufgewachsen. Denn ob Gattin oder Dienerin, weiß oder schwarz, jung oder alt – alle diese Frauen waren gekauft worden oder waren Töchter von Sklavinnen; und die freigelassenen lebten genauso wie die anderen. Ihre Welt endete an den Haremsmauern. Von der Welt jenseits dieser Mauern wußten sie so gut wie nichts. Die vielen Stunden, die sie damit verbrachten, durch die holzvergitterten Fenster, die Maschrabijjas[1], auf die Straße zu spähen, zeigten ihnen wenig mehr als den Alltag im Stadtviertel. Ein neues Gesicht, eine ungewohnte Bewegung waren Ereignisse, die eifrig kommentiert wurden. Das einzige, was den Rhythmus ihrer Tage bestimmte, waren die Gebetsrufe der Muezzins von den Minaretten der Umgebung.
Diese Frauen bildeten eine in sich geschlossene Gesellschaft. Jeder Tag brachte die gewohnten häuslichen Tätigkeiten und die vertrauten Rituale. Das Wechselspiel von Freundschaft und Feindschaft, Eifersucht, Intrige, Streit, Versöhnung, Krankheit oder Tod, Familienfesten und Feiertagen schien zu genügen, um ihrem Leben Farbe zu verleihen.
Wenn ich nach all diesen Jahren an meine Jugend zurückdenke, frage ich mich, ob sie unglücklich waren, diese Frauen, die ich gekannt und deren Leben ich geteilt habe. Ich glaube nicht. Vermutlich waren sie nicht unglücklicher, als sie es in der Freiheit gewesen wären. Sie vermißten die Freiheit nicht; sie hatten keine Vorstellung davon. Sie besaßen alles, was sie sich wünschten; sie waren zufrieden mit den Bequemlichkeiten, über die sie verfügten, und es gab nur wenige, die, wie ich, noch andere Bedürfnisse empfanden.
Ja, wenn ich an die Gesichter dieser längst entschwundenen Frauen zurückdenke, die mich geliebt haben, die ich geliebt habe, dann sehe ich darin nur Zufriedenheit. Meine Mutter mit ihrem sanften Blick; meine Großmutter, trotz ihrer strengen Miene unter den schwarzen Spitzen des Kopftuches; die stattliche Nargis, die ich Tante nannte und die, mehr noch als die Mutter, über meine Kindheit wachte; die schöne, stolze Gulistan, die erste Frau meines Vaters; die Chalfata Niamat, die den Harem regierte; diese oder jene Dienerin mit schwarzer oder bronzefarbener Haut – sie alle, Freundinnen oder Feindinnen, haben in meiner Erinnerung nur lächelnde Gesichter. Und dasselbe ruhige, zufriedene Lächeln liegt auch auf den Gesichtern Kütschüks und Mabruks, der beiden feisten Aghas, die diese Frauenwelt bewachten.
An das Gesicht meiner Mutter unter all diesen Gesichtern kann ich mich nie ohne Rührung erinnern. Für mich war sie immer jung, denn sie ist vor ihrem vierzigsten Lebensjahr gestorben. Sie hatte seidiges blondes Haar und einen hellen Teint. Sie war sehr schön, und vor ihrer Krankheit mußte sie noch schöner gewesen sein, aber die von ständigen Schmerzen gezeichneten Züge, die großen, vom Fieber dunkel umränderten Augen verliehen ihrem Gesicht einen besonderen Reiz. Stets lag darauf ein Ausdruck kindlicher Arglosigkeit, was ganz ihrem Wesen entsprach. Es gab kein Fünkchen Bosheit in ihr, und sie konnte sich Bosheit bei anderen Menschen gar nicht vorstellen. Als ich noch klein war, brachte mich ihre Nachgiebigkeit manchmal so auf, daß ich sie anschrie, nur um mich darauf weinend in ihre Arme zu werfen und sie um Verzeihung zu bitten. Von uns beiden war bald ich diejenige, die die Rolle der Älteren übernahm; niemand wagte sie in meiner Gegenwart anzugreifen, denn ich wußte sie zu verteidigen. Ich galt nämlich als ein schlimmes Kind, und ich sonnte mich in diesem Ruf.
Meine Mutter war eine ausgezeichnete Musikerin. Sie setzte mich neben sich ans Klavier, damit ich spielen lerne. Aber ich sagte: «Spiel du doch»; sie spielte, und ich konnte von ihrem Spiel nie genug bekommen.
In ihren letzten Lebensjahren lag sie oft stundenlang auf einem Diwan, und wenn ich sie husten hörte, hätte ich weinen mögen. Zuweilen rief sie mich zu sich, und dann schmiegte ich mich dicht an sie. Sie streichelte meinen Kopf und nannte mich ihre Gazelle. Bruchstückhaft, zusammenhanglos erzählte sie mir ihr ganzes Leben, das Leben einer Sklavin. In ihrer Naivität glaubte sie, die Schilderungen des glanzvollen Lebens, das sie geführt hatte, würden mich amüsieren. Konnte sie sich für mich ein besseres Los wünschen? Nie hat sie bemerkt, wie sich meine Hände beim Zuhören zu Fäusten ballten und meine rebellische Seele sich verhärtete.
Meine Mutter trug den türkischen Vornamen Indsche; ich selbst nannte sie vertraulich bei diesem Namen, als wir Freundinnen geworden waren. Sie war Slawin. In den letzten Wochen vor ihrem Tod, als das kleine Mädchen, das sie einst gewesen war, aus ferner Erinnerung auftauchte, hörte ich sie zum ersten Mal ihr Heimatdorf erwähnen. Wie es hieß, wußte sie nicht mehr. Sie sah es in einem Kranz von violetten Bergen. Sie spielte im Garten neben einem kleinen Haus in der Nähe einer Kirche. Das Innere der Kirche war hell erleuchtet; überall flackerten Kerzenflämmchen: vor den Bildern der Heiligen mit ihren Aureolen, am Lüster, der wie ein glitzernder Diamant vom unendlich hohen Gewölbe herabhing. Vor dem Altar stand ein Priester mit goldenem Bart und goldenen Haaren, der ein schimmerndes, reich mit Goldfäden besticktes Gewand trug und seinen Arm segnend erhob. Für sie war dieser Priester ihr Vater. Später einmal, in Istanbul, hörte sie eine Dienerin in einer fremden Sprache singen; ohne die Worte zu verstehen, erkannte sie den vertrauten Klang und erfuhr auf diese Weise, daß sie aus Serbien stammte.
Sie erzählte auch von einem Mann, der auf einem Gartenpfad neben einem Rosenstrauch auf sie zugetreten war; sie hatte keine Angst, denn sie kannte diesen Mann, aber auf einmal packte er sie, verschloß mit der Hand ihren Mund und schleppte sie davon. Das geschah in der Abenddämmerung. Sie hörte eine Frauenstimme «Olga!» rufen, und sie wollte «Mama» schreien, aber kein Laut kam über ihre Lippen. Meine Mutter hat mir diese Begebenheit erzählt, als wäre sie ein böser Traum gewesen; sie hatte immer wieder davon geträumt und immer wieder dieselbe schreckliche Angst empfunden. Es muß die Erinnerung an ihre Entführung gewesen sein. Die Nonnen der christlichen Schule in Istanbul, wohin man sie gebracht hatte, nannten das Mädchen noch Olga.
In Istanbul verbrachte sie fast ihre ganze Kindheit. Sie hatte das Glück, eine Mutter zu finden, die an die Stelle jener Mutter trat, der man sie weggenommen hatte. Taufika Hanum hatte das Kind einem Sklavenhändler abgekauft. Sie war Witwe; zwei ihrer eigenen Kinder waren gestorben, und so übertrug sie ihre ganze Liebe auf das kleine Mädchen. Meine Mutter hat mir oft gesagt, daß ihre eigenen Eltern sie nicht mit mehr Liebe und Aufopferung hätten erziehen können: «Sie nannte mich Kis, Tochter», berichtete sie, «und dieser Name klang in ihrem Mund wie eine Liebkosung. Ich nannte sie Nina – Mama.» Kis vergaß bald, daß sie jemals eine andere Sprache als die türkische, daß sie jemals andere Gebete als die des Islam gesprochen hatte. Dennoch ging sie auf die Rumeli-Hissar-Schule, die von christlichen Nonnen geleitet wurde. Dort lernte sie, das Türkische und Französische zu lesen und zu schreiben, zeigte sich sehr geschickt im Handarbeiten und Klavierspielen und erhielt Unterricht im richtigen Benehmen. Da sie hübsch war, versprach ihr die Hanum, sie werde sie mit einem Prinzen verheiraten, und damals gab sie ihr auch den Namen, den meine Mutter ihr Leben lang behalten sollte: Indsche – Perle.
Doch Taufika Hanum starb, bevor sie ihr Versprechen einlösen konnte. Sie besaß keine Verwandten außer einem älteren Bruder, der alles von ihr erbte, und Indsche war Teil dieses Erbes. Der Mann, ein ehemaliger Janitscharenoffizier mit blauroten Backen und einem langen grauen Schnurrbart, war ein finsterer, grober Mensch. Indsche fürchtete sich vor ihm. Das hatte die Hanum gewußt und deshalb ihrem Bruder das Versprechen abgenommen, die kleine Sklavin selbst über ihr weiteres Schicksal entscheiden zu lassen. Indsche entschied sich dafür, weiterverkauft zu werden.
Das verwunderte mich, und ich fragte meine Mutter, warum sie denn die Hanum, die sie doch so liebte, nicht freigelassen habe. Meine Mutter erwiderte, sie sei damals kaum vierzehn Jahre alt gewesen; was hätte sie mit der Freiheit anfangen können? Sie hatte natürlich recht. In einer türkischen Stadt jener Epoche bedeutete die Freiheit für ein Mädchen ohne Familienangehörige nichts als Unglück; da war der Sklavenhändler immer noch eine bessere Lösung.
In diesem Alter träumt man von Abenteuern. Die gute Erziehung, die Indsche genossen hatte, erhöhte ihren Handelswert. Sie wollte ihr Glück versuchen. Vielleicht würde man sie für den Harem eines Prinzen kaufen, wo sie brillieren konnte; sie würde seine Lieblingsfrau, seine Ehefrau. Prinzessin, vielleicht sogar Gattin eines Sultans! Warum nicht?
Der Zufall wollte es, daß sich damals der renommierteste aller Kairoer Sklavenhändler in Istanbul aufhielt: Rustum Agha. Er kaufte Indsche. Und so fand sie sich eines schönen Tages auf einem Schiff wieder, das nach Ägypten segelte. Mit ihr reisten etwa zwanzig weitere Auserwählte, die aus allen Provinzen des Osmanischen Reiches stammten und die nichts miteinander gemein hatten außer ihrem Sklaventum, ihrer Jugend und ihrer Schönheit. Diese Reise hatte bei meiner Mutter einen tiefen Eindruck hinterlassen. In der zweiten Nacht nachdem das Schiff in See gestochen war, brach ein gewaltiger Sturm los. Achtundvierzig Stunden lang blieben die Mädchen auf dem Zwischendeck eingeschlossen, ohne Licht, seekrank, zu Tode geängstigt, und schrien laut auf bei jedem Brecher, der gegen den Rumpf des kleinen Seglers krachte, daß die Planken ächzten. Alle glaubten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Endlich legte sich der Sturm, und sie durften wieder an Deck gehen. Man hatte im Heck einen Platz für sie hergerichtet, der vor den neugierigen Blicken der Mannschaft geschützt war. Sie wurden anständig behandelt, bekamen reichlich zu essen und genossen die restlichen Tage der Überfahrt wie die Kinder, die sie eigentlich ja noch waren.
Indsche freundete sich mit einer jungen Tscherkessin an, die während des Sturmes immer in ihrer Nähe geblieben war. Sie hieß Nargis und war ungefähr im selben Alter, aber größer und kräftiger als meine Mutter. Nargis, die von der Seekrankheit weniger geplagt worden war, hatte ihre Gefährtin gepflegt und getröstet. Die beiden Freundinnen erzählten sich ihre Lebensgeschichte. Nargis stammte aus einem Bergdorf im Kaukasus und hatte seit ihrer frühen Kindheit gewußt, daß man sie einmal als Sklavin verkaufen würde. Dazu hatten die Eltern sie aufgezogen, stets besorgt, daß keine Krankheit, keine schwere Arbeit den milchweißen Teint des Mädchens verdarb. Kaum hatte sie die Pubertät erreicht, wurde sie an einen der Sklavenhändler verkauft, die regelmäßig im Dorf vorbeikamen. Nargis empfand keine Sehnsucht nach ihrer Familie und ihrer Heimat. Auch sie träumte von einer glanzvollen Zukunft im Harem eines schönen jungen Prinzen.
Für Indsche und Nargis war diese Reise der Beginn einer Freundschaft, die bis zu ihrem Tode dauern sollte. Sie beteten zu Gott, er möge sie nie wieder trennen. Ihr Gebet sollte erhört werden.
Die Sklavinnen reisten weiter nilaufwärts in einem Dahabijja, einem schwimmenden Haus mit fensterlosen Räumen. Von Bulak, dem Hafen Kairos, brachte man sie in Haremskaleschen mit dicht zugezogenen Vorhängen in die Stadt. Meine Mutter ist nie anders als in einem solchen Gefährt gereist. Sie wußte nicht, wie die Straßen von Kairo aussahen. Sie wußte nicht, in welchem Stadtviertel sie wohnte, und falls sie dessen Namen kannte, weil jemand ihn ihr genannt hatte, so hatte sie doch keine Vorstellung davon, wo es lag. Hätte sie nach zwanzig Jahren in Kairo plötzlich den Drang verspürt zu fliehen, sie wäre weniger gut in der Lage gewesen, sich in der Stadt zurechtzufinden, als eine eben erst angekommene Fremde.
Man muß einmal gehört haben, wie diese Gefangenen des Harems voll naiver Neugier jene ausfragten, die die Welt dort draußen kannten: Dienerinnen, Eunuchen, Krämerinnen, sogar die eigenen Kinder, wenn diese eine Gelegenheit hatten, aus dem Haus zu kommen. Jedesmal wenn ich draußen gewesen war, mußte ich meiner Mutter genau beschreiben, wie die Straßen ausgesehen hatten, durch die ich gekommen war, und was ich unterwegs gesehen und gehört hatte. Dann stellte sie Vergleiche an zu dem, was sie seinerzeit in Istanbul auf dem Schulweg gesehen und gehört hatte, und wir plauderten lange darüber.
Meine Mutter hat mir nie erklären können, wo sich das Haus Rustum Aghas befand. Sie wußte nur, daß es ein sehr großes Haus gewesen war, in dem es unendlich viele Zimmer gab mit Fenstern hinter engmaschigen Maschrabijjas oder sogar starken gekreuzten Eisenstangen. Nie sprach sie mit Haß oder Groll von Rustum Agha, sondern nur mit Zuneigung. Er sei ein gütiger, großzügiger Mann gewesen, behauptete sie. Als ehemaliger Mameluck betrieb er sein Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Rukajja, auch sie eine freigelassene Sklavin. Beide waren schon alt. Sie genossen das Vertrauen und die Wertschätzung hochstehender Persönlichkeiten; sie waren Hoflieferanten des Khediven Ismail. Um ihre Sklavinnen kümmerten sie sich liebevoll; nie verkauften sie sie an den ersten besten, sondern verfolgten aufmerksam ihre Karriere und besuchten sie in den Harems, in die sie aufgenommen worden waren und zu denen Rukajja jederzeit Zutritt hatte. In allen Kaufverträgen gab es eine Klausel, die dem Verkäufer das Recht einräumte, ein Mädchen zurückzunehmen, falls es nicht gut behandelt wurde. Manche Sklavinnen, die im Kindesalter erworben worden waren, lebten jahrelang bei ihnen und erhielten eine sorgfältige Erziehung; im Hause Rustum Aghas gab es sogar eine regelrechte Schule, in der man ihnen alles beibrachte, was eine gute Ehefrau oder eine gute Dienerin können mußte. Diese Kinder nannten das Paar Vater und Mutter, und manche von ihnen wurden sogar adoptiert. Als Rustum Agha etwa ein Jahr nach dem Tode seiner Frau Rukajja starb, erbten die Adoptivtöchter sein ganzes Vermögen. Ich habe eine von ihnen gekannt. Sie bewohnte eine elegante Villa und zeigte mir einmal den Schmuck Rukajjas, den sie aufbewahrte; eine Prinzessin hätte sie darum beneiden können.
Indsches erster Aufenthalt bei Rustum Agha war nur von kurzer Dauer. Sie und Nargis wurden zusammen einem kugelrunden, in einen schwarzen Gehrock gezwängten Eunuchen vorgeführt, dem Rustum mit großer Ehrerbietung begegnete. Die Mädchen waren darauf gefaßt, einer eingehenden Prüfung unterzogen zu werden. Aber dazu kam es gar nicht erst: Der dicke Agha setzte wohl volles Vertrauen in Rustums Wort, denn er erwarb sie beide, ohne auch nur zu feilschen.
Ihr erster Eindruck war, daß man sie, wenn nicht für den Khediven Ismail selbst, so doch für einen seiner Söhne gekauft hatte. Das war ein Irrtum, und Rustum Agha stellte die Sache klar, versicherte ihnen jedoch, daß sie es dort, wo sie hinkämen, besser haben würden als im Palast eines Fürsten. Der Eunuch, der sie begutachtet hatte, war Baschir Agha, Vorsteher des Harems von Ismail Pascha, dem allmächtigen Mufattisch, dem Finanzminister des Khediven. Ausführlich schilderte Rustum den staunenden Mädchen die Vorzüge dieses Mannes, des reichsten in ganz Ägypten außer dem Khediven. Er sei der fähigste Finanzminister, den es je gegeben habe, ja der einzig fähige überhaupt, der prächtigste, großzügigste aller reichen Herren: Welch ein Glück für Indsche und Nargis, in ein solches Haus aufgenommen zu werden! Sie konnten Gott nie genug danken für ein solches Glück. Sie würden im luxuriösesten aller Paläste wohnen, wo man jeden Tag Feste veranstaltete, so glanzvolle Feste, daß sogar der Khedive – und Rustum Agha senkte die Stimme – daß sogar der Khedive selbst darauf neidisch war.
Nargis, die nicht so leicht zu verblüffen war, wollte wissen, ob ihr neuer Herr nicht schon reichlich alt sei. Rustum Agha widersprach. Der Mufattisch sei im besten Mannesalter, ein erfahrener Mann und gerade deshalb für junge Frauen sehr viel besser als ein Grünschnabel, zudem spendabel: Wer ihm zu gefallen verstehe, erhalte die kostbarsten Geschenke. Sein ganzer Hofstaat ließe sich für ihn in Stücke hauen, sein ganzer Harem sei sterblich in ihn verliebt.
Hingerissen und doch ein wenig besorgt lauschte Indsche diesem Bericht. Wenn sie sich freute, dann weniger wegen der Aussicht, einem allmächtigen Minister zu gehören, sondern weil dadurch sie und die gleichzeitig mit ihr gekaufte Nargis Schwestern auf Lebenszeit wurden. Das war es, was für sie zählte. Nach einem ungeschriebenen Gesetz der sonderbaren Welt des Harems entstand aus dem gemeinsamen Kauf zweier Sklavinnen eine Schwesternschaft, die sich oft als stärker erwies als die Blutsverwandtschaft. Von nun an nannten Indsche und Nargis einander zärtlich «Abla», Schwester. Ich habe selber gesehen, wie eng sie miteinander verbunden waren, und nannte Nargis meine Tante. Ein ähnliches Verwandtschaftsverhältnis gibt es unter den Nachkommen meines Großvaters väterlicherseits, der ein Mameluck Muhammad Alis gewesen war. Obwohl in diesem Falle die Kaufverwandtschaft zwei Generationen zurückliegt, pflegen wir noch heute diese familiären Beziehungen. In meiner Kindheit war ein solches Verhältnis derart fest verankert, daß es dieselbe Erbberechtigung verlieh wie leiblichen Verwandten.
Schon tags darauf wurden die beiden Schwestern von mehreren Schneiderinnen aufgesucht, die Baschir Agha hergeschickt hatte. Man nahm ihnen Maß und fertigte für beide genau die gleiche Garderobe aus rosa Seide an: Blusen und Kleider mit bauschigen Ärmeln, Westen und Gürtel aus Lamé, Schleier mit Fransen aus rosa Perlen. Indsche und Nargis genossen die Anproben wie zwei Bräute, die ihre Ausstattung vorbereiten. Sie waren beide kokett; ihr Status als menschliche Handelsware wollte es so. Von frühester Kindheit an hatte man ihnen die Kunst, ja die Pflicht zu gefallen beigebracht. Und im Grunde genommen waren sie immer noch Kinder.
Dann kam der Tag, da Rukajja sie in einem geschlossenen Wagen zum Palast des Mufattisch im neuerbauten Ismailijja-Viertel brachte. Unterwegs schärfte sie ihnen ein letztes Mal ein, wie sie sich zu benehmen hatten. Rukajja! Dieselbe Rukajja, die sie Nina nannten, die mit ihnen sprach wie eine Mutter mit ihren eigenen Töchtern, die über die bevorstehende Trennung ganz erschüttert war; Rukajja, die sie verkauft hatte und nun ihrem Kunden ablieferte!
Sie wurden dem Harem von Suchra Hanum zugeteilt, der ersten Gattin des Paschas – er besaß deren vier und darüber hinaus zahlreiche offiziell anerkannte Nebenfrauen. Rukajja übergab die beiden jungen Sklavinnen persönlich der Chalfata der Hanum, einer alten Äthiopierin mit strengem Blick, und bat, man möchte jeder von ihnen einen geeigneten Platz zuweisen, wo sie ihre Sachen unterbringen konnten. Sie wurden in ein Zimmer geführt, das mit zwei Betten, Schränken und verschiedenen anderen Möbelstücken eingerichtet war, alles ganz neu und direkt aus Paris. Dann begleitete Rukajja die beiden in einen Raum, wo sich ihre künftigen Gefährtinnen aufhielten, etwa zehn Mädchen, Sklavinnen wie sie, jung und schön, ebenso wie sie in rosa Seide gekleidet. Rukajja, die sie fast alle kannte, unterhielt sich noch eine Weile mit ihnen und bat vor ihrem Weggang um gute Aufnahme der beiden Neuen. «Aber trotzdem», erzählte mir meine Mutter, «waren die Blicke, die uns musterten, die uns nackt auszogen und bewerteten, kalt und gehässig: Wir waren Rivalinnen.» Die sensible Indsche geriet ob soviel Feindseligkeit ganz durcheinander; Nargis dagegen ließ sich nicht beeindrucken. Unbeirrt und ohne die Augen niederzuschlagen, gab sie auf alle Fragen Antwort, und als man die beiden aufforderte, ihr Können zu zeigen, zu singen, etwas vorzuspielen, zu tanzen, weigerte sie sich rundheraus und erklärte, sie würde dies nur vor der Herrin tun. Sie setzte im riskanten Spiel des Harems alles auf eine Karte: Wer sich einschüchtern ließ, hatte von vornherein verloren. Nargis setzte sich zur Wehr, auch für ihre Schwester.
Bald erschien die Chalfata, um die ganze Schar zur Hanum zu geleiten. Diese war eine großgewachsene, üppige Frau von etwa fünfzig Jahren, stolz und majestätisch, mit Juwelen behängt und stark geschminkt – das zumindest waren die Einzelheiten, die meiner Mutter am stärksten an ihr auffielen. Als Indsche an die Reihe kam, vorgestellt zu werden, musterte die Hanum sie von Kopf bis Fuß und bemerkte nur: «Du bist noch sehr jung! Gehorche mir immer aufs Wort, dann wirst du dich nicht zu beklagen haben.»
Alle Mädchen stellten sich im Halbkreis hinter der Hanum auf. Kurz darauf öffnete sich die Tür. Vier äthiopische Aghas in schwarzem Gewand und mit rotem Tarbusch kamen herein. Während alle Anwesenden, von der imposanten ersten Gattin bis zur letzten Sklavin, sich tief verneigten, betrat der Pascha den Raum. «Als ich es wagte, den Kopf zu heben und ihn anzublicken», berichtete meine Mutter, «war ich enttäuscht. Er war klein, gebeugt, viel älter und häßlicher, als ich ihn mir vorgestellt hatte; er schien sehr nervös und zupfte beständig an seinem grauen Bart herum.» Die Hanum bot ihm Kaffee an. Er jedoch ließ seinen Blick über den Halbkreis der Mädchen gleiten und schließlich auf Indsche und Nargis ruhen. Auf ein Zeichen der Hanum traten sie näher und warfen sich vor ihrem Herrn nieder. Er befahl ihnen, sich zu erheben, und machte die gleiche Bemerkung wie seine Gattin: «Die sind noch sehr jung.»
Inzwischen hatten die Mädchen Musikinstrumente geholt: Geigen, Uds, Darbukkas; die Hanum gab abermals ein Zeichen, und sie begannen zu spielen. Doch der Pascha unterbrach sie abrupt und richtete einige arabische Worte an Indsche, die man ihr übersetzte: «Du kommst ja aus Istanbul, da wirst du gewiß türkische Lieder kennen.» Als sie bejahte, forderte er sie auf zu singen. Und Indsche sang. Dem Pascha schien es zu gefallen.
Nachdem er gegangen war, erschien eine italienische Tanzmeisterin und ließ die Mädchen unter den gestrengen Blicken der Hanum verschiedene Figuren einüben. Indsche und Nargis machten mit, so gut es eben ging. Den restlichen Nachmittag verbrachten sie mit Musizieren und Spazierengehen. Abends führten die Aghas Indsche und ihre Gefährtinnen durch enge Korridore und über Geheimtreppen zu einer geschlossenen Galerie über dem Prunksaal des Palastes, auf der schon zahlreiche Frauen Platz genommen hatten. Durch schmale Öffnungen konnten sie, ohne selbst gesehen zu werden, auf die vielen Herren im Frack oder in bunter Uniform hinuntersehen, die beim Mufattisch zu Gast waren. Mehrere Musikkapellen spielten, Diener bahnten sich einen Weg durch die Menge und boten Erfrischungen an. Meine Mutter sprach voller Begeisterung von jenem Abend, an dem sie die Almas singen gehört hatte, die damals im Zenit ihrer Karriere stand. Gesehen hatte sie die berühmte Künstlerin, welche man «Diamant» nannte, allerdings nicht, denn diese blieb hinter einem Vorhang verborgen. Doch sie erinnerte sich noch an manche der Lieder, die sie bezaubert hatten.
Am folgenden Tag nahm sie an einem Fest teil, das in den Palastgärten veranstaltet wurde. Dieses Erlebnis war ihr unvergeßlich, und sie schilderte es mir immer wieder, wobei sie sich manchmal fragte, ob es nicht nur ein Traum gewesen sei, ob dieses Märchenfest auch wirklich stattgefunden habe.
Nachmittags zogen die Mädchen ihre rosaroten Gewänder an, und die Schneiderinnen befestigten ihnen am Rücken Flügel aus Seide, die über einen leichten Rahmen gespannt war. So geschmückt, gingen sie in den Park hinunter, dessen Tore von den Aghas bewacht wurden.
Die breiten, von Königspalmen mit weißen Stämmen gesäumten Alleen, die Nelken- und Rosenbeete, die Pavillons mit ihren filigranartigen Schnitzereien, die vergoldeten Kolonnaden der drei Paläste in den Verlängerungen der Hauptalleen – diese ganze märchenhafte Pracht bezauberte den Blick. In allen Pavillons spielten aus lauter Frauen bestehende Orchester; sie lösten einander laufend ab, so daß die Luft ständig von Wohlklang erfüllt war.
Unter der Leitung der Tanzmeisterin liefen Indsche und ihre Gefährtinnen die Alleen entlang, bemüht, die eingeübten Schritte und Figuren so graziös wie möglich auszuführen. Sie kreuzten andere Gruppen junger Sklavinnen, welche die gleichen geflügelten Gewänder trugen, aber in den Farben der drei anderen Gattinnen des Paschas: Grün, Gelb und Lila. Die Damen saßen in der Nähe der Freitreppe, umringt von kleinen Mädchen und Knaben, den Kindern des Paschas. Der Herr selbst erschien gegen vier Uhr. Er spazierte zuerst in Gesellschaft seiner Gattinnen durch den Park und nahm dann oben auf der Treppe in einem Sessel Platz.
Und dann spielte sich etwas schier Unglaubliches ab. Ohne die Augenzeugenberichte meiner Mutter und meiner Tante könnte ich heute noch nicht glauben, daß Lakaien sich eine solche Unterhaltung ausgedacht hatten, um ihren Herrn und Gebieter von seinen Sorgen abzulenken.
Nahe der Parkmauer, am Ende der Hauptallee wurden vier leichte Pferdewagen nebeneinander aufgestellt. Sie waren mit Seide ausgeschlagen, und an jedem von ihnen flatterte ein Banner, auf dem in Goldbuchstaben der Name einer Jahreszeit stand. Mit langen Bändern hatte man die jungen Mädchen vorgespannt. Jede der vier Gattinnen nahm auf ihrem Wagen Platz, dann wurde das Startsignal gegeben. Zu den anfeuernden Klängen der Orchester, unter dem Geschrei und Gelächter der Menge liefen die vier Gespanne mit wild flatternden Schleiern und Flügeln die Allee entlang. Die Siegerin – an jenem Tag war es die Dame im grünen Wagen – stieg aus und verbeugte sich vor ihrem Herrn, der ihr als Trophäe eine Diamantbrosche überreichte. Ihrem Gespann wurde zum Lohn eine Handvoll Goldstücke zugeworfen.
Meine Mutter hat mir dieses Erlebnis mit heiterer Miene berichtet, als wäre es ein lustiges Spiel gewesen, und bedauerte nur, daß nicht ihr Gespann das Rennen gewonnen hatte. Ich aber, obgleich damals noch ein Kind, errötete ob der Demütigung, die man ihr zugefügt hatte.
Später, nach dem Tod meiner Mutter, hat mir auch Nargis von diesen Festen erzählt. Sie fanden fast jede Woche statt. Der Anblick der jungen Mädchen mit ihren vom Laufen geröteten Wangen und leuchtenden Augen entzückte den Mufattisch. Wenn eine von ihnen ihm besonders gefallen hatte, bedachte er sie mit einem Kompliment. Die Gattin, der das betreffende Mädchen gehörte, wußte genau, was das zu bedeuten hatte. Am selben Abend kleidete sie das Mädchen eigenhändig an, parfümierte es, schmückte es mit ihren eigenen Juwelen. Dann ließ sie es zu den Gemächern des Paschas führen. Die Zufriedenheit des Gebieters zeigte sich tags darauf in einem mehr oder weniger kostbaren Geschenk, das er seiner Gattin zukommen ließ. Die Kinder, die einem solchen Intermezzo entstammten, gehörten der Herrin der betreffenden Sklavin; sie ließ sie nach ihrem Gutdünken gemeinsam mit ihren eigenen Kindern großziehen. Nur letzteres schien Nargis an der ganzen Sache zu stören; alles übrige fand sie durchaus natürlich und konnte meine Empörung nicht begreifen. Tatsächlich sind es diese oft gehörten Erzählungen gewesen, die in meiner Seele die Saat der Rebellion keimen ließen.
Es war das erste und zugleich das letzte Mal gewesen, daß meine Mutter zum Vergnügen eines Mannes vor einen Wagen gespannt wurde. Man brachte sie auch nie des Nachts in die Gemächer des Mufattisch. Nargis dagegen wurde diese Ehre zuteil. Sie hat mir die Umstände beschrieben, die dazu führten. Ihrer Meinung nach hatte nicht der Pascha selbst nach ihr verlangt. Man glaubte an jenem Abend bemerkt zu haben, daß er ungewöhnlich sorgenvoll aussah; seine Ehefrauen wußten nicht, wie sie ihn zerstreuen konnten. Suchra dachte, daß er an einer Jungfrau Gefallen finden würde, und ihre Wahl fiel auf Nargis, die körperlich weiter entwickelt und weniger schüchtern war als ihre Schwester. Nargis und die Chalfata mußten lange in einem Vorzimmer warten. Von nebenan, aus dem Arbeitszimmer des Paschas, hörten sie Schritte, Stimmen, das Knarren hin und her geschobener Möbel. Plötzlich ging die Tür auf, und der Pascha erschien. Als er die beiden Frauen erblickte, brüllte er zornig: «Macht, daß ihr wegkommt!» Erschrocken wandten sie sich zum Gehen, aber da rief er Nargis zurück und begann, anscheinend besänftigt, mit ihr zu sprechen; er erkundigte sich nach ihrer Heimat, ihrem Alter, dem Händler, der sie verkauft hatte. Auch über Indsche fragte er sie aus. Dann ging er in sein Arbeitszimmer, öffnete ein Schubfach und kam mit zwei Diamanten zurück, die er Nargis in die Hand drückte: «Für dich und deine Schwester.» Er sah traurig und stark gealtert aus. Nargis wollte ihm die Hand küssen, aber er hatte sich schon umgewandt und die Tür hinter sich geschlossen. An jenem Abend wußte Nargis nicht, ob sie sich wegen der Art, wie diese Begegnung verlaufen war, geschmeichelt oder gekränkt fühlen sollte.
Es war ihre letzte Begegnung mit dem Mufattisch. Am Tage danach erschien er bei keiner seiner Ehefrauen, um seine gewohnte Tasse Kaffee zu trinken. Der ganze Harem geriet darob in Aufruhr. Man besuchte sich gegenseitig, ratschlagte hin und her. Von den Aghas war nichts zu erfahren. Es hieß lediglich, der Pascha sei die ganze Nacht aufgeblieben und habe sich zusammen mit Baschir Agha und seinen Sekretären im Arbeitszimmer eingeschlossen. Nargis, die von allen bestürmt wurde, konnte nur immer wieder erzählen, was sie gesehen und was die Chalfata bereits berichtet hatte. Von den Diamanten sagte sie natürlich kein Wort.
Für den Nachmittag war ein weiteres Wagenrennen geplant. Die Mädchen zogen ihre rosaseidenen Kleider an, schnallten sich die Flügel um und warteten. Durch die Fenster sah man in den stillen, menschenleeren Park hinunter. Einmal begann irgendwo ein Orchester zu spielen, brach jedoch sogleich wieder ab. Etwa eine Stunde verging, und dann hieß es, das Wagenrennen finde nicht statt. Man nahm die Flügel wieder ab. Es war bereits dunkel, als Baschir Agha höchstpersönlich Indsche und Nargis rufen ließ. Er befahl ihnen, ihre Sachen zu packen und mit ihm zu kommen. Sie verließen den Palast und bestiegen eine Kalesche, die sogleich losfuhr. Es war eine milde Herbstnacht. Als die Kalesche hielt, bemerkten Indsche und Nargis, daß sie im Hof von Rustum Agha angekommen waren. Rukajja begrüßte sie überschwenglich und führte sie in das Schlafzimmer. Noch am selben Abend erfuhren sie, was Baschir Rustum Agha unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hatte.
Tags zuvor war es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Khediven Ismail und dem Mufattisch gekommen. Er mußte befürchten, abgesetzt, verhaftet, vielleicht sogar ins Exil geschickt zu werden. Da er voraussah, daß er auf längere Zeit in Ungnade gefallen war, hatte er noch in dieser Nacht seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht und jedem der höheren Bediensteten genaue Anweisungen erteilt.
Er war dabei, zusammen mit Baschir Agha die Verwaltung seines Harems zu regeln, als er im Vorzimmer Nargis entdeckte. Nachdem die junge Sklavin gegangen war, sagte er: «Baschir, diese Kleine gefällt mir, sie soll nicht bei Suchra bleiben», und fügte nach kurzem Überlegen hinzu: «Bring sie noch heute nacht zu Rustum zurück, dort ist sie besser aufgehoben.»
«Und was soll mit der anderen geschehen, ihrer Schwester?» wollte Baschir wissen.
«Bring sie ebenfalls dorthin und richte Rustum aus, er soll sich um die Mädchen kümmern, bis ich sie wieder holen lasse.»
Baschir gehorchte, doch war er der Meinung, daß sein Herr sich grundlos Sorgen gemacht hatte und daß jetzt keine Gefahr mehr bestand, denn der Khedive war höchstpersönlich gekommen, um sich mit seinem Minister auszusöhnen. «Ich war zugegen, als ein Palastwächter hereinkam und dem Mufattisch etwas ins Ohr flüsterte, worauf dieser erleichtert ausrief: ‹Ismail! Er ist selbst hergekommen, er kann nicht auf meine Dienste verzichten!› Dann eilte er in den Salamlik, wo in der Tat der Khedive ihn erwartete. Ich habe von weitem gesehen, wie sie sich die Hände schüttelten und freundschaftlich miteinander redeten, bevor sie gemeinsam den Palast verließen.» Sie hatten die Kalesche des Khediven bestiegen, die sie vor der Freitreppe erwartete, und waren im Galopp in Richtung der Kasr-an-Nil-Brücke gefahren, vermutlich, um sich zum Gasira-Palast zu begeben. Also war alles in bester Ordnung.
Baschir hielt sich nur kurz bei Rustum Agha auf und fuhr dann wieder zum Palast des Mufattisch, wohin sein Herr, wie er glaubte, inzwischen zurückgekehrt sein mußte.