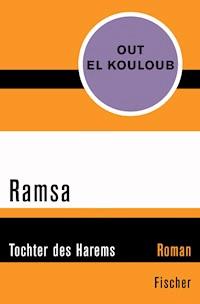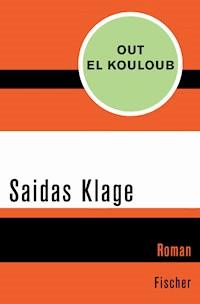
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach «Ramsa» der zweite große Roman der ägyptischen Autorin. Wieder ein lebendiges, berührendes Bild ägyptischen Frauenlebens im Kairo um die Jahrhundertwende. Mit sechzehn Jahren wird Saida mit einem reichen ägyptischen Kaufmann vermählt. Sie ist seine siebte Frau. Er hat bereits zwölf Kinder, lauter Töchter, und hat sich damit abgefunden, keinen Stammhalter zu haben. Doch als Saida guter Hoffnung ist, hofft der ganze Harem mit, nur Maschallah, die unfruchtbare erste Ehefrau, ist krank vor Eifersucht ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Out el Kouloub
Saidas Klage
Aus dem Französischen von Anne Büchel
FISCHER Digital
Inhalt
Wer drei Töchter ernährt,
oder drei Schwestern
oder zwei Schwestern
oder zwei Töchter,
und sie erzieht, ihnen Gutes
tut und sie verheiratet,
der erhält das Paradies.
Abū Dāwūd; Tirmidhī
I Die siebente Frau des Abdulmagid
1 Totenklage
Ju-ju-ju-ju! … Die schrillen Stimmen der Klageweiber übertönen sogar das Klingeln und Rattern der Straßenbahnen, die durch die Schari Muhammad Ali[1] fahren, stadteinwärts Richtung Asbakijja, stadtauswärts Richtung Zitadelle. Obst- und Gemüsehändler mit ihren Karren, Studenten der nahen Ashar-Universität, Gaffer und Müßiggänger, Büroangestellte, die von der Arbeit kommen, verschleierte Frauen, die von einem Besuch nach Hause eilen – sie alle halten einen Augenblick inne und sehen zu den Fenstern einer Wohnung im ersten Stock des Hauses Nummer 47 empor. Diese Wohnung gehört Badran Effendi, seines Zeichens Beamter im Wakf-Ministerium.
Ju-ju-ju-ju! … Die betagte Mutter Badran Effendis ist gestorben, vor zwei Tagen schon wurde sie begraben. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Diese hat weder Mühe noch Kosten gescheut, damit die Trauerfeier eine würdige, ja geradezu pompöse Angelegenheit werde und nicht etwa böse Zungen behaupten können, man sei erleichtert über den Tod der Schwiegermutter! Und so hat sie die beiden renommiertesten Klageweiber des Viertels aufgeboten, jene, von denen man sagt, sie würden, wenn sie nur wollten, selbst den kahlen Felsen des Mukattam Tränen entlocken.
Seit drei Tagen herrscht in dem kleinen Salon des Harems von Badran Effendi ein ständiges Kommen und Gehen. Verwandte, Bekannte, Nachbarinnen, alle von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllt, verbringen hier Stunde um Stunde, die einen auf Stühlen sitzend, den rechten Fuß unter den linken Schenkel geklemmt, die anderen auf dem Teppich kauernd, mitten im Raum oder Schulter an Schulter den Wänden entlang, wo immer sich ein Plätzchen gefunden hat.
Während der ersten beiden Tage haben die Klageweiber alle Tugenden der Dahingeschiedenen gepriesen und den tiefen Schmerz der Hinterbliebenen in den höchsten Tönen zum Ausdruck gebracht. Mehr Tugenden, als es auf dieser Erde gibt, können sie aber beim besten Willen nicht erfinden, weshalb sie sich heute, am dritten Tag, den Sorgen und Nöten der Menschheit im allgemeinen zuwenden.
Jeder Satz beginnt in verhaltenem Ton, steigert sich zum höchsten Diskant und endet in einem wahrhaft verzweifelten, durch Mark und Bein gehenden Geheul, in das jeweils die ganze Trauergemeinde einstimmt.
«Weh über den, der niemals einen Sohn zeugte! Weh über ihn, der niemals ein Söhnchen in den Armen hielt! Unglück ist sein Los, hundertfaches Unglück, tausend-, dreitausendfaches Unglück! Von Fremden wird er dereinst zu Grabe getragen!»
Alle Blicke wandern zu einer Dame, die auf dem Ehrenplatz sitzt, einem Armsessel mit vergoldetem Holzwerk und rotem Samtpolster, der nicht so recht zum übrigen Mobiliar paßt. Man hat dieses Prunkstück eigens aus dem Zelt herholen lassen, das vom Bestattungsunternehmen in einer Seitengasse aufgestellt wurde, für die männlichen Trauergäste, die Badran Effendi hier empfängt.
Die Dame, die in würdiger Haltung auf diesem Sessel thront, ist eine große, hagere Greisin mit zerfurchtem Gesicht und knochigen Händen. Sie trägt Schwarz wie die anderen Frauen, aber ihre weitärmelige Seidenrobe, ihr Umhang aus schimmerndem Satin und ihr Schleier aus feingemustertem Krepp sind neu und von allerbester Qualität. Jedes ihrer Schmuckstücke besteht aus massivem Gold: die breiten geflochtenen Armbänder, die schweren halbmondförmigen Ohrgehänge, die zahlreichen Münzen, die den Brustlatz bedecken.
Dieser Besucherin begegnet man mit jener ausgesuchten Höflichkeit, die einer reichen Verwandten gebührt. Im Laufe der dreitägigen Trauerfeier hat man auch erfahren, wer sie ist: Umm Machmud, die Witwe Abdulhamids aus Matarijja, die Mutter des Abdulmagid, jenes schwerreichen Abdulmagid, in dessen Händen, wie man zu sagen pflegt, sich sogar Sand in Gold verwandelt.
Dieser Abdulmagid, darüber sind sich alle einig, ist nicht nur ein reicher, sondern auch ein frommer und mildtätiger Mann, der seiner Lebtag noch keinem Bedürftigen ein Almosen versagt hat. Manche fügen – aber nur hinter vorgehaltener Hand – noch hinzu, daß aber gerade dieser reiche Mann, der mit seinem Geld alles kaufen kann, was sein Herz begehrt, daß dieser Gerechte, dem Gott doch alle Wünsche erfüllen müßte, mit dem größten Unglück geschlagen ist, das einen Muslim treffen kann: Er hat keinen Sohn. Vergebens hat er den Heiligtümern des Islam großzügige Spenden gewidmet, vergebens haben seine Knie auf den Gebetsteppichen aller Moscheen Kairos ihre Spuren hinterlassen. Sechs Frauen, vier legitime Gattinnen und zwei Nebenfrauen, haben ihm im Lauf der Jahre zahlreiche Kinder geboren – lauter Mädchen und nicht einen einzigen Sohn.
Dicke Tränen kullern über die Wangen der Greisin. Sie sieht mitleidige Augen auf sich gerichtet, und sie weiß, daß dieses Mitleid sicher nicht geheuchelt ist; denn nichts verbindet die Frauen so sehr wie eine schöne Trauerfeier. Da fühlt sich eine jede verpflichtet, den Kummer der anderen zu beweinen; Herzen, die lange verschlossen waren, tun sich auf; Augen, die lange trocken blieben, gehen über, und man vergießt heiße Tränen über das Leid von Menschen, die einem sonst eigentlich ziemlich gleichgültig sind.
Und so schluchzt und stöhnt die Trauergemeinde immer lauter, während die Klageweiber beim Gedanken an all die Goldstücke, die man ihnen in den Schoß legen wird, von neuem zu jammern beginnen:
«Wie düster ist ein Haus ohne Söhne! Der vorbeigehende Freund neigt den Kopf und schickt ein Gebet zum Himmel. Töchter sind nützlich für die Arbeit im Hause, doch wo ist der Sohn, der nach des Vaters Tod diesem Hause vorsteht? Sollen denn Fremde sein Erbe verwalten? Soll das von den Ahnen erworbene Gut in den Händen Fremder zunichte werden? Soll ein Fremder den Platz des Hausherrn einnehmen, seine Wasserpfeife rauchen, auf seinen Teppichen knien, in seinem Koran lesen? Soll ein bezahlter Knecht zu den Festtagen das Opfertier schlachten? Wer wird den Armen ihren Anteil vom Fleisch geben und wer den Bettlern allmorgendlich ihr Almosen? Und die Hungernden, werden sie an den Abenden des Ramadan vergebens an die Tür klopfen, müssen sie mit leerem Magen davongehen und nach einem Tag des Fastens nun auch die ganze Nacht lang fasten?»
Schier endlos ist die Aufzählung der Plagen, mit denen eine Familie ohne Sohn geschlagen ist, und sie kann, je nach der Höhe des erwarteten Lohnes, noch verlängert werden, aber irgendwann läßt sich beim besten Willen nichts mehr hinzufügen. Zudem sind ja noch andere Frauen mit anderen Sorgen zugegen. Wenn ein geschicktes Klageweib das Richtige errät und herzbewegend zu schildern versteht, gibt es zum üblichen Lohn allemal noch etwas hinzuzuverdienen …
Die beiden stimmen also eine neue Litanei an und beklagen nun lauthals das harte Los jener Frauen, die den Gatten oder ein Kind verloren haben, jener, die Kranke pflegen müssen, jener, die mit einem Geizhals verheiratet sind oder mit einem Verschwender, der die Familie ruiniert.
Keines dieser Kümmernisse scheint auf eine der Anwesenden zuzutreffen. Plötzlich aber, als die Mütter unglücklich verheirateter Töchter an die Reihe kommen, schlägt eine beleibte Dame, die nicht weit von Umm Machmud auf einem Schemel sitzt, die Hände vors Gesicht und beginnt erbärmlich zu schluchzen.
Es ist die Frau eines Tuchhändlers aus dem Muski-Viertel, eine entfernte Kusine von Badran Effendi, und die beiden Klageweiber wissen nicht genau, wieviel man von ihr erwarten kann und welcher Natur ihr ganz persönlicher Kummer ist. So stimmen sie aufs Geratewohl die Klage der unglücklichen Braut an:
«Wie traurig war der Kadi am Tage der Verlobung! Der weise Mann erblickte die Tochter des Freundes vor den Pforten der Hölle. Doch sogar die Hölle ist besser als der Harem eines Bösewichts!»
«Was nützt einer Braut ihre Schönheit, wenn sie nicht das Herz eines liebenden Gatten gewinnt? Milchweiß ist ihre Haut, doch er bemerkt nichts davon!»
«Lieber hätte sie eine Haut wie eine Negerin und einen liebenden Gatten!»
«Fein wie gesponnenes Gold ist ihr Haar, doch er streichelt es nie!»
«Lieber hätte sie krauses Haar und einen liebenden Gatten!»
«In ihren blauen Augen spiegelt sich das Paradies, doch er meidet ihren Blick!»
«Lieber wäre sie blind und hätte einen liebenden Gatten!»
Die Trauergemeinde indessen ist nicht mehr so recht bei der Sache. Alle Blicke richten sich auf die dicke Dame, die nun seufzend ein Taschentuch hervorzieht, um ihre Tränen abzutupfen und sich geräuschvoll die Nase zu schneuzen.
«Was haben Sie denn, Umm Hassan?» erkundigt sich schließlich eine der Frauen. «Soviel ich weiß, ist von Ihren drei Töchtern keine verheiratet.»
«Nein – und trotzdem ist sie vom Unglück verfolgt, meine Saida! Ein bildschönes Mädchen, sechzehn Jahre, eine Gazelle! Warum, barmherziger Gott, warum läßt du dieses unschuldige Kind so furchtbar leiden?»
Die Klageweiber sind verstummt. Wozu soll man sich Mühe geben, wenn ja doch niemand zuhört?
Alle spitzen die Ohren und warten gespannt auf die Geschichte, die nun unweigerlich kommen muß. Die Hausherrin winkt eine Dienerin herbei. Man bringt riesige kupferne Platten, auf denen sich Berge von Reis und gebratenem Fleisch und gefüllten Auberginen türmen; alles ist da, was ein hungriger Magen begehren kann – mit Ausnahme von Salaten und Süßigkeiten, die bei einem Trauermahl fehl am Platz wären.
Neue Besucherinnen kommen und lassen sich nieder, wo es eben geht, denn niemand steht auf, um ihnen Platz zu machen, und jene, die sich schon verabschieden wollten, setzen sich beim Anblick der leckeren Speisen hastig wieder hin.
Umm Hassan hat ihre Tränen getrocknet und verzehrt nun, um sich zu beruhigen und die Worte zurechtzulegen, mit gesundem Appetit eine Handvoll Falafil, in Öl gebackene Klößchen aus pürierten Kichererbsen. So schlimm ein Kummer auch sein mag, es ist eben doch allemal ein Vergnügen, eine interessante Geschichte zu erzählen, noch dazu vor einem so zahlreichen und aufmerksamen Publikum.
«Eines Morgens», beginnt also Umm Hassan, «ging mein Mann, Said Abdulfattach, in die Muski-Straße, um Pantoffeln zu kaufen. Da gibt es Pantoffeln in Hülle und Fülle, gelbe, rote, weiße, grüne, blaue – wie Trauben hängen sie in den Auslagen. Er ist sehr sparsam, mein Mann, und kauft nichts, ohne es sich reiflich zu überlegen und die Ware genau zu prüfen; wenn ein Händler nicht das Richtige am Lager hat, muß er eine Auswahl aus dem Nachbargeschäft herbringen lassen.
Kurz und gut, nach zwei Stunden hatte er immer noch nicht gefunden, was er suchte, und da tauchte auf einmal ein alter Bekannter auf, den er schon seit langem nicht mehr getroffen hatte: Hadsch Ali Chalil, ein wohlhabender Baumwollhändler. Der setzte sich zu ihm, und sie begannen, von dem und jenem zu reden, von den Preisen für Baumwolle und Seide – mein Mann besitzt ja einen Tuchladen – und von anderen Dingen. Es heißt immer, wir Frauen seien schwatzhaft, und dann erst die Männer, sage ich!
Während sie so redeten, ließ sich Abdulfattach noch mehr Pantoffeln zeigen und wählte schließlich drei Paar rosarote und ein Paar grüne aus, Frauenpantöffelchen.
‹Wie denn›, wunderte sich Ali Chalil, ‹Sie kaufen drei Paar Pantoffeln in derselben Farbe?›
‹Nun ja, ich habe drei erwachsene Töchter zu Hause, die älteste sechzehn, die jüngste zwölf. Wenn ich nicht für alle drei dieselben Pantoffeln kaufe, gibt es Streit, und deshalb bringe ich meiner Frau die grünen und meinen Töchtern die rosaroten mit.›
Als sie sich verabschiedeten, sagte Ali Chalil zu meinem Mann: ‹Dieses Wiedersehen hat mich sehr gefreut. Wenn Sie gestatten, werde ich Sie noch heute besuchen, aber erst nach Sonnenuntergang.›
Und wahrhaftig, kaum war es dunkel, kam er daher, begleitet von vier Sudanesen mit brennenden Fackeln. Es war Winter und also recht kalt draußen, und so bewirteten wir ihn mit heißem Zimttee und gerösteten Kastanien. Danach führten er und mein Mann ein langes Gespräch.
Ich hatte schon eine Weile geschlafen, da trat Abdulfattach ins Zimmer, machte Licht und weckte mich. Noch halb im Schlaf, spürte ich plötzlich, wie er einen schweren Beutel und ein Kästchen auf meine Bettdecke legte. Na, da war ich aber sogleich hellwach! Ich leerte den Beutel aus: dreihundert goldene Napoleons! Und in dem Kästchen lag ein kostbares Halsband mit rosa Diamanten.
‹Wo kommt denn das her?› fragte ich ganz entgeistert. ‹Hast du vielleicht einen Schatz entdeckt?›
‹O ja, und was für einen! Hadsch Ali Chalil will unsere Saida heiraten, und das hier ist sein erstes Geschenk. Der Mann ist steinreich, er hat mit Getreide und Baumwolle ein Vermögen gemacht und besitzt obendrein zweitausend Feddan fruchtbares Land in der Gegend von Simbillawain.›
‹Aber er ist doch schon alt, und außerdem ein Oberägypter! Nie im Leben heiratet meine Tochter einen Bauern aus Oberägypten!›
‹Hast du den Verstand verloren? Zweitausend Feddan, sag ich, wer wird denn einen mit zweitausend Feddan abweisen? Glaubst du tatsächlich, du könntest eine bessere Partie für Saida finden? Dann bist du nicht klüger als einer, der nichts hat außer einer mageren Kuh und sich einbildet, eine ganze Herde zu besitzen! Weißt du denn nicht, daß die Getreidespeicher in Rod al-Farag Ali Chalil gehören, und die beiden großen Baumwollager in Machmudijja auch? Und daß er in seinem Kontor mindestens zehn Schreiber beschäftigt? Er hat zwar bereits zwei Frauen, das stimmt, aber nur einen einzigen Sohn. Und unsere Saida wird ihm gefallen, eine Städterin, elegant und mit guten Manieren! Was glaubst du, wie gut sie es haben wird …›
Kurz und gut, ich ließ mich schließlich überreden. Die Katb al-Kitab fand statt, und alles lief wie am Schnürchen. Allmächtiger, wenn ich geahnt hätte, was meine beiden Schwägerinnen im Schilde führten, diese Giftschlangen, die mich schon immer gehaßt haben! Ins Unglück haben sie uns gestürzt, verflucht sei ihr Name! Was glaubt ihr: Während der Zeremonie versteckte sich eine von ihnen im Nebenzimmer, mit einem Faden und einer Schere, und bei jedem Wort, das der Kadi sprach, wickelte sie den Faden fest um die Schere. Und dann ging sie hin und warf das Ganze in den Nil.
Durch diesen bösen Zauber waren die Worte des Kadi unwirksam geworden. Der Bräutigam aber, der von allem nichts ahnte, war dadurch inwendig genauso zusammengeschnürt wie die Schere durch den Faden, und genauso, wie die Schere nicht mehr schneiden konnte, konnte er fortan weder Liebe noch Verlangen empfinden.
Eine Woche später, als die Hochzeit gefeiert wurde, glaubten wir immer noch, daß alles in Ordnung sei. Abends brachte man Saida zu ihrem Mann, doch als sie ihren Schleier ablegte – ach Gott! Anstatt sich zu freuen, wie sich jeder Mann gefreut hätte – denn die Kleine ist wirklich bildhübsch und wohlgestaltet –, machte er nur ein verlegenes und mißmutiges Gesicht.
Am nächsten Morgen besuchte ich die beiden und brachte ihnen Süßigkeiten mit. Und was mußte ich sehen? Das Ehebett war nicht einmal aufgedeckt worden, und meine Tochter, noch im Hochzeitskleid, schlief – in einem Sessel! Unter Tränen hat sie mir dann berichtet, was in der Nacht geschehen war: Ihr Mann habe sich, ohne sie eines Blickes zu würdigen, ohne auch nur ein Wort an sie zu richten, auf den Diwan gelegt und ihr den Rücken zugedreht. Sie habe sich nichts zu sagen getraut und gewartet und geweint, bis sie schließlich im Sessel eingeschlafen sei. Frühmorgens sei Ali Chalil aufgewacht und fortgegangen – einfach so!
Wir saßen etwa eine Stunde beieinander im Zimmer, da trat ein Diener ein und gab uns ein Papier: die Scheidungsurkunde. Man hat uns auch die Brautgabe ausgehändigt, beide Raten, und das Geld für drei Monate Unterhalt. Und damit war alles zu Ende.»
Umm Hassan hat, während sie den Schluß dieser tragischen Geschichte erzählte, abermals zu schluchzen begonnen, und auch manch einer Zuhörerin sind die Tränen gekommen. Eine ganze Weile herrscht im Salon bedrücktes Schweigen, sogar die beiden Klageweiber finden keine Worte mehr.
Auf den Platten sind nur noch einige Reiskörner, einige ölglänzende Auberginenscheiben zurückgeblieben. Die Trauerfeier ist zu Ende, und leise verschwindet eine Besucherin nach der anderen.
2 Heiratspläne
Umm Machmud sitzt in der Eisenbahn, die sie wieder nach Hause bringt, und schmiedet Pläne.
Also, überlegt sie, da wäre diese junge Frau, verheiratet und am Tag nach der Hochzeit verstoßen und noch unberührt – eine einmalige Gelegenheit für Abdulmagid! Die Aussteuer hat sie schon. Die Eltern wären zweifellos froh, diese Saida so bald wie möglich wieder an den Mann zu bringen. Die Kosten würden sich im Rahmen halten, denn eine Geschiedene ist weniger wert als ein junges Mädchen, da braucht es nicht so viele Geschenke …
In Matarijja angekommen, nimmt die alte Dame mit einem Seufzer der Erleichterung in dem Maultierwägelchen Platz, das vor dem Bahnhof auf sie gewartet hat. Endlich wieder zu Hause, wo alles seinen gewohnten Gang geht! Wenn man so alt ist wie sie, muß schon ein besonderer Anlaß vorliegen – wie diese Trauerfeier für eine Kusine –, damit man eine so lange Reise auf sich nimmt, ganz zu schweigen vom zweimaligen Übernachten in einem fremden Haus. Wobei diese drei Tage ja noch das Minimum waren, das die Höflichkeit in einem solchen Fall erfordert.
Hin und her gerüttelt in ihrem Einspänner, läßt sie sich die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen, und je länger sie nachdenkt, desto besser findet sie ihren Plan. Sie beschließt, für ihren Sohn um Saida anzuhalten.
Anstatt durch den Hofeingang zu fahren und direkt in ihre Wohnung zu gehen, läßt sich Umm Machmud am Gartentor absetzen. Sie will unverzüglich mit ihrem Sohn reden und hofft, ihn im Salamlik anzutreffen. Da ist er aber nicht. Vielleicht im Harem? Umm Machmud geht die breite, von einem Spalier überwachsene Allee entlang, die den Apfelsinen- vom Mandarinenhain trennt.
Der große, gepflegte Obstgarten ist Abdulmagids ganzer Stolz. Besonders die erst vor kurzem gepflanzten und äußerst anspruchsvollen exotischen Bäumchen liegen ihm am Herzen; diese hier, welche im Herbst Zimtäpfel tragen werden, und jene dort drüben beim Pavillon, wie heißen sie noch? Mangos, richtig … Umm Machmud hat noch nie eine dieser neumodischen Früchte gekostet; sie flößen ihr Mißtrauen ein, aber auch eine Art Respekt, hat man ihr doch gesagt, daß eine einzige dieser von ihr verschmähten grünen Mangos fünf Piaster einbringt! Kopfschüttelnd murmelt die alte Dame eine ihrer Lieblingssentenzen vor sich hin: «Was es doch heutzutage nicht alles gibt …»
Im Vorübergehen wirft sie einen Blick in die Laube, in der Abdulmagid oft mit seinen Freunden Kaffee oder Pfefferminztee trinkt und die Wasserpfeife raucht. Aber niemand sitzt auf den mit Kissen gepolsterten Holzbänken, und im klaren Wasser des kleinen Bassins spiegeln sich nur die Blätter der Kletterpflanze, welche Sitt mustachabbijja genannt wird, «die Frau, die sich versteckt», weil ihre Blüten unter dichtem Laub verborgen sind.
Umm Machmud geht an den herrlich duftenden Jasminsträuchern vorbei und bleibt einen Moment vor den rechteckigen Beeten stehen, auf denen Tamrahinna und Rosen wachsen. In den drei Tagen, die sie auswärts verbrachte, haben sich die Rosenknospen zu öffnen begonnen, schön fleischig und saftig sehen sie aus. Gleich morgen muß man sie pflücken, und dann wird Rosenkonfitüre eingemacht.
Die Blüten der Tamrahinna, der Paradiesblume, werden ebenfalls bald aufgehen. Dann werden ein paar Zweige abgeschnitten, getrocknet und zwischen die frischgebügelte Wäsche gelegt; die vom Vorjahr haben inzwischen ihren Duft verloren. Geranienessenz muß man auch noch zubereiten, die verleiht dem Gebäck einen so köstlichen Geschmack.
Ja, in einem großen Haushalt geht die Arbeit nie aus, sinniert Umm Machmud. Ihre Schwiegertochter mag sich nicht um all diese Dinge kümmern, sinniert sie weiter – aber eher mit einer gewissen Befriedigung als mit Bitterkeit –, weshalb es ein wahrer Segen ist, daß sie selbst, trotz ihrer Jahre, noch nach dem Rechten sehen kann. Was während ihrer Abwesenheit wohl alles passiert sein mag? Sie beschleunigt ihre Schritte, obwohl ihre Füße in den ungewohnten Schuhen schmerzen.
Das Wasserschöpfrad, von einer langsam im Kreis trottenden Büffelkuh angetrieben, singt sein eintöniges Lied. Erst jetzt nimmt Umm Machmud es wahr, denn dieses Lied hat sie ihr Leben lang begleitet. Sie hört es frühmorgens, wenn sie erwacht, und manchmal auch spätnachts, wenn sie, wie es halt so ist im Alter, schlaflos im Bett liegt. Als sie näher kommt, versetzt der Hütejunge dem Tier einen leichten Schlag mit dem Stöckchen, und für einige Augenblicke beschleunigt sich der Rhythmus. Hoo-hoo, hii-hii, so singt das Wasserschöpfrad im Obstgarten.
Und von den umliegenden Gärten und Feldern tönt es zurück: Hoo-hoo, hii-hii …
Umm Machmud stößt das Tor im mannshohen Bretterzaun auf und betritt den Gemüsegarten, ihr eigenes Reich. In den Obstgarten gehen die Frauen nur selten, denn das ist so eine Sache: Man muß sich vorher erkundigen, ob keine Männer zu Besuch sind, und falls welche da sind, muß man fragen lassen, ob sie die Güte hätten, so lange anderswohin zu gehen. Umm Machmud braucht sich ihres hohen Alters wegen zwar nicht an dieses Gebot zu halten, aber meistens tut sie es trotzdem.
Der Gemüsegarten dagegen ist Frauendomäne. Von hier aus überblickt man den ganzen Komplex der Küchen, der Backstube, der Vorratsräume, auch den Hof mit dem Ziehbrunnen und dem Stall, in dem jetzt, gegen Abend, bereits die zehn Büffelkühe darauf warten, gemolken zu werden.
In der Küche, umringt von Dienerinnen und Kindern jeden Alters, sind die beiden Nebenfrauen Abdulmagids, Nargis und Gulisar, mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt. Die ganze Schar läuft Umm Machmud entgegen und begrüßt sie mit Freudenrufen und Segenswünschen:
«Ahlan wa sahlan! Herzlich willkommen, Mutter! Ihre Rückkehr bringt Licht in dieses Haus!»
«Friede mit euch, meine Töchter. Ihr seid offenbar dabei, ein großes Diner zu kochen?»
«Gewiß, Abdulmagid hat Gäste eingeladen, wie jeden Abend, seit Sie verreisten.»
«Ich bin froh, wenn er ab und zu Freunde einlädt, um sich ein wenig von seinen Sorgen abzulenken. Was sollte er auch sonst tun? Ach ja, düster ist ein Haus ohne Söhne, wie man zu sagen pflegt …»
Gulisar zieht die Brauen hoch bei dieser Bemerkung, sagt aber nichts, während Nargis zurückgibt:
«Was können wir denn dafür, daß wir nur Mädchen haben? Als ob man wie auf Bestellung Söhne gebären könnte … Abdulmagid hat bereits viermal geheiratet, Gulisar und mich gar nicht mitgerechnet. Nun, wir werden ihn bestimmt nicht daran hindern, sich noch zehn Frauen zu nehmen, wenn ihm der Sinn danach steht, und –»
«Gut möglich, daß er so etwas im Sinn hat», sagt Umm Machmud.
«– und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, daß jede von ihnen ihm jedes Jahr Zwillinge schenkt!»
«Inscha Allah!»
Die Diskussion endet wie immer mit einem großen Gelächter. Im Laufe des jahrelangen gemeinsamen Lebens unter einem Dach, der gemeinsamen Arbeit und Sorge für das Wohl des Herrn und Gebieters ist zwischen den drei Frauen eine enge Freundschaft entstanden.
Nargis, die dunkelhäutige, lebhafte Äthiopierin mit dem breiten Gesicht, das fast immer vor Fröhlichkeit strahlt, ist trotz ihrer scharfen Zunge bei allen beliebt. Gulisar, die Tscherkessin mit dem hellen Teint und den schwermütigen Augen, ist von ruhigerem Wesen. Obwohl ein ganzes Stück größer und von stattlicherer Statur als Nargis, läßt sie sich von dieser in allem anleiten; es fällt ihr leichter zu gehorchen, als selbst Entscheidungen zu treffen. So vertragen sich die beiden sehr gut, seitdem sie nicht mehr in der Blüte ihrer Jugend stehen und folglich nicht mehr aufeinander eifersüchtig sein müssen.
Umm Machmud macht sich daran, die Töpfe und Pfannen zu inspizieren. In einer Kasserolle köchelt der Reis leise vor sich hin. Eine Dienerin zerstampft in einem Mörser das Fleisch für die Kufta, während zwei andere Weinblätter mit einer Masse aus Gehacktem, Reis und Zwiebeln füllen. Drei kleine Mädchen kauern auf der Erde und putzen Muluchijja für die Suppe.
«Und was soll es zum Nachtisch geben?» erkundigt sich Umm Machmud.
«Kommen Sie, ich will es Ihnen zeigen», sagt Gulisar und führt die Schwiegermutter in die Backstube nebenan. Dort glimmen Holzscheite unter einer ganzen Reihe von tönernen Backröhren – ein Luxus, der dem feinen Gebäck vorbehalten ist, denn für das Feuer im Kochherd verwendet man Fladen aus getrocknetem Büffelmist. Gulisar zeigt auf ein mächtiges Kupferblech: «Der Baklawa-Teig ist fertig», sagt sie, «die Mandeln habe ich schon untergemischt. Jetzt muß ich nur noch das Gittermuster einkerben … So, in den Ofen damit!»
Zwei kleine Mädchen sind den Frauen gefolgt und schauen neugierig zu. Umm Machmud fährt ihnen zärtlich durchs Haar. Es sind ihre jüngsten und liebsten Enkelinnen, Naima und Alijja, deren Mutter gestorben ist. Nun wohnen sie bei der Großmutter und werden von dieser noch mehr verwöhnt als die fünf älteren Mädchen, die Töchter von Gulisar und Nargis.
Umm Machmud liebt ihre Enkelinnen, alle miteinander, aber es sind eben doch nur Mädchen. Zwei sind bereits verheiratet und fortgezogen, Chadra mit einem Juwelier, Fathijja mit einem Gelehrten, der an der Ashar-Universität unterrichtet. Auch die drei, die schon so früh sterben mußten, waren Mädchen. Kopftücher und Lockenköpfe, wo man hinschaut! Nirgends ein Turban, nirgends ein Tarbusch – kein einziger Junge weit und breit …
Das Gejammer der Klageweiber geht Umm Machmud im Kopf herum: «Weh über den, der keinen Sohn zeugte, von Fremden wird er zu Grabe getragen!»
Kann es denn sein, daß Gott Abdulmagid mit seinem Zorn geschlagen hat? Sechs Frauen, und kein einziger Sohn! Sechs Frauen kamen in dieses Haus, drei von ihnen haben es wieder verlassen. Nafissa, die erste, die Mutter Fathijjas, ist tot. Tot ist auch die liebe, sanfte Nabiha, die sterbend unter Tränen ihre beiden Töchterchen, Naima und Alijja, der Obhut Umm Machmuds anvertraute. Die dritte, Faika, wurde verstoßen – eine schlimme Geschichte! Bleiben noch Nargis und Gulisar. Die kann man aber eigentlich nicht mitzählen, denn sie wurden seinerzeit als Sklavinnen gekauft. Und dann ist da noch Maschallah – welche nach achtjähriger Ehe immer noch kinderlos ist.
«Wo steckt übrigens Maschallah?» erkundigt sich Umm Machmud.
Nargis und Gulisar wechseln einen bedeutungsvollen Blick. Ein Lächeln huscht über das Gesicht der alten Dame; sie weiß, die beiden können die vierte Gattin Abdulmagids nicht ausstehen. Sie weiß auch, warum: nicht aus Eifersucht und nicht aus Mißgunst, nein … Niemand hat etwas dagegen, daß Maschallah in der schönsten und geräumigsten Wohnung des Harems einquartiert wurde, deren Vorzimmer auf einen großen, überdachten Balkon mündet. Er liegt über dem Eingang des Vorderhauses, und von dort aus kann man durch die feingedrechselten Holzstäbe der Maschrabijjas hindurch, ohne selbst gesehen zu werden, die Scheichs und Paschas in ihren prächtigen Gewändern beobachten, die Abdulmagid an den Besuchstagen in den Mandaras des Erdgeschosses empfängt. Nargis und Gulisar finden es auch ganz natürlich, daß Maschallah, die einer angesehenen Familie entstammt und über ein beträchtliches eigenes Vermögen verfügt, kostbare Teppiche besitzt, Geschirr aus ziseliertem Silber, ja sogar eine moderne europäische Schlafzimmereinrichtung, die aus Paris stammt und zu der unter anderem ein riesiger Kleiderschrank gehört, mit einem dreiteiligen Spiegel, der von allen Besucherinnen bestaunt wird …
Daß Maschallah über drei persönliche Dienerinnen verfügt, ist ihr gutes Recht. Daß bei ihr die Garderobe des Hausherrn aufbewahrt wird, ist ein Privileg, um das man sie zwar beneidet, das man ihr aber aufgrund ihres Ranges zugestehen muß. Man könnte ihr sogar verzeihen, daß sie faul ist und ihre Pflichten als Hausherrin vernachlässigt, niemals die Küche oder die Backstube betritt. Daß sie nie, aber auch gar nie ein freundliches Wort für ihre Gefährtinnen übrig hat, das allerdings kann man ihr nicht verzeihen.
Wahrhaftig, ein arrogantes Weib ist sie, diese kleine, dünne Maschallah mit ihrer spitzen Nase und ihrem vornehmen Getue! Alle behandelt sie wie Dienstboten, keine Gelegenheit läßt sie aus, um ein verletzendes Wort fallenzulassen, nicht einmal ihrer Schwiegermutter gegenüber zeigt sie Respekt – kurz und gut: Sie wird von allen aus tiefstem Herzensgrund gehaßt.
Auf die Frage Umm Machmuds erwidert Nargis schließlich:
«Maschallah? Die sitzt seit drei Tagen oben in ihrer Wohnung wie ein Rabe auf seinem Baum.»
«Sie ist nicht ein einziges Mal zum Abendessen heruntergekommen», ergänzt Gulisar. «Und beim Einmachen hat sie mir kein bißchen geholfen.»
«Hatte sie oft Besuch?» will Umm Machmud wissen.
«Jeden Tag, Mutter! Das war von früh bis spät ein Getrappel im Treppenhaus, schwere Schritte, leichte, langsame, schnelle, und dazu ein Geschwätz und ein Gekicher, pausenlos! Sie brauchen nur einmal wegzufahren, und schon fällt die ganze Sippschaft Maschallahs wie ein Heuschreckenschwarm übers Haus her. Gott gebe, daß Sie uns noch lange erhalten bleiben, Mutter! Mögen Sie eine spitze Gräte sein im Hals dieser abscheulichen Familie!»
«Aber dann», berichtet Gulisar weiter, «dann ist Nargis zu Maschallah gegangen und hat ihr einmal tüchtig die Meinung gesagt.»
«Allerdings! Stellen Sie sich vor: Jeden Abend ließ sie sich das Essen oben servieren, und hinterher schickte sie eines ihrer Mädchen herunter mit irgendwelchen Vorwürfen. Wir hätten schlecht gekocht, sie würde sich bei Abdulmagid beschweren … Na, mir ist das schließlich zu bunt geworden. Ich ging also rauf und sagte, sie solle sich gefälligst selbst um ihr Essen kümmern, anstatt den ganzen Tag vor dem Spiegel zu sitzen und sich zu schminken und Grimassen zu schneiden! Und da nannte sie mich doch eine ‹dreckige Negerin›! Ich war so wütend, daß ich ihr Dinge an den Kopf warf, die ich hier lieber nicht wiederhole.»
Bei der Vorstellung, was die schlagfertige Nargis alles gesagt haben mag, brechen die Frauen in schallendes Gelächter aus. Umm Machmud fühlt sich trotzdem verpflichtet, Nargis zu ermahnen, sie solle sich lieber nicht mit Maschallah herumzanken. Dann begibt sie sich nach oben; sie will endlich aus den Schuhen heraus, die entsetzlich drücken.
Umm Machmuds Wohnung, zu der eine eigene Treppe führt, liegt direkt über der Küche und den Vorratskammern und ist durch eine gedeckte Passerelle mit den drei Harems im ersten Stock des Vorderhauses verbunden.
A propos Wohnung, überlegt Umm Machmud und stößt einen wohligen Seufzer aus, als die Dienerin ihr die Schuhe aufschnürt: Wo können wir Saida, falls sie zu uns kommt, überhaupt unterbringen? Bei mir ist kein Platz, bei Nargis und Gulisar auch nicht. Maschallah hätte zwar ein Zimmer frei – aber eifersüchtig, wie sie nun einmal ist, wird sie keine zweite Frau in ihrer Nähe dulden, und schon gar keine junge, hübsche wie Saida. Man wird einen neuen Harem anbauen müssen, und bis der fertig ist … nun ja, so lange könnte sie bei Fatma wohnen.
Fatma ist eine Tochter Umm Machmuds, die Witwe eines Kavallerieoffiziers; sie wohnt mit ihren beiden Kindern in Abbassijja, einem neuen, eleganten Vorort von Kairo.
Während die alte Dame ihren Umhang ablegt, meldet eine Dienerin, daß Abdulmagid draußen sei und sie begrüßen möchte.
Umm Machmud redet nicht lange um den heißen Brei herum.
«Ich habe eine Frau für dich», verkündet sie ihrem Sohn.
«Aber Mutter, ich habe doch schon drei!» protestiert Abdulmagid lachend. «Glauben Sie tatsächlich, drei Frauen reichten mir nicht?»
«Von diesen dreien wirst du aber keinen Sohn bekommen! Wie heißt es doch: Weh über den, der keinen Sohn gezeugt hat, von Fremden wird er zu Grabe getragen …»
Abdulmagid protestiert wieder, diesmal ohne zu lachen:
«Aber Mutter, ich habe im Lauf meines Lebens sechsmal eine Frau genommen, ich habe zwölf Kinder gezeugt, und alle waren Mädchen. Wenn ein Mann getan hat, was in seiner Macht steht – was bleibt ihm anderes übrig, als sich dem Willen Gottes zu beugen?»
«Ja, wenn einer wirklich alles getan hat! Aber du hast noch nicht alles getan, und ich meine, du solltest es noch einmal versuchen!»
«Ich bin doch schon fast sechzig, Mutter.»
«Ja, aber du bist mit deinen sechzig Jahren immer noch schöner und kräftiger als manch ein Jüngerer», erklärt Umm Machmud im Brustton der Überzeugung.
Das stimmt auch: Trotz seines Alters ist Abdulmagid immer noch ein gutaussehender Mann. Großgewachsen und von stattlicher Figur, trägt er mit einer angeborenen Eleganz die Kleidung der Scheichs, ein hellbraunes Untergewand mit weiten Ärmeln, darüber einen dunkelbraunen, gelb gestreiften Kaftan, der von einem Gürtel mit Blumenmuster zusammengehalten wird. Die blütenweiße Seide des Turbans bringt seinen dunklen Teint und den gepflegten grauen Bart vorteilhaft zur Geltung.
Er hat eine hohe Stirn, eine markante Nase, einen wohlgeformten Mund, buschige Brauen und große, dunkle Augen, die manchmal düster und streng, manchmal heiter und zärtlich blicken; Augen, aus denen eine sanfte, gütige Seele spricht, wenn Abdulmagid in Gedanken versunken ist oder betet.