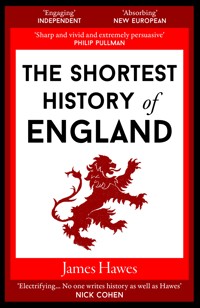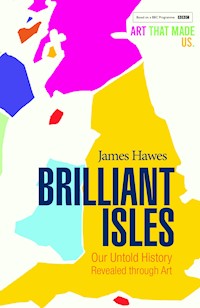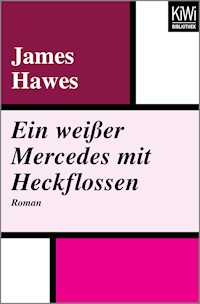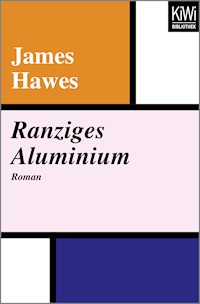
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Du steckst in einem Stau auf der M 25 und grübelst über die Höhe deiner Steuerrückzahlung nach, über deine Ehe, über dein Spermiogramm, über Margaret Thatcher und über Charmaine, als das Handy klingelt und man dir mitteilt, dass du pleite bist, bankrott, erledigt. Der große Schiedsrichter hat dir gerade die Rote Karte gezeigt. Es sei denn, der geheimnisvolle Mr. Kant liefert. Die Frage bleibt, was will er als Gegenleistung? Und was will seine hübsche Sekretärin dafür haben, dass du sie ins Bett zerrst? Und wo wir gerade dabei sind, was hat dein irischer Steuerberater mit der ganzen Sache zu tun – und dein Nachbar Gerry, der amerikanische Rechtsanwalt mit seinem kleinen, schäbigen Leben und seiner ernährungsbewussten Ehefrau? James Hawes, in England mit Nick Hornby und Irvine Welsh in einem Atemzug genannt, legte mit »Ranziges Aluminium« seinen zweiten Roman vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
James Hawes
Ranziges Aluminium
Roman
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über James Hawes
> Über dieses Buch
> Impressum
Inhaltsverzeichnis
Für Teresa und Owain. Und Dank an Steff, meine Mutter Janet und meinen Bruder Robert für ihre Hilfe; Tim; Richard; Jim B; Norman/Christine/Chris; Jüri Gabriel; Dan Franklin; Pascal Cariss und Sophie Martin bei Cape; Peter Howarth und Natasha Marsh. Außerdem danke ich aus verschiedenen Gründen Isia Tlusty-Sheen; Anoop; Menna; Tasmin; Noel, Phil & Magadalen XI1982; Simon Heaven bei der BBC Wales und Rhys Williams.
Prolog: PR und Feuerkraft
Ein passionierter Wetter hätte blind darauf gesetzt, dass Stefan Szymanskis Sarg an jenem Morgen in einem Lada zum Markt in Otradny gebracht wurde. Ein todsicherer Tipp: Denn alles in dem gut vier Hektar großen, mittelalterlich anmutenden Chaos, das den vor sich hin modernden ehemaligen Exerzierplatz der Roten Armee allsonntäglich überschwemmt, ist in einem der Ladas gekommen oder herangeschafft worden, die auf dem schlammigen Platz neben der weiß-orangefarbenen Kirche der heiligen Maria in Schmerzen eine Wagenburg bilden.
Auch die Kunden. Aus einem Umkreis von 100 Meilen sind sie gekommen, ganze Familien in Ladas gezwängt, ihre eisern ersparte harte Währung in Händen, um die Objekte ihrer langmütigen und lang gehegten Sehnsucht zu ergattern. Ein westlicher Händler oder Kunde würde mit seinen wundervollen Schuhen und seinen fetten, verwöhnten Augen auffallen wie ein Wesen aus einer anderen Welt.
Hier endet die Erste Welt und der Lada-Himmel beginnt.
Was macht einen Sarg anders? Gut, Stefan Szymanski ist an einer Überdosis 5,65 mm-Kugeln gestorben, aber was ist daran heutzutage schon besonders? Auch ein Sarg bekommt seinen Lada: einen schwarzen Lada-Kombi mit extra viel Chrom.
Der schwarze Kombi sticht unter den restlichen Ladas neben der Kirche hervor. Die meisten Wagen sind blassgrau wie die unverputzten Schlackensteinmauern der Häuser oder auch schmutzig braun wie der dichte schweflige Qualm, der aus rostenden Fabriken und Wellblechschuppen quillt (Braunkohle ist in diesen Breiten die einzige Alternative zum Strom, den man in unregelmäßigen Abständen dem erschreckend baufälligen Atomkraftwerk aus der Tschernobyl-Serie entlockt, das nur zwanzig Meilen entfernt allzu sichtbar drohend am Horizont steht.) Die restlichen Wagen sind senfgelb, dieser matte Ton, der penetrant an die frühen 80er Jahre erinnert.
Sie versammeln sich im ersten Morgengrauen und rülpsen ungefiltert Dämpfe in den feuchten, tief hängenden Morgenhimmel.
Ein paar der händlereigenen Ladas haben sich tagelang über die uralten Karawanen-Routen der Gesetzlosen, die Osteuropa noch immer mit Asien verbinden, geschlichen oder sogar gekämpft; andere sind lediglich über die deprimierenden heimischen Pfade geächzt und geholpert, voll gepackt mit allem, was ihre Besitzer finden, stehlen oder aus dem matschigen Boden rupfen konnten. Denn im Lada-Himmel herrscht jetzt die freie Marktwirtschaft.
Und so haben sie Folgendes mitgebracht: schwarz gepresste CDs und Copyright schmähende High-Tech-Spiele aus China; dünne, knallbunte Klamotten aus Taiwan mit gefälschtem Marken-Label; Plastik-Turnschuhe aus Malaysia und Billig-Walkmen aus Singapur, stangenweise Kents und Marlboros, die die halbe Welt bereist haben, um der Besteuerung zu entgehen; Duschbatterien von wer weiß woher, Steine zu Schleuderpreisen gekauft von ehemals sowjetischen Bauunternehmern, hochprozentiger selbst gebrannter Schnaps, stinkende Stapel von Kohlköpfen und -rüben sowie Ständer voller hagerer Hühner.
Nur der schwarze Lada, der hat natürlich einen Sarg dabei.
Der schwarze Lada-Kombi war die Art Leichenwagen, wie ihn ein Postbote oder kleinerer Beamter in den alten, ungefährlicheren Tagen bekommen hätte und die jetzt billig zu haben war. Richtig viel Geld hatten die um Stefan Szymanski Trauernden offensichtlich vor allem in die Ausstattung investiert: Unmengen von Blumen, die sich in grellen Wellen feuchter Farbe hüfthoch stapelten, und ein neuer Rahmen für das Foto des Toten, das am Fußende des Sarges aufgestellt war. Das ganze Spektakel fand vor dem Imbisswagen statt, der Würstchen und Kaffee verkaufte und schon vor dem Mauerfall das Zentrum des Marktes von Otradny gewesen war.
Ein romantischer Wessi hätte glauben können, die Männer, die sich um das Beerdigungs-Arrangement versammelt hatten, würden eine Totenwache für Stefan Szymanski abhalten, um seine aufsteigende Seele vor den Ränken böser Geister zu bewahren. Alle tranken einen undefinierbaren Schnaps aus kleinen, gelben, zerkratzten Pyrex-Gläschen und redeten, ohne sich anzusehen, in jenem leisen, hohlen Ton, den die Trauernden auf der ganzen Welt anschlagen. Ihre Blicke zuckten aus schmalen Augen über den Marktplatz, während sie mit den Händen ihre Zigaretten gegen den Regen abschirmten, die, wie Weihrauchfässer, schnell kleine Bögen von den Lippen auf Brusthöhe und zurück zu den Lippen beschrieben. Dünne graue Rauchfäden stiegen auf und verwoben sich um den Sarg zu einem schmierigen Dunst aus dicker Luft und teerhaltigem Atem.
Doch sie hatten sich auch Schrotflinten umgehängt, hier und da konnte man sogar das eine oder andere alte Gewehr entdecken. Sie warteten nicht auf irgendwelche Geister, die Stefan Szymanski an seiner Reise in die nächste Welt hindern könnten, sie warteten auf die Männer, die seinen Aufenthalt in dieser beendet hatten.
Sie warteten auf den schwarzen Mercedes.
Sie mussten nicht länger warten als an jedem normalen Samstag: Punkt acht Uhr – aus den neuen Sony-Lautsprechern auf dem Turm von St. Maria schallte gerade eine Aufnahme von Glockengeläut – rannte eine Horde Jungen auf den Platz und rief den Männern etwas zu, worauf diese sich neue Zigaretten anzündeten und gegenseitig ansahen, um in den Augen der anderen Mut und Entschlossenheit zu finden. Niemand war überrascht, als ein paar armselig bewaffnete Polizisten ihre Bierbäuche einzogen, ohne sich anzusehen zu ihrem eigenen rot-weißen Lada gingen und demonstrativ Richtung Stadtmitte lostuckerten.
Der schwarze Mercedes erklomm eine jener langen, sanften Furchen, die in diesen Breiten als Landschaft durchgehen: Vor dem kontrastlosen Grau, zu dem Himmel und Erde unmerklich verschmolzen waren, sah es aus, als würde er direkt aus der Erde aufsteigen. Jeder kannte den Wagen. Seit zwei Jahren war er jeden Samstag um acht Uhr aufgetaucht, um die Miete für die Stände einzusammeln. Das ereignete sich mit solcher Regelmäßigkeit, dass man es mittlerweile wie eine Naturerscheinung hinnahm; niemand machte sich noch die Mühe zu fragen, mit welchem Recht Golebiowski eigentlich seine Gebühren kassierte.
Außer Stefan Szymanski.
Als die Miete erneut erhöht werden sollte, hatte er öffentlich nachgefragt, mit einem Mut, der weniger Mut als vielmehr das schlichte Zucken im Knie eines Mannes ist, der weiß, dass er unerbittlich über den Rand des Abgrundes gedrängt wird. Er hatte Golebiowski die Frage direkt ins Gesicht gebrüllt. Jeder hatte ihm still einen Schnaps rübergeschoben, als man spätnachmittags die Stände zusammenklappte und der Abend sich mit Regen über den Platz gesenkt hatte.
Am nächsten Morgen hatten sie ihn schon steif in seinem durchlöcherten braunen Lada gefunden.
Und jetzt standen sie um seinen Sarg versammelt mit ihren alten Schrotflinten und ihren Gewehren aus dem Zweiten Weltkrieg und beobachteten, wie der schwarze Mercedes in ihr Blickfeld glitt. Und sie bemerkten jetzt auch die beiden Range-Rover, die hinter ihm herrollten, und schon bald konnten sie die Männer erkennen, die sich aus den Fenstern lehnten, Sonnenbrille im Gesicht und kurzläufige Maschinenpistole in der Hand.
Die Frauen und Kinder an den Ständen blickten zu ihren Männern. Die Männer sahen sich gegenseitig an. Jemand drehte sich um, trat im Matsch seine Zigarettenkippe aus und ging steif zu seinem Stand, sein Rücken eine einzige Herausforderung, ihm hinterherzurufen.
Binnen dreißig Sekunden war die einzige Person, die noch bei Szymanskis Sarg stand, seine Witwe, die stumme Tränen hilfloser Wut weinte, während sie den schwarzen Mercedes auf sich zukommen sah.
Doch in diesem Moment krachte es dröhnend hinter einer neuen Schlackensteinmauer neben der Kirche. Eine dicke schwarze Dieselwolke schoss schnurgerade himmelwärts; die Mauer brach wie ein Damm und ein kleiner Panzerwagen holperte auf den Platz.
Klein, für einen Panzerwagen. Klein und schnell.
Der Mercedes und die Range-Rover hatten keine Zeit mehr zu bremsen, sie fuhren direkt in den stotternden 20mm-Geschützhagel, der sie durchlöcherte. Die Standbesitzer hörten die Einschläge nicht: Sie hatten die Köpfe tief eingezogen und spürten die Detonation lediglich in ihren Eingeweiden, Herzkammern und Halsschlagadern.
Die nachfolgende Stille war wie vor dem Anbeginn der Zeit.
Dann begann die Welt aufs Neue und sie blickten vorsichtig auf und sahen, dass der Mercedes einfach platt gemacht worden war, ein zertretener dampfender Käfer. Einer der Range-Rover drehte noch abseits der Straße mit den Rädern in den Furchen eines kümmerlichen Kartoffelackers, nur dass oberhalb der Motorhaube außer schwarzem Qualm nichts mehr übrig war; der andere lag auf dem Rücken und brannte lichterloh. Sie konnten die Hitze auf ihren Gesichtern spüren. Der Panzerwagen umkreiste den sterbenden Range-Rover wie ein Hirtenhund, bis der brennende Wagen auf dem Acker zur Seite wegsackte und in seinem eigenen Scheiterhaufen aufging. Dann ließ der Panzerwagen den Motor aufheulen und holperte Richtung Kraftwerk davon, das, wie jeder wusste, auch als Basislager für die Truppen des Innenministeriums diente.
Und dann sahen sie hinter der Kirche einen noch größeren und noch schwärzeren Mercedes auftauchen.
Er war so schwarz, dass er beinahe violett glänzte: Die Fenster waren schwarz; Rück- und Bremslichter hatten schwarze Rahmen; und selbst die Scheinwerfer waren durch irgendein deutsches Technologiewunder schwärzlich getönt. Der Wagen führte eine Bugwelle stiller Ehrfurcht vor sich her, als er sich knirschend und Schlamm spritzend seinen gespenstischen Weg durch die Schlaglöcher zwischen den Markständen bahnte, während ein einzelner Scheibenwischer einen trägen, breiten Regenbogen durch die kleinen Tropfen sauren Regens wienerte, die von dem schwarzen Spiegel der Windschutzscheibe abstachen wie Quecksilber.
Der Mercedes blieb stehen und ein gut 1,80 Meter großer, uniformierter Chauffeur stieg aus, ging um den Wagen und öffnete die hintere Tür.
Nach einer kurzen Pause streckte der Mann im Fond ein schwarzes, wollgewandetes Bein in den Regen, so dass man eine schwarze Socke und einen glänzenden schwarzen Schuh einen Moment lang in all ihrem westlichen Glanz bewundern konnte. Dann trat er demonstrativ in die Mitte der tiefen Pfütze, die sich zwangsläufig vor seiner Tür befand. Er ließ den anderen Fuß folgen und hievte seine gut 100 Kilo Lebendgewicht langsam, aber mühelos in den Regen. Er sah ausdruckslos in den flachen Himmel, bevor er sich umdrehte und mit einer Frau redete, die sich hinter ihm halb aus dem Wagen lehnte.
Sie war viel jünger als der Mann, nicht mehr ganz jung, aber jung genug, um seine Tochter sein zu können. So wie sie ihr schwarzes Kleid trug, wusste man nicht, ob sie als trauernde Witwe oder männermordender Vamp unterwegs war. Er nickte ihr zu und sie blieb, wo sie war, im Wagen.
Er sah sich erneut um und fixierte die Trauernden mit einem trägen Blick aus blauen Augen. Ohne zu warten, dass sein Fahrer die Tür wieder schloss, und ohne sich noch einmal zu der Frau umzusehen, stapfte er mit herrlicher Achtlosigkeit durch den Matsch auf den offenen Sarg zu. Das Mädchen und der Fahrer sahen zu.
Er blickte dem Toten ins Gesicht, nickte stumm, bekreuzigte sich und zählte dann einen 50-Dollar-Schein nach dem anderen zu einem kleinen Stapel auf Stefan Szymanskis kalte, gefaltete Hände.
Irgendwann konnten die Händler nicht mehr anders: Ihre Blicke glitten vom Antlitz des Toten zu dem Haufen Geldscheine, der langsam, aber stetig wuchs, ohne dass erkennbar wurde, ob und wann das je wieder aufhören würde. In ihren Köpfen tauchten die uralten Waagschalen auf: Wag und Gewicht steht in Gottes Gericht. Ohne es zu wollen, fingen sie an, über Stefan Szymanskis Marktwert nachzudenken und den Preis abzuschätzen.
Der große Mann schien all das nicht zu bemerken, er blätterte nur weiter die Scheine hin, schon dreimal hatte er den Packen in seiner Hand aus einem unsichtbaren, unabschätzbaren Vorrat in der Innentasche seines schwarzen Kaschmir-Mantels erneuert. Die Menge der Standbesitzer beugte sich unmerklich vor. Sie reckten die Hälse, manche traten sogar einen winzigen, scharrenden Schritt vor.
Dollar, Dollar, Dollar. Klar wussten sie, wie Dollar aussahen, Dollar waren das Einzige, was sie außer D-Mark akzeptierten. D-Mark war okay, korrekt, aber sogar D-Mark kann kommen und gehen: Wer weiß schon, wann aus der D-Mark wieder eine Reichsmark oder eine Ostmark wird oder wann ein Dollar wie in Großvaters Jugend 2 Millionen D-Mark kostet? Deutschland ist groß und reich, aber Deutschland ist ein reales Land, in dem reale Dinge passieren: Man hat noch in lebhafter Erinnerung, wie Deutschland fanatisch wurde und andere Nationen verschlang, bevor es dann selbst in Trümmer zerschlagen und auseinander geschnitten wurde.
Aber Dollar!
Amerika ist nicht real, es ist ein Traum. Es ist das Land, in dem Vorfahren für immer verschwinden und das dafür, so geht die Mär, hin und wieder einen Kaugummi kauenden, sonnengebräunten Halbgott des Reichtums zurückschickt, der behauptet, irgendjemandes Großneffe zu sein, und der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass seine Geschenke angenommen werden. Ein Traum ist unempfindlich gegen Verletzungen, und der Dollar ändert sich nie: Und jetzt sahen sie, wie Stefan Szymanskis billiger Sarg langsam, aber unaufhaltsam in einen Schrein für Mr. Washington aus Amerika verwandelt wurde, den Schutzheiligen allen Strebens nach Glück.
Ohne aufzublicken oder innezuhalten, sagte der Mann mit dem Geld (sein Ukrainisch hatte einen stark baltischen Akzent) schließlich:
– Wo ist die Witwe?
Die kleine Frau mit dem schwarzen Kopftuch wurde durch die Reihen der Männer nach vorn geschoben. Sie sah aus wie fünfzig, obwohl sie in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht viel älter als dreißig war. Aber so war die Wirklichkeit, es war nur eine andere Wirklichkeit als die zentral beheizte, wohlgenährte Wirklichkeit der ersten Welt: 30 Jahre kalte, feuchte, wintergegerbte, vom Mann geprügelte, Kinder gebärende, auf dem Markt stehende, Schnaps trinkende, Zähne verfaulende Wirklichkeit zählt fast doppelt.
Sie sah den Mann mit starrem Blick an, als ob es das Einzige wäre, was sie davor bewahren konnte, auf das Geld zu schielen. Sie sah auch weiterhin nicht auf den Sarg, während sich inzwischen keiner der Männer mehr die Mühe machte, auch nur so zu tun, als würde er nicht mitzählen. Der Haufen Fünfziger breitete sich auf Stefan Szymanskis Brust aus, seine Hände waren schon gar nicht mehr zu sehen. Und der Mann zählte immer noch weiter.
Schließlich rutschte der Stapel unter seinem eigenen Gewicht auseinander, und die Hälfte glitt neben der Leiche tiefer in den Sarg. Der Mann hörte auf zu zählen, als gehorche er einem geheimnisvollen, aber präzisen Signal. Er blickte einen Moment auf den Sarg, legte noch einen weiteren Geldschein nach und bekreuzigte sich erneut. Dann sah er der Witwe in die Augen. Einen Moment lang hielt sie seinem Blick stand, bis Tränen der Wut aus ihr hervorbrachen und sie sich in seine Arme stürzte. Er tätschelte ihren Rücken in distanzierter väterlicher Fürsorge. Dann ließ er sie los und sah in die Runde der Männer. Er ließ den Blick von einem Gesicht zum nächsten wandern.
– Das ist schlechtes Biznes. Jetzt machen wir gutes Biznes. Ich kann nicht versprechen, dass die Mieten gesenkt werden. Aber in den nächsten sechs Monaten wird es keinen Inflationsaufschlag geben, darauf ich gebe mein Wort. Diese Woche ist Feiertag. Diese Woche keine Miete. Nächste Woche kommen meine Mitarbeiter wieder. Ich weiß, ihr werdet sie auch während meiner vorübergehenden Abwesenheit respektvoll behandeln. Ich wünsche gute Geschäfte.
Mit diesen Worten bekreuzigte er sich erneut und ging zurück zu dem schwarzen Mercedes, wobei er die ganze Zeit auf seine Füße starrte, die durch Matsch und Pfützen patschten. Als er näher kam, glitt das Mädchen Supermodel-mäßig-Arsch-voran zurück in das Dunkel des Wageninneren; er stieg nach ihr ein, und der Fahrer schloss die Tür. Die Schlösser klickten leise zu, der Anlasser seufzte kurz auf, und der Wagen spritzte durch Schlamm und Wasser davon.
Hinter der Kirche tauchte der rot-weiße Polizei-Lada wieder auf und tastete sich behutsam vor. Dann klapperte er los, um den Platz zu besetzen, auf dem bis eben der schwarze Mercedes gestanden hatte. Die Polizisten traten die Türen auf und blieben ohne jede Verlegenheit rauchend im Wagen sitzen. Sie hörten einen polnischen Radio-Sender: Elvis sang Love Me Tender.
In dem Mercedes, der mittlerweile ein gutes Stück weitergekommen war, sahen der Mann und das Mädchen sich an. Sie nahm drei Gläser mit eiskaltem Wodka aus dem Kühlschrank und reichte eines ihm und eines ihrem Mitfahrer. Der zweite Mann war groß und dünn und trug einen bemerkenswert gelben Anzug aus weichestem Tweed. Sein Gesicht sah aus wie frittiert; sein schwarzes, lockiges Haar war an den langen Schläfen, wo es erste Spuren von Grau zeigte, nach hinten gekämmt, und die Spitzen seines pechschwarzen Schnurrbarts zwirbelten sich eindrucksvoll um seine massige, stolze Nase fast hoch in die Winkel seiner dunklen Augen: Er sah aus wie die Kreuzung zwischen einem Sikh-Prinzen und einem brahmanischen Gelehrten, in einem gelben Anzug.
Er musterte den eisblauen Wodka mit einer Mischung aus unverhohlenem Abscheu und opferbereiter Schicksalsergebenheit. Mr. Kant prostete ihnen zu, und sie kippten den Wodka herunter. Das Mädchen hustete, der dunkle Mann verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf, während Mr. Kant lachte wie ein Bär.
– Du warst brillant, sagte sie.
– Es war Dr. Jones’ Idee. Auf Ihr Wohl, Dr. Jones! (Dr. Jones verstand, wenn schon kein Wort, zumindest die Geste, hob das Glas und lächelte mit zusammengepressten Lippen.) Nun, meine Prinzessin, vielleicht kannst du auf dieser Londoner Wirtschaftsuniversität tatsächlich etwas lernen. Dieser Engländer hat Recht: Wirtschaft ist vor allem, wie heißt es noch, ach ja, ›Pi-Ar‹.
– Hat er ›PR‹ gesagt? fragte Dr. Jones, weil das das einzige Wort war, was Mr. Kant auf Englisch gesprochen hatte.
– Das hat er, bestätigte das Mädchen nickend und in perfektem Bostoner Englisch. – Ich glaube, wir haben ihn überzeugt. Und bevor Dr. Jones sie aufhalten konnte, goss sie allen dreien mit einer Behendigkeit und Begeisterung, die in seltsamen Widerspruch zu ihrem Akzent zu stehen schien, Wodka nach und hob erneut das Glas:
– Nun denn, auf PR, sagte sie.
– PR, sagte Dr. Jones.
– P-R, stimmte Mr. Kant ihnen zu und lachte über sein eigenes Englisch. Doch bevor er das Glas an die Lippen setzte, hielt er erneut inne und drohte Dr. Jones freundlich mit dem Zeigefinger, während er nach dem anderen Wort suchte, das er bisher in der fremden Sprache zu lernen für nötig erachtet hatte. Endlich fiel es ihm ein:
– PR und Feuerkraft!
1. Tschernobyl auf der M 25
Am Ende, um 6 Uhr an jenem letzten Sonntagmorgen, hockte ich hinter einem Aktenschrank, weil mir dort, wer immer es war, auf den ich wartete (und logischerweise konnte es jeder von ihnen sein), keine Kugel durchs Fenster in den Rücken verpassen konnte; von hier aus konnte ich durch das kleine Drahtgitterfenster der Bürotür auch die Stahlkabel im Auge behalten, die wie schwarze Kletterpflanzen in dem vergitterten Schacht hingen.
Ich musste die Pistole für eine halbe Sekunde aus der Hand legen und mich halb aufrichten, um diese dämliche Lederhose zurechtzuziehen, damit sie mir nicht die Eier abklemmte; als ich die Pistole wieder in die Hand nahm und mich erneut niederkauerte, dachte ich: Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Brite, Himmel noch mal, ich bin dazu geboren, meinen Rasen zu mähen und mein Auto zu waschen. Wie, zum Teufel, hatte es bloß so weit kommen können?
Wenn das Wie auch ein Rätsel blieb, war das Wann doch hinreichend klar. Sie war genau in mein Hirn gebrannt, die Sekunde, als das unsichtbare Uhrwerk zu ticken begonnen hatte, das mich zu meiner Verabredung mit dem schwarzen Lada-Kombi trieb. Ich konnte mich daran erinnern, wie man sich an den Moment erinnert, als man zum ersten Mal von Tschernobyl hörte (wisst ihr noch?), als irgendjemand hereingestürmt kam und sagte, Kiew wäre gerade verglüht und eine riesige strahlende schwarze Wolke würde über die Erde treiben. Und man blickte zum Himmel und wartete auf die hohen, stillen Kondensstreifen … hohen, stillen Kondensstreifen. …
Ich steckte in meinem beschissenen Volvo auf der dunklen, nassen M 25 in einem Stau zwischen den Anschlussstellen 12 und 13, bearbeitete meine Zähne mit Zahnseide und beobachtete einen räudigen Hund, der eine rostige Brücke überquerte.
Beschissen ist ungerecht. Mein Volvo leistet praktisch alles, was ein Auto überhaupt leisten kann, und ich hasse ihn trotzdem. Vielleicht ist hassen zu viel gesagt. Also gut, ich hasse ihn nicht; er deprimiert mich bloß. Die Sache ist die, dass ich mir nur diesen abgewichsten Volvo gekauft (nun ja, geleast) habe, weil Gerry Shepperd einen hat (den gleichen Wagen zu fahren wie sein Nachbar ist die ehrlichste Form der Schmeichelei); und als ich ihn (vor zwei Jahren) bestellte, habe ich (wie Gerry) natürlich auch gleich den blöden eingebauten Kindersitz mitgeordert.
Sarah war dagegen: Sie wies mich darauf hin, dass Gerry und Melissa erst die Kinder und dann den Wagen mit eingebautem Kindersitz bekommen hatten. Ich lachte bloß.
Vor zwei Jahren hatte ich noch gelacht.
Heute hatte ich einen Termin für einen Sperma-Test.
Während ich die Zahnseide benutzte und dem Hund zusah, fragte ich mich vage, wie ich es schaffen sollte, die Probe abzuliefern (d.h. in ein Reagenzglas zu wichsen und es binnen fünfzehn Minuten zur Uniklinik zu bringen), damit man dort entscheiden konnte, ob ich für eine fruchtbare Ausbreitung des Lebens auf der Erde stand oder bloß evolutionsmäßig Zeit vergeudete, die man abschreiben konnte, und ob ich nicht besser meinen nutzlosen Volvo gegen einen kleineren sexy Zweisitzer eintauschte.
Außerdem spielte ich heimlich mit dem Gedanken, Sarah mit Charmaine zu betrügen, fruchtbar oder nicht.
Ziemlich arbeitsreicher Tag.
Als Hintergrundmusik dazu lief SouthEast FM, wo man mir riet, den Stau auf der M 25 zwischen den Anschlussstellen 12 und 13 zu umfahren.
Ich hasse scheiß SouthEast FM.
Hassen ist genau das richtige Wort. Ich hasse die Art, wie sogar der Wetterbericht von einer hörbar grinsenden Kraft-durch-Freude-Koksnase vorgelesen wird. Normalerweise höre ich South East FM überhaupt nur wegen der Verkehrshinweise und das auch nur dann, wenn es wirklich schlimm wird und ich mich langsam frage, ob der Stau jemals enden wird. Verrückt, ich weiß, aber das kommt vor. Vor allem um diese Jahreszeit.
Es ist kalt und es ist nass. Der groteske, sinnlose Konsumrausch eines weiteren Weihnachten als kinderloser Mittdreißiger wirkt auch fast zwei Monate später noch nach, im Kopf, auf dem Konto und um die Hüfte. Noch immer verlässt du vor Anbruch der Dämmerung das Haus und kommst erst nach Sonnenuntergang wieder zurück wie ein Statist aus Die Rache der Maulwurfmenschen. Deine Augen schmerzen vom Sternenregen der Öl verschmierten Scheinwerfer, die auf der Gegenfahrbahn vorbeikriechen wie schwankende Leuchttürme; dein Kopf ist betäubt vom dumpfen Pochen der Scheibenwischer. Du betrachtest all die Lichter vor, hinter und neben dir, all die Menschen, die sich Stoßstange an Stoßstange aufreihen, als würden sie verzweifelt versuchen, zu einem wundervollen Ort zu gelangen. Während in Wirklichkeit alle doch bloß wieder zur Arbeit fahren. Und genau genommen tun sie das nur, um sich die beschissenen kleinen Lustbarkeiten außer der Reihe leisten zu können, die man braucht, um all das zu ertragen.
Wenn es wenigstens eine vernünftige Zugverbindung gäbe.
Na ja, und manchmal ertappe ich mich an einem solchen Morgen dabei, wie ich meinen Staugenossen verstohlene Blicke zuwerfe und die abgedrehte Idee habe, dass jeder, der auf der M 25 zwischen den Anschlussstellen 12 und 13 feststeckt, in Wirklichkeit letzte Nacht gestorben ist. Die vom Stress zerstörten Körper kühlen noch in den sicheren Ehebetten ab; die verkniffene Trauer der fassungslosen Hinterbliebenen in den Heimatgebieten ergreift eiskalt nüchternen, unfruchtbaren Besitz von den ungeliebten Häusern, in denen man sein vergeudetes Halbleben verbracht hat.
Und hier sind wir, hocken herum wie Vögel in der Wildnis, verlorene Seelen, ohne jeden Grund unterwegs nach nirgendwo; Untote, gefangen in einer Vorhölle der Autogesellschaft, jenseits allen menschlichen Kontakts, für immer dazu verdammt, die Blicke voneinander abzuwenden und durch halb getönte Scheiben in eine feuchte, Halogen beleuchtete Ewigkeit zu starren, auf die gesperrte Ausfahrt mit dem Hinweisschild Leben und große gelbe Warntafeln, auf denen steht:
STAUGEFAHR: VORAUSSICHTLICH BIS IN ALLE EWIGKEIT.
Woraufhin ich verzweifelt SouthEast FM einschalte, um den aktuellen Verkehrsbericht zu hören. Ich drücke auf die Stationstaste und bekomme wenigstens plappernd bestätigt, dass dieser Stau tatsächlich irgendwann irgendwo endet und die Leute darin, also wir, wieder anfangen können zu leben, und sei es auch noch so nutzlos.
Außer den Verkehrsnachrichten erfährt man bei SouthEast FM nur noch, was für ein Zeug Zwanzigjährige, die ihre Akne und ihre Unschuld kaum überwunden haben, mit ihren grässlichen Modeopfer-Outfits, die sie tragen müssen, um Individuen zu sein wie alle anderen, sich heutzutage so anhören. Aber warum sollte ich, der ich jetzt 35, genau genommen sogar schon 35 ½ war, das wissen wollen?
Ich schnaubte verächtlich und suchte nach einer CD, um die Plapperstimme von SouthEast FM zum Verstummen zu bringen. Ein bisschen alte Musik würde mir gut tun.
Ihr wisst schon, die alte Musik: den Kram, den sie früher im Radio und auf Feten gespielt haben. Den Kram, den du vielleicht um fünf Uhr morgens bei der Zigarette danach aus einem Fenster gegenüber gehört hast, während du an die Decke starrtest und spürtest, wie der Schlaf über dich hinweg wehte wie ein kühler Windhauch; und das Atmen der vage vertrauten Person neben dir, das Geräusch von Luft, die durch Nasenlöcher strömte, ging über in einen Traum von großen Wellen, die an den Strand rollen, und du hattest die fast körperliche Gewissheit, dass ein langes, glückliches, unbekanntes Leben auf dich wartete.
Den Kram, auf den du abgefahren bist, als du zwanzig warst und deine Unschuld und deine Akne selbst kaum überwunden hattest, mit deinen schrecklichen Modeopfer-Outfits, die du damals tragen musstest, um ein Individuum zu sein wie alle anderen. Den Kram, mit dem die Werbeheinis jetzt Memory mit deinem Gehirn und deiner Brieftasche spielen. Der Kram, den du nicht mehr loswirst, solange du lebst.
Ich stand vor der Memory Lane und steckte fest.
Ich meine, vor der Fabrik, der Memory Lane-Kuchenfabrik.
Sie lag gleich links unter der Brücke hinter einem Maschendrahtzaun: ein flacher Industriebau mit diesen lächerlichen, angeklebten, falschen 80er-Jahre-Giebeln. Ich kannte sie gut, und das sollte ich, verdammt noch mal, auch, schließlich sah ich sie jeden Tag. Sie kroch jeden Morgen langsam rückwärts an meinem Fenster vorbei, während ich uninformiert, genervt und trübe der alten Musik lauschte, ziellos in meinem Verkehrsstau hockte, sinnlos meinen Blutdruck in die Höhe trieb, unerbittlich mein Hemd durchschwitzte, unweigerlich meine Wirbelsäule ruinierte, hilflos Hämorrhoiden entwickelte und jede Fruchtbarkeit zerstörte, die ich vielleicht noch übrig hatte. Während ich die Krebs erregende, halbverbrannte-Kohlenwasserstoff-Partikel-haltige Verkehrsstau-Luft entweder durch mein offenes Fenster (wenn ich es aufmachte), durch meine Lüftung (wenn ich sie einschaltete) oder mittels der Dämpfe einatmete, die in jeden Wagen dringen, sei es ein klappriger alter Ford oder ein Volvo mit Doppelairbag. Und dabei dachte ich versonnen: Du atmest Scheiße oder atmest Scheiße oder atmest Scheiße.
Nein, kein Kuchen: Kekse.
Memory Lane ist eine Keks-Fabrik, die mit aufwändigen Verpackungen eine Marktnische des gehobenen Segments bedient. Man sieht ihre Produkte in affektierten Spezialgeschäften in Kaffs wie Henley. Gute Tour das. Leckere Kekse, übrigens. Jedenfalls weiß, wer immer Memory Lane managt, dass die GmbHs des Vereinigten Königreiches heutzutage nur noch auf der Traditionsmasche segeln können. Die Läden, wo sie den echten Edelkram stapeln und an leitende Angestellte verticken, gehören inzwischen alle Japanern, Deutschen, Malaysiern und Koreanern. Wir Briten können nur noch die miesen kleinen Törtchen-Salons bedienen, die auf gelangweilte Reiche zielen. Oder aber Regale in den Superstores voll stopfen.
Memory Lane. Jeden Morgen, wenn ich im Schritttempo daran vorbeirollte, musste ich ein bitteres Lachen ausstoßen, denn jenseits des Zauns konnte man in einer Nebenstraße ein Fabriktor sehen, an das irgendein Lagerverwalter, der entweder sehr witzig, sehr blöd oder vielleicht auch einfach nur Country&Western-Fan war, ein Schild gehängt hatte, auf dem stand:
NO ENTRANCE TO MEMORY LANE.
Ich konnte nie daran vorbeifahren, ohne leise zu lachen und jaulende Country-Gitarren und zwei hohe, einsame Stimme zu hören, die im langsamen 4/4-Takt sangen:
(2,3 …)
No Entrance (pläng)
To Memory Lane (pläng, pläng, plängeläng)
Und das wird nie was
Mit dir und Charmaine.
Oder was immer mir an dem Morgen gerade einfiel.
Verdammt richtig.
Kein Zutritt. Es hatte keinen Zweck zu versuchen, die Straße der Erinnerung entlangzufahren in jene Zeit – Herrgott, war das erst drei Jahre her?! – als alles boomte. Als das Geld nur so anrollte, die Partner Schlange standen, die Banken Kohle abdrückten und es Verträge regnete. Himmel, sogar mein Sex-Leben mit Sarah war damals toll gewesen, bevor wir dann angefangen hatten, uns vor lauter Sorge ganz verrückt zu machen, zuerst wegen der Knete und dann in letzter Zeit wegen der Fruchtbarkeit und dem ganzen Kram. Ihr wisst schon: ob ich mindestens zwei Wochen lang auf Alkohol verzichten musste (zwei Wochen!), damit sie nur allererste Sahne bekam, und ob sie anschließend zwei Wochen lang auf Alkohol verzichten musste für den Fall, dass sie tatsächlich schwanger geworden war, und all das.
Memory Lane: als die alte Musik noch neue Musik war.
Ich hörte auf meine Zähne zu säubern und dachte an Charmaine.
Scheiß auf die alte Musik.
Letzten Freitag (heute war Donnerstag) waren wir alle zusammen im Spice of Life am Cambridge Circus gewesen und hatten ein schnelles Freitags-Feierabend-Bier getrunken, um uns von der Woche zu erzählen und die Rush-Hour abzuwarten. Und es waren (wie üblich) drei schnelle Bier geworden.
Irons und Jobson, meine Partner, die Schweine, waren natürlich auch da. Wir machen Business-Training-Videos für drittklassige Colleges und beschissene so genannte „New Universities“. Irons und Jobson sind für die eigentliche Produktion und das Marketing zuständig, während ich die Ideen liefere, die ich aus Klappentexten und Zusammenfassungen von Handbüchern für Führungskräfte klaue (jüngst beispielsweise aus einem Buch von einem seltsam aussehenden Guru im gelben Anzug). Außerdem frisiere ich zusammen mit Deeny, unserem schmierigen Steuerberater, die Bücher. Irons und Jobson finden Buchhaltung langweilig; sie hängen lieber mit den Film-Fritzen aus Soho rum, also lassen sie mich in Ruhe. Großer Fehler. Unsere Bücher sind nämlich sehr interessant. Ein Steuerprüfer etwa würde sie faszinierend finden.
Jedenfalls waren wir am letzten Freitag dort: Irons lehnte an einer Säule neben der Juke-Box, Deodorantschwaden zogen unter seiner lächerlichen Lederjacke hervor. Das gute Stück war aus Pferdeleder, sah aus wie eine mittelalterliche Rüstung mit Schulterstücken und hatte weiß der Himmel wie viele Reißverschlüsse und Gürtelschnallen, also die Art Ausstattung, die normalerweise Typen mit großen Motorrädern oder dicken Schnurrbärten tragen; Jobson hatte sich auf einen Barhocker gepflanzt und hing über dem Tresen, stopfte angegammelte Erdnüsse in sich hinein und schlurfte an einem Bier, während seine Augen unter einem Mopp aus glattem Haar hin und her zuckten. Er sah aus wie eine Steinfigur, die ein Sinnbild für die Hinterlist sein sollte. Hinter Irons sah ich einen Typen mit rosigem Gesicht und sichtbar zurückweichendem Haaransatz, unter dessen Hemd sich über dem Gürtel deutlich erkennbar ein Bauchansatz abzeichnete, als er sich vorbeugte, um mit irgendwelchen Sekretärinnen zu plaudern.
Dann wurde mir klar, dass die Säule, an der Irons lehnte, ein Spiegel war und es sich bei dem anderen Typen um mich handelte. Das schien unmöglich, weil ich ja ich war. Aber da kann man mal sehen.
Jämmerlich: Ich meine, was sollte das Ganze eigentlich?
Was bringt es, an einem Freitagabend drei Bier zu trinken und dann um halb sieben damit aufzuhören? Selbst wenn man diese drei Bier mit Uma Thurman trinken würde: An einem Freitagabend um halb sieben damit aufzuhören wäre die unfehlbarste Methode, dass man sich um sieben beschissen fühlt.
Doch (natürlich) war keiner von uns in der Lage, der Illusion zu widerstehen, die Abwechslung durch Trinken verspricht. Wir wollten die Fantasie nicht aufgeben, dass in einem Pub freitagsabends alles passieren kann. Die abendliche Stimmung wurde angeheizt durch verlogene Erinnerungen, die so taten, als wären sie noch Möglichkeiten. Wir gaben vor, miteinander zu reden, doch jeder von uns trank allein und träumte denselben beschissenen bierseligen Traum: dass er nämlich nur für einen Abend noch einmal im Junggesellenhimmel antreten darf. Ihr wisst schon: jene glücklichen Jahre um Mitte zwanzig, wo du Pickel und nervöses Gekicher längst hinter dir, Sorgen um Bauch- oder Haaransatz noch weit vor dir hast. Wo du mehr verdienst als alle anderen, jeden unter den Tisch labern und saufen und zur Not auch jedem beliebigen Teenager die Fresse polieren kannst, während du gleichzeitig noch über die armen alten Säcke über dreißig lachst. Wo du auf neunzehnjährige Mädchen ungeheuer erfahren und auf dreißigjährige Frauen faltenlos enthusiastisch wirkst.
Wie gesagt: jämmerlich. Oder (wie Charmaine sagen würde, und wie wir es uns in letzter Zeit alle angewöhnt haben): traurig.
Zurück im Jetzt auf der M 25, hörte ich auf, meine Zähne zu säubern, nahm Finger und Daumen aus dem Mund, betrachtete die körnigen Klümpchen und die gelbe Schmiere an meiner Zahnseide und dachte: Traurig? Trau-rig? Seit wann genau und warum, zum Teufel, bedeutete dieses Wort statt emotional niedergeschlagen auf einmal sozial unangemessen? Das hätte Goebbels gefallen.
Am letzten Freitag hatten wir die tödliche Drei-Bier-Grenze jedenfalls ziemlich schnell erreicht und sehnten uns danach, auf Fluchtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Die Widerstandskraft war gesunken: Überall in der warmen, lauten Kneipe sah ich Leute zusammenzucken, als sie auf ihre Uhr blickten und vergeblich hofften, dass es früher war, als es, wie sie wussten, in Wirklichkeit war. Man konnte sehen, dass ihre Blicke mehrmehrmehr wollten. Die neue Musik drang in unsere alten Köpfe: Drei Bier hatten die schmerzhaft schrillen Höhen gedämpft und der Bass-Beat fühlte sich in unseren Eingeweiden schon fast zu Hause. Ich verspürte sogar die alte, verrückte, trau-rige Versuchung mitzusingen. Keiner von uns wollte zugeben, dass es Zeit war, nach Hause zu fahren. Nutzlos, jämmerlich und nur ein bisschen über dem Limit nach Hause zu fahren.
Betrunken genug, um den Führerschein aufs Spiel zu setzen, aber noch noch nicht so betrunken, dass es uns egal gewesen wäre; spät genug, um irgendwelche großen Wir-essen-mit-Freunden-Pläne von Sarah durcheinander gebracht zu haben, aber noch zu früh, um den Abend abzuschreiben; müde genug, um einigermaßen gleichgültig zu sein, aber noch zu wach, um gar nichts zu tun.
Man versucht, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und am Ende steht man unweigerlich, es kann gar nicht anders sein, mit einer doppelten Portion Scheiße da.
F: Warum werden Männer mit Mitte dreißig fett?
A: Weil sie aufhören, so viel zu trinken.
Wenn du jung und voll drängender, schwärmerischer Verzweiflung bist, die nicht als Verzweiflung zählt, weil du ja noch jung bist, trinkst du zehn Halbe und machst dann bis zum Morgen weiter und am Ende bist du sie wieder los, hast sie rausgetanzt oder ausgekotzt. Deshalb bleibst du dünn. Während ich, der ich eine Herzinfarkt verursachende Position zu verlieren und meine liebevoll eingebildete Würde zu verteidigen habe, mich nach drei oder vier Bier verkrümele, schuldig, obwohl ich gar nichts gemacht habe, in meinen Volvo krieche und zu meiner verständlicherweise angesäuerten Frau und meinen verheirateten Freunden nach Hause fahre (vorausgesetzt, einer von ihnen konnte einen Babysitter bekommen), wo natürlich nichts passieren kann und demnach auch nichts passiert. Ich kippe noch ein paar obendrauf, schlafe meinen Halbrausch aus und der Alkohol verwandelt sich in Fett.
Nicht die Exzesse, sondern die Kapitulation hat mich aufgeschwemmt: Der verhasste Rettungsring, den ich realistischerweise nicht mehr länger verleugnen kann, ist nur das verräterische Anzeichen meiner seelischen Schlaffheit.
Charmaine, Charmaine! Unsere Lady des straffen Lycra.
Also habe ich am letzten Freitag darauf geachtet, dass ich als Erster, gar nicht traurig, mein drittes Bier leerte, als ob ich noch etwas anderes vor hätte, als zur Bar zu gehen und ein viertes zu bestellen. Ich stand mehr oder weniger im Takt zur Musik auf, sah auf meine Uhr, log schamlos, dass ich die Clique meiner Frau treffen müsste (als wäre meine Frau irgendein pralles Supermodel und unsere Wochenenden so was von aufreibend) und sagte Bis dann, Mädels zu Charmaine und Co, die zur Musik auf ihren Stühlen rumwippten.
Charmaine sprang auf und kam zu mir rübergetippelt, in dieser merkwürdigen Gangart, zu der Mädchen in engen Röcken auf hohen Schuhen gezwungen sind: Die Knöchel kreisen fast. Sie kam ganz nah heran und brüllte (sie musste ganz nahe herankommen und brüllen wegen der lauten Musik und des freitagabendlichen Rummels): Hey Pete (was sich anhörte wie Eya, Peit, weil sie aus Birmingham stammt), was für Musik wünschst du dir für die Fete? Worauf ich sie amüsiert ansah, wie es Mills&Boon-Bücher empfehlen, und zurückbrüllte: Hey, was immer du willst, Charlie. Spiel, was dir gefällt. Übernimm du das. Und sie brüllte: Magst du das, was gerade läuft, Pete? Und ich zuckte die Schultern und brüllte: Weiß nicht, klingt ganz okay. Worauf sie mich fassungslos ansah und brüllte: Was, du hast du noch nie ›Partyline‹ gehört? Also sah ich ihr direkt in die Augen und brüllte: Charlie, ich bin ein verheirateter Mann, und sie erwiderte meinen Blick und brüllte: Das heißt doch nicht, dass du die Musik nicht mögen darfst, und noch bevor einer von uns es beabsichtigt hätte, sahen wir uns auf diese ganz spezielle Art an, nach der einem für das weitere Gespräch nur zwei Möglichkeiten bleiben: entweder man erzählt sich mit einem eindeutigen Lächeln Harmlosigkeiten oder mit einem harmlosen Lächeln Eindeutigkeiten. Die Musik klang auf einmal gedämpft: Wir waren einander und unserem Ziel näher gekommen. Also brüllte ich (und entschied mich für die Harmlosigkeiten/eindeutiges Lächeln-Option): Die Nummer gefällt mir jedenfalls, und sie brüllte: Hörst du manchmal SouthEast FM? und ich brüllte: Nur für den Verkehrsfunk, und sie brüllte: Hör nächste Woche mal rein, ist echt cool, und ich brüllte Okay, mach ich, und dann zwinkerte ich ihr zu und ging.
Ich habe den ganzen Weg nach Hause gelacht, bis mein Arsch anfing zu brutzeln, weil ich aus Versehen die blöde Sitzheizung eingeschaltet hatte, als ich mich anschnallen wollte. So viel zu meinem Sperma-Index.
Natürlich erzählte ich Sarah nichts von dem, was passiert war, weil ja gar nichts passiert war. Es war nur ein kleiner Flirt mit der Möglichkeit. Irgendwie nett. Schmeichelhaft, sozusagen. Eine der Sekretärinnen hatte mich gebeten, Musik für die Party auszusuchen, das war alles. Das gehört gewissermaßen zu meinem Job. Für jemanden in meiner Position war es zweifelsohne wichtig, einen guten Draht zu den jüngeren Mitarbeitern zu haben. Gar keine Frage. Jedes unserer Management-Training-Videos würde das bestätigen. Teamgeist. Yeah.
Charmaine ist neunzehn oder so, ja, neunzehn stimmt, kurz vor Weihnachten hatten wir in der Kneipe ihr Geburtstagsbesäufnis. Sie kam und setzte sich verspielt auf meinen Schoß. Sie hat noch ungefähr zwei Jahre Lager-and-Lime Zeit vor sich, bevor sie bei Trevor, einem stämmigen jungen Rocker aus Birmingham und seines Zeichens unser Stamm-Motorradkurier, endgültig unter die Haube kommt. Sie hat pummelige Arme, runde Schultern und große Brüste, hübsch auf eine Art, die bis maximal 25 hält; sie hat eine Stupsnase und runde Wangen; ihr Mund zeigt den Ausdruck andauernden unintelligenten Erstaunens, was perfekt zu ihrem Akzent passt; wenn sie längere Röcke trägt (was zugegebenermaßen nicht oft der Fall ist), schmiegt sich der Stoff eng an die Rundungen ihrer Pobacken, bis er am höchsten Punkt glatt herabfällt und mit jedem ihrer Schritte durch die leisen Bewegung dessen tanzt und zittert, was eines Tages ein ziemlich beträchtlicher Arsch sein wird.
Mit sechzehn hätte ich sie für eine unerreichbare Sexgöttin gehalten, mit fünfundzwanzig hätte ich sie keines zweiten Blickes gewürdigt.
Mit fünfunddreißig fing ich an, SouthEast FM zu hören.
Traurig, aber wahr.
Die ganze Woche über war ich jungdynamisch ins Büro marschiert, mit eingezogenem Bauch, die Schultern zurück, hatte SouthEast FM-Zeug gesummt und, während ich jeden Tag ein bisschen näher an ihr vorbeiging, munter gefragt, Sag, wie heißt noch diese Band, Charlie, weißt du, die Nummer geht da da da da dadada, damit sie anfing zu singen, sich auf ihrem hydraulischen Stuhl drehte, mit dem Kopf nickte und mit ihren Armen Bewegungen irgendwo zwischen Flamenco und Nudeldrehen vollführte.
Gestern (Mittwoch) fragte sie: Alles klar für die Party, Pete?, und ich sagte: Ja, ich freu mich schon, Charlie, und sie meinte Ich auch, und dann fragte sie: Bringst du deine Frau mit? und ich sagte: Ich glaub nicht, bringst du Trevor mit? und sie meinte: Neee, und ich sagte: Sekt oder Selters, und trollte mich.
Jetzt konnte ich den Klang ihrer Absätze schon auf fünfzig Schritte Entfernung von allen anderen Bürogeräuschen unterscheiden.
Was die Party angeht, habe ich Sarah nicht angelogen. Ich meine nicht, dass ich ihr nichts erzählt habe, ich meine, dass ich nicht gelogen habe: Ich habe sie offen ausgeladen.
Vermutlich ist sie daran gewöhnt, dass ich ausweichend und mürrisch reagiere, wenn es ums Geschäft geht oder das Kinderproblem oder darum, dass ich mir wünschte, wir würden uns häufiger und spontaner lieben, so wie früher, und, na ja, ihr wisst schon: eben diese allgemeine dumpfe, jammervolle, beschissene Unzufriedenheit, die stark genug ist, das Leben zu vermiesen, aber noch nicht so stark, dass sie einen zwingen würde, etwas dagegen zu unternehmen. Sie ist es gewöhnt, mich nur halb-lebendig zu erleben. Und jetzt erzählte ich ihr die reine Wahrheit, damit sie sehen konnte, dass ich ein aufrichtiger Typ war. Ich sagte: Warum kommst du nicht mit? nicht so, als ob ich aus irgendeinem zwielichtigen Grund wollte, dass sie mitkam, aber auch nicht so, als ob ich es aus irgendeinem zwielichtigen Grund nicht wollte.
Ich genoss die Pseudo-Freiheit und falsche Ehrlichkeit, die sich einstellen, wenn man alle Verantwortung komplett aufgegeben hat. Ich hatte beschlossen, das geschehen zu lassen, was immer geschah: Für Sarah hörte es sich an wie die Wahrheit. Vielleicht war es das auch.
Vielleicht war ich aber auch in Wahrheit einfach so müde, dass es mir scheißegal war, und vielleicht war es das, was sie sah.
Vielleicht ist Resignation auch eine Art Befreiung (pläng, pläng).
Jedenfalls kam Sarah nicht mit zu der Party, und das bedeutete, dass irgendetwas mit Charmaine passieren würde.
So oder so.
Zurück auf der Mittelspur der M 25 kam mir eine wilde Idee. Ich konnte heute mit Charmaine flirten in dem sicheren und beruhigenden Wissen, moralisch gerechtfertigt wichsen zu dürfen. Wir könnten beispielsweise in der Mittagspause einen Drink nehmen, und wenn mir die Dinge entglitten, konnte ich sie tatkräftig in die Hand nehmen, im Klo der Kneipe meine Probe raushauen und so zwei Fliegen mit einem Reagenzglas schlagen. Ich meine, ich hatte seit Ewigkeiten nicht mehr gewichst. Natürlich ist mir manchmal nach einer schnellen Handarbeit, das geht jedem so. Aber ich bin ein verheirateter Mann; man kann kein häuslicher, verheirateter Mann sein und wichsen, das wäre einfach zu traurig. Aber heute war es nicht weniger als meine eheliche Pflicht, irgendwann zwischendurch einen schnellen Sherman zu schieben, einen kunstvollen J. Arthur. Man könnte sogar meinen, dass ich, indem ich ein wenig mit Charmaine herummachte, den Liebesakt mit Sarah orginalgetreuer nachahmte; ich meine, das Vorspiel und den Kram. Dann würde auch meine Probe realistischer ausfallen, oder nicht? Unbedingt.
Gut, was? Man fragt sich doch, warum sich noch irgendjemand die Mühe macht, über Tatsachen zu streiten, wo wir doch so versiert darin sind, alles so zu sehen, wie wir wollen. Nehmen wir zum Beispiel dieses ernste Gespräch nach Voranmeldung vor etwa vier Tagen in unserer Küche, als Sarah und ich beschlossen (d.h.Sarah hatte beschlossen), dass ich diesen beschissenen Sperma-Test überhaupt machen sollte:
SZENE: KÜ IN HUNTER’S ROW NR. 25, EIN EXKL WOHNPROJ. MIT NUR 26BESCHISSENEN FREIST. MANAGER-BEHAUS. IN TOP-AUSST., GARAGE, LUXUS-KÜ, ANBINDUNG M 3,4,25, ZAHLR. OBJ. STARK ÜBERSCHULDET
ICH:
Ein Sperma-Test? Ich?
SIE:
Nun, du bist der mit den Spermien.
ICH:
Sexistisches Schwein.
SIE:
Mal im Ernst. Das haben wir doch Weihnachten abgemacht, weißt du nicht mehr? Noch zwei Zyklen. Es wäre bloß ein Test, verstehst du, um zu untersuchen …
ICH:
Einfach nur um zu untersuchen, ob ich ein Mutant bin.
SIE:
Es ist bloß ein simpler Test.
ICH:
Ja, ja. Vermutlich …
SIE:
Lass uns einfach den Test machen und sehen, ja?
ICH:
Du glaubst, dass es daran liegt, stimmt’s?
SIE:
Ich denke bloß, wir sollten es testen.
ICH:
Wir?
SIE:
Okay, du. Du könntest dich ruhig untersuchen lassen.
ICH:
Okay, okay, gut, ich lasse mich untersuchen. Was ist mit dir?
SIE:
Was?
ICH:
Ich lasse meine Spermien untersuchen, was ist mit dir?
SIE:
Ich habe keine Spermien, Peter.
ICH:
Ha, ha, ha.
SIE:
Um so bedauerlicher.
ICH:
Was?
SIE:
Tut mir Leid.
ICH:
Mir auch. Sorry. Ich meine, weißt du, vielleicht könntest du irgendwas anderes untersuchen lassen?
SIE:
Was zum Beispiel?
ICH:
Was zum Beispiel? Was weiß ich? Eileiter oder irgendwas?
SIE:
Eileiter oder irgendwas. Hm-hm?
ICH:
Himmel noch mal, was weiß ich, ich bin schließlich kein Gynäkologe.
SIE:
Oh, und natürlich bist du ein Mann und kein Mann versteht, was da unten in einer Frau passiert, weil alles so seltsam und kompliziert und weiblich ist, richtig?
ICH:
Das habe ich nicht gesagt.
SIE:
Das hättest du aber sagen sollen.
ICH:
Hätte ich das?
SIE:
Weil es so ist, ja, genau, du hast bloß diese zwei hart gekochten Eier in einem Sack, und ich habe hunderte, ja Eileiter, Leiter, Höhlen, Spalten, Durchgänge, Lager, Membranen und Eingänge, ja, verdammt richtig, es ist tatsächlich komplizierter als zwei Tischtennisbälle in einer behaarten Frischhaltefolie.
ICH:
So habe ich sie mir noch nie vorgestellt.
SIE:
Nein, du hast sie dir wahrscheinlich als Gott vorgestellt.
ICH:
Es muss schon verdammt schwer sein, als heterosexuelle Frau unter sooo grässlichen und jämmerlichen Männern zu leben.
SIE:
Nein, die meisten anderen Männer sind lediglich grässlich. Tut mir Leid. Peter, Peter. Oh Gott, ich sage doch bloß, dass wir scheinbar ein Problem haben, okay?
ICH:
Scheinbar?
SIE:
Okay, okay, sagen wir: Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, dann haben wir ein Problem.
ICH:
Jetzt ist es auf einmal schon bald? Ich wusste nicht, dass die Zeit seit neuestem schneller läuft.
SIE:
Wir versuchen es jetzt schon seit zwei Jahren, Peter.
ICH:
Na ja, wir haben aufgehört, es nicht zu versuchen …
SIE:
Genau. Und es war aufregend, oder? Es war dieses Wow-Gefühl, das ist also Sex, und jetzt das Ganze von vorne.
ICH:
Ja.
SIE:
Nun, ich bin froh, dass du dich wenigstens daran erinnerst.
ICH:
Wie könnte ich das vergessen.
SIE:
Du lagst lächelnd auf dem Bett und hattest nichts weiter an als eine nagelneue Levis.
ICH:
Mmmmmmmmm. (Wir küssen uns.)
SIE (unvermittelt):
Aber es hat nicht geklappt! Das ist ungerecht!
Und dann weinte sie wie ein Kind und ihre Brust bebte, als würde sie ersticken.
Ungerecht. Dieses unscheinbare sinnlose Wort, dessen Bedeutung schon kleine Kinder instinktiv erfassen. Gerecht: Wenn man zum ersten Mal denkt: Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Himmel, man stelle sich vor, wie einfach das Leben wäre, wenn wir uns alle nur zurücklehnen und sagen könnten: Tja, so ist das Leben, Pech. Aber das haben wir uns vor etwa 2000 Jahren abgewöhnt, als wir anfingen, stattdessen zu sagen: Das ist ungerecht. Jetzt haben wir alle ein großes Bild im Kopf, möglicherweise unscharf, aber hell und klar, davon, wie die Dinge sein sollten, doch es ist nicht so, wie die Dinge sind. Jetzt rufen wir alle zum Himmel und können nicht mehr zwischen könnte – und sollte sein unterscheiden, wir wollen alle Gott spielen und unsere eigene Welt erschaffen. Kein Wunder, dass so viele am Ende einen feierlichen Walzer von einem hohen Gebäude hinuntertanzen oder eines Morgens vergessen, die Garagentür zu öffnen. Gerecht ist das nicht.
Kein Wunder, dass Sarah weinte. Vielleicht hätte ich einstimmen sollen, aber das tat ich nicht. Ich bin, wie gesagt, Engländer. Ich bin mit Sendungen wie Biggles, Roy of the Rovers und The Victor aufgewachsen, man hat uns damals noch fast unverhohlen auf eine nächste Somme oder ein nächstes Arnheim vorbereitet. Und jetzt sollte ich weinen, bloß weil mein Leben total verkorkst war? Oh nein. Ich hätte mich mit Sarah zu einem Knäuel zusammenrollen und heulen sollen, aber stattdessen hielt ich sie Daddy-haft im Arm und redete wie ein beschissener Dickie-Attenborough-Klon auf sie ein: Sieh mal, ich meine, absolut, du hast absolut Recht, Liebling, ich mache den Test, ich gehe gleich morgen zum Arzt, wir kriegen das alles hin, du wirst schon sehen …
Bald hörte sie auf zu weinen. Daddy regelt das schon. Und ich hatte es wieder geschafft, den ganzen Kram sicher und fest unter Verschluss zu halten, und damit zweifelsohne wieder ein paar rebellische Zellen in den großen, sich drehenden Krebs-oder-Infarkt-Jackpot geworfen.
Aber es bedeutete auch, dass ich mir jetzt ein wenig Spaß mit Charmaine erlauben konnte, gefolgt von einer sauberen Handarbeit. Manchmal ist es schon schwer, ein Mann zu sein (pläng, pläng).
Ich ließ die Zahnseide mit der linken Hand los und hielt sie mit der rechten behutsam von der Schulter weg und dehnte den Sicherheitsgurt, um das vollgemüllte Handschuhfach durchzuwühlen, bis ich den kleinen Plastikbecher mit dem weißen Verschluss in dem praktischen, verschließbaren Beutel gefunden hatte. Ich betrachtete ihn und bekam schon beim bloßen Gedanken, dass ich jetzt ungefährdet mit Charmaine rummachen konnte, einen Steifen. Ich schüttelte den Kopf, um ihn wieder zurechtzurücken, steckte den Becher in die Hosentasche und hatte dabei eine winzige Vorahnung, was das Schicksal für mich bereithalten sollte, bevor ich mich wieder auf meine Zahnpflege konzentrierte.
Ich hatte Probleme, meine Finger richtig herum in die richtige Position zu bringen: Ich hatte jetzt wieder Daumen und Zeigefinger beider Hände im Mund und die gewachste Zahnseide um den rechten Zeigefinger. Das andere Ende musste ich mit dem linken Daumen und Zeigefinger festhalten, um es zwischen den Zähnen bis zum Zahnfleisch durchzuziehen, wie es mir die dralle Hygiene-Assistentin meines Zahnarztes neulich erklärt hatte.
Vielleicht hatte ich nicht richtig aufgepasst, als sie es mir an dem Gips-Gebiss demonstriert hatte: Die ganze Zeit dachte ich nur an die Wärme, die ihrem gestärkten Kittel entströmte, während sie mir mit großen ernsten Augen erklärte, was ich machen sollte, wie nachlässig ich gewesen wäre und dass ich, wenn ich mich zusammenreißen und das Richtige tun würde, mein Leben noch immer retten könnte. Ich habe bloß dagesessen und genickt.
Ich will keine Füllungen mehr, weil ich irgendwo gelesen habe, dass man von Amalgam Alzheimer kriegt. Meine Großmutter hatte das: Sie landete schließlich in einem orangefarbenen Sessel in einem Zimmer voller alter Damen, das Raum-Deo kam nicht ganz gegen den Mief an und ein lokaler Radiosender spielte Queen (Queen, Gott bewahre!). Jedes Mal wenn ich jetzt Queen höre, denke ich an Tod im Altersheim. Ich sehe die Bilder vor mir und rieche die Gerüche. Ich spüre wieder dieses Gefühl, das Gefühl von gar nichts: als ob man auf ein verspätetes Flugzeug wartet, das einen an einen Ort bringt, wo man sowieso nicht hin will, und man hält ein wenig den Atem an und blickt nur beiläufig auf die Anzeigetafel, ohne Hoffnung oder große Verärgerung.
Jedes Mal wenn ich Queen höre, will ich losrennen und einen dieser Stempel kaufen. Ich würde in Knallrot jede Seite meines Filofax und kleine gelbe Haftis bestempeln: Ich würde sie in meinem ganzen Büro verteilen und auf den Bildschirm meines Computers kleben; ich würde sie auf die Milchflaschen in meinem Kühlschrank, die Fernbedienung meines Fernsehers und alle Spiegel im Haus pappen; und vor allem würde ich sie auf Sarahs Stirn kleben, damit ich, wohin ich auch gehe und vor allem jedes Mal, wenn ich Sarah ansehe und mich dabei ertappe, dass ich ihr nicht zuhöre oder sie vollquatsche, immer lese:
Achtung: Ernstfall
Achtung: Ernstfall
Achtung: Ernstfall
Aber (natürlich) denke ich so was nur, wenn ich ohnehin nichts machen kann, zum Beispiel um drei Uhr morgens im Bett, wenn (wie man sagt) die Alten sterben, oder jetzt, d.h. um 8.10 Uhr im Stau auf der M 25, wenn (wie man sagt) die nicht ganz so Betagten einen Herzinfarkt erleiden. Also versuche ich stattdessen etwas halbwegs Nützliches zu tun, etwas, das mir das Gefühl gibt, mich zumindest anzustrengen.
Eine Zeit lang habe ich mit dem Gedanken gespielt, in einen Fitness-Club einzutreten, um mich in Form zu halten. Doch dann habe ich ernsthafter darüber nachgedacht. In einer Kneipe mache ich eine ganz passable Figur, auch wenn ich den Bauch einziehen muss; bei der Arbeit bin ich, Rettungsring hin oder her, einer der Chefs. Wenn ich aber einem Fitness-Club beitrete, religiere ich mich freiwillig und selbstmörderisch in die neue Unterschicht der fetten, glatzköpfigen alten Säcke.
FETTER, GLATZKÖPFIGER MANN IM FITNESS-STUDIO: Bitte, bitte, ich möchte den Körper eines griechischen Gottes haben! (Seine Arme, seine Nase und sein Schwanz fallen ab.)
Also habe ich stattdessen beschlossen, Zahnseide zu benutzen. Ich ziehe die Zahnseide heraus und betrachte erneut das Ergebnis wie jemand, der sich gerade einen Mitesser ausgedrückt hat. E-kelhaft. Wenn man an all die Jahre denkt, in denen das ganze Zeug ungestört zwischen Zahnfleisch und Zähnen vor sich hingammeln konnte. Klumpenweise. Ich roch an der Zahnseide. Ich roch an den Fingern: Der Geruch dessen, was auch immer in diesen dunklen, warmen Lücken lauerte, klebte mittlerweile schon an meinen Fingern. Es war ein strenger, metallischer Geruch, der so weit in meiner Nase hinaufwanderte, dass er schon fast ein Geschmack und kein Geruch mehr war. Er hatte etwas von dem süß-sauren Hauch einer Brauerei und etwas von dem giftigen Kick verbrennenden Diesels. Vor allem aber erinnerte er mich an etwas, an das er mich logischerweise gar nicht erinnern konnte, weil ich es gar nicht kannte, und wie kann man an etwas erinnert werden, das man nicht kennt? Ich weiß aber nur, dass es nach ranzigem Aluminium roch.
Ohne es zu wollen, schaute ich in den Rückspiegel und sah mein Gesicht wie das eines Fremden. Ich hatte den Gesichtsausdruck, wie man ihn vielleicht bei einem sechsjährigen Kind beobachten kann, das selbstvergessen in einem toten Kaninchen voller Maden herumprokelt, oder bei einem schlaftrunkenen Bauarbeiter, der sich durch seine verstaubten Jeans am Arsch kratzt und dann gedankenlos an den Fingern riecht. Eine Mischung aus distanziertem Interesse, tiefer Befriedigung und instinktivem Ekel.
Der Erkenntnis nicht unähnlich, dass dieses fettige, unrasierte, übernächtigte Gesicht im Spiegel, ein Gesicht, das an den Seiten bereits absackt, weniger durch den Lauf der Zeit als schlicht durch die Schwerkraft, dein eigenes ist.
Ich dusche jeden Morgen und rasiere mich zweimal am Tag, und alle zwei Tage wasche ich mir auch die Haare oder was davon noch übrig ist. Denn ich habe schon vor langer Zeit erkannt: Es gibt einige wenige Glückliche, die über das Geheimnis (oder die Gene oder was auch immer) verfügen, das es ihnen erlaubt, am Morgen danach gut auszusehen. Selbst wenn sie schon über vierzig sind, je zerknautschter und zerknitterter sie aussehen, desto mehr denkt man: Mein Gott, der Glückspilz hat bestimmt letzte Nacht die Puppen tanzen lassen oder so, scheiße, wenn nur das Haus und die Hypothek und die Kinder nicht wären, dann könnte ich auch so sein.
Ich nicht.
Ausgeschlossen.
Ich konnte bestenfalls darauf hoffen, und das war, auch als ich noch alle Haare hatte, nie anders gewesen, einigermaßen ansehnlich rüberzukommen. Bei funktionierender Verdauung, rasiert und geduscht sehe ich auf eine langweilige englische Art nicht allzu traurig aus. Aber am Morgen danach oder selbst am Nachmittag nach einem ausgedehnten Mittagessen, mit einem Tag zu lange nicht gewaschenem Haar oder nach einem Morgen ohne Rasur, sehe ich aus, als hätte ich mich gerade selbst aus der frauenfreien Zone eines möblierten Zimmers entlassen. Ich komme mir vor wie die wandelnde Warnung an jüngere Männer: Achtung, Achtung, das könntest du sein, schließe jetzt eine Lebensversicherung ab und gründe einen Hausstand, bewerbe dich jetzt oder du endest genau so.
Ich würde jetzt täglich Zahnseide benutzen.