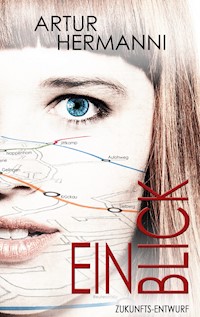Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach einem Mord in einem Linienbus Richtung Lattenkamp ahnt nur der nervöse Gerichtsmediziner Dr. Ketelsen ein nahendes Unheil. Erst Jahre später, als eine Frau in einer ruhigen Wohnstraße in Allermöhe Opfer einer Messerattacke wird, kann er auch den Eimsbütteler Kommissar Borlanski von seiner Theorie überzeugen. Nur langsam zeichnet sich ein Bild von dem ab, was in der Hansestadt vorgeht. Warum aber wird ein Bankierserbe in Winterhude Opfer der offenbar gleichen Tötungsmethode. Wie passt all das zusammen? Auch dieser Thriller von Artur Hermanni setzt mit der Liebe fürs Detail unscheinbaren Hamburger Straßen und Orten Denkmäler der besonders blutigen Art. Authentisch und fundiert bringt er individuelles Erleben psychologischer Störungen erschreckend nah. Lassen Sie sich mitreißen in einen Strudel bedrohlich realer Emotionen und nachvollziehbarer Sinneseindrücke. Vielleicht führt es dazu, dass Sie demnächst nur noch ungern Busse und Bahnen benutzen. Es könnte aber auch sein, dass Sie sich zukünftig häufiger selbst über Ihre Schulter schauen. Wer weiß?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Buch I: Die Relevanten
1. Der Visionär
2. Die Vertretung
3. Die Bleibende
4. Die Sterbende
5. Der Schlagende
Buch II: Die Intermezzi
6. Der Väterliche
7. Die Engelsgleiche
8. Der Rückkehrer
9. Der Urlauber
10. Die Gefallene
11. Die Suchenden
12. Der Spielende
13. Der Entfliehende
Buch III: Das Ätherium
14. Der Ermittelnde
15. Der Wiedergebende
16. Die Ahnenden
Nachwort
Danksagung
Prolog
Winterhude, 1. November 2010, 2:30 Uhr
Der alte Mann schlief tief und fest in dieser Nacht zum Samhain. Ein plötzliches, ungewohntes Geräusch ließ ihn jedoch hochschrecken. In der tiefen Dunkelheit des Raumes zog es seinen Blick sofort auf den diesigen Lichtkegel der offenen Tür, in der jemand zu stehen schien. Doch das schwach gräuliche Licht, das von der Galerie in sein abgedunkeltes Schlafzimmer drang, blendete seine empfindlichen Augen. Nur mühsam richtete er sich in seinem Bett auf. Den Mann, der zu ihm ans Bettende trat, nahm er ohne seine Brille nur verschwommen wahr.
… Was ist …? Hat der gerade etwas gerufen? Bin ich davon aufgewacht? Warum steht da überhaupt dieser völlig Fremde vor meinem Bett und hebt wie zum Gruß den rechten Arm? Wie kommt der überhaupt hier herein? Was bildete der sich ein, mich zu stören, mitten in der Nacht? Und was hält er da in der Hand? …
Das Letzte, was er spürte, war der brennende Schmerz, der seinen Adamsapfel durchfuhr und ihn zeitgleich wie mit einem Schlag Richtung Fenster aus dem Bett schleuderte. - Noch bevor er dumpf polternd auf dem Boden neben seinem Bett aufschlug, versank alles um ihn herum ins Dunkel.
Buch I
Die Relevanten
1 Der Visionär
Thesdorf, Eidelstedt, 2002/2003
In jenem letzten Sommer war alles anders und besser geworden, so erschien es Lennart jedenfalls. Nur wenige Wochen zuvor war er bei seinem Vater ausgezogen, und sein Lehrbetrieb hatte ihn übernommen, wenn auch nur für die gleiche Filiale, jenseits der Hamburgischen Landesgrenze, in Thesdorf, im Kreis Pinneberg. Sein Wunsch, in eine der Hamburger Ideafilialen zu wechseln, konnte ihm lediglich in Aussicht gestellt werden. Wegen des Geldes schlug er bei diesem erstbesten Angebot dennoch zu. Bevor Lennart ein paar Monate später überraschend seinen Wunscharbeitsplatz in Eimsbüttel, in der Osterstraße/Ecke Heußweg, angeboten bekam, blieb also erst einmal alles beim Alten für ihn.
Diese ihm so vertraut gewordene Thesdorfer Filiale war einer der großen Märkte seines Konzerns. Mit einem Parkplatz amerikanischen Ausmaßes lag dieser Supermarkt gleich neben der gleichnamigen S-Bahn-Station der Linie S3. Als frisch gebackener Einzelhandelskaufmann begann Lennart in dieser Zeit jedoch, auch seinen ersten eigenen Hausstand zu begründen. Und so war, jenseits seiner täglichen Arbeit, doch alles irgendwie neu. Eine kleine Genossenschaftswohnung im Astweg in Eidelstedt bildete das erste Wohnungsangebot. Auch hier zögerte Lennart nicht, denn jede weitere Suche schreckte ihn ab. Seine Zweifel darüber, dass er nach einem anstehenden Arbeitsplatzwechsel möglicherweise einen längeren Weg in Kauf nehmen musste, empfand er angesichts des Hamburger Wohnungsmarktes als das kleinere Übel. Von Redingskamp mit dem Bus der Linie 281 bis Krupunder und zwei Stationen stadtauswärts mit der S3 bis Thesdorf war die Filiale für ihn auch von seinem neuen Wohnquartier in Eidelstedt bequem erreichbar. Obwohl die Strecke kurz und das Umsteigen in die S-Bahn meist reibungslos klappte, vermied Lennart jedoch das Busfahren, wann immer es ging, und fuhr nur bei Bedarf, und das hieß bei schlechtem Wetter. Er fuhr einfach ungern Bus, und weil es zeitlich keine Nachteile hatte, ging er eben zu Fuß. So bewältigte er an den meisten Tagen des Jahres die erste Etappe seines Arbeitsweges bis in den späten Herbst hinein als Fußgänger. Erst mit dem Einsetzen der kalt-nassen Novembertage verzichtete Lennart auf seinen morgendlichen Spaziergang bis Krupunder. Die zweite Etappe mit der S-Bahn genoss er aber umso mehr, auch wenn es nur zwei Stationen bis Thesdorf waren. Richtung Pinneberg führte die S3 frühmorgens nur wenige Fahrgäste mit sich, weil sie antizyklisch gegen die Pendlerströme fuhr. Richtung Innenstadt dagegen waren die S-Bahnen schon in der morgendlichen Dunkelheit immer dicht gedrängt mit Arbeitswilligen angefüllt. Von diesem Gedränge hielt Lennart sich möglichst fern. In Krupunder stieg er am liebsten in den letzten Waggon ein, und dort am liebsten beim letzten Eingang. Er liebte es, in dem leeren Fahrgastraum ganz hinten zu sitzen. Nur dort am Waggon- und Zugende gab es den einzigen, mittig angeordneten Sitzplatz mit diesem weiten Blick über die gesamte Ganglänge, den er so liebte. Für Lennart war die S-Bahn ein guter Ort, wenn alles für ihn stimmte. Auf seinen morgendlichen Wegen zur Arbeit in jenem scheidenden Herbst und Winter, nach dem ersten Sommer ohne die Drangsal seines Vaters, fuhr er fast ausnahmslos auf diese Art allein im hintersten Waggon die zwei Stationen bis Thesdorf. Im frostkalten Januar des neuen Jahres jedoch war es für ein paar Wochen anders.
An jenem Tag, als es begann, und er wieder einmal in Krupunder zustieg, saßen sie bereits im letzten Waggon, zwei junge Handwerker in voller Arbeitskluft. Lennart war sofort beeindruckt von den zwei nur wenige Jahre älteren Männern, ohne zu verstehen, warum. Nicht nur weil sie plötzlich in dem sonst leeren Waggon saßen, als er zustieg, schienen sie alles zu verändern. Die beiden hatten sich im mittleren Bereich des Fahrgastraumes auf der bahnsteigabgewandten Seite platziert, deshalb sah Lennart sie erst, als er einstieg. Wenn sie ihn auch nicht beachteten während der kurzen Strecke mit nur einem Halt in Halstenbek, vermochte er doch seinen Blick nicht von ihnen abzuwenden. Sie wirkten unerklärlich anziehend auf ihn. Schon bei dieser ersten, kurzen gemeinsamen Fahrt mit den beiden in der Bahn handelte er ganz im Widerspruch zu seinem sonstigen Verhalten. Er setzte sich an diesem frühen Morgen nicht möglichst weit entfernt von den überraschend mitfahrenden Fahrgästen und begab sich auch nicht auf seinen bevorzugten Platz nach ganz hinten. Lennart wunderte sich über sich selbst, als er stattdessen ebenfalls in die Mitte des Waggons ging und sich dort in der Sitzbucht gegenüber, also direkt vis-à-vis der zwei, niederließ. Nur durch den Gang zwischen sich und den Männern getrennt, hatte er sie im wahrsten Sinn vor Augen. Er vermutete, dass sich die extrem vital wirkenden Typen auf ihrem Weg zur Baustelle befanden. Ungewöhnlich intensiv wirkte das sie umgebende Duftgemisch auf ihn. Er sah es durch diese Gerüche geradezu vor sich: den frischen Beton, das rohe, nach Harz riechende Holz und die Zigaretten, die sie rauchten. Ohne zu verstehen, was sie sagten, hörte er wie gebannt ihre lauten, tiefen Stimmen aus unmittelbarer Nähe. Vielleicht gerade, weil sie nicht viel sagten, fokussierte er seine ganze Wahrnehmung auf die beiden Mittzwanziger, die ihn durch ihre ruhige, wortkarge Unterhaltung ganz und gar faszinierten. Erst kurz vor der Einfahrt in Thesdorf wurde ihm sein Stieren selbst bewusst. Innerlich erschrak er darüber und wendete seinen Blick hastig nach draußen ab. Aber er vermochte dort in der morgendlichen Dunkelheit mit ihren grellen Lichtern nichts anderes wahrzunehmen. Während die Handwerker im Singsang ihres sonoren Gespräches aufeinander gerichtet blieben und ihn nicht zu bemerken schienen, lenkte Lennart seine Beobachtung auf das Spiegelbild der beiden in seiner Scheibe. Bis zur letzten möglichen Sekunde am Halt in Thesdorf sog er jede Einzelheit ihrer spartanischen Gestik in sich auf.
Tag um Tag wiederholte sich ihre Begegnung auf diese Art. Einer der beiden fiel Lennart in den kommenden Tagen besonders durch seine traditionelle Kleidung auf. Als Zunftbruder trug er den wetterfesten Schlapphut mit der breiten Krempe, den er auch in der Bahn aufbehielt. Das übliche kragenlose, weiße Hemd war ersetzt durch ein dickes, rot-schwarz kariertes Flieshemd. Die Weste fehlte ganz. Trotz der bitteren Kälte, die draußen herrschte, trug dieser Zunftbruder sein verschlissenes, beigefarbenes Cordjackett offen darüber. Dafür wirkte die schwarze Cordhose mit Schlag und Vorderluke und den zwei Reißverschlüssen authentisch, aber auch etwas vulgär. In der mit Leder eingefassten Seitentasche steckten ein Zollstock und ein Kugelschreiber - kein roter Zimmermannsbleistift, was Lennart ein bisschen enttäuschte. An den Ärmeln seines abgenutzten Jacketts waren deutlich je drei Knöpfe zu erkennen, die stellvertretend für drei Lehr- und Wanderjahre standen, das wusste Lennart, ohne sich erklären zu können, woher. Der Mann ging auf die Walz, und seit seiner ersten Begegnung mit den beiden hatte in ihm etwas begonnen, was ihn auf eine unmerkliche Art anzog und zu lenken schien.
Jeden Morgen, und zwar in dieser Sekunde, bevor sich Lennart von ihnen losriss, um in Thesdorf auszusteigen, richtete er seinen Blick noch einmal schamhaft kurz, ohne dass sie es bemerkten, direkt auf den einen der zwei Männer, den Zunftbruder. Dabei scannte er jedes Mal den auffälligen, silbernen Ohrring jenes Wandergesellen. Dieses markante Zunftzeichen mit Siegel, Schrotsäge, einem Zirkel, Breitbeil und gekreuzter Axt wies ihn als Zimmermann aus. Wie heimlich gemachte Blitzaufnahmen brannten sich die wiederholten Bilder des schlichten Handwerkerschmuckes durch die immer gleiche Abschiedsszene in ihm ein. Selbst nachdem er den Waggon verlassen hatte und zügig über den Bahnsteig Richtung Ideafiliale eilte, während die beiden Männer die letzte Strecke bis zur Endstation Pinneberg weiterfuhren, flackerten sie noch minutenlang in ihm auf, die Abbilder all dieser faszinierenden Werkzeuge und Waffen. Schon in jenen kurzen Momenten an jedem einzelnen dieser Tage mutierte dieser schlichte und harmlose Handwerkerschmuck zu einer Ansammlung scharfer Klingen in Lennart.
… Warum macht ihr mich so an? Was macht euer glänzendes, hartes Metall mit mir? Was macht euch in meiner Vorstellung so unvermeidlich zu scharfen Klingen? Klingen für mich? Warum sehe ich euch so? Warum glaube ich euch rufen zu hören, als ob ich euch suchen sollte; als ob ihr wünschtet, ich fände euch. …
Auch wenn er den Zunftbruder nie hatte gehen und sich bewegen sehen, sah Lennart ihn doch immer wieder ganz klar vor sich: auf den Wegen seiner Walz. Ein muskulöser, vierschrötiger, junger Kerl, wie er dahinschritt, unbeirrt, kraftvoll, aggressiv, seinen Blick in die Weite gerichtet, den Stenz immer fest in seiner Hand. Dieser Typ schien so ganz anderes als er selbst, und doch fühlte Lennart:
… Auch wenn ich dich bewundere, ich brauche nicht so zu sein wie du, so muskulös, so männlich, so kraftstrotzend. So wie du, so kernig, so ein Typ bin ich leider nicht! Und dennoch lässt du mich spüren, dass ich auch kann, was du kannst. Ich kann es auch, aber ich werde es anders machen; ja, anders, als du mit deiner Kraft. Du und dein Zunftzeichen sagen mir, geben mir dieses Gefühl, dass genau das möglich ist, dafür danke ich dir! …
An dem Morgen, an dem die Handwerker plötzlich nicht mehr in der Bahn auftauchten, vermisste Lennart die beiden Männer schmerzlich. Wie zwei alte Freunde, die er nie gehabt hatte, wünschte er sie, ihre Präsenz, ihre Gerüche und ihre Stimmen sehnlichst zurück. Ohne je ein Wort mit ihnen gewechselt zu haben, fühlte er sich ihnen tief verbunden. Die Bilder vom Zunftbruder mit seinen breiten Handgelenken und Schultern, den prankenartigen, verhornten Händen, die zahlreiche Scharten und Kratzer aufwiesen, hatten sich in diesen wenigen Wochen tief in ihm eingebrannt. Dabei schienen ihm diese Details die besondere Kraft jenes Gesellen besser auszustrahlen als der derbe Hosenstoff, geschweige denn der feinere Cord des Jacketts.
Er empfand es als dessen Gruß, wenn er in seinen inneren Bildern die jeweils drei Perlmuttknöpfe an den Ärmeln glänzend aufleuchten sah. Zweimal drei Knöpfe, zweimal drei Jahre. Drei Jahre Lehre, drei Jahre Wanderschaft. All das hatte dieser Mann hinter sich.
… Aber, warum hast du dich dieser Entbehrung und einem derartig kargen Leben gestellt? Warum wähltest du dieses Leid freiwillig? …
Die Handwerker waren fort, und dennoch blieben sie auf eine ihm fremde Weise noch viele Tage bei ihm; in ihm. Lennart schien es oft, als sähe, höre und röche er sie auch weiterhin, wenn er in der S-Bahn durch die Kälte und Dunkelheit des beginnenden Jahres zur Arbeit nach Thesdorf fuhr. Als er in jenem besonders kalten Januar des Jahres 2003 auf seiner Wegstrecke zwischen Krupunder und Thesdorf morgens wieder allein in dem großen, leeren Waggon fuhr, entstand etwas Neues in ihm. Ohne dass er gleich verstand, was es war, fühlte er sich ungewöhnlich wohl in diesen Minuten, an diesen Tagen, wenn er Bahn fuhr. Für Lennart war die S-Bahn ein guter Ort, wenn alles für ihn stimmte. Und mit diesem Gefühl entstand sie unterwegs auf seiner kurzen S-Bahn-Fahrt, Tag für Tag ein bisschen mehr, seine Vision.
… Ihr beide müsst das gemacht haben, als ich mir in den zweieinhalb Wochen morgens den Waggon mit euch geteilt habe. Ihr habt mich dazu inspiriert. Ich habe es nicht gleich begriffen. Es hat schon ein paar Tage gebraucht, damit sie in mir entsteht, entstehen konnte, danke! Sie ist so fantastisch, im wahrsten Sinn, und fast wie von Zauberhand ganz allein in mir entstanden, verrückt. Jetzt erst, wo ihr fort seid, entdecke und verstehe ich, dass auch ich dadurch etwas gänzlich Fremdes und Neues, etwas für mich bis jetzt Undenkbares, tun kann. Das ist meine Vision, die durch euch entstand:
Auch ich werde meinen Stenz finden und mit ihm auf meine Walz gehen. Du Zunftbruder hattest deinen Stenz nicht mehr dabei, hattest ihn schon wieder abgelegt, denn du bist ja schon wieder zurückgekehrt in die normale Welt. Dort, wo alles vorbestimmt und geregelt ist, brauchst du ihn nicht mehr, stimmt’s? Bei mir dagegen beginnt erst alles, und deshalb nehme ich meinen Stenz jetzt auf. Auch ich hoffe, eines Tages von meiner Walz zurückzukehren, mit je drei Perlmuttknöpfen an meinen Ärmeln. Ja, ab jetzt bin auch ich auf meiner Walz, und das, ohne große Muskeln zu haben. Ich bin jetzt unterwegs, bin bereits losgegangen, und ich werde es auf meine Art machen! Und ich werde irgendwann, rechts und links, je drei Perlmuttknöpfe an meinen Ärmeln tragen. Ich weiß nur noch nicht, für was sie stehen werden, jedenfalls nicht für die Jahre meiner Lehre und Walz. Mein Stenz wird auch kein gewundener, gewässerter und verdrehter Haselnussstock sein, so wie der typische Wanderstab eurer Zimmermannszunft. Er wird auch nicht nur aus Holz sein, das fühle ich jetzt bereits sehr deutlich. Mein Stenz wird eine Klinge haben. Sie wird glänzen wie dein silberner Ohrring mit dem Zunftzeichen, das du trugst. Sie wird scharf sein wie die gekreuzten Klingen von Breitbeil und der Axt in diesem Symbol. Sie wird schön sein, lang und geschwungen. Und ich kann noch etwas spüren: Einen schönen hölzernen Griff, wie er sich in meine Hand schmiegt. So wird mein Stenz werden; sein! Mein Stenz wird mein Stecken und Stab sein, mit dem ich es tue, irgendwann, auf meine Art, auf meinen Wegen; auf meiner Walz. Und dafür brauche ich ihn nur zu suchen und zu finden, damit er sich mit mir verbindet und mein Freund wird. …
Tagelang schien sich nichts zu verändern. Anfang Februar schließlich träumte Lennart in einer frostkalten Nacht etwas Fremdes, Neues und Undenkbares, das er nicht mehr vergaß. Und obwohl es ihm den Schlaf raubte in dieser Nacht, blieb er fasziniert von diesem Traum.
… Diese Enge, wie ich sie hasse. Sie sind alle so nah, viel zu nah. Wie Vieh sind wir hier zusammengepfercht in diesem stickigen S-Bahn-Waggon. Die Türen verriegelt, die Fenster geschlossen und von innen beschlagen mit dem ekligen Atem der Anderen. Ruckend und quietschend fährt der überfüllte Zug von Dammtor ab. Ich will nicht Teil sein von dieser trägen Masse Menschen. Ihr steht zu dicht, ihr stoßt mich an, ich will das nicht! Geht weg, geht alle weg! Eure vielen Körper, ich kann sie riechen, sie ekeln mich alle an. Alles und jeder stinkt hier. Ihr verbreitet eure Gerüche, und ich muss sie einatmen, eure Ausdünstungen. Kalter Zigarettenatem, Hundekot unter Schuhsohlen, viel zu alter Schweiß, Parfum, das ich nicht mag, eine Knoblauchfahne. Wie ich das alles verabscheue. …
… Und diese gebeugte Gestalt direkt vor mir muss eine alte Frau sein. Sie riecht besonders muffig und nach ranzigem Fett, ekelhaft. Warum muss die so riechen? Wie soll ich das nur aushalten? …
… Wer bist du in meiner Hand, ein Messer? - Bist du es? Wirst du also mein Stenz sein?! Ich grüße dich, heiße dich willkommen! Du wirst mir also helfen? Wie siehst du aus? Ich kann dich nicht sehen, aber deutlich spüren. Ja, du fühlst dich gut an, und ich kann dich singen hören, ja, singen, das Singen deiner Klinge. Als hätte jemand sie angeschlagen wie eine Stimmgabel. Was singst du da? - Wenn ich mit dir zustechen würde, würde ich mich besser fühlen, meinst du das? Es würde mir guttun, meinst du? Ja, ich glaube dir. Und weißt du was, ich werde es tun! Ich tue es! Ich kann dich spüren, Messer, du liegst nicht nur in meiner Hand. Du schmiegst dich in ihr an, schön. Ich soll also zustechen? Ich soll diese Frau, die so stinkt, erstechen, einfach so? - So, richtig? …
… Unglaublich, ich habe sie wirklich erstochen, die alte Frau. Ein seltsam schönes Gefühl, ein Messer wie dich in jemanden hinein zu rammen; nun steckt es in ihr! Du steckst bis zum Anschlag in ihr, irgendwo unterhalb ihres Brustkorbes, mitten in ihrem Leib. Es war gar nicht schwer, leicht geradezu. Sie hat nicht ein Geräusch dabei von sich gegeben, sie ist nur etwas in sich zusammengesackt, ist nur leicht zurückgekippt und lehnt jetzt an der Abtrennung zur ersten Sitzbucht. Komisch, als wäre sie federleicht. Wie eine lebensgroße, luftgefüllte Hülle, die ich angestochen habe. Wieso fällt sie eigentlich nicht um? Das Gedränge ist es nicht. Sie ist gegen die Abtrennung gekippt, das hält sie im Stehen. Mit erstarrtem Blick schaut sie aus ihrem beigefarbenen Mantel heraus. Sie scheint in ihrem eigenen Kragen zu versinken. Jetzt dreht sie sich doch, als wäre durch meinen Stich zu viel Luft aus ihr entwichen, und dann drückt sie ihr verzerrtes Gesicht wie ein Kind an die obere Scheibe der Abtrennung. Das sieht albern aus bei dieser alten Frau. Nur die zwei ihr vis-à-vis sitzenden Fahrgäste reagieren auf das, was sie von der Alten sehen. Aber sie bewegen sich nicht, schreien auch nicht, sie starren die alte Frau nur entsetzt und fragend an. Ich kann fühlen, wie das Blut aus ihrer Wunde rinnt und mir langsam über die Finger meiner Hand fließt. Es lässt mich eins werden mit dem Griff, mit der Klinge und mit dieser Frau. Schätze, die hagere Alte wird wohl kaum eine Chance haben, das zu überleben, selbst wenn sie an der nächsten Station Sternschanze gleich Hilfe für sich erhalten würde. Das würde sie vermutlich nicht retten. Ich glaube, sie ist schon tot. Sie sieht so aus, als ob. …
… Ich schaue auf den Boden im Waggon. Dunkelrot und metallisch riechend tropft Blut herab. Mein Herz rast und ich weiß nicht warum? Ich kann nur wenig erkennen in den Schatten und dem Gedränge zwischen unseren Beinen. Aber dass es auf meinen rechten Fuß kleckert, das sehe ich. Solange das Messer noch in ihr steckt, kann ich meinen Stand nicht verändern. Warum schlägt denn noch keiner Alarm, immerhin habe ich die Frau gerade erstochen? Ich halte meinen Blick nach unten gerichtet und versuche krampfhaft, mehr zu erkennen. Das Blut zieht mich an, und nach einer Weile kann ich auch etwas mehr erkennen. Das immer noch auf meine Schuhspitze herabtropfende Blut hinterlässt einen roten Sprühkranz auf dem Linoleumboden der S-Bahn. Ich finde, es sieht schön aus, fast wie ein Stern um meinen Fuß herum. Ich kann es kaum fassen, ich vergieße tatsächlich das Blut eines anderen Menschen. Ein gutes Gefühl, und ich bin gar nicht erschrocken darüber, es getan zu haben. Dennoch habe ich jetzt genug, ich will hier raus. Ich weiche einen Schritt zurück und stoße mit meinem linken Arm gegen die geschlossenen Waggontüren. Draußen rauscht plötzlich Dunkelheit vorüber. Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich hier am Rand des Gedränges, direkt am Ausgang, stehe! Wann hält die Bahn endlich wieder? Verdammt, ich will jetzt sofort raus hier. Das Messer, das ich mit meiner Rechten fest umschließe, steckt noch in ihr drin. Es ist ein ungetrübt gutes Gefühl, aber es ist auch irre, finde ich. Langsam ziehe ich die Klinge heraus, es geht ganz leicht. Unaufhörlich starren die beiden Fahrgäste weiter, aber ohne etwas zu sagen. Warum reagiert niemand? Hat denn niemand gesehen, was ich hier mache? Es ist trotz dieses Wahnsinns ein schönes Gefühl, wie die lange Klinge herausgleitet aus dem Körper der Alten. Ein Schwall warmen Blutes fließt dabei über meinen Handrücken, auch das ist ein schönes Gefühl. Aus dem Inneren des Waggons höre ich jetzt eine Frau laut schreien. Na endlich reagiert mal jemand. Sie ist anscheinend die Erste, die meine Tat realisiert und sich traut. Während ihr Schrei verhallt, spüre ich etwas, das eher einem Schaben gleicht, als die Klinge an der Kleidung der Alten herausgleitet. Erneut sehe ich auf die Frau herunter. Mit dem gesteckten Messer habe ich sie bis soeben festgehalten, wie es scheint, aber das habe ich gar nicht gespürt. Wie leicht kann denn ein Mensch sein? Sie wirkt fast wie eine Puppe, die sich mit einem Messer an die Wand heften lässt. Jetzt erst kippt sie langsam etwas in meine Richtung und rutscht, zwischen mir und der Abtrennung, bis auf den Boden des Vorraumes herab. Dort unten wirkt sie wie Bündel blutverschmierter Kleidung. Nur um die Einstichstelle hebt sich kontrastreich ein dunkelroter Fleck auf ihrem hellen Mantel ab. Das sehe ich wohl nicht als Einziger. Plötzlich ertönt, als folgten sie einer effektvollen Choreografie, ein ganzer Chor weichender, scharrender, teils polternder Schuhe. Die im Vorraum stehenden Fahrgäste rücken trotz der Enge von mir ab, sodass ein Freiraum wie ein Graben um mich herum entsteht. Verzerrte Gesichter schauen mich an, ich kann ihre Augen aber nicht erkennen, als hätten sie plötzlich keine mehr. Die Zeit um mich herum wird langsamer. Sekunden werden zu Stunden. Jetzt, nachdem sie Platz gemacht haben und mehr Licht einfällt, kann ich alles viel besser erkennen. Das rote Blut glänzt sogar unter dem Neonlicht im Waggoninneren. Noch immer halte ich am ausgestreckten Arm das Messer vor mich hin. Und dennoch kann ich es nicht sehen, obwohl ich es immer noch in meiner Hand halte und spüre. Allein den warmen Holzgriff in meiner Hand zu fühlen, ist echt schön. Es gehört zu mir, es kann nicht anders sein, aber sehen kann ich es nicht. …
… Die Waggontür steht plötzlich offen. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie sie sich öffnete, spüre nur die Kälte, die von außen eindringt. Keiner steigt aus, und die umstehenden Fahrgäste sind vor mir noch weiter in Richtung Waggoninneres zurückgewichen. Eine Wand aus augenlosen, angsterfüllten Gesichtern verabschiedet mich. Ich bin es, der die Starre dieser Szene aufreißt, indem ich spontan hinausspringe. Kaum, dass ich auf dem Bahnsteig lande und wankende Schritte mache, schließen sich die Waggontüren wieder zischend hinter mir, und die Bahn fährt wie in Zeitlupe ruckend an. Mein Sprung aus der abfahrenden S-Bahn lässt mich weiter über den Mittelbahnsteig stolpern. Von diesem Schwung vorangetrieben komme ich nur eine Fußbreite vor der gegenüberliegenden Bahnsteigkante zum Stehen. Das alles erschreckt mich aber nicht. Wieder spüre ich das immer noch blutige Messer in meiner Rechten. Als hätte ich so etwas schon tausendmal gemacht, streife ich die Klinge schnell und beidseitig an meinem linken Hosenbein ab und lasse das Messer in meinem halb geöffneten Blouson verschwinden. Dabei höre ich die Klinge wieder singen. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich dieses Messer bekommen habe, aber es ist mein Messer. Eine lederne Scheide trage ich wie ein Holster an meiner linken Körperseite unterhalb des Arms. Auch dieses Ledergeschirr, das meinen Oberkörper angenehm umspannt, kommt mir sehr vertraut vor. Ein gutes Gefühl, das Messer so nah bei mir zu haben. Mein Herz hämmert, und ich habe noch immer den Geruch frischen Blutes in meiner Nase. Erleichtert, endlich aus dem warmen Dunst des Waggons heraus zu sein, atme ich tief ein und aus. Hier auf dem S-Bahnhof Sternschanze ist es bitterkalt, aber die frische Luft ist ein Segen. …
… Aufrecht stehe ich auf dem Mittelbahnsteig und hebe meinen Blick Richtung Ausgang Schanzenstraße. Auf einer Bank, kurz vor dem kleinen Kiosk, sehe ich einen Mann sitzen mit einem Kassettenrekorder auf seinem Schoß. Wo hat er dieses alte Gerät nur her? Niemand benutzt heute so was noch. Ich habe keine Zeit mehr, mich zu wundern, denn ich höre nur noch, wie er spult. Er spult mich zurück. Sekunden können Stunden sein! - Während ich mich noch frage, wie dieser Mann es aushält, dort in der Kälte auf dem Bahnsteig zu sitzen, ist er plötzlich fort. Ich kann ihn nicht mehr entdecken! Auf dem Platz, wo er gesessen hat, liegt stattdessen eine Zeitung. Das Datum vom 13. November ist das Einzige, was ich erkennen kann. Ein kalter Wind pfeift erbarmungslos über diesen hoch gelegenen Bahnsteig. Ich frage mich, wie es plötzlich November sein kann. Als ich in die Bahn stieg, in der ich die alte Frau gerade erstochen habe, war es doch noch Februar. Dann höre ich ihn noch einmal, aber nur gedämpft, den Schrei der Frau aus dem Inneren des Waggons. Während die immer noch abfahrende Bahn, aus der ich Minuten zuvor ausgestiegen bin, Richtung Holstenstraße an mir vorüberrauscht, sehe ich ihn kurz, aber deutlich im Waggon sitzen: den Mann von der Bank von eben. Mit seinem Kassettenrekorder auf dem Schoss fährt er im Februar davon, und ich bleibe auf dem Bahnsteig im November zurück. …
Mit diesem letzten Traumbild der sich entfernenden S-Bahn wachte Lennart in jener unabänderlichen Dunkelheit des noch nächtlichen Februarmorgens wieder auf. Bevor er, einem spontanen Impuls folgend, daran ging, alles, was er im Traum getan und erlebt hatte, aufzuschreiben, fragte er sich, wie es sein konnte, dass er ihn so real hatte empfinden können. Wie hatte er das so genau spüren können, als die lange Klinge fast ohne Widerstand in den Leib der alten Frau eingedrungen war? Das würde er niemals mehr vergessen können. Besonders der Geruch des warmen, frischen Blutes wirkte noch tagelange in seiner Nase nach, als wäre das alles wirklich passiert. Sein dadurch ausgelöstes Herzrasen belastete Lennart stark. Es folgte unvermeidlich, wenn er Blut roch, frisches Blut. Das wiederum ging auf eine Kindheitserfahrung zurück. Sein Vater hatte ihn als Zehnjährigen so stark geschlagen, dass Lennart heftig blutete. Bodo hatte das so nur dieses eine Mal getan, und nur dieses eine Mal war Lennarts eigenes Blut geflossen, doch seitdem triggerte ihn der Blutgeruch. Diese Assoziation schien selbst dann zu funktionieren, wenn er von Blut träumte. Das blieb fatal und anstrengend für Lennart, weil der beschleunigte Herzschlag dazu in Wechselwirkung stand. Roch er Blut, raste sein Herz; raste sein Herz, roch er auch sofort Blut. Das eine provozierte das jeweils andere. Wie aneinander gekoppelt wirkte diese Bedingtheit verlässlich in ihm und die Beeinflussung aufeinander. Normalerweise vermochte er den körperlichen Mechanismus von Reiz und Reaktion im nächtlichen Schlaf zu durchbrechen. Doch diesmal gelang es ihm erst nach vielen Tagen, sich aus der erschöpfenden Endloskette von Assoziation und Reaktion herauszuwinden. Auch blieb Lennart noch wochenlang im Erleben des geträumten, kalten Novembertages gefangen. Das verwirrte ihn nicht zuletzt deshalb, weil die Wetterlage des beginnenden Jahres im realen Februar sich in jenen Tagen kaum von der eines kalten Novembers unterschied. Dieser Umstand verstärkte sein Erleben, in seinem Traum verblieben zu sein. Wenn es auch nur ein Traum war, so vermittelte er Lennart doch eine Ahnung; eine Ahnung von etwas Fremdem, Neuem und Unvorstellbarem, das irgendwie real werden konnte. Noch nie zuvor hatte er träumend alles so intensiv gefühlt und wahrgenommen. Noch nie hatte er sich selbst erlaubt, sich zu wünschen, was er in diesem Traum getan hatte. So wie sich die Präsenz und Wirkung seines Traums erst über Wochen verlor, wechselte auch Lennart nur langsam in seine Normalität zurück. Je mehr sein Traumerleben in eine verblassende Erinnerung überging, umso stärker wurde ihm jedoch noch etwas anderes bewusst.
An die wechselnden Schichtzeiten hatte sich Lennart mit Beginn seiner Verkäuferlehre nur langsam gewöhnt. Noch bis in das zweite Jahr seiner Ausbildung irritierte es ihn, alle paar Tage zu anderen Zeiten zur Arbeit gehen zu müssen, mal früh, mal erst mittags. Als die Gewöhnungsphase schließlich irgendwann endete, mochte er die Spätdienste am liebsten. Das änderte sich auch nicht, nachdem er im März des laufenden Jahres von der Thesdorfer in die Eimsbütteler Ideafiliale gewechselt war.
Auch in der Osterstraße bestand sein Dienst überwiegend aus Packen, Packen, Packen. Nach dem Grundprinzip First-In-First-Out holten Lennart und seine Kollegen alte Ware aus den ungezählten Verkaufsregalen heraus, stellten neue hinein und, wenn noch vorhanden, die alte wieder davor. Eine mühsame und nie endende Arbeit, die vor den Öffnungszeiten und während eines jeden Verkaufstages in jeder Schicht, früh oder spät, verrichtet werden musste. Darin bestand seine Arbeit. In den Frühdiensten arbeitete Lennart stets mit wenigen Kollegen zusammen, weil die volle Besetzung, einschließlich Hendrik Hamanns, seines Chefs, erst um 8:00 Uhr eintraf. Zu diesen Diensten musste er schon um 4:00 Uhr morgens aufstehen, um die Anlieferungen ab Schichtbeginn um 5:00 Uhr von den Lkw in die Verkaufsräume zu befördern. Die beiden Kollegen, die mit ihm meistens zur Frühschicht eingeteilt wurden, waren Raucher. In diesen frühen Stunden konnten sie sich die Raucherpausen selbst einteilen. Auch wenn Lennart selbst nie dem Tabak frönte, begleitete er sie jedes Mal. Sie mussten nur darauf achten, bis 8:00 Uhr ihr morgendliches Pensum zu schaffen. Seine Kollegen hätten gerne während ihrer Arbeit geraucht, was untersagt war und wegen des Geruchs sicher bemerkt und geahndet worden wäre. Dafür machten sie aber viele kleine Pausen. Ihre frühmorgendliche Routine begann mit dem Abladen. Verschweißte Paletten mussten im Eiltempo von den Fahrzeugen herunter und in das kleine Vorlager gewuchtet werden. Erst danach arbeiteten sie im eigenen Takt. Die Folien der gut verpackten Waren mussten runter und so weit entfernt werden, dass die Kollegen, die um 8:00 Uhr ihre Arbeit begannen, mit ihnen zusammen die Regale mit der neuen Ware auffüllen konnten. Dafür musste alles grob vorsortiert und teilweise in eine bestimmte Reihenfolge gebracht und abgestellt werden. Das betraf besonders die schweren Gebinde wie Getränke und Konserven, die deshalb direkt bis vor die entsprechenden Regale befördert wurden. Auch wenn Lennart diese Frühdienste seit Anbeginn nie besonders gemocht hatte, absolvierte er auch diese Schichten gewissenhaft und pflichtbewusst. Dass sich genau das veränderte, das war es, was ihm bewusst wurde!
Anfang des Jahres, als er noch in Thesdorf arbeitete, war es nur ein diffuses Gefühl gewesen. In der Rückschau erkannte Lennart es jedoch deutlich für sich. Schon damals, in der weit geräumigeren Filiale, hatte es begonnen. Es war die Enge auf seiner Arbeit, die ihn bereits dort plagte, als er in jenen kalten Januartagen den beiden Zimmermännern in der S-Bahn begegnet war. Ohne es zu bemerken, hatte sich dieser größer werdende Widerwille über die Monate wie ein Geschwür in ihm ausgebreitet. Obwohl er den Wechsel nach Eimsbüttel durchgesetzt hatte, blieb die Arbeit doch stets die gleiche. Unter der unfreiwilligen Nähe zu den Kunden in der räumlich viel engeren Altbaufiliale jedoch litt Lennart nun täglich. Der Warenstrom durfte auch hier nie versiegen, nur gab es hier noch viel weniger Platz. Die Regale und Auslagen mussten immer voll und frisch bestückt sein. Darin bestand doch sein Job, den er bis dahin eigentlich okay fand, vormittags und nachmittags, Tag für Tag. Leider kamen ihm zu viele Kunden immer und immer wieder viel zu nahe, wenn er in den deutlich engeren Gängen arbeiten musste. Völlig unberechenbar kamen sie ihm vor, wenn sie neben oder hinter ihm auftauchten, stehen blieben oder viel zu dicht an ihm vorbeigingen. Oft streiften sie ihn dabei. Immer waren es die Kunden, die ihn auf den beengten Laufflächen hinderten und störten. Freundlichkeit und Höflichkeit gegenüber Kunden war Gesetz. Aber Lennarts Wille, diesen unumstößlichen Verpflichtungen zu entsprechen, kämpfte mit dem Impuls, die Menschen, die ihm ungefragt zu nahe kamen, wegzustoßen oder gar zu schlagen. Es machte ihn aggressiv, lud ihn regelrecht auf. Sich trotzdem beherrschen zu müssen, empfand er als besonders kräftezehrend und demütigend. Aus reiner Verzweiflung begann er seine Arbeit zu unterbrechen, um kurz ins Lager oder nach draußen zu gehen. Diese selbst erwählten Maßnahmen wurden immer häufiger notwendig. Eigentlich normale Arbeitssituationen im Frühdienst empfand er als so belastend, dass er sich ihnen regelhaft ausgesetzt sah. All das entnervte Lennart zunehmend. Auch nachmittags wurde das First-In-First-Out-Prinzip durchgezogen, genau wie an den Vormittagen, aber alles in kleinerem Umfang. Paletten und große Gebinde waren vor Ende der Frühschicht bereits komplett weggeräumt. Dennoch wurden auch in den Spätdiensten viele Waren mit in die Verkaufsräume genommen, aber eben nur in Mengen, die man als Einzelner tragen konnte. Nachladen nannten sie das. Dadurch entstand im Vergleich zu vormittags eine räumlich angenehmere Arbeitssituation für Lennart. Vergeblich bat er Hamann darum, nur noch Spätdienste machen zu dürfen. Dieser ließ sich aber nicht auf eine verbindliche Zusage ein, sondern wollte Lennarts Wunsch lediglich, wenn es in den Dienstplan passte, berücksichtigen.
Auch wenn sein unvergesslicher, faszinierender Traum vom Februar langsam zu einer Erinnerung wurde, blieb er ihm doch bis in diese Märztage hinein noch sehr präsent. Lennart erschien es, als wollte jener Traum ihm etwas sagen. Er glaubte, erst durch ihn zu verstehen und sich darüber bewusst zu werden, dass er den Spätdienst nicht nur immer schon bevorzugt hatte, sondern dass er sich in den Frühdiensten mittlerweile regelrecht unwohl fühlte. Die späten Feierabende und den zwangsläufig späten Heimweg empfand er als viel entspannter. An solchen Abenden war die Rushhour der nie ruhenden Hansestadt bereits abgeebbt, und U-Bahnen und Busse wurden langsam leerer. Besonders dieser Umstand gefiel Lennart, weil er sich dadurch wenigstens ein bisschen für die ungeliebten Frühdienste entschädigt fühlte. Am schwersten jedoch wog die bedrohliche Erkenntnis, dass seine Arbeit für ihn nicht mehr zu funktionieren schien. Auf Lennart wirkte das, als ob ein Schutzwall, der ihn umgab, eingerissen wurde. Und so etwas hatte er schon einmal erlebt.
… Weißt du, Paula, Bodo kam einfach in mein Zimmer gestürmt, damals, als ich gerade zehn geworden war. Wie sollte ich das ertragen? Er, mein Vater, hatte das bis dahin so selten getan, sodass ich es als Zehnjähriger für normal hielt, dass er dort praktisch nie auftauchte. Ich begriff ja gar nicht, mein Zimmer als einzigen Raum zu bewohnen, in dem ich mich vor ihm zurückziehen konnte. Nur dort war ich vor ihm sicher, obwohl ich nicht einmal ahnte, dieses Refugium auch zu brauchen, um vor ihm sicher zu sein.
Ich lebte in diesem letzten verbliebenen Schutzraum, während du ins Krankenhaus gegangen bist, um von dort niemals mehr wiederzukommen. Du warst noch nicht einmal gestorben, als Bodo mir diese letzte Sicherheit entriss. Der Erhalt meines Schutzraumes war einer deiner wenigen Verdienste an mir, aber auch nur so lange, wie du ein anwesender Teil unseres Lebens warst. Durch dich war ich geschützt, geschützt durch meine eigene Mutter vor meinem eigenen Vater. Und als du für immer gingst, mich alleine liest, blieb ich ihm total ausgeliefert. …
Jahr um Jahr folgten danach diese Quälereien die Lennart ertragen musste, bevor sie mit dem Tag seines fünfzehnten Geburtstages endeten, ohne dass er verstand, warum sein Vater so unverhofft damit aufhörte. Vermisst hatte er die Vaterspiele, wie Bodo sie nannte, jedenfalls nicht. Aber dadurch brauchte er auch seine Fluchtmöglichkeit nicht mehr. Es gab plötzlich keine Schmerzen mehr, die ihn zuvor so sehr bedrohten, dass er ihnen entfliehen musste. Es war in dieser schlimmen Zeit, in diesen Jahren der Vaterspiele, als er sie kennenlernte. Sie, die undurchsichtigen Nebel des Vergessens und der Dunkelheit, wurden zu seinem einzigen Weg. Zu ihnen war er damals geflüchtet, aber danach hatte Lennart sie irgendwie vergessen.
So wie er einst seinem Vater schutzlos ausgeliefert war, fühlte er sich, auch bei seiner Arbeit, der ungewollten Nähe zu anderen Menschen ausgesetzt. Was er einst als Kind erlitten hatte, widerfuhr ihm jetzt als Neunzehnjähriger ein weiteres Mal. Ein Entrinnen schien es für ihn auch dieses Mal nicht zu geben. Und mit seiner neuen Not kamen die Bilder von damals zurück. Erinnerungen an das, was ihm seine Mutter mit ihrem Tod vorenthalten hatte, erfüllten Lennart mit einer Neuauflage seiner kindlichen Verlorenheit. Sich wieder so schutzlos wie ein Zehnjähriger zu fühlen, ließ ihn noch einmal die gleiche Verzweiflung von damals empfinden. Aber das sollte nicht das einzige bleiben.
Nach einer Spätschicht Ende März auf dem Rückweg von seiner neuen Filiale in Eimsbüttel vermochten es die Gerüche und Geräusche zu bewirken, in Lennart Türen zu längst Vergessenem zu öffnen. Vielleicht verstärkte die extrem feuchte Luft an jenem regennassen Vorfrühlingstag das Aufleben alter Verzweiflung. Kaum hatte er den feucht-warmen Bus betreten, beförderten die intensiven Gerüche wie Walküren plötzlich alles Angsteinflößende seiner Kindertage an die Oberfläche seines Bewusstseins. Und sie katapultierten ihn durch die Zeit zurück bis zu jener ersten Busfahrt, zu der ihn Bodo gezwungen hatte, damit er es lernte, seinen Schulweg zu seiner neuen Schule am Sportplatzring allein zu bewältigen. Wieder war er der verängstigte Zehnjährige von damals. Was fürsorglich scheinen könnte, diente jedoch nur den praktischen Erwägungen seines Vaters. Auf diesem Probelauf an jenem verregneten Sommertag vor seinem Schulwechsel hatte Lennart nur schiere Angst vor seinem Vater und dem Neuen empfunden.
Wegen der gleichen Sinneseindrücke in der Gegenwart spürte und litt Lennart wiederholt die grausamen Ängste, Schmerzen und Qualen, die ihm in jener Zeit widerfahren waren. Als dann auch noch das monoton rauschende Dröhnen im Inneren des Busses zu dem vertrauten Rauschen der Pappeln mutierte, was damals in seinem Kinderzimmer zu hören gewesen war, erstand das klare Bild seines mächtigen Vaters vor seinem geistigen Auge, und er wurde wieder zu dem hilflosen Kind in höchster Not, das verzweifelt nach einem Ausweg aus der unerträglichen Realität der Gegenwart suchte. Und wie damals glitt Lennart hinüber. Wieder zog es ihn wie von Zauberhand hinein, in die undurchsichtigen Nebel des Vergessens und der Dunkelheit.
»Nächste Haltestelle Eidelstedter Platz«, drang wie aus dem Off die Ansage im Businneren an Lennarts Ohr. Nur mühsam kehrte er aus seiner Trance zurück, in der er minutenlang gewesen war. Müde verließ er langsam am Eidelstedter Platz den Bus, um in den 281er umzusteigen, die letzte Etappe an diesem späten Abend auf seinem Weg nach Hause.
In den Tagen und Wochen danach wurde Lennart klar, dass nicht nur sein Traum vom Februar ihn gewarnt hatte. Für ihn machten sich die Nebel selbst zu Warnungen, wenn sie ihm nun allabendlich auf seinen Busfahrten nach seinen Spätdiensten vorführten, dass er dringend einen Fluchtort brauchte. Sie, die jahrelang aus seinem Bewusstsein verschwunden schienen, wurden wieder Teil seines Alltags. Lennart glaubte jedoch nicht, dass sie zurückkamen, um ihm zu helfen. Was ihm zuletzt als Teenager widerfahren war, passierte ihm jetzt als junger Arbeitnehmer, nun auf jeder späten Heimfahrt mit dem Bus von Eimsbüttel nach Eidelstedt, kaum dass er den Bus der Linie 4 bestieg. Und obwohl Lennart möglichst immer einen Sitzplatz am Gang wählte, um auf großem Abstand zum Fenster zu bleiben, konnte er das Kommen der Nebel damit nicht verhindern, auch dann nicht, wenn er sich stattdessen hinstellte. Ob an klaren Sommerabenden oder wolkenverhangenen Tagen, jedes Mal war es die verschwommene Sicht dort draußen, die ihn in die Nebel beförderte. Selbst dann, wenn er das schemenhaft Konturlose nur in den Augenwinkeln wahrnahm, wirkte es wie ein Sog, dem er sich nicht entziehen konnte. Die Beobachtung, dass dies besonders schnell geschah, wenn an bedeckten Tagen Wind und Regen nur noch als grünblauer Schleier an ihm vorüberwischten, beunruhigte ihn zunehmend. Der Sommer würde zwangsläufig von dunklen Herbst- und Wintertagen abgelöst werden. Allein der Gedanke daran verstärkte sein Gefühl, den Nebeln wieder, wie damals als Kind, ohnmächtig ausgeliefert zu sein.
Dass er wegen seiner anhaltenden Wahrnehmung von Enge und Bedrängnis seinen Job verlieren könnte, wurde zunehmend bedrohlicher für Lennart. Während er verzweifelt nach einer Lösung suchte, erinnerte er sich erneut an seine Vision und seinen Traum. Mit ihnen hatte es in jenen kalten Wochen des Jahresanfangs begonnen. Inständig hoffte er weiter, dass sie immer noch etwas für ihn bereithielten, das zu Veränderungen führte. Veränderungen, die ihm auch bei seiner Arbeit helfen konnten. Allein die Tatsache, sich wieder in die fantastischen Bilder und Vorstellungen vertiefen zu können, machte ihn zuversichtlich. Seine Vision hatte ihm doch etwas gebracht, was er jetzt dringend brauchte. Ein Zutrauen, das er etwas gänzlich Fremdes, Neues, etwas für sich bis dato Undenkbares tun konnte. Mit seinen Erinnerungen stellten sich auch erneut seine hoffnungsvollen Empfindungen ein. Und mit ihnen sah sich Lennart wieder selbst mit seinem Stenz auf seiner Walz. Er sah sich, auch wenn er kein echter Zunftbruder mit starken Muskeln war, wie er einst mit Perlmuttknöpfen an seinen Jackettärmeln zurückkehren würde. Er würde irgendwann etwas überwinden und erreichen, irgendwann.
… Und was ich dazu brauche, habe ich bereits kennengelernt in meiner Vision und in meinem Traum. ...
In jenem Traum in jener Februarnacht hatte er seinen Stenz aus seiner Vision als Messer erkannt. Er hatte es zwar dort auch noch nicht sehen können, aber dafür deutlich gespürt, in seiner Hand fühlen können. Lennart hoffte darauf, dass sich für ihn mit seiner Vision und seinem Traum, die erneut in ihm auflebten, etwas zum Besseren wendete. Parallel zu seiner Verzweiflung über seine tägliche Arbeit steigerte sich auch seine Faszination für jene geheimnisvolle Klinge. So zäh, wie sich das beginnende Jahr im März und April noch an die winterliche Kälte klammerte, entstand auch in Lennart nur langsam der Wille, selbst etwas zu tun. Vor allem wünschte er sich nicht nur ein klareres Bild. Er wollte herausfinden, ob es so ein Messer auch wirklich gab, und dann sehen, was das mit ihm in der Realität machte oder ob es etwas machte. Anderes Reales außer Vorstellungen, Empfindungen und Traumbilder hatte er jedoch bisher noch nicht gefunden. Als er ein paar Tage vor Ostern mit einer gezielten Suche im Internet begann, konnte er noch keine Veränderung spüren, aber dafür fühlte es sich richtig an, etwas zu tun. Diese vitalisierende Wirkung seiner aktiven Suche ließ ihn ahnen, dass er auf dem richtigen Weg war. Irgendwann würde er vielleicht dieses Messer auch ganz real in der Hand halten. Bei seiner Recherche im Netz wurde Lennart schnell klar, dass dann nur bestimmte Messertypen in Betracht kamen. Die lang geschwungene Klinge entsprach Messern, die zum Beispiel zu Standardausrüstungen professioneller Messersets von Köchen und Fleischern gehörten. Entsprechende Werkzeuge mit Holzgriffen jedoch waren eher Kandidaten für Angler und Outdoorfreaks. Lennart blieb sich unschlüssig, wie er weiter vorgehen sollte, und entschied sich deshalb für den Besuch eines Fachgeschäfts. Er glaubte, dort am ehesten so ein Messer zu finden, ja, zu entdecken, und vor allem in die Hand nehmen zu können.
Es wütete immer noch ein zäher Frost in der Hansestadt, als Lennart an diesem Gründonnerstag das Geschäft in der Feldstraße betrat. Schon den Wechsel aus der nicht enden wollenden Kälte in die Wärme des großflächigen Ladens empfand er als besonders angenehm. Die vielen hochwertigen Schneidewerkzeuge aus geschliffenem Edelstahl, die ihn plötzlich umgaben, schienen auch körperlich auf ihn zu wirken. Lennart empfand ihren Anblick wie ein mystisches Vorspiel auf seiner Suche. Im Angesicht glänzender und scharfer Klingen, die um ihn herum ausgestellt waren, überfluteten ihn zugleich innere Bilder, blutige Bilder. Wie ein warmer Regen umspülten ihn Ideen und Vorstellungen neuer und unvorstellbarer Dinge und Taten, die zu tun er sich vorher niemals zugestanden hätte. Das viele Blut, das er dabei in seinen inneren Filmen sah, konnte er plötzlich riechen. Es brachte sein Herz wieder zum Rasen.
… Denn rieche ich Blut, rast mein Herz: rast mein Herz, rieche ich Blut. Scheiße, als wenn ich nicht schon aufgeregt genug wäre. ...
Diese Flut äußerer und innerer Bilder empfand Lennart wie eine lang verschollene Sammlung, wie einen wiederentdeckten Fundus in ihm selbst, aus dem er aber erst seit Kurzem wieder schöpfen konnte. Angesichts dieser Messer- und Klingenwelt schien alles in ihm aktiviert und intensiv in Aufruhr versetzt. Ein Teil von ihm fühlte sich im Bann und umnebelt, und ein anderer ihm bisher unbekannter Teil erwachte. Es hatte schon beim Betreten des Geschäfts begonnen. Die Zeit schien sich wieder zu teilen, wie damals in seinem Traum, auf dem Bahnsteig Sternschanze.
Lennart war sich sicher, sie singen zu hören, die Klingen, all die vielen Klingen, und wusste doch, dass es nicht wahr sein konnte. So etwa stellte er sich den betörenden Gesang der Sirenen vor, die Odysseus gehört haben mochte, als sie ihn lockten, bevor er an den rettenden Mast gebunden wurde. Dem griechischen Superhelden gleich fühlte er sich wie angelockt, aber auch wie vernebelt. Er spürte, er war am richtigen Ort. Vielleicht musste auch ihn jemand an den Mast binden, wenn er sein Messer hier fand und es ihn verführte. Diese Vorstellung gelang ihm ganz leicht - und sie gefiel ihm gut. Klar zu denken jedoch schien mit jedem weiteren Schritt in diese faszinierende Welt hinein schwieriger zu werden. Was würde ihn hier noch erwarten, wenn es schon so begann? Im hinteren Teil des großflächigen Fachgeschäftes sah und hörte Lennart, wie ein Verkäufer mit jemandem sprach und sein Beratungsgespräch offensichtlich gerade beendete. Es schien nur diesen einen Verkäufer zu geben, denn dieser kam zielstrebig auf ihn zu, während der Kunde den Laden verließ. Lennart wäre gerne noch für sich geblieben. Nur unter Mühen reagierte er auf die freundliche Begrüßung. Er fürchtete, dass seine kaum noch vorhandene Konzentration nicht ausreichen würde, um dem Mann zuzuhören. Gezielt fragte er deshalb nach einer Auswahl von Messern mit langen Klingen und Holzgriffen, um andere Aspekte im Vorhinein abzuwenden. Als ihn der Fachverkäufer in eine andere Ecke des Ladens führte, schlug es ihn beim Anblick einer Vitrinenauslage in den Bann. - Unter Glas lagen verschiedene Modelle von Lachs-, Schinken-, Fisch- und Filetiermessern direkt vor ihm aufgereiht. Er war sich plötzlich sicher, dass er dort sein Messer aus dem Traum liegen sah. Der aufmerksame Verkäufer nahm wahr, wie er ein bestimmtes Messer fokussierte. Unfähig, etwas zu sagen, zeigte Lennart darauf und nickte dem Mann stattdessen freundlich zu. Dieser verstand und akzeptierte die Geste, wollte es sich aber auch nicht nehmen lassen, sein Wissen zum gewünschten Messer weiterzugeben, während er es aus der Vitrine herausholte: »Das ist ein finnisches Filetiermesser mit lang und dünn ausgeschliffener Klinge, dreiundzwanzig Zentimeter, und mit einem hellen Holzgriff, sehr schön. Liegt gut in der Hand. Wird deshalb auch oft von Köchen bevorzugt, obwohl es eigentlich ein Anglermesser ist. Es wird Ihnen leicht vorkommen, nehmen Sie mal.«
Seinen Impuls, dem Mann noch während er redete das Messer aus der Hand zu reißen und an sich zu nehmen, vermochte Lennart nur unter Mühe zu unterdrücken. Er hörte dessen Ausführungen deshalb nur zum Schein bis zum Ende zu. Selbst diese wenigen Sekunden, die er warten musste, waren kaum für ihn zu ertragen. Schließlich gab der Verkäufer es ihm in die Hand. - Sekunden konnten Stunden sein! - Ab dem Moment, in dem er das Messer berührte, hörte er nicht mehr, worüber der Verkäufer redete. Er hatte sein Messer endlich gefunden, er spürte es ganz real und konnte es kaum fassen. Es fühlte sich genauso an wie in seinem Traum! Die Faszination über das Messer an sich und dieses mystische Wiedererkennen paralysierten ihn. Unfähig, anderes um ihn herum wahrzunehmen, umfasste Lennart den hölzernen Griff mit seiner Rechten und sah es glücklich an. - Beschwingt durch die Berührung katapultierte es ihn im Geist durch die Zeiten. Wieder schien er im kalten November auf dem Bahnsteig Sternschanze zu stehen. Und wieder hielt er das noch blutige Messer in der Hand und sah der abfahrenden Bahn nach, in der es auf sonderbare Weise Februar geblieben war. Einerseits fand er sich in jenem eindrucksvollen Traum zurück, als hätte er nie aufgehört ihn zu träumen, und andererseits war er sich bewusst darüber, an diesem letzten Tag vor Ostern in diesem Laden zu stehen. Obschon er genau erfasste, wo er sich befand, kam es Lennart dennoch so vor, als erlebe er diesmal parallel noch eine dritte Realität. Einzig die anhaltende Kälte verband die Zeiten vom November, über den Februar bis in diesen gegenwärtigen noch so winterlichen April hinein.
Lennart vermochte nicht einzuschätzen, wie lange diese verwirrende Parallelität der Zeiten gedauert hatte. Er war weg gewesen, aber diesmal erschien es ihm anders, ganz anders. Erleichtert registrierte er, dass weder Nebel noch Vergessen oder Dunkelheit seine Sinne betörten, die ihn damals so arg mitgenommen hatten. Während er sich noch fragte, wie ihn der Verkäufer wohl wahrnahm, glaubte er den betörenden Gesang der beiden Klingen unaufhörlich singen zu hören. Jetzt hätte er gerne jemanden gehabt, der ihn an seinen schützenden Mast band, um ihn wieder ganz mit der Realität zu vereinen. »Entspricht das Ihren Vorstellungen?«
Lennart hörte den Mann, der in keiner Weise von ihm irritiert zu sein schien, auch wenn er das selbst nicht recht glauben konnte. Den Verkäufer, der ihn mit dieser Frage ansprach, nahm er nur wie aus der Ferne wahr, und sich selbst empfand er weiterhin, als sei er nicht anwesend. Alles, einfach alles, rückte in den Hintergrund vor dieser ihn überwältigenden Erkenntnis, dass er tatsächlich bei seinem Messer aus seiner Vision und seinem Traum angekommen war. Der anschmiegsame Holzgriff und das leichte, doch spürbare Gewicht der dünnen und so stabil wirkenden Klinge lagen allzu vertraut in seiner Hand. Während die Worte des Verkäufers weiterhin an ihm abperlten, sogen seine Sinne begierig auf, was sie vom Messer wahrnehmen konnten: »Knochen sind für dieses Messer kein Hindernis. Dieses Messer ist dafür gemacht, sich dem Verlauf von Knochen und Gräten beim Filetieren anzupassen. Sie werden Ihre Freude damit haben. Viele Ihrer Berufskollegen arbeiten zusätzlich mit diesem finnischen Fabrikat, obwohl es eigentlich für den Outdoorbereich gemacht wurde.«
Lennart schwieg und wog das Messer lange in seiner Hand. Der freundliche Verkäufer deutete sein Verhalten als Unschlüssigkeit und bot ihm daraufhin noch weitere Messermodelle von anderen Fabrikaten an, da diese ähnliche Merkmale aufwiesen: »Darf ich Ihnen noch ein paar Alternativen zeigen?«
Lennart aber vermochte ihm kaum noch zuzuhören. Wieder fühlte er sich wie Odysseus, doch überraschender Weise sah er sich diesmal festgebunden am Mast seines eigenen Schiffes, nur was war sein eigenes Schiff? Deutlich spürte er die Andersartigkeit seines Zustandes. Es schien ihm eine ganz neue und sanftere Form des Abgleitens zu sein, bei der er nicht komplett aus seiner gegenwärtigen Realität herausgeholt wurde. Obwohl Lennart spürte, wie er in dieser ungewohnt leichten Trance verblieb, fürchtete er dennoch, vor diesem Mann die Kontrolle zu verlieren und gänzlich abzugleiten. Innerlich mit seinem Zustand kämpfend, suchte er nach einer schnellen Möglichkeit, das Gespräch zu beenden: »Das nehme ich erst mal. Was soll es kosten? Ich würde jetzt gerne los!«
Den Preis, den der Mann ihm nannte, vernahm Lennart nicht. Erst am Kassentresen sah er flüchtig auf den Beleg. Der Kaufpreis deckte sich mit dem, was er bereits aus seinen Recherchen wusste. Gleichgültig registrierte er den im Vergleich zu dem im Netz leicht überhöhten Ladenpreis. Lennart hoffte lediglich, dass dem Verkäufer seine besondere Aufmerksamkeit für dieses eine Filetiermesser nicht aufgefallen war und dass ihm die Situation nicht allzu schräg vorkam. Aufgewühlt und beseelt verließ er wenige Minuten später das Fachgeschäft. Als er mit der dickwandigen Plastiktüte und dem sorgfältig verpackten Filetiermesser auf die Straße trat, umhüllte ihn sofort frostkalte Luft. Dennoch half sie ihm nicht, seine ungewöhnliche Benommenheit abzuschütteln. Endlich war er mit sich allein. Lennart begann loszugehen. Plötzlich erfüllte ihn das überwältigende Gefühl, mit seinem Messer eins geworden zu sein, und eine beglückende Entspannung keimte in ihm auf. Mit dem Empfinden, sich auch zukünftig in verschiedenen Welten und Zeiten zu befinden, wechselte er an der Ampel Marktstraße in einem Tross von Menschen auf die andere Straßenseite. Es erschien ihm, als schwebe er - immer noch benommen - vom Straßenniveau über den Treppenabgang zur U-Bahn-Station Feldstraße hinunter. Wie ferngesteuert und doch wach absolvierte er die Etappen seines Rückweges bis Schlump, wechselte von der U3 in die U2 Richtung Niendorf-Nord und nahm für den Rest der Strecke den Bus. Um an der Haltestelle Hagenbecks Tierpark den abseits davon liegenden Busbahnhof zu erreichen, wählte er, so wie er es immer tat, die Unterführung. Erst hier, unterhalb der stark befahrenen, beidseits mehrspurigen Koppelstraße fiel seine neue Art der Benommenheit, seine leichte Trance, wieder von ihm ab.
... Was war das? Ich bin weg gewesen, aber nicht abgeglitten! Hat mein Messer das bewirkt? ...
Mit der einsetzenden Erkenntnis spürte er nicht nur das Gewicht der Plastiktüte in seiner Rechten, ihn erfüllte plötzlich auch eine nie gekannte Vorfreude. Als er den 281er Richtung Krupunder bestieg, der Bus der ihn nach Eidelstedt zurückbringen würde, empfand Lennart sich durch sein Messer innerlich wie neu aufgerichtet und gewappnet. Einer spontanen Eingebung folgend gab er seinem Messer den Namen Loki. Nach Loki, dem listenreichen, geheimnisvollen Blutsbruder des Göttervaters Odin, der den sich anbahnenden Untergang der nordischen Götterwelt aktiv einleitete. Gerade weil ihm diese Rolle in der germanischen Mythologie zukam, erschien Lennart dieser Name wie gemacht für sein neues Messer. Loki hatte sich erfolgreich selbst befreit, indem er aus dem Schatten seines mächtigen Bruders herausgetreten war. Mit seinem facettenreichen Charakter und seinen vielfältigen Eigenschaften hatte er es vollbracht, wenn auch auf seine ihm eigene perfide Art, einem Gott zu trotzen. Ab jenem Moment war sein Loki für Lennart nicht mehr nur ein Messer, das er visioniert, erträumt, gesucht, gefunden und schließlich gekauft hatte. Er empfand dieses Stück aus Stahl und Holz wie jemanden, den er lange erwartet hatte, wie eine Person, die nun endlich bei ihm angekommen war.
Eine weitere überraschende Wirkung setzte gegen Abend des gleichen Tages ein. Besonders diese Begebenheit ließ Lennart sein real gewordenes Messer geradezu mächtig erscheinen. Er bemerkte die Veränderung, als er Loki nochmals in seinen Händen hielt und die abendliche Stille in seiner Wohnung genoss. Versonnen sah er auf das helle Holz des Griffs und nahm den Geruch der ledernen Messerscheide in sich auf. In der Ruhe dieser Minuten wurde Lennart bewusst, was sich mit Lokis Ankunft zusätzlich verändert hatte. Er bemerkte diese positive, schon einmal erlebte Änderung erneut!
Seine bislang latent wirkenden Schmerzen waren weg! Das war die besondere Kraft, die für niemanden sichtbar erst durch Loki geschah, so jedenfalls glaubte Lennart. Diese Schmerzen, die ihn seine gesamte Kinder- und Jugendzeit hindurch traktiert hatten, waren plötzlich fort. Er konnte sich selbst nicht erklären, wie Loki das machte, aber diese tägliche Marter stechender, brennender Schmerzen in Händen und Füßen endeten abrupt an jenem Abend des Tages, an dem er zu Loki gefunden hatte. - Die Erleichterung darüber ließ ihn plötzlich und lange weinen, etwas, das er nur sehr selten getan hatte, weil seine Mutter es verabscheut hatte. Aber nicht nur Paula, die ihm das Weinen immer untersagt hatte, war fort. Endlich waren es auch seine Dauerschmerzen. Schmerzfreiheit kam Lennart einer wundersamen Heilung gleich, denn sie bewirkte eine weitere Veränderung, die er an diesem Abend das erste Mal empfand.
… Bodo, ich habe dir etwas zu sagen: Ich kann spüren, was ich noch nie gespürt habe: Die Schmerzen, die verfluchten, sie sind verschwunden, aber da ist auch noch etwas Neues, Fremdes. Bodo, du bist nicht nur mein Vater, du bist auch der Vater meiner Schmerzen. Sie quälten mich bis heute, obwohl du schon lange aufgehört hast, mit mir deine verfluchten Vaterspiele zu spielen. Sie sind es, die Folgen deiner Quälereien, die mich bis heute marterten, bis heute! Diese Dauerschmerzen blieben in mir, auch noch als ich von dir ging, du teuflischer Vater! Ich habe keine Ahnung, wie mein Messer das gemacht hat, aber so wie es aussieht, hat es mich von ihnen befreit. Und Loki hat mir noch etwas anderes deutlich gemacht: Eine Gewissheit, nein, es ist mehr eine Zuversicht! - Ich kann spüren, dass ich dir irgendwann gegenübertreten werde, Vater, du Verfluchter, irgendwann! Ich kann unsere Begegnung geradezu spüren! …
Loki erschien ihm an diesem Abend vor Karfreitag wie jemand, der ihn kannte, schon bevor er ihn kennenlernte. Einer, der ihn verstand und deshalb wusste, was er brauchte. Loki vermochte ihm offensichtlich nicht nur die Schmerzen zu nehmen, er gab Lennart zudem die Gewissheit, sich wehren zu können. Loki führte ihm eine bis dahin unvorstellbare Option vor Augen. So wie ein Befreier ein viel zu lange besetztes Land zurückeroberte, entstanden in Lennart plötzlich befreiend neue und bereits bekannte Bilder. Wie ein quirliger Bergbach zogen sie in seiner Vorstellung vorüber. Diejenigen, die er schon kannte, schienen jetzt noch intensiver, nachhaltiger und realer zu sein. Sie waren ungewöhnlich, teils schockierend, teils blutig. In jeder Szene war Loki dabei: scharf, präzise und tödlich; überwältigend lebendig, wie schon in seinem sonderbaren Traum, als er die alte Frau in der S-Bahn erstach. Wenn dies auch nur träumend geschehen war, so hatte er dort schon Anfang des Jahres gespürt, dass er etwas Fremdes, Neues und Unvorstellbares irgendwann auch würde tun können. Aber erst in diesem Moment glaubte er es auch. Lennart empfand, nicht mehr allein zu sein. Er hatte das Gefühl, einen wahren Freund gefunden zu haben, mit dem er alles tun konnte.
Durch das Gefühl der Verbundenheit mit Loki entstand in Lennart der Wunsch, seinen neuen Freund ständig, selbst wenn er hinausging, mit sich führen zu können. Er wollte an keinem Ort mehr ohne diese Gefühle von Sicherheit und Gewissheit sein, die nur Loki ihm zu geben vermochte. Wie das geschehen sollte, hatte ihm bereits jener Traum gezeigt, in dem er es hatte spüren können und er Loki bereits am Körper trug. Was ihm für die Umsetzung noch fehlte, war die technische Möglichkeit, um ihn genau wie in jenem Traum ständig bei sich zu tragen. Sich ein Holster über das Internet zu bestellen, wäre kein Problem gewesen, aber keines sagte ihm zu. Er wählte schließlich einen anderen Weg. Über telefonische Voranfragen bei verschiedenen Waffenläden in Hamburg wurde er schließlich in Osdorf fündig. Dort bot ihm bei Waffen-Kalkhoff ein Herr Kesselmann ein leicht beschädigtes Schulterholster für längere Messer an. Lennart wusste, dass bei diesem handelsüblichen Holster die Scheide kopfüber mit der Öffnung nach unten positioniert war, und fürchtete daher, er könne Loki ungewollt verlieren. Niemals wollte er riskieren, seinen neu gewonnenen Freund und Begleiter - im schlimmsten Fall ohne dass er es bemerkte, - auf diese Art zu verlieren. Ungeachtet dieser Nachteile wollte er trotzdem einen Blick auf das Holster werfen. Als er im Laden dem untersetzten und etwas mürrisch wirkenden Händler gegenüberstand und sich die Mängel bewahrheiteten, fasste Lennart einen Entschluss. Er kaufte es mit dem festen Vorsatz, es nach seinen eigenen Vorstellungen umzubauen. Zwar verfügte er über keinerlei Erfahrung in Lederarbeiten, war sich jedoch seltsamerweise sicher, er werde das irgendwie hinbekommen. Und so kam es auch. Damit sein Freund nicht aus dem Holster fallen konnte, nähte er es entsprechend um, legte es sich um die Schulter, zog seinen graubraunen Wildlederblouson an und testete vor dem Spiegel, ob Loki fremden Augen verborgen blieb. Diese Lederjacke, die er sich von seinem ersten richtigen Gehalt gekauft hatte, war ideal, wie er fand. Sie hatte leider kein wintertaugliches Futter, bauschte dafür jedoch leicht auf und verbarg dadurch seinen Freund, auch dann, wenn er sich bewegte, sogar wenn er die Arme hob. Für das Umziehen auf der Arbeit in Eimsbüttel entschied er, sich vor Beginn und nach Dienstschluss auf dem WC einzuschließen, damit niemand sah, wie er das Halfter an- oder ablegte. Und auch in seinem verschlossenen Spint blieb Loki in seinem dort stets geschlossenen Rucksack jedermann verborgen.
Schon seit Anfang Mai war Hendrik Hamann die anhaltende Anspannung seines jungen Mitarbeiters aufgefallen. Als Filialleiter und Chef der Ideafiliale in Eimsbüttel deutete er sie als Erschöpfung oder Überarbeitung, ohne zu verstehen, warum so ein junger Kerl in einen derartigen Zustand verfiel. In der Hoffnung, dass sich sein ansonsten zuverlässiger Mitarbeiter wieder fing, entschied er kurzerhand, ihm ausnahmsweise Ende Mai ein verlängertes Wochenende freizugeben. Ohne Vorrede und ohne ihn zu Wort kommen zu lassen, verordnete er Lennart barsch die arbeitsfreien Tage. Zu mehr als diesem Zeichen der Fürsorge war er nicht bereit, da er keine weitere Zeit opfern wollte, um mit Lennart zu sprechen. Hamann blieb im Glauben, seinem Angestellten damit etwas Gutes getan zu haben. Lennart empfand dieses Privileg jedoch nicht als Hilfe. Ganz im Gegenteil: Er kam nach dieser Ansage seines Chefs einfach nicht mehr zur Ruhe.
… Hamann, wenn du wüsstest. Du begreifst ja nicht einmal im Ansatz, wie das für mich ist. Erklären kann ich dir auch nicht, dass ich die Kunden nicht mehr ertrage. Das macht mich irre. Aber allein zu Hause zu hocken, tagelang, das ist noch viel schlimmer. Ich schlafe jetzt schon immer schlechter. Was soll erst werden, wenn ich drei Tage lang nicht zur Arbeit gehe? …
Seine angeordneten freien Tage, die als langes Wochenende bereits mit dem Freitag beginnen sollten, glaubte Lennart nicht aushalten zu können. Allein die Vorstellung, sich selbst drei Tage und Nächte ausgeliefert zu sein, empfand er als unangenehm, regelrecht bedrohlich. Einzig die Tatsache, dass in der Woche nach diesem unfreiwillig freien Wochenende in Hamburg