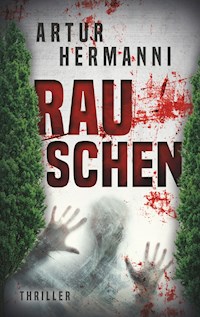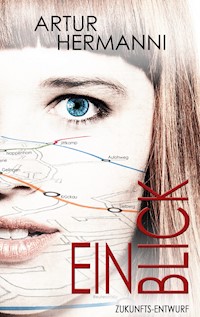
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stellen Sie sich vor sie lebten in 100 Jahren und schauten zurück. EINBLICK denkt konsequent durch und zu Ende, was möglich ist. Eine positive und sehr "konkrete Utopie" (nach Ernst Bloch), und wie sie der Transformations-Forscher Harald Welzer stereotyp anmahnt: "Der Welt mangelt es an Utopien". EINBLICK ist so eine Utopie. Ein Zukunftsentwurf der an dem Gegenwärtigen ansetzt und ein lebenswertes Morgen konkret entwirft. Mit EINBLICK wird die Kleinstadt Barmstedt im Herzen Schleswig-Holsteins zum globalen Repräsentanten. Sie wird zum Erklärungsmodell für die Entstehung von nachhaltigem Leben. Ein machbarer und positiver Zukunftsentwurf der sich fundiert und selbstbewusst dem Heer der Dystopien entgegenstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Diese neue Erfahrungswelt
spiegelt sich schlussendlich
darin wider,
dass eine neue Erzählung
über unser
gesellschaftliches Zusammenleben
installiert wird.“
(Jacob Wiesinger, Harald Welzer, Mentale Infrastrukturen, 22.03.2020)
Inhaltsverzeichnis
BUCH I: Wie werden wir sein?
1. Kapitel: Talente 2000 - 2008
2. Kapitel: Fusionen 2008
3. Kapitel: Kompressionen 2015
4. Kapitel: Visionen 2029
5. Kapitel: Idiotien 2029
BUCH II: Wie werden wir gewesen sein?
6. Kapitel: Utopien 2130
Vergessen & Erinnerung
Über den Autor
BUCH I
Wie werden wir sein?
1. Kapitel
Talente 2000 - 2008
Begabungen, die jemanden zu ungewöhnlichen Leistungen auf einem besonderen Gebiet befähigen.
Benni
„Tick, du bist!“ Benni hasste es, wenn er aus dem Nichts angestupst wurde. Was bei den anderen Kindern verlässlich zum Auftakt einer Spielsequenz wurde, nervte ihn. Für ihn waren sie meist nur laute und nie ruhende Wesen, die ihn in seinen Gedanken störten. Ihr spaßiges Treiben, ihr Trollen und Tollen, ihre Hektik und spontanen Aussprüche, all das blieb ihm fremd. Sie hielten ihn deshalb sicher für einen Langweiler und eine Spaßbremse, aber das war ihm egal. Wenn die stupsnasige Emma es bei ihm versuchte, war es am schlimmsten. Obwohl er sie von allen am liebsten mochte, wurde er trotzdem jedes Mal wütend. Heiß schoss es dann durch seine Hände, bis in die Fingerspitzen, doch er rührte sich nicht, das konnte er gut. Als drang dann plötzlich die ganze unruhige Horde, die ihn sonst nur umgab, gegen seinen Willen in ihn selbst hinein. Er hasste das, denn in solchen Momenten fühlte er sich ihnen ausgeliefert. Dieser lachenden und so überschäumend albern quietschenden Bande hatte er nichts entgegenzusetzen. Einer von ihnen zu werden, ein Teil dieser dahinstobenden Chaoten, er hatte das oft genug versucht, war ihm nie gelungen. Und schließlich ergab es auch keinen großen Unterschied. Das zu begreifen, machte es ihm leichter, damit umzugehen, und zu lernen, esschlicht auszuhalten. Denn ob eine Spielaufforderung von seinen Ablehnungen quittiert wurde oder nicht, spielte schon lange keine Rolle mehr. Sie kannten seine und er die vielen Varianten ihrer Reaktionen. Ihn aufzufordern und zu wissen, dass er Spielen eigentlich immer doof fand, war schon lange selbst zu einem Spiel geworden. Und sie alle hatten ihren Text. Sie nörgelten, warteten mit gespieltem Weinen oder Rummeckern auf, um ihn vielleicht unerwarteter Weise doch irgendwann zum Mitspielen zu gewinnen. Emma genoss ihr Offerten-Spiel besonders. Scheinbar neugierig und so unschuldig schaute sie ihn mit ihren klaren blauen Augen an. Ungeachtet des Schmerzes, der dabei durch seine Glieder schoss, fegte sie damit jeden Unmut ihn ihm hinweg. Wenn sie dann auch noch ein Lied vor sich hin summend, mit einem verträumten Blick und einer gekonnten Drehung um sich selbst ihr Spiel beendete, schaffte sie es sogar, ihm ein Lächeln abzugewinnen. Und bevor sie dann, nur einen Augenaufschlag später, schon wieder abtauchte in das wilde Treiben der unruhigen Gruppe, winkte sie ihm noch einmal zu wie eine Diva, wenn sie die Bühne verließ. Er fand es toll, wenn sie ihre Ballettfiguren tanzte. Es faszinierte ihn noch mal mehr, als sie ihm davon erzählte, wie sie Ballettunterricht im Auhof bekam, und dass sie einmal tanzen können möchte wie Iris, ihre Lehrerin. Allein sie schaffte es auf diese tänzelnde Weise, ihn manchmal sogar zu völlig sinnlosen Antworten auf alberne Fragen zu animieren. Wenn sie begann mit: „Herr Benni, wollen Sie nicht mit mir spielen?“, wusste er schon, dass es nicht um eine echte Antwort ging, sondern um eine möglichst alberne oder vermeintlich lustige Antwort, wie: „Fang mich doch, Eierloch!“ Oder: „Maus, komm raus, saus dich aus!“ Er mochte Emma, und Jannes war sein Freund, aber so sein wie die beiden, das ging trotzdem nicht. Dafür konnte er andere Dinge.
Die meisten davon lernte er von Herrn Jarl, der auch nichts dagegen hatte, wenn man ihn mal Hartwig nannte oder „du“ sagte. Frau Sengels Vornamen kannten die Kinder zwar, sie hieß Nicole, und sie schimpfte auch nicht, wenn man sie mal duzte, aber es war für jedes Kind spürbar, dass sie das überhaupt nicht mochte. Deshalb geschah es lediglich selten und dann aus Versehen. Herr Jarl war der ältere der beiden Erwachsenen, die sie im Waldkindergarten betreuten. Benni mochte ihn vom ersten Tag an. Frau Sengel war nett, aber so richtig mögen konnte er sie nicht. Bei ihr geschah eigentlich alles mit viel Gerede. Hartwig war immer so ruhig und schien keine Worte zu brauchen oder nur ganz wenige, wofür seine junge Kollegin sehr viele an sie als Kinder richtete. Die Teile des Tages, in denen sie etwas als Gruppe gemeinsam machten, übernahm fast ausnahmslos Frau Sengel. Auch das war ein Grund, warum bei Benni das Gefühl präsent war, dass Frau Sengel fast immer redete und zwar laut. Selbst wenn sie freies Spielen hatten und die ganze Gruppe auf ihren Waldplatz verteilt war, brauchte man nur horchen, wenn man wissen wollte, wo Frau Sengel gerade war. Ihre Stimme zu überhören, war gar nicht möglich. Hartwig dagegen, wie ihn die Kinder unter sich immer nannten, war einfach da. Benni konnte sich nicht entsinnen, jemals nach ihm Ausschau gehalten oder nicht gewusst zu haben, wo er sich gerade aufhielt.
Gerade in diesen freien Spielzeiten konnte man mit Hartwig tolle Sachen erleben und lernen. Er zeigte es, indem er es selber machte. Wenn er dann sprach, war es meistens eine Frage oder er antwortete, weil eines der anderen Kinder etwas von ihm wissen wollte. Er baute oder bastelte mit allem, was man im Wald finden konnte. Ob es Rindenstücke, Moos, Stöcke, Steine, Äste oder Blätter waren, Hartwig kannte unendlich viele Dinge, die man daraus bauen oder was man mit ihnen spielen konnte. Das waren die Zeiten, die Benni liebte. Dazu kamen sie mit ihrem Betreuer anfänglich unter einem Baum oder neben einem Baumstumpf zusammen. Jeder, der Lust dazu hatte, was er machte, kam einfach hinzu. Manchmal blieb Hartwig bei ihnen und manchmal ging er weg, aber das hat dann niemanden gestört. Weil er auf diese Art mal bei der einen Gruppe oder einer anderen oder bei einem einzelnen Kind verweilte, war er für alle irgendwie immer da. So begann er mit ihnen die bekannten oder neuen Spiele, und fast immer war es dann so, dass niemand mehr aufhörte damit, ganz gleich ob er noch dabei war oder nicht.
Was Benni an Hartwig am meisten beeindruckte, verwunderte ihn zugleich. Dieser Betreuer war der einzige Erwachsene, den er kannte, der wie er das Rauschen der Bäume nicht nur hörte, sondern sich auch Zeit dafür nahm. Das waren die Momente, wenn er sah, wie Hartwig irgendwo kurz stehenblieb, die Augen schloss und einfach horchte, wie der Wald sang.
Mit Worten oder gemeinsamen Spielen war Benni das nicht gelungen. Doch er entdeckte für sich eine Methode, damit sie zu ihm kamen, wenn er es wollte. Rasselnd klang es aus seiner Jackentasche heraus, wenn er rhythmisch von außen auf seinen Anorak klopfte. Er wusste, darauf reagierten nicht nur Jannes und Emma sofort. Gleich mehrere Kinder verharrten mitten im Spiel, drehten synchron ihre Köpfe in seine Richtung, um dann wie eingeübt aus ihren ganz verschiedenen Positionen sich auf ihn zuzubewegen. In solchen Momenten, und diese liebte er, kam er sich vor wie ein Zauberer, und zwar so einer wie er immer schon sein wollte. Es war sogar leicht, die Dinge, die er dazu brauchte, zu besorgen. Seine Großeltern besuchten ihn regelmäßig. An diesen Samstagnachmittagen, an denen sein Papa entweder auf Montage war oder zum Sport ging, versorgten sie ihn verlässlich. Er brauchte nur ein paar Mal gezielt darum zu bitten, was er sich wünschte. Dass er es tat, war neu. Bis dahin waren sie zu Recht der Auffassung gewesen, dass ihr einziger Enkel keine Süßigkeiten mochte oder zumindest selten welche aß. Dass er sie dennoch darum bat, damit überraschte er sie ganz offensichtlich. Bedenken seitens seiner Großeltern gab es jedenfalls keine. Besonders seiner Oma spürte er ab, wie gern sie seine Bitte zu erfüllen bereit war, fast so, als tat er ihr damit einen Gefallen. Selbst seine Mutter, die erkannte, wie er seine Großeltern zu Lieferanten machte, hielt sich heraus. Um Süßigkeiten zu bekommen, die er am besten gebrauchen konnte, bedankte er sich ausdrücklich nur noch für die Smarties, weil die Kinder aus der Gruppe diese am liebsten mochten. Es war leicht, für Nachschub zu sorgen. Ab und zu behauptete er dafür sogar gegenüber seiner Oma, sie würden ihm gut schmecken. In Wahrheit verstand er auch weiterhin nicht, wie man diese bunten Linsen mögen konnte. Oma-Lutzhorn musste sich doch etwas darüber gewundert haben, denn sie fragte sogar nach, ob er die Smarties auch wirklich gerne mochte und ob sie ihm bekommen würden. Er hatte nur nicken brauchen und sogar ergänzt, dass er Smarties am liebsten aus den kleinen Röhren mochte. Seitdem brachte sie ihm immer die Dreierpackung kleiner Röhrenschachteln Smarties mit. Die Größe war wichtig, weil eine große Röhrenschachtel, die seine Großmutter zuerst mitbrachte, nicht in seine Anoraktasche passte.
Mit den Smarties in der Jackentasche, und wenn er das Richtige tat, machten die anderen Kinder genau das, was er wollte. Ein bisschen blieb er darüber verwundert, weil das ja eigentlich auch für seine Großeltern galt. Durch die anderen Kinder, die so gerne Smarties aßen, änderte sich für ihn nichts an seiner Abneigung für Süßigkeiten. Auch wenn er ab und zu selbst einen Smartie aß, hatte ihm besonders Schokolade noch nie geschmeckt. Wenn er naschte, dann waren es Chips, alles andere interessierte ihn eigentlich nicht.
Alle Kinder aus der Gruppe freuten sich über seine süßen Mitbringsel, es gab nur ein Problem, Frau Sengel. Sie war mit Abstand die strengere der beiden Erwachsenen, die sie im Waldkindergarten betreuten. Herr Jarl war da ganz anders. Hartwig lächelte nur, wenn er es sah, was Benni zwischendurch heimlich verteilte. Bei Frau Sengel dagegen musste er sehr genau aufpassen, sie sah es gar nicht gern, wenn Kinder etwas anderes aßen und zu einer anderen Zeit, als während des gemeinsamen Frühstücks. Es war deshalb notwendig, sie vorher immer eine Weile aufmerksam zu beobachten, um einzuschätzen, wann er Süßigkeiten an die anderen Kinder weitergab, ohne dass sie es mitbekam. Ein paar Mal erwischte sie ihn und ermahnte ihn mit vielen Worten, die er sich nicht alle merken konnte. Hartwig sagte nichts dazu, wenn Frau Sengel schimpfte. Er schien dann immer eher amüsiert. Einmal nahm sie Benni sogar seine Naschies weg. Aber all das hinderte ihn nicht, denn er hatte keine Angst vor ihr. Irgendwann hatte er es schlicht drauf, wie er es machen musste.
Während einer seiner Verteilaktionen kam Benni eine Frage in den Sinn, die ihn fortan begleitete. Warum gab es Smarties in allen denkbaren Farben, nur nicht in Weiß? Es gab keine weißen Smarties, und dass, obwohl Weiß seine Lieblingsfarbe war. Alles fing immer direkt am Waldrand an der Wartehütte im Bornkamp an. Dort begannen die Tage, die Benni mit den anderen Kindern im Wald verbrachte, seitdem er drei Jahre alt geworden war. Sein Fahrrad stand fest angeschlossen am Metallbügel des Sammelplatzes, gleich vorne, direkt neben dem metallicblauen Mountainbike von Jannes. Auf dem zweiten Platz in der Reihe der Fahrzeuge, denn er war mittlerweile eines der ältesten Kinder in der Gruppe, ein Maxi. Er gehörte auch zu denen in der Gruppe, die schon seit ihrem ersten Jahr im Waldkindergarten mit dem Rad hierherkamen und nicht wie die meisten anderen Kinder anfänglich noch mit dem Laufrad. Als Maxi half er den Minis beim Einparken und Anschließen ihrer Laufräder. Etwas, was ihm besonders gut gefiel, weil er dann nicht mit den andern sprechen musste. Mehr noch als das Reden störten ihn laute Geräusche. Es waren nicht nur die anderen Kinder, sondern Autos, die Benny immer zu laut fand. Seine Ohren wurden oft schon auf dem morgendlichen Hinweg zum Wald schmerzhaft angefüllt mit dem Lärm der Straße.
Bennis Zuhause lag in der Heidkampstraße und gehörte, obwohl es kurz vor Barmstedt lag, noch zur Gemeinde Groß Offenseth-Aspern. Von dort führten ihre Wege immer erst über die Hauptstraße, jene viel befahrene Einfallstraße zwischen ihrem Dorf und Barmstedt. Weil Benni bei seinen ersten Versuchen als Zweijähriger die Landstraße nur Hautstraße zu nennen in der Lage war, blieb das seitdem in seiner kleinen Familie der Name für diese vielbefahrene Landstraße. Diese sogenannte Hautstraße wurde somit auch zu seinem täglichen Weg in den Kindergarten. Gemeinsam mit seiner Mutter bewältigte er die anderthalb Kilometer in den Kindergarten vom ersten Tag an auf seinem Puckyrad.
In diesen Jahren auf seinem Weg zum Wald hatte Benni auf seiner ersten morgendlichen Etappe an der viel befahrenen Landstraße immer zwei Begleiter: seine Mutter und den Schmerz. Die Geräusche vorbeirauschender Autos empfand Benni immer als viel zu laut. Erst wenn sie in den Bornkamp einbogen und dort an der Schrebergarten-Kolonie vorbeiradelten, wurde es leiser und das Ziehen in seinen Ohren etwas erträglicher. Auch auf dem letzten Streckenabschnitt, durch die Wohnsiedlung bis zum Sammelplatz am Waldeingang, quälten ihn besonders im Sommer so manches Mal noch andere Lärmquellen: unangenehme Motorengeräusche, die sich über das gesamte Wohngebiet vorm Wald ausbreiteten. Schon vom Bahnübergang im Bornkamp konnte Benni sie deutlich hören, besonders wenn es mehrere Geräte waren. Ihm erschienen sie dann wie Insekten-Monster. Summend, surrend und knatternde Ungetüme, die wie im Blutrausch über Blätter und Zweige herfielen, ohne sie aufzufressen. Auch noch Stunden später, wenn er mit den anderen Kindern mittags wieder aus dem Wald herauskam und er von seiner Mutter abgeholt wurde, lärmten sie ihm oft noch entgegen. Eine dröhnende Variante dieser Motorengeräusche setzte irgendwann unverhofft an kalten Herbsttagen ein, wenn sich die Gartenbesitzer nach und nach mit Laubpustern auf die schon gefallenen Blättermeere stürzten.
An solchen Tagen litt Benni besonders in den Minuten, in denen seine Mutter ihn brachte oder holte. Im Gegensatz zum wundersam stillen Voßlocher Gehölz kam es ihm vor, als werde dieser Lärm immer nur lauter je länger er ihn vernahm. Ungeduldig sehnte er sich dann einfach nur noch nach der tiefen Ruhe, die er aus diesem Forst kannte. Und dabei hatte sie anfangs unheimlich auf ihn gewirkt. Doch schon nach seinen ersten Tagen war der Wald zu seinem schönsten Wohlfühlort geworden. Immer war es die Ruhe, die er dort am meisten liebte, die tiefe Ruhe und das Rauschen dort drinnen. Sein siebter Geburtstag war jetzt genau eine Woche her. Er hatte sich noch gegrämt, weil sein Tag auf einen Samstag gefallen war, sodass er nicht im Wald mit den Kindern hatte feiern können. Als Geburtstags-Maxi hätte ihm das besonders gut gefallen, weil er dann ganz offiziell, ohne dass Frau Sengel meckern würde, Süßigkeiten verschenken durfte. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr, nach den Ferien würde er kein Maxi mehr sein, sondern ein Schulkind werden, eines von vielen, die gleich alt waren. So viele Tage waren gleich gewesen, doch an seinem letzten im Waldkindergarten schien Benni alles seltsam anders zu sein. Selbst der üblich schmerzende Straßenlärm wirkte verändert, irgendwie langsamer. Benni verstand es einfach nicht. Dann kam ihm plötzlich etwas in den Sinn. Seine Eltern hatten sich am Tag zuvor zum Abendbrot darüber unterhalten. Seine Mutter hatte nur gelacht über das, was sein Vater bewusst halblaut erzählt hatte. Von seinem Zimmer aus hätte er es nicht gehört. Nur seinen Namen hatte er verstehen können. Neugierig geworden hatte er sich im Flur noch mal heimlich bis an die Küche herangeschlichen, um alles gut hören zu können. Es ging um Freitag, den 13. Sein Vater hatte wohl schon oft erlebt, wie gerade an diesem Datum ungewöhnliche Dinge geschahen, er glaubte das nicht nur, er hatte es selbst erlebt, sogar mehrmals. Und der Anlass, dass die beiden darüber redeten, war Bennis letzter Tag in seinem Waldkindergarten, der auf den 13. Juli, einen Freitag, fiel. Das musste der Grund sein, warum auch ihm so manches komisch vorkam, was sonst?
Da war aber noch etwas anderes, was ihn schon wochenlang beschäftigte, ihm aber erst an diesem letzten Tag klar wurde. Der besonders trockene und heiße Hochsommer hatte alle Menschen mit einer mörderischen Hitze gemahnt, und dennoch brüllten alle Automotoren weiter und verbreiteten ihre Abgase, so wie sie es immer und unaufhörlich taten.
Sie müssen doch aufhören damit, sie sind doch der Grund dafür, warum die ganze Erde so warm wurde. So hatte Hartwig es ihnen erklärt. In den Abgasen war das CO2, das die Wärme festhielt auf der Erde, wie mit einem Mantel, der immer dicker wurde, nur dass die Welt nicht schwitzen konnte, sondern Fieber bekam. Und genauso wie es für Kinder wichtig war, das Fieber sich wieder senkte, um gesund zu werden, war es auch für die Erde und die Menschen lebenswichtig.
Auch an diesem Morgen, als Benni sich noch ein letztes Mal mit den Maxis und den tapsigen Minis der Waldparzelle im Innern des Voßlocher Gehölzes näherte, begrüßte ihn diese wundersame Stille. Dass war über die vier Jahre in seinem Kindergarten immer der schönste Moment für ihn: Der Wechsel vom Lärm in die Ruhe des rauschenden Waldes. Doch an diesem letzten Tag in seinem Wald war es plötzlich noch viel stiller um ihn her. Das Rauschen der Bäume dagegen übertönte alles! All die Blättermeere an diesem heißen Julitag sahen zudem seltsam anders aus, so als sei es bereits Herbst. Benni schwieg irritiert, während er mit Emma an der Hand in der kleinen Schar auf dem Gruppenplatz unter den Hohen Fichten eintraf. Trotz der nun lauter werdenden Kinder, die wie befreit ihre Taschen ablegten und zu ersten Spielmanövern auseinanderstobten, versuchte Benni immer noch zu verstehen. Auch an diesem letzten Tag empfand er die anderen als zu laut. Dennoch waren sie es, mit denen er seinen Wald all die Jahre erlebt hatte. Nur mit ihnen zusammen.
Wald, Wind, ich höre euch so gerne. Euer Rauschen hier drinnen ist so weich und trotzdem ein ganz klein bisschen kratzig, so dass es fast kitzelt, wenn ich es höre. Aber sagt, was passiert heute in meinen Ohren? Es ist anders an diesem Morgen. Wie macht ihr das nur, Wald, Wind? Ich weiß es doch, wie ihr all den Lärm verschluckt, der immer und überall dort draußen von irgendwelchen Motoren gemacht wird. Sobald wir hier drinnen sind, muss er still werden. Doch heute ist die Stille so tief und euer Rauschen so laut. Warum nur?
In diesem Moment dachte Benni an Pappeln. Er wusste, dass die Kronen dieser Baumart immer etwas lauter rauschten, als alle anderen Bäume, weil sie härtere Blätter hatten. Doch sie gab es hier nicht. Und besonders windig war es auch nicht. Dann verstand er plötzlich. Der ganze Wald rauschte lauter, weil alle Blätter viel trockener waren, und zwar alle Blätter an jedem Baum. Die Hitze hatte ihnen allen, jedem einzelnen Blatt, Wasser entzogen, und das machte sie härter und dadurch lauter. Es konnte nicht anders sein. Er bedauerte, wie sehr die Bäume Durst leiden mussten, sie taten ihm leid. War er denn der Einzige, der es bemerkte, und wer würde ihnen zu trinken geben? Und weil er sich sicher war, dass schon ein paar Wochen später niemand mehr unterscheiden können würde, was so viele Blätter so früh trocken und viele von ihnen sogar schon hatte welk werden und herniederfallen lassen, bedauerte er umso mehr. Traurigkeit erfasste ihn. Die Bäume litten, er spürte es doch, und dennoch sangen sie ihm ein Lebewohl.
Er würde viele seiner Freunde nicht wiedersehen. Emma blieb noch ein Jahr und Jannes würde zu seinem Vater nach Hamburg ziehen. Benni begriff, er hatte noch einen Freund, der ganz in der Nähe bei ihm bleiben würde: sein Wald.
Benni war der Erste, der sich an ihrem letzten gemeinsamen Tag im Wald seinen Rucksack aufschnallte und sich ganz von alleine aufstellte. Ungeduldig wartete er darauf, dass Frau Sengel das Zeichen zum Aufbruch gab. Die hochstehende Mittagssonne warf ihnen nur ganz kurze Schatten voraus. Eine drückende Stimmung schien sich über die Gruppe der nur zögerlich losmarschierenden Kinder zu legen. Benni dagegen erfasste eine freudige Aufregung, er brannte darauf, seiner Mutter von seinem Freund, dem Wald, zu erzählen. Auch während dieser letzten Minuten, in denen sie in den Lärm da draußen zurückkehrten, war alles irgendwie anders. Nur wenige und ganz ungewöhnlich gedämpfte Plappereien begleiteten sie auf ihrem vertrauten Weg hinaus.
Zunehmend nervös versuchte Benni es spontan Emma zu erzählen, vergeblich. Er konnte es gar nicht fassen und blieb ratlos. Ungläubig und enttäuscht nahm er hin, wie erst Emma und dann sein allerbester Freund, der vor ihm gehend die Doppelreihen der kleinen Gruppe anführte, nicht einmal reagierte, als er begann zu erzählen. Sie schienen nichts aufzunehmen, als könnten sie ihn nicht hören. Im Anblick des so vertrauten Bildes der sie erwartenden Eltern kam es Benni jedes Mal so vor, als winkten sie ihnen zum Abschied. Immer war es das blendende Sonnenlicht, aus dem sie hervortraten, dass ihre Eltern zwang, sich die Hände schützend vors Gesicht zu halten. Wie immer brach ihr Zweierverband schon im Anblick der Wartehütte auf. Emma und Jannes verfielen mit gleich mehreren Kindern ad hoc in ein letztes wildes Tickenspiel um die allseits offene Hütte herum.
Wieso wollt ihr lieber spielen, als zu erfahren, dass der Wald mein Freund bleibt?
Benni hätte es so gerne seinen beiden besten Freunden erzählt. Traurig begriff er, die Chance dafür war vertan. Im Tohuwabohu von Kindern, Erwachsenen, Worten, Gelärme und blendenden Sonnenstrahlen, die mit den Schatten unter den Bäumen zu tanzen schienen, schloss er sein Rad auf und schob sich damit aus dem Menschenknäuel vor der Hütte heraus. Er hatte nicht einmal mehr Lust sich zu verabschieden. Niemand hielt ihn auf. Schweigend und mit hängenden Schultern ging er langsam zum Vorplatz vorm Tennisplatz hinüber, wo seine Mutter mit ihrem Rad auf ihn wartete. Das hatte sie all die Jahre so gemacht. Auch sie mochte das Gewusel der Übergaben nicht.
Ein anderer Gedanke hellte seinen betrübten Geist etwas auf. Es war Freitag und das hieß Pizzatag. Doch vor der leckeren Pizza, die vermutlich schon vorbereitet und belegt zu Hause auf dem Herd wartete, würde er seiner Mutter von seinem neuen Freund erzählen. Sie hatten ja noch die gemeinsame Heimfahrt. Auf Höhe der Kleingartenkolonie am Bornkamp war dafür die beste Gelegenheit, bevor sie die Landstraße erreichten. Er wusste, wenn nicht gerade ein Auto vorbei wollte, konnte er dort ein Weilchen neben ihr her radeln. Wenigstens ihr würde er es heute erzählen. Wie gewünscht war gerade kein Verkehr auf dem Bornkamp. Auf Höhe des ersten Kleingartens brach es ungestüm aus ihm heraus:
„Der Wald ist mein Freund, Mama.“
„Ja, Schatz, und nach dem Sommer wirst du ein Schulkind werden, toll, ganz toll. Du, was soll ich dir gleich auf deine Pizza machen?“
Abermals konnte Benni nicht fassen, dass auch sie ihm gar nicht richtig zugehört hatte. Trotzig verweigerte er seiner Mutter die Antwort und schwieg, bis sie den Hofplatz ihres Grundstücks in der Heidkampstraße erreichten. In einem genervten Tonfall antwortete er seiner Mutter bewusst verspätet: „Pilze mit viel Käse“, während er sein Rad unter dem Carport platzierte und sich außerhalb ihrer Sichtweite auf die Bank hinter dem Haus zurückzog.
Tief enttäuscht war er sich in drei Sachen ganz sicher: Der Wald konnte jeden Lärm verschlucken, besonders wenn er durstig war. Der Wald war sein Freund und würde es für immer bleiben. Und es gab niemanden außer ihm, der diese schönen Dinge wissen wollte.
Eugenia
Schon als kleines Mädchen hatte sie es fasziniert, wie man die Räume der Menschen gestalten konnte, auch wenn diese anfangs nur aus Sandkastenspielen bestanden. Als ihre Spielkameradinnen nur noch mit Puppen spielen wollten, blieb sie bei den Jungen. Doch es waren nicht ihre wilden Fang- und Ballspiele, die ihr auch gut gefielen, die sie zum Bleiben drangen. Mit ihnen entdeckte sie die neuen Dimensionen, die Sandkästen in Fantasiewelten zu verwandeln vermochten. Der Spielplatz in der Siedlung, auf dem es jeder einzelne Grashalm schwer hatte zu existieren, wurde ein Kontinent zum Gestalten. Sandflächen wurden zu Wüsten, Neubau- oder Tagebauarealen, Steinsammlungen zu Steinbrüchen, Felsformationen oder Gebirgszügen, Baumstümpfe zu Hochplateaus oder futuristischen Hochhäusern. Selbst der spärliche und hart gelittene Grasbewuchs wurde nur immer wertvoller je seltener er noch zu bekommen war. Als unentdeckte Wälder, Dschungel oder Rückzugsgebiete für seltene Tiere fielen sie früher oder später der unvermeidlichen Rodung zur Holzgewinnung anheim.
Auch der heimische Garten wurde von ihr hartnäckig in gleicher Weise immer wieder überplant und gestaltet. Ihre Projekte, die akribisch über Wochen und Monate entstanden, war sie gewohnt, gegen ihren gärtnerisch eher konservativ agierenden Vater zu verteidigen. Die kreativen Werke, diese frühen städtebaulichen Weltkonzepte seiner Tochter zu unterbinden, fiel ihm schwer. Da auch nach unzähligen Aufforderungen keine Einsicht bei Eugenia zu erzielen war, forderte ihr Expansionsstreben ihn jedoch in größeren Abständen zum Handeln heraus. Wenn es Hermann Hausmann also mal wieder zu bunt wurde, vollzog er am Wochenende ein Tabularasa. Wenn auch nicht in der klassischen Nacht und seinen Nebeln, so doch in den frühen Morgenstunden, noch vor dem Frühstück, um Tatsachen zu schaffen, bevor seine Tochter als Letzte aufstand. Sowohl Eugenias unvermeidlicher Proteststurm über die erlittenen Zerstörungen ihrer Werke als auch die stoische Haltung ihres Vaters waren unvermeidlich. Doch der Preis für ihren Vater war hoch. Gescholten und verdammt musste er über Wochen ertragen, von seinem einzigen Kind mit Missachtung gestraft zu werden. Dennoch erkannte er die Berufung, die in seiner Tochter entstand, und war als Vater bereit, sie darin zu unterstützen. Ihr Dauerstreit um den Garten diente aus seiner Sicht durch ihre zahlreichen Gespräche der Vergeistigung ihrer Leidenschaft, Räume zu gestalten. Die sprachliche Verteidigung der hartnäckig besetzten Mutterböden machte sie schon im Alter von zehn Jahren zur glaubwürdigen Kämpferin für ökologisch nachhaltige Städtebaukonzepte. Eugenia sah sich dann selbst wie Johanna von Orléans, wobei ihr Vater die Rolle des französischen Königs Karl VII. übernahm, der sie schändlich verriet, indem er sich von ihr abwandte, obwohl er mit ihrer Hilfe König geworden war. Auch wenn ihre Pubertät dem kindlichen Spiel in Sand und Erde ein Ende setzte, blieb in Eugenia die Leidenschaft, Landschaften, Städte und Räume zu gestalten. In der Oberstufe ihres Gymnasiums bot man ihr lediglich das Fach Kunst, um schon in Teenagertagen ihre besondere Neigung und bereits umfangreiches Wissen zur Anwendung zu bringen. Die auf Kunstgeschichte fokussierten Lerninhalte waren inspirierend für Eugenia, mehr jedoch nicht. Nur die wenigen Projektarbeiten boten einen Rahmen, in dem sie ihr Talent ausleben konnte. Aber auch diese vermochten nicht ansatzweise ihren Hunger auf reales Gestalten zu stillen. Die Schule mit einem guten Abitur hinter sich zu lassen, um sich endlich in das Studium des Städtebaus stürzen zu können, kam für Eugenia einer geistigen Erlösung gleich.
Alma
Nur um diesen Moment an diesem späten Sommerabend noch ein letztes Mal bewusst zu spüren, wendete Alma sich von der Glasfront ab und trat vor die Tür ihres Büros. Es war dieses unvergleichliche Gefühl, das repräsentative Haupt einer Stadt zu sein, sein zu dürfen, genau dafür gewählt worden zu sein. Verlässlich schoss auch in diesem Augenblick das Dopamin in sie hinein und beschenkte sie mit dem vertrauten und erhebenden Gefühl von Stolz und Glück zugleich. Noch Minuten dieses Wohlgefühls auskostend, dort allein auf der vierten Etage des Rathauses stehend, erlaubte sie sich einen letzten Blick zum Abschied auf das Namensschild: Alma Mathiesen Bürgermeisterin. An dem Tag, an dem sie ihr Büro vor nunmehr acht Jahren, in Begleitung des Bürgervorstehers Harms, erstmals betreten hatte, war es die Aussicht auf den Marktplatz gewesen, die ihr am besten gefallen hatte. Heute, nach ihrer zweiten Amtsperiode, und das überraschte sie, war es die Entscheidung des Stadtparlaments. Es hatte doch alles so lange gebraucht, warum gelang es jetzt an ihrem letzten Tag? Schon in ihrem ersten Amtsjahr war es ihr, damals für undenkbar gehaltener, Vorschlag und entsprechender Antrag gewesen, diese neue Position im Bauamt zu schaffen. Dass die Fraktionen sich in völlig unüblicher Eintracht zu dieser Entscheidung hatten durchringen können, würde ihr ein Rätsel bleiben. Zu glauben, dass es ihr galt, quasi als Abschiedsgeschenk, weil sie mit dem heutigen Abend, nach ihrer letzten Stadtratssitzung, auch ihre Amtsgeschäfte in der Stadt niederlegte, wollte ihr nicht recht gelingen. Nein, diese Entscheidung hatte Gründe, die sie nicht kannte und vermutlich auch nicht mehr in Erfahrung bringen würde. Dass politische Entscheidungen so manches Mal eigene kuriose Wege gingen, war ihr in ihrer Karriere als Referatsleiterin und später als Bürgermeisterin schon oft aufgefallen. Alma hoffte nur, sich in der Abgeschiedenheit der Schwarzwälder Bergwelt, in der sie ihren Resturlaub zu verbringen beabsichtigte, keine weiteren Gedanken an diese Frage verschwenden musste. Besonders weil ihr gewählter Nachfolger erst in ein paar Wochen, zum Anfang des nächsten Monats, ihr Amt übernahm, wünschte sie sich keinen weiteren Kontakt. Mit der notgedrungenen Besetzung einer kommissarischen Leitung über die folgenden Wochen hatte sie sich bereit erklärt, im Hintergrund erreichbar zu bleiben. Ein freiwilliges Angebot ihrerseits, welches sie sofort bereute, nachdem sie es dem Stadtverordneten, dem guten alten Harms, gemacht hatte. Als sie dann auch noch erfuhr, wer sie temporär vertrat, bis der neue Bürgermeister zur Verfügung stand, war genau diese von ihr so unerwünschte Kontaktaufnahme sogar sehr wahrscheinlich geworden. Klara Petersen war eine Seele von Mensch, alle liebten sie, aber ihre Unsicherheit, die ab einem gewissen Stresspegel unvermeidlich war, würde sie viel zu schnell an den Punkt bringen, Alma in ihrem Urlaub anzurufen. Es würde dann nicht darum gehen, bei Klara irgendeine mangelnde Kompetenz auszugleichen, sondern um sie zu ermutigen, etwas zu sagen oder zu tun, was sie sich selbst schlicht nicht traute.
Mit dem Bild des abendlichen Marktplatzes, die lederne Tasche in der Linken und ihren leichten Sommermantel über dem rechten Arm gelegt, wendete Alma sich ab und ging für immer. Ohne es verhindern zu können, kehrten ihre Gedanken noch mal zu dieser überraschenden Entscheidung zurück, endlich eine Stelle für einen Stadtplaner für Barmstedt auszuschreiben. Es war eine völlig unerwartete Wendung, die sich leider erst zum Ende ihrer zwei Amtszeiten ergab. Stadtplanung den Weg in die Kleinstadt geebnet zu haben, nahm für Alma selbst eine herausragende Größe in ihrer heimlichen Bilanz ein, die sie aus eigener Sicht nach acht Jahren in dieser Stadt vorzuweisen hatte. Nicht zuletzt deshalb, weil sie sich nüchtern eingestand, dass es zu den wenigen Dingen gehören würde, die bleibend waren und irgendwann sogar sichtbare Auswirkungen haben würden. Die Gestaltung der Stadtinfrastruktur und Besiedlung würde damit einen strategischen Anfang nehmen und hoffentlich in Zukunft von generationsübergreifender Weitsicht getragen werden. Eine Einstellung, die sie, selbst als konservative Politikerin, in den Köpfen der meisten Stadtvertreter, ganz gleich welcher Couleur, schmerzlich vermisst hatte.
Ilja und Volker
„Ilja, können wir bitte reingehen, mir ist arschkalt, und mir tränen die Augen von den verfickten Haselnüssen.“
Schweigend und mit dem üblichen Blick aus einer Mischung von freundschaftlicher Verbundenheit und einem Anflug aus Mitleid für die unsportliche Natur seines alten Freundes hielt Ilja kurz inne. Er schmunzelte ob dieses unvermeidlichen Drehbuchs, dem sie, ohne je ein einziges Wort darüber verloren zu haben, schon seit ewigen Zeiten folgten:
Er, Ilja Pawlow, der sportliche und gut situierte Beamte aus Barmstedt wollte immer „erst mal an die Luft“, bevor sie sich zu einem Kaffee, einer Mahlzeit oder einer Besprechung in die Suite der Seeterrassen zurückzogen. Wie lästig. Nach ihrer beiderseitigen herzlichen Begrüßung wartete sein untersetzter Freund und sehr erfolgreicher Selbstständiger Volker Garwind eigentlich immer nur auf die erstbeste Gelegenheit, den obligatorischen Spaziergang mit ihm zu beenden, noch bevor er richtig begonnen hatte. Kein noch so lauer Sommertag oder lieblicher Sonnenschein vermochten das zu verhindern. Und das, obwohl keiner es nötiger hatte als Volker. Seine Bereitschaft, sich freiwillig zu bewegen, hatte nicht einmal dazu ausgereicht, das direkt am nördlichen Ende des Einfelder Sees gelegene Rondeel komplett gemeinsam mit ihm zu begehen. Die ungezählten Treffen hier am See hatten ihnen mehr als genug Gelegenheiten dazu gegeben. In Wahrheit hielt Volker das für Zeit- und Energieverschwendung. Nur seine entwaffnende Höflichkeit jedem Menschen und ihrer Anliegen gegenüber sorgte für eine scheinbare Zustimmung. Erst einmal ja sagen, verhandeln kann man danach dann ja noch alles. An guten Tagen legten sie bestenfalls zweihundert Meter Seite an Seite zurück, bevor Volker schwer atmend den Rückweg mit einer charmanten Ausrede einleitete.
Als er seinen Schulfreund nach Jahren auf einer Tagung der Ingenieurkammer wiedertraf und sie ihre Freundschaft neu belebten, hatte er schnell verstanden. Wenn man mit Volker zusammenarbeitete, musste man Sitzfleisch haben. Darin hatte Volker Übung. Er hatte sich auch als Pennäler schon jeder sportlichen Aktivität entzogen, wo immer sich ihm die Möglichkeit bot. Auf der Walter-Lehmkuhl-Schule, die sie gemeinsam als Neumünsteraner Teenager erlitten hatten, setzte Volker sich während der gesamten Verweildauer in der Oberstufe erfolgreich mit einer Null-Sport-Lösung durch, wie er es damals genannt hatte. Die Nachteile nahm er hin mit einer stoischen Gleichgültigkeit und glich sie aus durch brillante Leistung in fast allen anderen Fächern.
Das war es, was Volker Garwind immer schon ausgemacht hatte: sein Ding durchziehen. Damit hatte er sich nicht verändert, nur war er über die Jahre noch besser darin geworden. Sein Unternehmen hatte ihn deshalb auch wohlhabend gemacht. Auf Volker war aber auch absolut Verlass. Das Wichtigste von allem jedoch: Er vertraute ihm. Nur all das in der Summe hatte ihn dazu bewogen, sich die Pläne seines alten Freundes überhaupt anzuhören. Ein Investor der Immobilienfond-Projekte anleierte und ein Bauamtschef, allein diese Konstellation, die sie beide beruflich darstellten, wäre schon viel zu beunruhigend gewesen. Niemand wusste von ihrer Verbindung, das hatten sie in einer stillen Einvernehmlichkeit schon mit ihrem ersten Treffen vor mehr als vier Jahren so gehalten. Nur mit Volker konnte man so was machen. Volker war eben Volker!
Die Seeterrassen in Mühbrook waren auch Volkers Idee gewesen, und so hatten sie sich, nachdem sie sich so glückvoll als Freunde wieder vereint hatten, über die Jahre darauf eingeschossen, sich dort zu treffen. Die Lage, direkt am Einfelder See, vor den Toren Neumünsters, im Ambiente dieser gemütlichen Hotel- und Landgastronomie, war einfach optimal für sie beide.
Keiner, der Volker kannte, würde annehmen, dass er sich freiwillig in Mühbrook in Naturnähe und am Einfelder See aufhielt. Warum auch, sein bevorzugter Aufenthaltsort war sein Büro und nachts seine Villa in der Marienstraße. Beides in der Neumünsteraner Innenstadt gelegen, nur wenige Minuten fußläufig voneinander entfernt, selbst für Volker akzeptabel, bildeten seinen Lebensraum, den er nur selten verließ. Und wenn sie sich trafen, war der Einfelder See nur einen Katzensprung entfernt und schnell erreichbar.
Für sich selbst sah Ilja den größten Nutzen in der Entfernung zu Barmstedt. Auch wenn er dadurch den weiteren Weg nach Mühbrook bewältigten musste. Die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Begegnung war einfach extrem gering. Und dennoch war es einmal passiert, wenn auch nur kurz. Ohne dass sie sich gegenseitig erkannten, hatte er Alma Mathiesen vom Parkplatz des Hotels abfahren sehen. Ob die Bürgermeisterin ihren Bauamtschef irgendwo zuvor im Gebäude erkannt hatte, das hätte weder Volker noch er mit Sicherheit sagen können. Da ihr Projekt-Spitzerfurth damals noch ganz am Anfang stand, hatten sie beide die gleiche Einschätzung. Bevor das Projekt Realität werden würde, wäre Alma Mathiesen sehr wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Dagegen befand sich ihr Projekt jetzt an einer ganz anderen Schwelle.
„Das haben wir beiden doch fein gedeichselt, Ilja, besonders du. Dass die Bebauungspläne so schnell durchgegangen sind, habe selbst ich nicht erwartet.“
„Seit wann bist du denn so euphorisch, Volker? Es sind doch noch diverse Hürden für die Bebauung des Geländes zu nehmen.“
„Ja, aber keine, die mir noch Sorgen machen, mein Lieber.“
2. Kapitel
Fusionen 2008
Verschmelzung oder Zusammenschluss zweier oder mehrerer Individuen, Institutionen oder Organisationen. Wobei diese ihre Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und ihr Potential, sich unabhängig entwickeln zu können, verlieren.
Die Erlaubnis
Schon seit seinem letzten Kindergartenjahr war es eines der vielen Streitthemen zwischen seinen Eltern. Er verstand es nicht, denn eigentlich machten sie sich beide Sorgen und waren deshalb nicht wirklich unterschiedlicher Meinung. Eigenartig war nur, dass sein Vater ein besonderes Interesse an seinem Radfahren hatte. Das war schon komisch. Es hatte doch auch sonst kaum etwas gegeben, was Benni betraf, was die Aufmerksamkeit seines Vaters bekam. Warum nur war ausgerechnet sein Radfahren von so besonderem Interesse für ihn? Bei seiner Mutter war es normal, denn sie war eigentlich immer nur besorgt um ihn. Benni verstand zwar auch nicht, warum sie ihn so wenige Dinge alleine machen ließ, auch wenn er sie schon gut konnte, aber sie hatte das bei ihm immer schon so gehandhabt. Bei ihr war er daran gewöhnt. Sie war immer dabei, egal ob es Hausaufgaben waren oder wenn er zum Sport ging. Selbst, wenn er sich nachmittags mit anderen Kindern traf, begleitete sie ihn die ganze Zeit. Bei seinem Vater, der sehr oft gar nicht zu Hause war, hatte er das Gefühl, er wäre ihm egal. Interesse schien er lediglich für seine Arbeit zu haben, die immer irgendwo anders war und die ihn deshalb zum Reisen zwang. Die Abwesenheit seines Vaters empfand Benni nicht nur als normal, sie war ihm auch viel angenehmer. Es gab ja auch nie etwas, was sein Vater von sich aus mit ihm hätte unternehmen wollen. Von anderen Kindern hörte er das zwar, wie sie mit ihren Vätern spielten oder irgendetwas bauten oder machten, aber mit seinem Vater hatte er das noch nie erlebt, nur mit seiner Mutter. Er vermisste aber auch nichts mit ihm. Wenn Bernhard Kruse, der geniale Monteur, wie er sich selber nannte, mal nicht auf Montage war, dann machte er meistens irgendetwas draußen im Garten oder im Schuppen, wo er eine große Werkstatt hatte. Diese hatte Benni noch nie von innen gesehen, weil nur sein Vater allein sie betrat und immer hinter sich abschloss, wenn er hineinging. Das war ein Ort, der Benni interessiert hätte, aber eben auch nur der Ort. Er hatte sich nie getraut seinen Vater zu fragen, ob er ihm diese geheimnisvolle Werkstatt zeigte, und so blieb es ein unerreichbarer Ort für ihn.
Mit dem Rad konnte er schon sehr gut fahren, aber alleine zu seiner Schule zu radeln, ganz ohne die Begleitung seiner Mutter, war etwas, was er sich nur im Stillen wünschen konnte. Doch genau dieser Wunsch erfüllte sich aus dem Nichts. Seine Eltern, so konnte er nur vermuten, mussten sich irgendwie geeinigt haben, aber mitbekommen hatte er das nicht. Und so geschah etwas, was vorher sonst nie passierte. Die Erlaubnis, allein mit dem Rad zur Schule fahren zu dürfen, bekam er überraschend von seinem Vater. Ausgerechnet er, der sich sonst nie für ihn interessierte oder sich um seine Angelegenheiten kümmerte, verkündete ihm die überraschende Entscheidung:
„Nach den Ferien wirst du allein zur Schule fahren!“
Seinen Vater diesen Satz sprechen zu hören, empfand Benni als fremdartig. Für ihn blieb diese einmalige Verkündigung seines Vaters ungewöhnlich, und er hatte das Gefühl, seiner Mutter Astrid ging es genauso. Und dann war es so weit. Die Sommerferien endeten. Auch am Morgen seines dritten Schultags fühlte Benni immer noch den Stolz, Zweitklässler geworden zu sein, der überdies auch ganz ohne Probleme allein seinen Schulweg bewältigte. Etwas, was nicht alle Kinder durften, die mit dem Rad zur Schule kamen. Es war ungewohnt ohne seine Mutter, und auch, dass sie ihn so lange umarmte, bevor er losfuhr. Er hatte noch ihren Geruch in der Nase, niemand roch so wie sie, und ihre Umarmung glaubte er auch noch immer spüren zu können, als er sich dem Eckhaus ihrer einzigen Nachbarn am Ende der Heidkampstraße näherte. Umgeben von Äckern und Feldern war es morgens sehr ruhig auf dieser kurzen Stichstraße. Einzig die Geräusche vorbeifahrender Autos, auf der Ausfallstraße Richtung Groß Offenseth-Aspern, durchschnitten, ohne dabei einen Takt zu finden, die Stille.
Und immer dann, wenn ihm die Ruhe genommen wurde, kamen sie zu ihm, die Gedanken, die er nicht mochte. In diesem Moment, in Sichtweite der endenden Heidkampstraße, waren es seine Erinnerungen an die fast immer gleichen stereotypen Sätze seiner Eltern, wenn sie über sein Radfahren stritten, die seinen Geist ausfüllten. Wie Repräsentanten des Für und Wider begann in der Regel sein Vater: „Das sind doch nicht mal zweihundert Meter bis an die Landstraße, und ab da ist ja auch ein Fahrradweg! Was soll denn passieren? Das kann er doch schon.“ Und in verschiedenen Variationen erwiderte seine Mutter, indem sie, egal ob sie nun gerade stand oder saß während sie sprach, tief ein- und auszuatmen schien: „Ja, aber er muss die Straße überqueren! Du weißt doch, wie unkonzentriert er immer ist!“
In der Nacht zuvor hatte es geregnet. Dem Gefälle folgend floss anfallendes Regenwasser auf den tiefer gelegenen Asphalt im Mündungsbereich der Heidkampstraße hinab. Von dort seitlich abfließen konnte es jedoch nicht, zumindest nicht sofort. Ein aus Gras gewachsener wulstartiger Rand, ein Produkt aus dem Spülsanden des Regenwassers und einer gepflegten Nachlässigkeit des Straßenbauamtes, verhinderte das ungestörte Abfließen in die beidseitigen Gräben der kleinen Seitenstraße. So stauten die Niederschläge bei Regen und spülten immer auch Sande mit sich und aus der seitlichen Vegetation heraus, die dann nach den Regenfällen auf der Straße verblieben. Nach dem Abtrocknen bedeckte eine frische sandige Schicht großflächig den Ein- und Ausfahrtsbereich der kleinen Seitenstraße.
Benni liebte diesen Bereich und konnte ihn hören, wenn er ihn erreichte. Dafür schloss er kurz die Augen, wenn er glaubte, diesem Übergang zur versandeten Fläche zu erreichen. Er hatte das schon im Wald herausgefunden, Hören mit geschlossenen Augen war viel einfacher und deutlicher. Der Sand sang. So nahm er es wahr, wenn er diesen Bereich an der Kreuzung zur Landstraße erreichte.
Als Benni noch gemeinsam mit seiner Mutter morgens zum Waldkindergarten gefahren war, war er auf dieser ersten Etappe in der Heidkampstraße immer vorausgefahren. Dadurch versuchte er die weit in die Straße hineinreichenden Sandflächen vor ihr zu erreichen. Er genoss besonders das Gefühl zu beschleunigen. Mit steigerndem Tempo setzte er zu einer Vollbremsung an. Am meisten Spaß machte es, das Ausbrechen seines Hinterrades auf dem versandeten Asphalt gekonnt abzufangen. Seine Mutter hatte es ihm zwar nicht verboten, bestand aber kompromisslos auf ausreichenden Abstand vor der Hauptstraße. Deshalb ermahnte sie seine morgendlichen Bremsspiele immer mit den gleichen Sätzen: „Nicht zu dicht an der Landstraße, Benni, nicht zu dicht! Nur bis zum Grenzstein, hörst du?“ Das dämpfte seine Freude daran, hinderte ihn aber nicht. Der Grenzstein war ein schon leicht schräger, kurzer, kniehoher Betonpfeiler, auf dem die ehemals weiße Farbe schon lange abgeblättert war. Nur dieses hässliche Stück Beton stand für seine Mutter weit genug weg. Wie war sie nur auf dieses Ding gekommen? Benni fand immer schon, es wäre auch noch ausreichend, wenn er hinter dem Stein zum Stehen kommen würde. Wo er bremste, war ihm eigentlich egal, Hauptsache da, wo genug rutschiger Sand war. Das war nach jedem Regenfall immer ein bisschen anders, aber das schien seine Mutter irgendwie nicht zu verstehen. Besonders nervte ihn das an den Tagen nach Regen, wo eine super Sandfläche bis hinter den Grenzstein reichte.
An diesem Morgen seines dritten Schultages als Zweitklässler begann Benni zu beschleunigen bevor er den Sand singen hörte, weil er schon von Weitem sah, dass der nächtliche Regen eine besonders große sandige Fläche hinterlassen hatte. Obwohl er allein war, hörte er im Geist die vertrauten Ermahnungen seiner Mutter: „Nicht zu dicht an der Landstraße, Benni, nicht zu dicht! Nur bis zum Grenzstein, hörst du?“
Sekunden konnten Stunden sein!
Was Benni besonders irritierte, war das diesmal sehr viel lautere Singen des Sandes, während er ein cooles Bremsmanöver auf dieser großen, unberührten Sandfläche vollzog. Es war plötzlich so nah, obwohl er so wie immer auf seinem Rad saß. Wieso nur konnte er die eher zischenden Geräusche seines Bremsens auf dem frischen Sand und zugleich noch ein anderes lautes Singen des Sandes hören? Alles um ihn herum schien ihm immer nur noch näher zu kommen. Direkt vor ihm leuchtete es schmerzhaft grell auf. Mit einem Knall bremste es ihn abrupt ab. – Dann war es nur noch dunkel und still.
Warum geht es nicht weiter, die Straße war doch frei bis zur Ausfahrt? Und warum hat mein cooles Bremsen so plötzlich aufgehört? Wieso bin ich überhaupt hier? Und wo bin ich eigentlich, es ist komisch hier, so weich und hell. Ich kann nichts sehen und die Vögel singen nicht mehr. Auch die Autos auf der Landstraße, ich kann sie gar nicht mehr hören! Was ist los, was ist passiert, ich will nicht hier sein!
Schmerzgepeinigt kehrte Benni zurück aus seiner Bewusstlosigkeit und öffnete seine Augen.
Oh, warum nur tut alles so weh, mir geht es gar nicht gut. Wo kommt denn der Drache da oben auf einmal her? Ein richtiger Drache mit grünschimmernden Schuppen, und ziemlich groß ist er auch. Es gibt sie also doch. Will der mich verschlingen?
Ich sehe etwas Komisches. In dem Drachen, hinter seinem schlierigen Auge, sitzt eine Frau. Sie sieht schön aus! Tut ihr auch alles weh, und hat sie auch so eine Angst, wie ich sie habe? Sie scheint der Drache schon gefressen zu haben. Ja, sie muss schon von diesem grünen Monster verschlungen worden sein. Ich möchte ihr helfen. Noch nie hat mich jemand so angesehen aus einem Drachen heraus. Ich gebe ihr meinen Blick. Sie nimmt ihn an. Wir machen das nur mit unseren Augen. Mein Blick wird ihr helfen. Sie hat so große Angst, und sie will da wieder raus.
Ich kenne das. Ich weiß, wie sie sich fühlt. So was Ähnliches hat mein Papa schon mal mit mir gemacht. Er war böse auf mich und hat mich umschlungen, als wären seine Arme zwei große Pythons, die mich erwürgen wollten. Das war schlimm. Als er losließ, konnte ich eine Weile nicht Atem holen, ich glaube, mein Papa wollte mich verschlingen, damit ich weg bin, so wie er auch immer weg ist. Erst Mama hat ihn dazu gebracht aufzuhören, sonst hätte er es wahrscheinlich geschafft. Ich sehe noch sein Gesicht, so böse war er noch nie zuvor auf mich gewesen.
Werde ich jetzt auch noch von dem Drachen verschlungen, so wie die schöne Frau, die schon in ihm drin ist? Ich sehe sie, wenn auch etwas undeutlich, hinter dem milchigen Auge des Ungetüms gefangen. Sie hält sich mit ihren Augen an meinem Blick fest, weil sie so verzweifelt ist. Sie will raus, so wie ich damals aus den Armen meines Vaters, damit auch sie wieder atmen kann.
Der Drache fliegt fort. Mich hat er verschont. Doch er nimmt die schöne Frau mit, die er verschlungen hat, und sie meinen Blick. Sie hat meinen Blick behalten. Hoffentlich wird er ihr helfen.
Mit diesem letzten Gedanken umschlang ihn die Dunkelheit erneut.
Die Bewerbung
Eigentlich war es nur ein spielerischer Versuch. Eugenia wusste, dass ihre erste auf zwei Jahre befristete Stelle in der städtebaulichen Planungsabteilung in Hamburg-Altona und ihr zweiter Job in Itzehoe ein guter Berufsstart gewesen waren, aber sie wollte noch mehr.
Als junge Ingenieurin für Architektur und Städtebau würde sie sicher auch bei anderen Behörden einen Job bekommen, jedoch nur, wenn sie sich bundesweit orientierte. In der Hansestadtzeichneten sich keine Optionen ab, darüber hatte sie sich Gewissheit verschafft. Die ausgeschriebene Stelle in Barmstedt war die einzige im nordwestlichen Umland Hamburgs. Sie wollte nicht fort aus dem Norden. Fast an allen Orten wehten Winde, doch nirgends so verlässlich frische wie in Schleswig-Holstein. Und wenn es nicht Hamburg werden würde, so wollte sie doch in norddeutschen Gefilden bleiben. Also hatte sie es versucht und prompt eine Einladung zum Gespräch erhalten. Das allein, so viel wusste sie mittlerweile über öffentliche Jobausschreibungen, sagte noch nichts aus. Denn allein um sich vor etwaigen Klagen von Bewerbern zu schützen, erhielten viele von ihnen eine Einladung, die die formalen Kriterien erfüllte. Bei ihr, so vermutete Eugenia, war es das Geschlecht. Keine Behörde wollte sich mit dem Vorwurf der Diskriminierung konfrontiert sehen. Aber selbst, wenn sie eine Quotenfrau im Verfahren war, es war eine Chance, die sie nutzen wollte.
Das kleinstädtische Bauamt Barmstedt suchte ausdrücklich einen Planer mit behördlicher Berufserfahrung, und die konnte sie mit ihren zwei Jahren in der Stadtplanungsabteilung des Bezirksamtes Altona vorweisen. Ob das reichte, war ihr nicht klar, aber die Einladung hatte sie hoffen lassen. Aus der Anzeige im Hamburger Abendblatt wusste sie, dass mit der neugeschaffenen Stelle vorrangig die fachliche Bauherrenvertretung über laufende und anstehende Planungen und Realisierungen von Neubesiedlungsprojekten dieser nördlichen Kleinstadt besetzt werden sollte. Sie war sich sicher, diesen Teil würde sie gut erfüllen können, auch wenn sie ihn nicht besonders mochte. Was Eugenia Haussmann neben dieser benannten Hauptaufgabe jedoch eigentlich reizte, war der letzte Punkt im Anforderungsprofil: Regional- und Stadtplanung für die Stadt Barmstedt und Umland. Die Königsdisziplin für jeden Stadtplaner. Damit würde sie Teil einer Neugestaltung werden können, die sich für sie in einer Großstadt wie Hamburg niemals bieten würde. Um in der Hansestadt jemals in so eine Position hineinzuwachsen, hätte sie vermutlich zweihundert Jahre alt werden müssen. Die Chance, ihre Planungskompetenz als Stadtplanerin anzuwenden, und damit real eine Region zeitgemäß und nachhaltig zu gestalten, würde sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Das war es, worauf sie schon seit Kindertagen hoffte: selbst zu gestalten.
Es war früh an diesem 3. September 2008, der Tag, an dem Eugenia zu ihrem Bewerbungsgespräch ins Rathaus Barmstedt eingeladen war.
Sie erinnerte sich, während sie in Itzehoe auf die Straße hinaustrat und ein paar Minuten vor ihrem Hauseingang stehenblieb, um die Morgensonne zu genießen. Hier, hinter dem viergeschossigen Blockrandriegel, war der Straßenlärm vom Langen Peter erträglich. Diese Dachgeschosswohnung, die sie sich damals auf die Schnelle hatte suchen müssen, lag nicht nur direkt an der Bundesstraße 206, der Ausfallstraße nach Wrist, sie war selbst für Itzehoe viel zu teuer.
Überhaupt war es ernüchternd für sie gewesen festzustellen, in Itzehoe schlechter zu stehen als in der Großstadt, aber so war es. Diese erste Anstellung nach ihrem Studium, an der Behörde in Hamburg, war nicht nur auf zwei Jahre befristet, sondern auch mit einem kläglichen tarifgebundenen Anfangsgehalt ausgeschrieben gewesen. Dachte sie jedenfalls. Das Stadtplanungsbüro in der Itzehoer