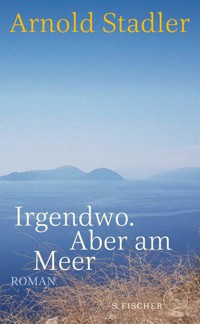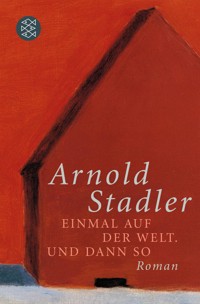9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist Glück? Später weiß man es. Alain und Mausi, beide vierzig und seit 15 Jahren verheiratet, sind in der Mitte des Lebens angekommen. Aber nicht nur ihr Leben, auch die Liebe ist in die Jahre gekommen. Fast scheinen sie die Liebe hinter sich zu haben – jetzt droht »die vegetarische Zeit«. Als überraschend die gemeinsame Freundin Elfi stirbt, ist Mausi in ihrer Wohnung in Berlin und Alain auf einem Übersetzerkongress in Köln. Es ist ein Tag im Juni 2004. Bei beiden reißen alte Wunden auf. Elfi, das war eine Freundin aus den Tagen der Freiburger Wohngemeinschaft mit Alain, Mausi, Justus, Inge, Toby und Babette. Elfi, das war eine lebenslustige und sterbenstraurige Fotografin, deren einziges Sujet die Männer waren, auch Alain. 1983 hat man gemeinsam einen Sommer der Liebe und Freiheit an der französischen Atlantikküste verbracht, den keiner von ihnen vergessen hat. Aber was hat die Zeit seitdem aus ihnen gemacht? Justus und Inge sind Spießer geworden, Norbert ist an Aids gestorben, Toby spurlos verschwunden. Jetzt, mehr als zwanzig Jahre nach dem Sommer von 1983, begegnet Alain in Köln seiner großen Liebe Babette wieder, und Mausi verliebt sich in Berlin in einen blonden Dänen, der sich in der Oper neben sie setzt. Der Rest wird in diesem Roman erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Arnold Stadler
Rauschzeit
Roman
Über dieses Buch
Was ist Glück? Später weiß man es.
Alain und Mausi, beide vierzig und seit 15 Jahren verheiratet, sind in der Mitte des Lebens angekommen. Aber nicht nur ihr Leben, auch die Liebe ist in die Jahre gekommen. Fast scheinen sie die Liebe hinter sich zu haben – jetzt droht »die vegetarische Zeit«. Als überraschend die gemeinsame Freundin Elfi stirbt, ist Mausi in ihrer Wohnung in Berlin und Alain auf einem Übersetzerkongress in Köln. Es ist ein Tag im Juni 2004. Bei beiden reißen alte Wunden auf. Elfi, das war eine Freundin aus den Tagen der Freiburger Wohngemeinschaft mit Alain, Mausi, Justus, Inge, Toby und Babette. Elfi, das war eine lebenslustige und sterbenstraurige Fotografin, deren einziges Sujet die Männer waren, auch Alain. 1983 hat man gemeinsam einen Sommer der Liebe und Freiheit an der französischen Atlantikküste verbracht, den keiner von ihnen vergessen hat. Aber was hat die Zeit seitdem aus ihnen gemacht? Justus und Inge sind Spießer geworden, Norbert ist an Aids gestorben, Toby spurlos verschwunden.
Jetzt, mehr als zwanzig Jahre nach dem Sommer von 1983, begegnet Alain in Köln seiner großen Liebe Babette wieder, und Mausi verliebt sich in Berlin in einen blonden Dänen, der sich in der Oper neben sie setzt. Der Rest wird in diesem Roman erzählt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arnold Stadler wurde 1954 in Meßkirch geboren. Er studierte katholische Theologie in München, Rom und Freiburg, anschließend Literaturwissenschaft in Freiburg, Bonn und Köln. Er lebt seit dem Jahr 2000 in Sallahn/Wendland und vom ersten Tag an in seinem Elternhaus, einem Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert, in Rast über Meßkirch. Arnold Stadler erhielt zahlreiche bedeutende Literaturpreise, darunter der Georg-Büchner-Preis. Zuletzt erschienen »Komm, gehen wir«, »Salvatore«, »Einmal auf der Welt. Und dann so« und »New York machen wir das nächste Mal«.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Überarbeitete Neuausgabe
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign|München
Coverabbildung: © Dirk Wustenhagen/Trevillion Images
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402069-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Wir wissen wenig voneinander
Teil I
1. Alain
2. Irene
3. Alain
4. Irene
5. Alain
6. Irene
7. Alain
8. Irene
9. Alain
10. Irene
11. Alain
12. Irene
Teil II
1. Alain
2. Irene
3. Alain
4. Irene
5. Alain
6. Irene
7. Alain
8. Irene
9. Alain
10. Irene
11. Alain
12. Irene
Teil III
1. Irene
2. Alain
3. Irene
4. Alain
5. Irene
6. Alain
7. Irene
8. Alain
9. Irene
10. Alain
11. Irene
12. Alain
13. Irene
Teil IV
A
Teil V
1. Irene
2. Alain
3. Irene
Teil VI
1. Irene
2. Alain
3. Irene
4. Alain
5. Irene
6. Alain
7. Irene
8. Alain
9. Irene
Wir wissen wenig voneinander
Georg Büchner
Teil I
1. Alain
Die Welt war der Ort, wo uns die Zeit davonlief, von diesem Satz in meinem Kopf war ich schon gleich nach 5 Uhr aus dem Bett getrieben worden, und mit den Sätzen von Irene, die sie mir mit auf den Weg nach Köln gegeben hatte, stand ich nun vor meinem Morgenspiegel: Dass du wie ein Waldschrat aussiehst, weißt du. Und außerdem hatte sie mich kurz darauf auch noch gefragt: »Sollten wir nicht ins Vegetarische wechseln?« Das setzte die Geschichte von Menschen voraus, deren große Zeit vorbei war.
Ich war nie zur rechten Zeit glücklich. So war Professor Pfotenhauer mit seinem Eröffnungsvortrag des Internationalen Übersetzersymposiums angekündigt gewesen: Untertitel: Nachgetragenes zu Jean Paul. Ein Leben mit Jean Pauls Abschweifungen des Lebens. Aber wegen eines Pilotenstreiks in London, der Stadt von Twiggy, Margaret Thatcher, der Queen, Sherlock Holmes, der Krimis, des Geldes und der Petticoats, saß er in Heathrow fest,und ich war, wenn ich ehrlich gewesen wäre, eigentlich nur deswegen nach Köln gefahren, vielleicht auch noch ein wenig aus Schreck über Mausis Sätze aus Berlin vertrieben.
Aber nun stand ich allein mit Jean Paul und Ich war nie zur rechten Zeit glücklich vor diesem Spiegel und dachte, was aus diesem Satz noch werden sollte.
Ich war nun ein Mann von vierzig Jahren, der so langsam sein Buch Ein Mann von vierzig Jahren hätte beginnen müssen und davon schreiben, und in der grauen Mitte meines Lebens hätte der Satz stehen müssen, dass ich nie zur rechten Zeit glücklich gewesen war, das sollte mein erster Satz sein. Doch der ging nun überhaupt nicht mehr. Denn gerade jetzt musste ich mit dem Blick in diesen Spiegel, und keinem sonst als mir, sagen: Jetzt bist du gerade zur rechten Zeit unglücklich.
Ja, es war auch unsere Geschichte, dachte ich nun, die Geschichte von zwei Liebenden, deren große Zeit vorbei war. Es waren genau genommen mindestens zwei Geschichten. Die es vielleicht niemals gegeben hatte. Vielleicht hatte es auch mich nie gegeben? Aber diese Wörter gab es: »vegetarisch« und »Waldschrat« …, die nun in diesem Raum standen, so groß wie ich. »Dass du wie ein Waldschrat aussiehst, weißt du.« Das wusste ich schon länger. Das hatte Mausi mir wieder gestern früh gesagt, als wollte sie nicht, dass sich in Köln meine Chancen in der Welt der Frauen und Männer, die wussten, wo es langging, verminderten, und sie sich mit mir blamierte. Es war gar nicht so lange her, da hatte sie noch von mir geschwärmt: Mit dir bin ich immer gut angezogen! Jetzt war ich zum Waldschrat geworden, als sie in meine Wohnung herüberkam, wir waren ja durch eine gemeinsame Binnentür miteinander verbunden, und ich stand gerade in meinem Badezimmer mit seinem überdimensionalen Spiegel, in den ich noch gar nicht richtig hineingeschaut hatte, und machte mich für Köln zurecht. Und dann, als sie weg war, schaute ich doch in diesen Spiegel: Sie hatte vielleicht recht. Ja, eine Rasierklingenreklamefresse war es nicht mehr. Immerhin: Eine Minusfresse hatte ich noch nicht. Doch das Wort »Waldschrat« war so groß wie ich … und dann kam noch, wie nebenbei, das vegetarische Angebot. War es tatsächlich schon so weit? Hatten wir uns schon so auseinandergelebt, dass wir nicht mehr zusammenkamen, schon eingependelt in einen Vegetarier-Modus oder Vegetarier-Status? War es nicht genug, dass wir schon in unseren getrennten Zimmern schliefen? Ich wusste es nicht. Die Zeit, da sie »my Bonnie« zu mir sagte und mich zu den fleischfressenden Pflanzen rechnete, war lange her. So weit konnte ich Mausis Wörter übersetzen, ein Vierzigjähriger, noch so einer, ein Mensch vor dem Spiegel, und ich sah nun aus wie gewaschen bei 60 Grad, dachte ich, und machte mich nun weiter für den ersten Tag zurecht. Ein wenig auch wie Kafkas Gregor Samsa, Kafkas Käfer, am anderen Morgen.
Und dann hörte ich, es war im Deutschlandfunk: »Die meisten Menschen sind glücklicher, als sie es wissen« … und was so alles geredet wird im Radio, am Morgen zwischen fünf und sechs. Kannte dieser Mensch mich? Was wusste er von mir? »Wenn ein Rollstuhlfahrer hereinrollt, geht es mir schon ein wenig besser« und so fort; ich schämte mich, dass dieser Psychologe die Menschen für so primitiv hielt, und einen von ihnen sah ich vor mir, der mit Wörtern wie »Waldschrat« und »vegetarisch« gestraft, in diesem seitenverkehrenden Spiegel stand, so dass ich mich nun fragen konnte, ob mein Leben nicht ein Irrtum war. Das wusste ich nicht. Aber ich sah nun einen vor mir, dem bei diesen neobarbarischen, darwinistischen, natürlich wahren Sätzen nun seine alten Empfindungen in die Quere kamen: Es zerriss mich vor Schmerz, weil es mich nicht vor Schmerz zerriss. Und ich war schon ganz verzweifelt, weil ich immer noch so viel Hoffnung hatte.
Meine Frage war nun: Was ist Glück? Und meine Antwort: Nachher weiß man es. Und zurückfahren nach Berlin musste ich auch noch. Aber erst übermorgen, am Sonntag, nachdem die Konferenz vorbei wäre.
So stand ich mit meinem Duschgel und meinem spiegelverkehrten Gesicht, ganz nackt und sonst nichts, ein Mann von vierzig Jahren, und ich fragte mich, ob es nun der Höhepunkt in meinem Leben gewesen sein sollte, dass ich einmal im Fahrstuhl von oben nach unten Yoko Ono begegnet war, und wie sie beim Aussteigen so schaute, als hätte sie »Auf Wiedersehen – Bye!« sagen wollen, und ich in diesem Gesicht, das kein Gedicht war, mehr nicht lesen konnte? Oder war es das Höchste, einmal im Frankfurter Hof übernachtet zu haben, aufgrund einer Verwechslung, als Gast des Börsenvereins, wo mir im Fahrstuhl Yoko Ono so nahe kam, dass ich sie hätte töten können? Oder war das der Gipfel, auch der Erkenntnis, wie zwei Fernsehphilosophen in Nietzsches Sils Maria 1803 Meter über dem Meer über den Tod (um das Jahr 2000) diskutierten?
Und ich hörte es. Über den Tod in der Oper und den Tod der Oper, etwa zu der Zeit, als die Welt brannte, und anderswo, irgendwo auf der Welt, der Mensch in den Tod sprang, und auch die Tosca.
Ach, die Philosophen hatten so viel über alles geredet, über die ganze Welt, die der Ort war, wo wir uns nicht begegneten und in der Zeit verloren.
Es war um diese Zeit vor einem Jahr, am längsten Tag gewesen, dass ich zu diesen Vorträgen ins Hotel Waldhaus gepilgert war, und übernachtet hatte ich in der billigsten Pension, die mir vom Veranstalter, der Nietzschegesellschaft, genannt worden war, ohne dass ich danach gefragt hätte. Vielleicht war es wegen meines ausländischen, unamerikanischen Akzents meiner Sprache. Es war eine Sprache, die nicht nach Geld klang. Eher nach Inkompetenz und fehlender Finanzfrische. Vielleicht war es auch meine Stimme, die wohl auch so klang, als hätte es da einer noch nicht geschafft, eine zu junge Stimme für einen dafür zu alten Menschen. Und keiner dachte, dass da irgendetwas nicht stimmte mit mir. Nicht einmal ich selbst war damals auf diesen naheliegenden Gedanken in meinem Kopf, der mir eigentlich näher war als ich mir selbst, gekommen. Gewiss, ich hätte mir auch etwas anderes leisten können, zur Not auch das Waldhaus, denn ich hatte ja Irene, die von allen ihren Menschen Mausi genannt wurde, die mit ihrem Gewehr hinter mir stand. Das war eine Redensart ihrer Tante, die von ihren Liebsten auch schon Mausi genannt wurde. Doch ich wollte ihr nicht derart auf der Tasche liegen, wie der Mensch immer noch einfach und deutlich sagte. Mausi hatte zwar keinen Igel in der Tasche – so umschrieben meine Verwandten in Isigatreute in ihrer Muttersprache einen geizigen Menschen – und ich auch nicht.
Nun war ich in Köln; und es war das ibis (immerhin nicht in der Budget-Abteilung) in dem ich abgestiegen war, wie Tante Mausi noch sagte, in dem ich zu liegen kam.
Über Nacht hatte es damals in Sils Maria über alles hinweggeschneit, ja, am längsten Tag des Jahres hatte es geschneit, und der Schnee blieb auf den Autos liegen, die freigeschaufelt werden mussten, und die im Schneesturm überraschten Menschen auf dem Malojapass evakuiert. Und ich? War mit einem Herbstgedicht von Nietzsche in meinem Kopf aufgewacht und sah draußen den Schnee und sagte das Gedicht vor mich hin: »Dies ist der Herbst: der – bricht mir noch das Herz!«, das ich wieder einmal ganz falsch auf mich bezog, denn es hieß: »Dies ist der Herbst: der bricht dir noch das Herz!«, und mit diesem »dir« meinte Nietzsche gar nicht mich, sondern sich, so dass ich mir sagte: nie wieder. Auch weil es schon Ende Juni war, und ich so langsam mit dem Zitieren aufhören und mit dem Leben beginnen sollte.
Und bevor ich damit wieder einmal anfing an diesem Morgen und hinausging, setzte ich mich noch etwas auf das ibis-Bett, denn der Mensch will bleiben. Aber er muss gehen, und ich war schon zum ersten Mal müde an diesem Tag, und sah wohl aus wie der ratlose Christus auf jener Stele in der Heiligblut-Kirche von Wilsnack, unweit von Stendal.
2. Irene
Was ist Glück? Nachher weiß man es.
Irene lag da und lebte. Sie lag in ihren weißen elegant-robusten Bruno-Paul-Korbmöbeln vom Sonnendeck des längst untergegangenen Norddeutschen Lloyddampfers Columbus. Ja, sie lebte, leichtbekleidet und erwartungsvoll, und hatte gerade in Inges Geburtstagsgeschenk P.S. I love you zu lesen begonnen, im Original, denn sie war eine Übersetzerin, die von so etwas träumte. Es gab keinen schöneren Titel als P.S. I love you, dachte sie. Das Lied, das genauso hieß, kannte sie auch schon: »Yesterday we had some rain, but on the whole, I can’t complain« … So wie es Rudy Vallée 1934 gesungen hatte. Was waren schon siebzig Jahre, wenn sie vorbei waren. The Hilltoppers aus den vierziger Jahren waren aber auch nicht schlecht.
Es war auf ihrer Dachterrassenlandschaft in der Haberlandstraße. Für den Abend stand die Tosca mit Inge und Justus auf dem Programm. Der Gutschein für die zwei Tosca-Karten stammte von jenen Freunden, denen Irene zweihundert Euro wert war. Das Wort Gutschein war eigentlich schon gänsehauterregend. Für die Karte von Alain, also für den Platz neben Irene, hatte Justus, wie er sagte, einen idealen Ersatz gefunden. »Lass dich überraschen!« Nur so viel wollte er verraten: »Es ist ein blonder Däne.« War das nicht eine Tautologie? Dachte sich Irene, und das hätte schon wieder der Titel eines Liebesromans sein können: Der blonde Däne. Ein tautologischer Liebesroman, geschrieben von einem Menschen, der das Leben hinter sich hatte, und sich noch sehr wohl daran erinnern konnte, und auch noch daran, was die Liebe für ein seltsames Ding war. Eigentlich nur geglückt in einem Liebesroman und gelesen von ebensolchen Menschen wie Irene, Frauen wie Irene, als wären sie von der Natur für die Liebe wie das Lesen von Liebesgeschichten vorgesehen, Liebesgeschichten, die vom Leben als Glück gedacht, von der Schriftstellerin jedoch als Unglück beschrieben werden mussten, das sich im letzten Augenblick noch in ein Entsagungsglück wendete.
Und das ist gut so, dachte sie schon fast vergnügt an ihre Tante Mausi, die schon früh, das heißt in einem Alter, in dem sie selbst jetzt war, gesagt hatte: »Ik hab abjedankt. Sollen die Jungen mal ran!«
In solchen Romanen war es dann so, als wären die Frauen von einem Mann ausgedacht, seine Geschöpfe, und als hätte Gott zu den Männern gehört. In den Liebesopern war es genauso. Immer nur Männer, oftmals alte, die diese dicken Romane und Opern geschrieben hatten, und über die Jahrhunderte und Jahrtausende waren es Frauen, die sich von den Männern erklären lassen sollten, was die Liebe war.
Also ein blonder Däne, der neben ihr mitanhören und mitansehen müsste, wie Tosca singend in den Tod sprang. So hatte es Puccini verfügt, geschrieben in Rom, in ein paar Monaten des Jahres 1899, und zum ersten Mal gehört ebenda, anno 1900, zum dreißigsten Geburtstag Italiens und der Eroberung Roms durch die Italiener. Das war nun über zweieinhalbtausend Jahre nach der Eroberung Italiens durch die Römer. So viel Geschichte musste sein.
Puccini ließ eine Frau in den Tod springen, von der Engelsburg, die gerade noch die Zuflucht des Papstes gewesen war, auf der Flucht vor den päpstlichen Männern und Folterern. Das erwartete sie. Mehr wusste Irene nicht. Sie lebte gerne, es war Freitag, der 25. Juni 2004. Jetzt wurden die Tage wieder kürzer. Friedrich Gulda (sonst war es immer Lili Kraus) spielte gerade für sie das Andante con variazioni in fa minore von Franz Joseph Haydn. Alain war in Köln.
3. Alain
Es war mittlerweile schon wieder Zeit für die Nachrichten. Ich war zwei Minuten zu spät. Also nun schon wieder im ersten Stau des Tages, wie hätte es anders sein können. Ich hörte: Bottrop, und das war für mich ein Geräusch im Ohr wie ein immer noch nicht geleerter, überfüllter Mülleimer im Augenblick, da sich irgendein Mensch seiner erbarmt. Es kamen wunderbare Menschen aus Bottrop, ich kannte mindestens zwei, und auch aus Dorsten kamen die wunderbarsten Menschen, also sorry, doch dieses Geräusch war es, wie alles in den nächsten Container hineinrutschte, und dann, wie es klang, wenn der leere Mülleimerdeckel wieder einschnappte und aufschlug: Bottrop. Als reimte es sich auf: Waldschrat, immerhin: Das Metrum stimmte. Und wenn ich wie jedes Jahr im Oktober zwei Wochen auf dem Land war, im Allgäu, stimmte mich das Krähen der jungen Hähne im Oktober, die es noch bis Weihnachten schaffen würden, noch wehmütiger als die Amseln, die längst zu singen aufgehört hatten und verstört im Boden herumpickten und auf das warteten, was kam oder nicht.
Das Wort »frisch machen« gab es auch noch. Das war ein Lieblingswort Irenes. Sie hatte mich gestern Morgen schon zweimal gefragt: »Machst du dich noch frisch?« Als hätten wir uns schon so weit auseinandergelebt, dass Trennung schon gar nicht mehr in Frage kam, ja, dass nicht einmal der Gedanke daran in Frage kam. Was sonst noch war? Es gab Menschen, die wie Überlebende eines Botox-Unglücks aussahen, ich sah Menschen, die dürfte meine Nachbarin von einst, Madame Cyprian, nie gesehen haben. Zu ihnen dürfte ich niemals gehören, war das schon ein Trost, dass ich etwas Unschönes niemals gesehen haben würde?
In meiner Kindheit, in den Ferien bei meinen Großeltern oberhalb von Lindau und bei meinen Tanten zwischen Isigatreute und Burladingen, und auch später auf meinen Weltreisen hatte ich noch Menschen gesehen. Menschen, ganz ohne Implantate, mit unverwechselbaren Zähnen und Zahnlücken. Da war alles, und nichts fehlte. Auch Pasolini hätte an so etwas seine Freude gehabt. Im Laufe von ein paar Jahren war die Natur wie die natürliche Schönheit immer weniger geworden, du Morgenfresse, dachte ich. Und Lindau war das Weltzentrum der Botox-Industrie in Deutschland. Das waren alles nur Erinnerungen an die großen Ferien bei den Großeltern in Deutschachberg. Wenn gar nichts anderes mehr übrig blieb als der Tod, sprach der übrig gebliebene Mensch immer noch von der Natur und dem Lauf der Dinge. Und die dazugehörenden Psychologen wollten mir auch noch den Schmerz ausreden oder austreiben, wie früher die Exorzisten, so dass der Mensch, noch um den Schmerz und den Tod betrogen, brauchbar durchs Leben geschleust wurde, fitgemacht für ein ganzes Mitläuferleben. Doch war es nicht meine Zeit und mein Schmerz und mein Tod? Von der Zeit war oftmals nicht viel mehr geblieben als eine Patek Philippe oder eine große Rolex.
Die Stichworte in den Nachrichten waren wieder einmal »Nullrunde« und das »Bundesverfassungsgericht« gewesen. Aus dem ich als alter Wortverdreher schon wieder das »Bundesverfassungsgedicht« machte. Mit welcher Betonung die Gewerkschaftsfunktionäre am Tisch »Nullrunde« sagten und wie die Stiftung Warentest das Wort »Verbraucher« in die Mitte ihrer Welt stellte. Und mit welcher Betonung die Wissenschaftsgläubigen »neue Studien in den USA ergaben« in die Welt hinausplärrten. Und mit welch feierlicher Betonung die Juristen das »Bundesverfassungsgericht« aussprachen, als wäre es das Höchste, der Herr über Leben und Tod. Und wie die Nachrichtensprecher alles herunterlasen. Längst gab es auch Nachrichtensprecherinnen, ja, sie hatten mittlerweile das Ruder übernommen, die sich auch nichts daraus machten, die 20000 Toten des Erdbebens von Bhuj vorzulesen und sich eine Woche später nicht einmal mehr daran erinnern konnten und dabei immer tadelloser aussahen, ja etwas mehr. Ich war ja noch in der Abenddämmerung der schwarzweißen Fernsehwelt groß geworden, die glaubte, das sei eine Revolution, als zum ersten Mal eine Frau auf dem Nachrichtenbildschirm auftauchte, so züchtig wie Wibke Bruhns. Beim Namen der Fernsehansagerin Ursula von Manescul, von der mein Großvater noch schwärmte, so kindisch war er geworden, wurden, wie man damals noch sagte, die Männer schwach. Es war in einer Zeit, da hat sich der Vater von Irene noch mit über achtzig ein Autogramm von Marlène Charell und ihren Beinen kommen lassen. Und dann erst Dagmar Berghoff bis hin zu Udo Walz, der Kulturinstanz in der Wowereit-Zeit, die ich beide das erste Mal zusammen in Lindau erblickte, ich in Sommerferien bei meinen Großeltern, sie zu einem Upgrade-Check bei »Nasen-Mang«, einer Schönheitsfarm mitten auf der Insel. Fernsehansagerinnen gab es nun auch nicht mehr, dafür aber so intelligente Fernbedienungen und Menüs und User, die bewiesen, dass der Mensch durch den Verbraucher ersetzt war und auch sonst von Tag zu Tag alles besser wurde.
Das war ein Kurzdurchlauf einer ganzen Lebenszeitgeschichte, die ich mir schuldig war an diesem Morgen, dachte ich.
Wer etwas sein wollte, sprach von Paradigmenwechsel.
Nettes kleines Hotel. Hatte Christl aus Salzburg zu ihrem Hotel in der Taubengasse gesagt. Und sie tat so, als hätte sie gar nichts anderes gewollt. Und auf die anderen gezeigt und gelacht, die zweihundert Euro für eine Nacht ausgeben konnten. Die spinnen ja!
Doch was waren das für Menschen, die barfuß in einem derart versifften Zimmer auf und ab gingen? Nur in Paris war es noch schlimmer, was da alles unter den Decken und Teppichböden herumkroch.
Geweckt worden war ich wie zu Hause von einem Rabengeschrei. Raben gab es allerdings in Paris nicht, die wurden durch das passende Mittel entsorgt. Die erste Musik des Tages in meinem Viertel am Bayerischen Platz kam von den Raben, Morgen für Morgen, die so langsam, getreu dem darwinistischen Prinzip, andere nannten es Natur, auch in meinem Leben überhandzunehmen schienen. Ich riss den Vorhang zur Seite und sah einen blauen Himmel dahinter und sonst nichts. Die Amseln sangen. Ich hatte gehört, dass schwule Amseln nicht mehr sangen, und dann waren sie keine Amseln mehr. Und dass sie weder Steuern zahlten noch arbeiteten, also auch keine Steuern hinterziehen konnten wie die Menschen im Radio, das ging mir alles im Kopf herum. Auslöser war gewesen, dass ich, anders als in meinem früheren Leben, nicht von Amseln aus dem Schlaf geweckt worden war, schönere Wecker konnte es nicht geben, dachte ich. Aber Anfang Juli hörte es dann auf. Ich führte das Leben eines Schmutzfinken weiter. Aber etwas mehr Körperhygiene, besonders im Unterwäschebereich, hätte sie sich schon gewünscht, und zwar bei keinem anderen mehr als bei mir.
P.S. I love you fand ich dann in meiner Lieblingsunterhose mit dem breiten Querbalken Emporio Armani. Ich entdeckte das Buch erst, nachdem ich schon als Waldschrat und Vegetarier ein Wechselbad der Gefühle vor dem Morgenspiegel hinter mir hatte. In jener Unterhose, die Irene in mein Gepäck geschmuggelt hatte. Ein Stringtanga war es aber nicht. Derart zärtlich konnten Irenes Überraschungen sein. Für so etwas hatte sie keinen Coach oder Spiritual Trainer nötig. Frontal, mit dem Logo auf der Schwanzseite, so kam sie mir entgegen. Ich verstand sofort.
Sie liebte mich also immer noch. Aber eigentlich hätte es dieser Art des Beweises nicht bedurft. Beim zunächst lustlosen, bei diesem Titel aber dann irgendwie doch neugierigen Herumblättern in P.S. I love you auf Futtersuche nach Argumenten für meine Vorurteile, kam ich erst spät auf den Gedanken, dass Irene mir auf diese etwas seltsame, aber doch deutliche Weise sagen wollte, dass auch sie mich immer noch liebte und auch nicht mehr als immer schon, das Jahr über eher vegetarisch, und dass sie zur Strafe »Waldschrat« zu mir sagte, und dass es eine milde Strafe war, darauf kam ich, und zwar beim Lesen, als ich auf diesen appetitlichen, schönen Satz stieß, den irgendjemand, das konnte aber nur eine liebende Frau sein, unterstrichen hatte: »Breakfast in bed on birthday with him.« Ließ es sich schöner sagen?
Und nun entdeckte ich beim weiteren Herumlesen und Herumblättern, das war nur ein Zeitvertreib und von Berufs wegen, entschuldige ich mich … dass da irgendwer, noch jemand, vielleicht Inge, schon herumgelesen und unterstrichen hatte und auf entscheidende Sätze gestoßen war.
Und beim Herumblättern fand ich noch ein paar unterstrichene Stellen, aber »breakfast in bed on birthday with him« rührte mich am meisten, und ich wusste doch nicht, wer das unterstrichen hatte, ob Irene oder schon Inge oder sonst ein Mensch, konnte es mir aber denken, wusste nur nicht, ob die Leserin diesen Satz besonders toll oder besonders daneben fand. Ach, Irene, dachte ich. Jetzt soll ich das auch noch lesen. Eine Aufgabe mehr, doch sehr charmant verpackt und vielsagend, wohl auch eine kleine Entschuldigung für »Waldschrat« und »vegetarisch«. Wahrscheinlich wollte sie mit mir, zurück in Berlin, über das Buch und dieses Thema sprechen. Vielleicht sollten die Unterstreichungen geheime Hinweise für mich sein, vielleicht auch nicht. So viel war klar: P.S. I love you war ein Megaseller, der diese wunderbare Tatsache wohl dem Titel und dem Foto der Autorin verdankte: Cecelia schaute so in die Welt, als glaubte sie ihrem Buch und jedem seiner Sätze. Und auch jedem seiner Küsse.
Es war ein vernünftiger Mensch, wohl eine Frau, mit Potenzial, das entnahm ich dem entschiedenen Unterstreichen, die sich nicht noch einmal im Teufelsmoor oder Biotop einer liebesverwirrten Siebzehnjährigen verirren wollte, eine Welt, die hinter ihr lag, ich aber hatte Mitleid mit Cecelia, diesem Mädchen, das sich mit seinen Sätzen bis aufs Mark entblößte, und liebte sie dafür. Und dann handschriftlich am Rand: »bis hierher und nicht weiter!« Das war wahrscheinlich Inge. »Stripteaseliteratur«, »Fräuleinwunder für lüsterne Alte«. »Frauen mögen so etwas nicht«, so Inges Anmerkungen. Aber als Geschenk war dieses Buch, das sie loswerden wollte und das andere für sie nun zu Ende lesen sollten und ihr das Wichtigste in ein paar zitierbaren Smalltalksätzen bei der nächsten Begegnung beim Italiener neben dem Essen her mitteilen, doch wieder einmal typisch Inge.
Und während erst gestern die ganz andere Irene meine Sachen für Köln zusammenpackte, hätte sie wahrscheinlich … auch noch jenen Schmetterling, der sich möglicherweise in mein Zimmer verirrt hätte, gerettet; und zwar mit den geschickten Handgriffen einer Frau, die zwei Semester Biologie studiert und erfolgreich die Präparationskurse I und II absolviert hatte. Gegen die Glaswand hin rettete ihn, den Schmetterling, seine Leichtigkeit; doch vielleicht noch am selben Abend wäre er während eines kurzen Gewitters von den Regentropfen erschlagen worden. Und wäre es heute gewesen, auf seinen unergründlichen Flugbahnen auf und ab und hin und her? Sie hätte ihn, den Schmetterling, zu dem der männliche Artikel wieder einmal gar nicht passte, und das Wort »Tier« passte irgendwie auch nicht, abermals gerettet, und zwar mit einem einfachen Wasserglas, das für diese Zwecke, bis hin zu den Spinnen, immer in Griffweite auf der Terrasse und an den Fenstern stand. So praktisch war sie. Das sah ich freilich nicht, doch ich wusste, wie ihre feinen Hände aussahen, und wie es aussah, wenn sie mit ihren Händen kam, und konnte mir es vorstellen und denken. Ich musste aber einfach an so etwas denken, wenn ich an Irene dachte, als ich daran dachte, wie sie mir wieder einmal eine Aufgabe mitgegeben hatte, und mich zugleich etwas ganz Liebes wissen ließ und mich auch behandelte wie einen Schmetterling, und dann musste ich lächeln wie Roberto Irazoqui in seiner Rolle als Jesus, wie er die Kinder an seinem Gewand zupfen sieht im Evangelium nach Matthäus, einem Film von Pier Paolo Pasolini. Und ein wenig sah ich damals immer noch aus wie er, der Hauptdarsteller. Zumindest konnte ich so schauen und lächeln. Das sagte nicht ich, sondern Irene. Wahrscheinlich saß Irene nun vor meinem Fenster, an meinem Schreibtisch, weil ich die schönere Aussicht hatte, vor allem auf diesen großen, unteilbaren Himmel, die Allmende der Augen. Ich konnte ja nie sehen, wie ich schaute, oder höchstens dann einmal, wenn ich mich selbst dabei erwischte, in irgendeinem zufälligen Spiegel, aber auch dann war es immer noch spiegelverkehrt, und dazu noch im Aggregatzustand der Zweidimensionalität, so dachte ich mir wieder einmal das Leben etwas zu poetisch und zu sehr um die Ecke.
In den Verkehrsnachrichten, mitten hinein in die WDR-Musik, hörte ich schon wieder: Bottrop. Die Verkehrsmeldungen wurden in ihrer Impertinenz nur noch von den Wetternachrichten übertroffen, das eine war immerhin manchmal lebenswichtig für die Autofahrer, denn immer wieder mussten Geisterfahrer gemeldet werden, die von den Psychologen auf lange Sicht durch »Falschfahrer« aus dem Verkehr gezogen werden sollten, um die sogenannten Verkehrsteilnehmer nicht zu schrecken; für das andere, das Wetter, hätten doch die Augen genügt. Und dann konnte ich zum Fenster hinausblickend sehen, was für ein schönes Wort am Himmel das Wort »bewölkt« war, wie ich es zwischen den Türmen des Doms und dem Himmelblau sehen und lesen konnte. Aber Bottrop hörte sich für mich, sorry, immer noch nach jenem Mülleimer an, der auf seine Erlösung wartet.
»Das hast du schnell gelesen«, hatte sie gesagt. Mit dem »du« meinte sie sich selbst, und vielleicht auch mich, hatte ich gedacht. Als gäbe es irgendein Buch auf der Welt, das ich hätte schnell lesen können. Aber mitgeben wollte sie mir das Buch doch nicht, bis ich es dann in meiner Wäsche fand, und ich musste noch einmal selig lächeln. Als ich mich daran erinnerte, wie ich auf Irenes P.S. stieß.
Ich hatte bemerkt, dass auch in diesem Hotel schon wieder jemand in meinem Gepäck gewühlt hatte, wahrscheinlich gestern Nachmittag, als ich bei den Übersetzern saß und dem Faulkner-Übersetzer und seinem Versuch, Als ich im Sterben lag neu zu übersetzen, lauschte, das war nun ein sogenanntes Projekt. Und das Wühlen in meinem Koffer im Lobby-Bereich war wohl nur der Versuch eines Menschen, etwas Wertvolles zu finden, doch dann war es nur P.S. I love you. Ja, dieses P.S. gefiel uns, die wir das Leben hinter uns hatten. Und schon kam mir wieder die Erinnerung in die Quere, die mir ihren Fuß zwischen Tür und Angel setzte, an der Tür zum Vergessen hin. Und machte uns auch ganz schön wehmütig.
Die Erinnerung sei der typischste Fall der Verdrängung, so hörte ich es, und als ich P.S. I love you in meiner Unterhose entdeckte … da wusste ich, dass der Streit wegen des »Poesie-Albums« von Elfi, in dem fast alle Männer, mit denen sie in den vergangenen zwanzig Jahren geschlafen hatte, in einer typischen Pose fotografiert, das heißt: festgehalten und aufgehoben waren, vielleicht verschmerzt, wenn auch nicht vergessen war. Am Ende hatte Irene nämlich mich in dem Album entdeckt, wie ich in der Datsche in Leest auf Elfis Bett sitze und so, wie mich Gott geschaffen hat oder nicht, in ihre Kamera lächle. Seither, es war ja samt meinem nachlassenden Leben erst im Mai gewesen, gab es nun eine Krise zwischen Irene und Elfi, eine Sendepause, und auch, wegen dieser Aufnahmen, zwischen Irene und mir. Elfi kam ja auch nicht zum Geburtstagsfest von Irene, heute vor einer Woche, und grollte wohl immer noch. Und dann, als wäre es nicht genug, kam mir meine Erinnerung auch schon wieder mit jenem schönen Satz in die Quere, wie ich mich schon wieder »Zieh dich aus« sagen höre. Und kam schon wieder auf andere Gedanken meiner Wollust. Der Satz »Zieh dich aus« kam in P.S. I love you wahrscheinlich nicht vor, wohl aber in meinem Hirn. Das machte mich irgendwie wehmütig. Der Satz »breakfast in bed with him« sagte mir, dass »Zieh dich aus« schon hinter ihnen lag. Das machte mich irgendwie noch wehmütiger. Dass alles so schnell vorbei gewesen war … auf dem Weg nach Köln, von Berlin hierher, da hatte ich gerade den Container vor unserem Haus gesehen.
Erst gestern war ich wieder an jenem Auszugscontainer vorbeigegangen, mit den ganzen alten Sachen, die er, der verstorbene Herr A., bis zuletzt nicht hatte wegwerfen können, die nun zu Müll geworden waren, den niemand mehr brauchen konnte, auch Sperrmüll, der entsorgt werden musste laut Mietvertrag. Da stand dieser wehmütige Container, der die letzten Sachen von Herrn Dr. Arenhövel, dem Herausgeber der Reihe Topographie des Terrors, aufgenommen hatte, die Seele des ganzen Hauses in den vergangenen vierzig Jahren. Er war praktisch der Erste der Menschen gewesen, die nach den Rosenstocks, den Menschen, deren Namen nun anderswo auf den Stolpersteinen erschienen, dieses Haus wieder belebt hatte. Auf dem Grund des Containers lag wohl eine halbe Tonne der unverkauften Restauflage der Topographie des Terrors.
Aus dem Container schaute ein alter Spazierstock heraus. Wohl der letzte, oder auch schon geerbt und nicht entsorgt, vielleicht die Erinnerung an seinen Vater, nicht übers Herz gebracht, ihn zu entsorgen, aber einmal wird es vorbei sein, und das war jetzt. Das hatte ich gerade noch gesehen, das Letzte, was ich auf dem Weg zum Hauptbahnhof vor meiner Haustür gesehen hatte von ihm: diesen Spazierstock. Es war ein alter Stock, sein letzter, der aus dem Container herausschaute. Der Rest, der von diesem Leben übrig blieb oder das übrig gebliebene Leben. Und ich dachte: Genauso ist es.
4. Irene
Auf den Tag genau vor einer Woche hatten sie ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert, was steuerlich nicht absetzbar war. Und auch den fünfzehnten Hochzeitstag, es war im Juni 1989 gewesen, der Termin war ihnen noch von Onkel Adalbert aufgeschwatzt worden, denn so konnten sie die Steuervorteile für
das ganze Kalenderjahr geltend machen, sagte er. Und nun sagten die Immobilienhändler von ihrer Wohngegend im 1-A-Segment oder Tripple A: Da werden die Wohnungen nicht verkauft, sondern vererbt. Und sprachen von Filetstücken und lichtdurchfluteten Residenzen auf der Höhe des Jahres 2000, vom Stall von Bethlehem an gerechnet. Es handelte sich vielleicht auch nur um lichtdurchflutete Schweineställe.
»Was ist Glück? Nachher weiß man es.«
»Es ist ein blonder Däne … und heißt Jesper … kommt von einer Insel im Kattegat. Hjelm«, sagte er, und Irene wusste freilich nicht, dass die Insel nicht bewohnt war. Aber es gab sie. Angeblich hatte Justus ihn im Netz gefunden, als Ersatz für Alain, der ja auf der Übersetzerkonferenz in Köln sein musste.
Irene schaute gleich bei Wiki nach.
Eigentlich lag die Zeit der Brandstiftungen hinter ihr.
»Und das ist gut so.« … Dass es ein Mann war, der neben ihr dreieinhalb Stunden lang die Tosca hören sollte, einer von 49 Prozent Menschheit auf der Welt, war noch nichts Besonderes. Dass er blond war, schon eher, denn wohl mehr als 95 Prozent ihrer Bewohner waren eigentlich schwarz und grau oder hatten ihre Haare schon verloren. Das meiste Blond war das Ergebnis einer Milliardenumsatzindustrie. Die reichste Frau Frankreichs, dem Land der Liebe, aus dem auch Alain kam, verdankte ihren Reichtum den Frauen und auch ein paar Männern, die blond sein wollten. Irene selbst war einmal eher dunkelblond gewesen und mit den Jahren immer blonder geworden, die Farbe, keine Beleidigung, passte zu ihr. Also ein blonder Däne, der neben ihr mitanhören und mitansehen müsste, wie Tosca singend in den Tod sprang. Das erwartete sie. Mehr wusste sie nicht.
Sie war nun vierzig, aber so viel Zeit schien auch wieder nicht vergangen, dass sie es nicht mehr gewusst hätte, und noch mehr: sich hätte nicht mehr an die Stelle erinnern können, wo die Verliebten »ich brenne« sagen, sich wenig später aus Liebe in den Tod stürzen wollen und es manchmal auch tun und so das Mainstreamglück immer wieder skandalös in Frage stellen. Wenn auch im gesungenen Fall nur als Theater. Denn danach würde die Tosca lachend beim Italiener sitzen inmitten privilegierter Zuhörer und Zuschauer, die auch dafür bezahlt hatten wie der Mörtel-Lugner für Andie MacDowell beim Wiener Opernball.
Tosca war aber eine von jenen Frauen, die mit ihrem Leben und Sterben den Mainstreamglauben, dass das Leben dem Tod vorzuziehen sei, grauenhaft konterkarierten, und den Suizidforschern, den Stardirigenten und Startenören und dramatischen Sopranen sowie der ganzen Kulturindustrie ein luxuriöses Leben ermöglichten und mit ihrem Tod auch noch finanzierten. Es war einer der lukrativsten Sprünge in den Tod aller Zeiten.
Auf die Tosca, zumal als Nachmittagsveranstaltung um 17 Uhr gegeben, hatte Irene nun noch weniger Lust. Immerhin: Ich kann diese Frau verstehen, dachte sie schon im Voraus, in ihrer prototypischen Liege von Bruno Paul, dem Vater des Designs, bei dem Mies van der Rohe, der eigentlich nur Mies hieß, Jahre in die Lehre gegangen war. Bruno Paul hatte immerhin ein Ehrengrab auf dem Dahlemer Waldfriedhof, »besaß« ließ sich ja schlecht sagen. Aber etwas zu verstehen bedeutete auch für Irene nicht unbedingt, dass sich ihre Lust darauf gesteigert hätte. Nicht alles, was wir verstehen können, ist etwas für mich. Das hatte sie bei mancher Zigarette herausgebracht, deren schönem Rauch sie nun wieder einmal hinterhersah. Den Menschen hinterhersehen, wie sie singend in den Tod sprangen und den Satz der Bremer Stadtmusikanten »Etwas Besseres als den Tod findest du überall« als falsch überführten, ja falsifizierten?
Immerhin: Bremen lag schon fast am Meer. Sie konnte es schon riechen, daher fuhr Irene auch so gerne nach Bremen. Von wo, vor nicht allzu langer Zeit, was waren schon hundert Jahre, wenn sie vorbei waren, eine schöne Frau, eine ihrer vier Urgroßmütter, in Begleitung der ganzen Familie unterwegs nach Potsdam war: Dort bekam ihr Papi aus der Hand des Kaisers einen höchsten Orden der Allerhöchsten Majestät überreicht. Anschließend durfte Irenes Urgroßmutter ein eigens dafür verfasstes Gedicht von Rudolf Alexander Schröder vortragen. Bei dieser Gelegenheit sah und hörte sie auch zum ersten Mal das Wunderkind, ihren späteren Mann Max, genannt Maxi, auf seiner Stradivari spielen, die er von der Fürstin Fugger geschenkt bekommen hatte, wohl aus Liebe. Die Ehe hielt aber nur die Geburt von drei Kindern lang.
Die Urgroßmutter wurde schuldhaft geschieden und verschwand auf dem Landgut ihres sächsischen Porzellanfabrikanten, das war schon in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts gewesen, warum eigentlich, das erfuhren die Nachgeborenen auch nie. Die drei Kinder blieben beim Wunderkind, das alsbald wieder heiratete, und gingen bald an seine zweite Frau über. Das preußische Recht verfügte es so, dass eine schuldhaft geschiedene Mutter ihre drei Kinder, die zwischen zwei und sechs Jahre alt waren, fünfzehn Jahre nicht sehen durfte. Am Ende starb das Wunderkind im Steckrübenwinter von 1917, ungewiss, ob verhungert oder erfroren, und hinterließ sechs Nachkommen, eine geschiedene, unglückliche Frau sowie eine rechtmäßige Witwe und eine Stradivari und einen Papagei. Und dann auch noch die Inflation, ein Wort, das Egon bis zu seinem Tod in seinem Wortschatz behielt und damit die oftmals wohlhabenden Gäste in Irenes Elternhaus schreckte. Und dann erst recht nach dem Mauerbau: Gleich hinter dem Haus ihrer Großeltern, in dem auch Tante Mausi bis zu ihrem durch die Tuttlinger Firma mit Gewalt erzwungenen Auszug gelebt hatte, begann damals der Todesstreifen, und mit dem Geld, auf die sechs Kinder aus der ersten und zweiten Ehe verteilt, wurde von Irenes Erbteilseite dann jene Sofagarnitur, auch sie von Bruno Paul entworfen, gekauft, die nun in Irenes Salon stand, und die Geschichte dazu erzählte sie immer wieder. Irenes Freundin Inge sagte dann jedes Mal: Ihr wollt auch alles gehabt haben und gewesen sein! Als hätte sie sich wieder einmal hinaufgeschwindelt.
Dabei war es eher hinaberzählt. Reichskanzler Fürst Bülow war der Freund von Irenes Ururgroßvater von der Bremer Seite, der wie der Kaiser gewollt hatte, er wäre Kolonialminister des Reichs geworden, die Briefe dazu gab es noch. Dieser Mann, von dem Irene in gerader Linie herrührte, sie war ja kein Baum und hatte keine Wurzeln, dirigierte die Schiffe des Norddeutschen Lloyd auf den Weltmeeren, dazu ein Heer von Arbeitern an Land, durchweg Männer. Zu diesem seltsamen Geschlecht gehörte auch der Kaiser. Die Geschichte Preußens endete bekanntlich in einem Holzhacker. So viel Ordnung musste sein. Aber seit 1989 lebte sie, die Geschichte Preußens, langsam wieder auf, gerade im Jahr, als Irene nach Berlin zurückgekehrt war, dieses Mal mit Alain. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Alles war nur gleichzeitig. Und der Mensch, der es nicht genauer wissen wollte, sprach dann von Zufall und träumte sich seine Geschichte hinzu und zurecht, denn Träumen war einfacher als Denken.
Zu Füßen der Bremer Stadtmusikanten, der Märchenfiguren und ihrem Denkmal, zwischen den Fisch- und den Würstchenbuden konnte sie das Meer schon riechen und träumen. Und gleich daneben den Roland, Weltkulturerbe mit seiner ungeheuren Schnalle mit dem musizierenden Engel drauf und wohl Rolands Schwanz gleich dahinter. So viel Ordnung musste sein. Ja, auch das Meer war eine große Gegenwart, und eine solche Nähe so weit weg vom Meer gab es nur in Bremen. »Mein Mann kommt vom Meer« oder »meine Frau liebt das Meer«, was für schöne Sätze, die mit »beati sunt« begannen, die an jedes Meer und jeden Beginn und jedes Ende einer Liebesgeschichte passten. Und manchmal noch dachte der übrig gebliebene Mensch »und ich dachte, sie liebt mich« dazu. Doch das Meer war vieles, am Ende auch noch ein Bauch, in dem alles verschwand, ein Loch, gefüllt mit Leben und Tod, Liebe, Hass und Müll. Und doch. Ja, sie liebte das Meer, immer noch, und daran würde sich wohl nichts mehr ändern, und dass sie nicht ans Meer gezogen war, würde einer der Fehler ihres Lebens gewesen sein, so dachte sie. Dass sie nicht ans Meer gezogen war: Das hätte sie heute vor einer Woche, als sie auf dem Geburtstagsabend »Was wir am meisten bereuen« spielten, bekennen müssen, fast schon eine Sünde, ihrem Leben gegenüber.
Alain kam (auch) vom Meer, mit dem sie immer noch verheiratet war, eigentlich mit beiden, mit Alain und dem Meer. Und es gab eigentlich keinen Grund mehr, sich von dem einen oder dem anderen zu trennen. Es war Bigamie.
Er kam aus der Ville d’Hiver, einem Stadtteil von Arcachon. Das war ganz im Westen Frankreichs, man konnte schon fast bis Amerika sehen, und der Abendhimmel war manchmal so blau wie eine Aral-Tankstelle, und von ihrem Haus konnte man noch etwas den Sand von der Düne von Pilat riechen, wie auch das Salz, und zwischen den schönen alten Meerkiefern hindurch sah man gerade noch die Spitze des Leuchtturms von Cap Ferret. Das Meer wurde vom Hinausschauen auch nicht kleiner. Das hatte der aufmerksame Mensch von vierzig Jahren, zu denen auch Mausi gehörte, längst herausgefunden. Und auch, dass der Vers von Horaz: »Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt«, stimmte. Das war selbst noch auf diesem Foto so, Datum »15.8.1983«, und hinten die Zeile: »Am Morgen, als wir uns das erste Mal zum Schwimmen aufmachten, kurz vor der Flut«, das sie auf ihrem Schreibtisch stehen hatte, als könnte ein Foto die Zeit festhalten, doch das blieb: eine Erinnerung. Und alles hatte in einem Satz Platz, die Wellen, das Foto, das Meer, du und ich. Es war ein Foto, gemacht von Elfi, gerade in dem Augenblick, als sie dabei waren, sich in Richtung Wellen aufzumachen, Alain und Babette, Toby und Irene, und auch noch Norbert. Und wie einer von ihnen wohl »kommst du« gerufen hatte. Und dass auch Irene damit gemeint sein konnte, die mit den anderen, die nun im Verlangen, sich mit dem Meer zu vermählen, in Richtung Wasser liefen, bald rannten. Kurz zuvor hatten sie noch auf ihrem Lieblingsplatz beim Bunker auf jenem Streifen aus Sand zwischen den Wäldern und dem Meer gelegen. Und dann, im Anschluss an dieses Foto verfolgten sie sich, als spielten sie, einmal zu dritt, einmal zu viert, einmal zu fünft, und einmal nur Alain und sie, wie Hunde, die hintereinander her waren, oder wie junge Katzen, als spielten sie. »Kommst du?« Doch die ganze Geschichte, die vergangene und auch noch die kommende, würde im Meer enden. Und das war auch an diesem Tag so, an dem es nicht dunkel werden wollte und die Nächte blau waren Ende Juni, und am Anfang, in der Mitte und am Ende aller Geschichten stand das Tuwort: lieben.
So war es auch mit ihnen, von der Küche im neunten Stock des Studentenheims UZH in Freiburg an, wo sie alle sich eines Tages entdeckten, und bald auch eines Nachts, und wie sie sich schon in der Küche gefragt hatten: »Willst du?«
Norbert war lange tot, Toby blieb verschwunden, und Alain war im Augenblick in Köln, seit gestern. Ihre Meerliebe, ihr Meerblick war unverwüstlich. Einst, es war an ihrem Lieblingsplatz, am Bunker, bei den Dünen, konnte sie den Leuchtturm von Cap Ferret sehen und den Himmel über dem Leuchtturm und alles riechen.
Auf die Tosca hatte sie, bei diesem blauen Himmel und seinen Amseln, die Ende Juni auch bald den Singbetrieb einstellten, nun noch einmal weniger Lust. Es war eigentlich nur wegen des blonden Dänen. Denn Irene war immer noch erwartungsvoll, diese Regung war ihr noch nicht abhandengekommen mit den Jahren. Die Geschenke von Inge lagen auch noch da. Es waren zwei Bücher: Abscheu vor der Weltgeschichte und P.S. I love you. Bis zum Abend hatte sie noch viel Zeit.
5. Alain
Ich kannte noch Menschen, die im Schlosshof vom Hausherrn gefragt wurden:
»Hatten Sie eine gute Anreise?«
»Ja … Ein kleiner Stau bei Baden-Baden.«
»Das freut mich!«
Derweilen warteten die Damen im Salon. Und taten hocherfreut, als ich in den camere separate aufkreuzte, in der Tiefe des Hauses, in der Beletage, wo die Salons waren. So etwas wurde ich beim ibis-Check-in freilich nicht gefragt. Das wollte man von mir nicht wissen. Da wollte man von mir nichts wissen, außer der Kreditkarte. Es war wie in der USA-Foreigners-Schlange von Chicago O’Hare. Sie sahen das Dr. – »So etwas brauchen wir hier nicht.« Und Leute standen um mich und den Check-in-Counter (das war aber nicht mein Wort, ich las es nur) herum, die lachten beim Wort »Dr.« und operierten virtuos mit den Wörtern IBAN und BIC, und andere waren bestimmt auch so patent, dass sie am Tag der offenen Tür ins Kanzleramt gingen und einmal selbst sehen wollten, von Tür zu Tür, wer da die ganze Arbeit für sie machte. Tante Mausi kannte noch den Direktor des Schrebergartenvereins Nuthewiesen, früher einmal als Allzweckwaffe in Diensten der Karows, der sich von seinen Vereinsmitgliedern mit »Herr Direktor« anreden ließ. Jene Menschen waren aber nun längst ausgestorben. Doch immer noch gab es auch solche wie mich, die sich sagen mussten: Ohne deine Irene und die Mastercard wärst du gar nichts (mehr).
Auch meine Hohenzollern’sche Großmutter – sie kam aus Deutschachberg, dem südlichsten Ort von Preußen, ein paar Kilometer hinter dem Bodensee – hat einst allen, die ins Haus kamen, zur Begrüßung eine Erfrischung, wie sie es nannte, angeboten und gefragt: »Hatten Sie eine angenehme Anreise?« Und dann haben sie immer gesagt: »Ja.« Und sie: »Das freut mich.« Wie ihnen das beigebracht worden war. Und dann kam Gerda mit dem Spirituosenwagen, der immer gerne angenommen wurde mit seinen Likörs und stellte den Gästen dazu eine Karaffe hin.
Hier im ibis profitierte ich immerhin von amerikanischem Lebensstil: Es gab einen Tauchsieder auf dem Zimmer und jederzeit die Möglichkeit, aus diesen vakuumverpackten Dingen mir einen Kaffee zu machen, der mir nicht schmeckte, aber es war ein Ritual, das mich von der Tatsache ablenkte, wie langweilig das Leben sein konnte. Yoko Ono, du blöde Kuh, dachte ich. Eine Theorie besagte, dass fünf bis sechs Glieder genügen, um mit jeder Person dieser Welt in Verbindung gekommen zu sein … und Inge meinte: Was, nur fünf bis sechs?
Ich wohnte also im … ibis, da hatten sie mich untergebracht. Immerhin: Von Christl, die damals noch nicht so berühmt war wie heute, Chevalier der Ehrenlegion geworden für ihre Stendhal-Übersetzungen, hatte ich schon gehört, sie wären in einem Hotel einquartiert, wo auf dem Bett eine schlechte Praline neben einem vielleicht ebensolchen Kondom lag. Wahrscheinlich kamen das Jahr über nur solche Leute. Meinte sie. Ein Bad gab es nicht, nur ein Waschbecken und ein Klo, das seinen Namen nicht verdiente, denn es war nur durch einen Plastikvorhang vom Bett getrennt. Dort liefen nachts ganz große Mäuse zwischen der Kloschüssel und jenem Verbindungsloch unter dem Bett hin und her. Ganz große Mäuse. So hatte es Tante Mausi als Kind gesagt, von den verwahrlosten Nachbarn zurück, welche die Küchenabfälle einfach hinters Haus warfen. Solche Leute konnte es auch mitten in einem Villenviertel geben. Alle sind nun längst tot, all das ist nun längst gegessen, aber Menschen gab es immer noch, denen das gar nichts ausmachte, vielleicht erregte sie noch die Vorstellung, das Stockwerksbad mit den anderen Schmutzfinken, noch ein Wort von Jean Paul, zu teilen, und dass durch das Schlüsselloch vielleicht jemand zusah … Aber das war ja in Hotels auch längst keine Möglichkeit mehr in Zeiten der Chipkarten.
Die Eröffnung war gestern Abend gewesen, das Wort »Schmutzfink«, das wir ebenso wie »Sprachgitter« Jean Paul verdankten, war noch nicht gefallen, denn Professor Pfotenhauer, mein Reiseziel, käme erst am Freitag wegen eines Pilotenstreiks. Das hatte ich in jenem Mehrzweckgebäude am Albertus-Magnus-Platz, genannt Universität, gestern Abend erfahren, meine Enttäuschung war groß. Eigentlich war ich, ehrlich, nur wegen des Eröffnungsvortrags Ich war nie zur rechten Zeit glücklich nach Köln gefahren. Nun kam es darauf an, zu improvisieren, was ich so den ganzen Tag machen sollte, diese Umstellung des Programms bedeutete für mich, so glaubte ich, den Verlust eines ganzen Tages. Ich war überhastet nach Köln aufgebrochen, um ja den Eröffnungsvortrag nicht zu versäumen, ich wollte sehen, was der Mensch aus seinen Sätzen machte, war direkt zum Albertus-Magnus-Platz gefahren, hatte nur mein schmales Gepäck in der Lobby zwischen Kaffeeautomat und Schwingtür zum Séparée deponiert, und ich hoffte, dass es noch da wäre, so war es auch, mein Koffer sah auch nach nichts aus. Da lagen auch einige Gratiskarten herum sowie gebrauchte Bücher, Mallorca von hinten war nicht dabei. »Late Check-in« war auch nicht mein Wort, doch ich war auf diese Wörter, die nicht meine waren, angewiesen, vor allem beim Zappen und Reisen – es gab da fast nur noch solche Wörter. Welche Räume ich nun auch durchfuhr, es waren nimmermehr meine.
Als ich von der Uni zurückkam, ging ich bald zu Bett, für einen Besuch eines der Nachtlokale, die ich kannte, war es noch viel zu früh, mir aber war es schon zu spät. Nach ein paar Häppchen und Wiedersehensbussis fuhr ich mit der Straßenbahn zurück, für den schönen Wein beim Italiener waren wir noch zu schlapp, hatten wir uns gesagt, erst einmal ankommen, auch wenn es draußen immer noch hell war. Es war schon 10 Uhr abends, ich kam zurück vom Ersatzvortrag Der unübersetzbare Schmerz bei Heimito von Doderer und bat um mein Gepäck, der Nachtportier war schon seit zwei Stunden im Dienst. Auf dem Display meines Handys hatte ich gerade noch eine »Lieferung von Viagra innerhalb von 1 Kalendertag« gesehen, so das unverlangte Angebot. Ich war immerhin in einem Hotel abgestiegen, das gerade noch über einen Nachtportier verfügte, dessen Blick mir allerdings sagte, dass er auch mich zu jenen rechnete, die es nicht geschafft hatten, ja, ich reiste ohne Rolex und mit einem ziemlich abgegriffenen Koffer der ersten Generation von Samsonite, und so sah ich schon am Blick des Nachtportiers genau, dass diese Leute keinen Respekt vor mir hatten. Also auch nicht vor sich selbst. Das wusste ich nun nach einer langen Zeit des Reisens, von Lobby zu Lobby. Denn wer hier als Nachtportier arbeitete oder auch nur zum Schlafen herkam, zählte zu denen, die es nicht ganz geschafft hatten. Die es vorerst nicht geschafft hatten. »Vorerst« war aber das Lieblingswort im Hirn der Loser, die dumm genug waren, das Glas für halbvoll zu halten, und noch nicht mit dem Gedanken spielten, dass die Hoffnung für jene ist, die schlecht informiert sind. Summa: Zum Zyniker hatte ich es doch nicht geschafft. Denn ich errötete manchmal immer noch, ganz für mich selbst, und verstotterte mich, wenn ich an mein Leben dachte. Ich war nun ein Mann von vierzig Jahren.
Dann habe ich noch in Goethe und seinen Zahnlücken in seinem Mann von fünfzig Jahren herumgelesen und von seiner Liebe mit bald achtzig, was wohl niemals mehr ins Altfriesische übersetzt werden würde. Lebte er heute, mit einer Lebenserwartung von hundert, bekäme er noch mit neunzig Viagra zugeschickt, zu Hause lägen nun überall Uhren und Brillen und Kontaktlinsen herum. Es sähe aus. Mit neunzig bekam der Mensch noch Viagra und Kreditangebote zugeschickt. Das war die Zuversicht der Kapitalmärkte. Das gute alte Wort Spekulant war durch das Wort Investor ersetzt. Der Papst war mir auch wieder erschienen in der vergangenen Nacht, und neben ihm wieder einmal Babette, auf die ich nach ihrem Verschwinden vor bald zwanzig Jahren lange noch gewartet hatte. Der Heilige Vater hatte mich abermals geduzt und zu mir gesagt, dass das Geld die Scheiße des Teufels sei. Das glaubte ich nicht, und ich widersprach ihm, man konnte doch so viel Schönes machen damit, doch Die Welt war der Ort, wo wir uns in der Zeit verloren hätte schon jetzt der Titel meiner Autobiographie sein müssen. Und Jochen, der auch ein Dichter war, hatte mir gerade geschrieben: »Wo Du ernst bist, bist Du am besten.«
Und das war’s dann wieder einmal gewesen, nur noch ins Bad musste ich kurz – musste ich? – und dann das Licht ausmachen. Gerade recht, so war es eben, dachte ich … so war ich eben, und ich war eingeschlafen, wie, kann ich nicht sagen, das meiste von dem, was bei mir von selbst funktionierte, wusste ich nicht, verstand ich nicht, angefangen mit dem Atmen.
6. Irene
Ich nöle etwas herum …
Irene lag immer noch auf ihrer Balkonlandschaft und lebte, unweit vom Bayerischen Platz, von dem aus sie, blickte sie nach links, den Mercedesstern auf dem Europa-Center sah, wie er sich drehte, auf der anderen Seite sah Irene den Gasometer auf der Roten Insel, noch rechtzeitig vor dem Ersten Weltkrieg fertiggestellt, zwischen zwei hochgewachsenen, mittlerweile hundertfünfzigjährigen Pappeln, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überstanden hatten, auf die schon Einstein geblickt haben mochte, bevor er aus diesem Viertel und Leben vertrieben wurde. Jetzt aber wurden sie zusammengestutzt, weil sie angeblich eine Gefahr darstellten, vielleicht waren es auch die nach oben guten Beziehungen der neuen Penthousebewohner, welche diese schönen, himmelhohen Bäume störten, kaum einmal war ein missratener darunter, auch das unterschied sie von den Menschen, die eines Tages für viel Geld von Dr. Mang zurechtgestutzt würden.
Irene aber wollte sich einen schönen Tag machen. Es war in der ersten Wowereit-Zeit, in der Wowereit-Zeit, die mit dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends zusammenfiel und für Alain, der es gerne gereimt hatte, schon fast ein Reim war. Hatte Professor Pfützenmeister, ihr Therapeut, mit dessen Namen es sich gut spielen ließ, ein anderes Mal war er Pfützenmeier, dann wieder Pfützenmeister oder gar Pfützenmacher, recht, der das Reimen als eine Nebenwirkung von Alains definitiv diagnostiziertem »leichten« Tourette sah? Der Name Wowereit war, wie vielleicht auch die systematisierungssüchtige Psychologie, die sich ja zu den Naturwissenschaften zählte, gewiss von einem preußisch-administrativen Sprachpanscher, vielleicht schon zu Beginn der Nazizeit, zurechtgestutzt worden, seine Mutter hatte vielleicht noch Wowieraitis geheißen. Das dritte Wowereit-Jahr wurde gerade gefeiert, die Stadt galt als arm, aber sexy. Als wäre das jemals in Berlin ein Widerspruch gewesen. Seitdem Irene, zusammen mit Alain, die Erbschaft ihrer Tante Mausi angetreten hatte, beziehungsweise das, was vom Vermögen der Tante und ihrem Satz »Für euch ist gesorgt!« noch geblieben war, ging es ihnen eigentlich ganz passabel, und sie hatten vielleicht nicht die Sorgen anderer Übersetzer, doch zufrieden mit ihrem Leben war sie eigentlich auch ganz unabhängig von jedem Geld. Sie konnte einfach so daliegen und musste nichts anderes tun, nicht einmal rauchen, nicht einmal schauen. Jetzt aber, da ihr Tante Mausis Satz eingefallen war, griff sie das erste Mal seit einer halben Stunde zu ihrer Zigarettenpackung. Über den Sinn des Lebens nachzudenken war vielleicht schwerer in einem Porsche als auf der Flucht. Irene konnte den Rauch zu etwas Rundem verwandeln, das bald mit dem Himmel verschmolz. Es sah schön aus.
An ihrer Tante Mausi geschult, deren Leben manchem als unstatthaft vorgekommen sein mochte mit seinen lebensnahen Sätzen und Männern, angefangen mit Onkel Adalbert, ihrem Mann, seinem Leben und seinen Sätzen (»Eine Lüge ist glaubwürdiger als zwei«, »Ich kenne deinen Gedanken nicht, aber ich missbillige ihn«), lebte Irene nun schon fast, was die Liebe betraf, wie ihre Tante nach dem Prinzip »Ich habe abgedankt«, und lebte gut und gerne damit, wenn auch das Wort »vegetarisch« eigentlich nur eine Vorstufe davon war.
Alain, der Mann, zu dem Irene aber nie »mein Mann« sagte, hatte sie gerade das erste Mal angerufen. Sie dachte: Hat er das Buch immer noch nicht entdeckt? Hat er sich wieder einmal immer noch nicht geduscht?
Irene lag und lebte, gerade hier, mitten in Berlin, in einer der kleinsten und abgelegensten, ruhigsten Straßen der Stadt, »fast schon so kurz wie die Tusnelda-Allee«, wie sie immer wieder von den Berliner Taxifahrern gesagt bekam. Ja. Leichtbekleidet, um nicht zu sagen: nackt und erwartungsvoll, auf ihrer einsehbar uneinsehbaren windgeschützten Dachterrassenlandschaft sah sie auch über den kleinen Park und die Haberlandstraße hinweg, woher eine schöne Musik, der Singsang eines Spielplatzes und schon um diese Zeit die Rufe von der Seitenlinie, die Vater- und Mutterstimmen kamen, »Jennifer pass auf!« Als es schon zu spät war. Der Klang von Fußball spielenden Lebewesen, der Ball in der Luft, und wie er mit den anderen Festkörpern zusammenstieß, und wie es klang. Alles zusammen, und dazu die wenigen kaum herauszuhörenden Autos, die im Fünfminutentakt auf Parkplatzsuche waren. Und dann noch die Amseln, die auch aus Liebe sangen, die wussten, dass das Schönste noch kommt.
Alles erinnerte Irene nun an zu Hause, an die Wiese, die zum See führte, wo sie damals bis zur Blauheit der Lippen ins Wasser springen konnte mit ihren Freundinnen, mit Elfi vor allem und auch den Freunden, und wenig später hatte sie ihm, dem einen Ersten, jeden seiner Küsse geglaubt. Es war eines solchen Nachmittags auf der Bank hinter dem Buschwerk aus Rosensträuchern und Jasmin, bei der Terrasse, wo Frau von Pyritz, ihre Großmutter, zusammen mit der Schwiegertochter von Frau Spoerl mit ihren zeitweisen Damen zusammensaß, und alle hatten nebenbei ein Auge auf die übernächste Generation, als wollten sie auch noch etwas aufpassen auf ihre schon zeugungsfähigen oder empfängnisbereiten Kinder, wie sie von ihrer Putzfrau, die die Unterwäsche in der Waschküche nach Geschlechtern getrennt sortierte, genau wussten. Ein diskreter Putzfrauenhinweis genügte, und sie waren auf dem neuesten Stand. Ich nöle etwas herum, hatte sie am Telefon zu Alain gesagt.
Die Post, die längst unten lag, hatte sie immer noch nicht geholt. Die Postbotin hatte sie schon um halb sieben herausgeklingelt und »Ein Eilbrief für Sie« in die Sprechanlage gegeben … »Werfen Sie den Brief ins Fach, vielen Dank«, und Irene ging zurück ins Bett.
7. Alain
Am anderen Morgen, und doch. Ich hatte mich aufgerappelt und hineingefunden in diesen Freitagmorgen, ich war mittlerweile schon wieder etwas zuversichtlicher und erwartungsvoller.
»Dass du wie ein Waldschrat aussiehst, weißt du«, von diesem Satz aus meinem Kopf war ich schon gleich nach 5 Uhr aus dem Bett getrieben worden. Dazu von meinem jüngsten Albtraum: Doch auch ein Albtraum rechnete zu den Träumen. Es war ein Traum, mein Traum, und ich hatte gerade als Letztes den Satz in Tante Mausis Testament gelesen: »Erben sind die Katzen Wiens«, und war davon aufgewacht. Und doch. Die Hoffnung, bald der Verdacht, dass all diese Autoren, und am meisten die leidenschaftlichen Aufsetzer von Testamenten, doch etwas vom Leben hatten, wenn sie schrieben, kam mir immer wieder beim Lesen. Nie war ich glücklicher als beim Lesen, dann hatte ich ganz vergessen, dass ich las, oder in dem Augenblick, da Lili Kraus das Andante con variazioni in f-Moll von Haydn gegen das Ende hin zulaufen ließ: bis zu jener Stelle am Wasserfall. Dada-dà!, ein Anapäst, den Abgrund hinab. Sie hatte auf der Hochzeit des Schahs von Persien gespielt, bei Marija Judina war es Mozart, Stalins Lieblingskomponist, den dieser von seiner Lieblingsinterpretin hören wollte. Die große, arme Judina, wie sie mit ihren Händen das Lacrimosa aus dem Requiem spielte, bei Lili Kraus war es noch Irenes Urgroßvater, das Wunderkind, gewesen, dem sie mit ihren Händen das Andante con variazioni vorgespielt hatte, und es folgte das Leben, es war in Budapest. So hatte mir das Irene gesagt.
Und dann wurde ich von den Nachtgespenstern im Morgengrauen, die zu dieser Zeit noch einmal über mich herrschten, aus dem Bett getrieben, und wie lange es so noch weitergehen sollte, wusste ich auch nicht. Auch andere Albträume hatten mich wieder gequält, zum Beispiel der Papst. Als wäre es nicht genug gewesen, wurde ich auch noch fast jede Nacht von Albträumen eingeholt. Es waren meine Albträume. Vor ein paar Nächten hatte es »Kommen Sie herein!« geheißen. Der Papst stand in einem Schiesserunterhemd im Konklavezimmer und war gerade dabei, sich für das Urbi et Orbi