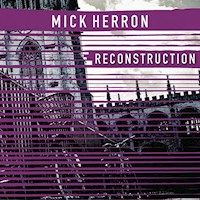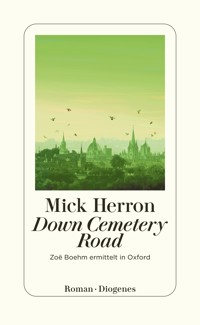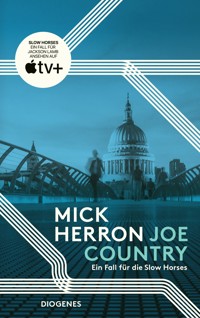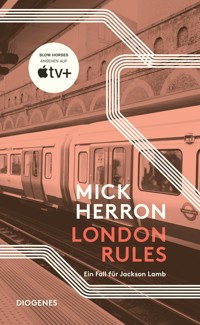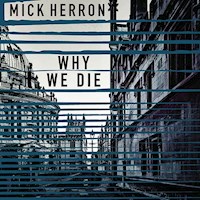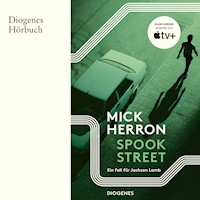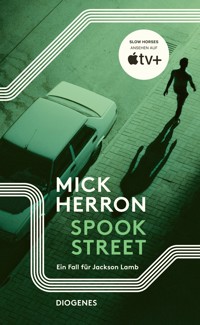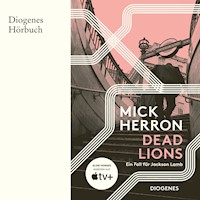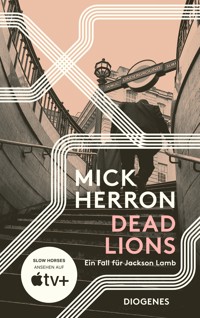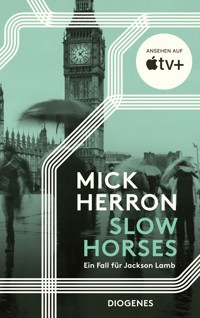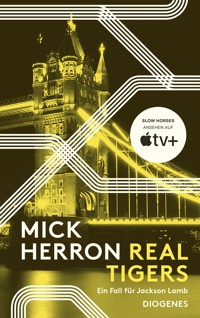
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jackson Lamb
- Sprache: Deutsch
Jackson Lambs Assistentin ist so diskret, dass es zuerst keiner merkt, als sie nicht zur Arbeit erscheint. Und erst recht nicht glaubt, dass sie entführt wurde … von einem ehemaligen Liebhaber. Doch Catherines Entführung ist nur die Spitze des Eisbergs einer viel größeren Verschwörung – gegen den MI5 und sogar gegen den Premierminister.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mick Herron
Real Tigers
Ein Fall für Jackson Lamb
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer
Diogenes
Für Eleanor
1
Wie die meisten Varianten des Verderbens begann auch diese mit Männern in Anzügen.
Ein Wochentag am Rand der Stadt: feucht, dunkel, neblig, noch vor fünf Uhr früh. In den nahe gelegenen Hochhäusern, von denen einige bis zu zwanzig Stockwerke hoch aufragten, waren verschiedene Fenster beleuchtet, die zufällige Muster in den Glas- und Stahlrastern der Fassaden bildeten. Manche dieser Lichter bedeuteten, dass bettflüchtige Banker an ihren Schreibtischen saßen und die Märkte sondierten, doch hinter den meisten waren die anderen Stadtarbeiter am Werk, diejenigen, die Overalls trugen und deren frühmorgendliche Aufgaben im Staubsaugen, Wischen und Entleeren von Mülleimern bestanden. Paul Lowells Sympathien galten Letzteren. Du beseitigst entweder den Dreck anderer Leute oder nicht – genau darin bestand das Klassensystem, deutlicher ging’s nicht.
Er blickte auf die Straße hinunter. Achtzehn Meter waren ziemlich hoch, so von oben betrachtet. Er ging in die Knie und spürte, wie die entsprechenden Muskeln protestierten und sich der billige Stoff seiner Hose unangenehm um die Oberschenkel spannte. Der Anzug war zu klein. Lowell hatte gehofft, der Stoff wäre dehnbar genug, doch jetzt, im entscheidenden Moment, fühlte er sich eingeengt, und er zog aus dem Anzug nicht das Selbstvertrauen, das er sich von ihm erhofft hatte.
Vielleicht wurde er einfach zu dick.
Lowell befand sich auf einer Plattform – was wahrscheinlich nicht der richtige architektonische Begriff dafür war –, oben auf einem Überbau, unter dem die London Wall hindurchführte, die zweispurige Durchgangsstraße zwischen der Aldersgate und der Moorgate. Über ihm ragte ein weiteres Hochhaus auf, Teil einer schräg stehenden Doppelkonstruktion, in der eine der weltweit führenden Investmentbanken sowie eine der berühmtesten Pizzaketten ansässig waren. Hundert Meter entfernt verlief auf einem grasbewachsenen Hügel am Rand der Fahrbahn ein Stück der römischen Mauer, der die Straße ihren Namen verdankte, einer Mauer, die einst die Stadt umgeben hatte, noch Jahrhunderte nachdem ihre Erbauer längst unter der Erde lagen. Ein Symbol, das erkannte Lowell in diesem Moment. Manche Dinge überdauerten, überlebten den Wandel der Zeiten, und es lohnte sich, für den Erhalt ihrer Überreste zu kämpfen. Das war es im Grunde auch, warum er jetzt hier war.
Er wand die Schultern aus den Trägern seines Rucksacks, stellte ihn zwischen seine Knie, öffnete einen Reißverschluss und packte den Inhalt aus. In etwa einer Stunde würde sich der Verkehr in Richtung Stadtzentrum und nach Osten verdichten. Ein Gutteil davon würde unter dem Überbau durchfahren, auf dem er saß, und all diese Autos, Taxis, Busse und Fahrräder würden unweigerlich zu Zeugen werden. Und in ihrem Kielwasser würde das Unvermeidliche folgen: die Nachrichtenteams und Kameras, die seine Botschaft der Nation verkünden würden.
Alles, was er wollte, war, sich Gehör zu verschaffen. Nachdem man ihm jahrelang seine Rechte verweigert hatte, war er bereit zu kämpfen, und wie andere vor ihm hatte er sich für eine bestimmte Methode entschieden. So wurden Traditionen geboren. Er glaubte keine Sekunde daran, dass seine heutige Tat weitreichende Bedeutung haben würde, aber andere in seiner Lage würden hinsehen, daraus lernen und vielleicht ebenfalls handeln. Eines Tages würde sein Beitrag bedeutsam werden.
Er hörte etwas, drehte sich um und sah, wie sich eine Gestalt auf das hintere Ende der Plattform hievte, nachdem sie das Gebäude von der Straße aus erklettert hatte, so wie Lowell es zehn Minuten zuvor getan hatte. Es dauerte einen Moment, bis er erkannte, wer es war, aber dann klopfte sein Herz vor Aufregung, als wäre er wieder zwölf Jahre alt. Denn das war es, wovon jeder Zwölfjährige träumte, dachte er, als sich der Neuankömmling näherte. Das war der Stoff, aus dem die Träume kleiner Jungs gemacht sind.
Groß, breit und zielstrebig schritt Batman durch feuchte Nebelbänder auf ihn zu.
»Hey«, rief Lowell ihm zu. »Schickes Kostüm!«
Er blickte an seinem eigenen hinunter. Spiderman war kaum altersgerecht für ihn, aber er wollte schließlich nicht modisch punkten: Sein Ziel war es, in die Abendnachrichten zu kommen, und Superheldenanzüge triggerten die richtigen Medienkanäle. Es hatte schon vorher funktioniert und würde wieder funktionieren. Er war also Spiderman, und der Typ, den er heute zum ersten Mal traf und mit dem er alle Absprachen anonym über ein Message Board getroffen hatte, war Batman. Sie beide als Paar würden einen Morgen lang ein dynamisches Duo bilden und für den Rest der Woche durch die Nachrichtensendungen geistern. Mit einer Hand auf der Leinwandrolle, die er ausgepackt hatte, richtete sich Lowell auf und hielt dem Mann die andere Hand hin, denn auch das war Teil einer alten Tradition: Männer treffen sich, begrüßen einander, verbünden sich und machen gemeinsame Sache.
Batman ignorierte Spidermans ausgestreckte Hand und schlug ihm ins Gesicht.
Lowell fiel rückwärts, die Welt geriet außer Kontrolle: Beleuchtete Bürofenster sausten vorbei wie Sternschnuppen, und alle Luft entwich seinen Lungen, als er auf feuchtes Mauerwerk aufschlug. Doch schon hatte sein Verstand in Arbeitsmodus geschaltet, und er rollte sich seitwärts, weg vom Rand, als Batmans Fuß mit voller Wucht niedersauste und seinen Ellbogen nur knapp verfehlte. Er musste auf die Füße kommen, aus der Bauchlage konnte niemand einen Kampf gewinnen, und darauf konzentrierte er sich für die nächsten zwei Sekunden, anstatt sich zu fragen, warum ihm Batman die Scheiße aus dem Leib prügelte. Seine Konzentration hätte sich beinahe ausgezahlt, denn er schaffte es auf die Knie, bevor ihn erneut ein Schlag am Kopf traf. Blut sickerte durch Lowells Spiderman-Maske. Er versuchte zu sprechen. Ein unverständliches Gurgeln war alles, was er hervorbrachte.
Und dann wurde er zum Rand der Plattform geschleift.
Er schrie, weil klar war, was als Nächstes passieren würde. Batman hielt ihn unter den Achseln gepackt, und er konnte sich nicht befreien – die Hände des Mannes waren wie aus Stahl. Er trat um sich und traf die Leinwand, die zum Rand rollte und sich dabei entfaltete. Er schwang einen Arm in Richtung von Batmans Schritt, traf aber stattdessen einen harten, muskulösen Oberschenkel. Und dann hing er im Leeren, nur noch von den Händen des Kreuzritters im Umhang gehalten.
Für einen Moment verharrten sie in einer Beinahe-Umarmung, Batman starr aufrecht, Spiderman baumelnd, als posierten sie für eine Cover-Illustration.
»Nein!«, flüsterte Spiderman.
Batman ließ ihn fallen.
Die Leinwandrolle kam vor Paul Lowell auf der Straße auf, war bis dahin aber keine Rolle mehr, denn sie wickelte sich über dem Asphalt auf und wurde anstatt des Banners, das er sich vorgestellt hatte, zu einem Teppichstreifen. In dreißig Zentimeter hohen Buchstaben zerfloss sein handgemalter Kampfschrei, GERECHTIGKEIT FÜR VÄTER, als die Bodennässe in den Stoff eindrang, zusammen mit einer nicht unwesentlichen Menge von Lowells Blut. Dennoch gab sie ein erfreulich nachrichtentaugliches Bild ab und würde noch vor Ende des Tages in vielen Sendungen erscheinen.
Von denen Paul Lowell jedoch keine mehr sah.
Was Batman anging, so war er schon längst fort.
Erster TeilFalsche Freunde
2
An einem höllisch heißen Abend öffnet sich im Bezirk Finsbury eine Tür, und eine Frau tritt hinaus in einen Hof. Nicht vorne auf die Straße – sie verlässt Slough House, und die Haustür von Slough House öffnet und schließt sich bekanntermaßen nie –, sondern in einen Hof, in den nur selten Sonnenlicht fällt und dessen Wände folglich von einer weichen Schimmelschicht bedeckt sind. Hier herrscht ein Geruch von Verwahrlosung, der sich mit einiger Konzentration als Mischung aus Essen und Fett aus dem chinesischen Restaurant identifizieren lässt, abgestandenem Zigarettenrauch, längst getrockneten Pfützen und etwas Undefinierbarem aus dem Abfluss, das in einer Ecke gurgelt und am besten nicht genauer untersucht werden sollte. Noch herrscht nicht völlige Dunkelheit – es ist die blaue Stunde –, aber im Hof scheint die Nacht bereits angebrochen zu sein. Die Frau hält nicht inne. Es gibt nichts zu sehen.
Doch angenommen, sie selbst würde beobachtet – angenommen, der leichte Luftzug, der beim Schließen der Tür an ihr vorbeihuschte, war keine ersehnte Brise, wie sie der August auszuschließen scheint, sondern ein wandernder Geist auf der Suche nach einem Ruheplatz –, dann könnte der Moment vor dem Schließen der Tür eine kurze Gelegenheit bieten. Schnell wie ein Sonnenstrahl schlüpft er hinein, und weil Geister, vor allem Wandergeister, keine Langweiler sind, würde sich alles Folgende lediglich in einem Wimpernschlag abspielen, nämlich die blitzartige Sondierung dieses halbvergessenen und völlig ignorierten Nebengebäudes, dieses »administrativen Verlieses« des Geheimdienstes, wie es einst genannt worden war.
Unser Geist schwebt die Treppe hinauf, da sich keine andere Möglichkeit bietet, und registriert dabei die Konturen an den Treppenwänden – eine zerklüftete braune, schuppige Markierung wie die Umrisse eines unvollendeten Kontinents, die anzeigt, wie hoch die Feuchtigkeit gestiegen ist; ein welliges Gekritzel, das man im Dunkeln fast für züngelnde Flammen halten könnte. Eine phantasievolle Vorstellung, verstärkt jedoch durch die Hitze und die allgemein bedrückende Atmosphäre, die das Haus erstickt, als übe jemand – etwas – einen bösartigen Druck auf alle darin aus.
Auf der ersten Etage: zwei Bürotüren. Unser Geist sucht sich wahllos eine aus und landet in einem unordentlichen, schäbigen Büro mit zwei Schreibtischen, auf denen zwei Computer stehen; die Stand-by-Lämpchen ihrer Monitore blinken lautlos im Dunkeln. Verschüttete Flüssigkeiten wurden so lange nicht weggewischt, dass sie sich zu Flecken entwickelt haben, Flecken, die so lange ignoriert wurden, dass sie zur Farbgebung beitragen. Alles ist gelb oder grau, entweder kaputt oder repariert. Ein Drucker, der in einen zu engen Zwischenraum gequetscht wurde, weist einen gezackten Riss quer über der Klappe auf, und der Lampenschirm aus Papier, der eine der Birnen an der Decke verhüllt – die andere hat gar keinen –, ist zerrissen und hängt schief. Der schmutzigen Tasse auf einem der Schreibtische fehlt der Griff. Das benutzte Glas auf dem anderen hat einen Sprung. Der Lippenstift am Rand ist ein Gruselkuss, ein höhnisches, fettiges Grinsen.
Dies ist also kein Ort für einen wandernden Geist: Unserer rümpft die Nase, wenn auch nicht hörbar, bevor er verschwindet und danach im angrenzenden Büro wiederauftaucht, dann in den beiden Büros im nächsten Stockwerk und schließlich auf dem Treppenabsatz in der Etage darüber, um sich einen Überblick über das Gebäude als Ganzes zu verschaffen … der, wie sich herausstellt, nicht gerade vorteilhaft ausfällt. Diese scheinbar leeren Räume sieden vor unterdrücktem Groll, sie schäumen vor Frustration und nicht wenig bitterer Galle; sie winden sich in den Qualen von erzwungener Trägheit. Nur einer unter ihnen – der mit dem modernsten Computer – wirkt von dem Leid der ewigen Langeweile relativ unberührt; und nur ein anderer – der kleinere der beiden im obersten Stock – zeigt Anzeichen effizienter Arbeit. Alle übrigen vibrieren von der ständigen Schinderei sinnloser Aufgaben; von Aufträgen, die für untätige Hände gesucht und gefunden wurden und scheinbar aus der Verarbeitung von riesigen Mengen an Informationen bestehen, Rohdaten, die sich kaum von einem Durcheinander verstreuter Alphabete unterscheiden lassen, gewürzt mit Zufallszahlen. Als wären die Verwaltungsaufgaben eines Speicherdämons ausgelagert und den hiesigen Bewohnern aufgebürdet worden; es wird von ihnen erwartet, diese scheinbar alltäglichen Pflichten endlos und unaufhörlich zu erfüllen; andernfalls werden sie in eine noch entlegenere Finsternis katapultiert – verdammt, wenn sie es tun, und verdammt, wenn sie es nicht tun. Der einzige Grund für das Fehlen eines Warnschildes, beim Betreten des Hauses jede Hoffnung fahrenzulassen, ist, wie jeder Büroangestellte weiß, die Tatsache, dass es nicht die Hoffnung ist, die einen umbringt.
Was einen tötet, ist das Wissen, dass es die Hoffnung ist, die einen umbringt.
Unser wandernder Geist hat von diesen Räumen gesprochen, dabei hat er einen ausgelassen – den größeren der beiden auf der oberen Etage, der zwar in Dunkelheit gehüllt, aber dennoch nicht leer ist. Wenn unser Geist Ohren hätte, müsste er nicht mal eines an die Tür pressen, um dies festzustellen, denn der Lärm, der von drinnen kommt, ist nicht zu überhören: Er ist laut und polternd und könnte ebenso gut von einem Bauernhoftier stammen. Und unser Geist schaudert leicht, in einer fast perfekten Imitation eines menschlichen Schreckens, und noch bevor dieses laute Grollen, halb Schnarchen, halb Rülpsen, ganz verstummt, ist er schon wieder durch Slough House hinabgeschwebt; vorbei an den Bürohöhlen im zweiten und ersten Stock und dann die letzte Treppe hinunter, außer der es im Parterre nichts gibt, da das Haus zwischen einem chinesischen Imbiss und einem Zeitungskiosk eingekeilt ist. Dann gleitet er hinaus in den schimmligen, muffigen Hof, gerade, als die Zeit sich wieder manifestiert und unseren wandernden Geist auslöscht wie ein Scheibenwischer, der ein Insekt wegfegt, so plötzlich, dass er ein leises Plopp hinterlässt, jedoch diskret und höflich genug, damit die Frau es nicht bemerkt. Stattdessen zieht sie an der Tür – sie vergewissert sich, dass sie geschlossen ist, obwohl sie meint, es gerade schon einmal getan zu haben –, und dann macht sie sich mit der gleichen Effizienz, die sie in ihrem Büro im obersten Stockwerk verbreitet hat, auf den Weg vom Hof in die Gasse und um die Ecke auf die Aldersgate Street, wo sie nach links abbiegt. Sie ist kaum fünf Meter gelaufen, als ein Geräusch sie erschreckt: kein Plopp, kein Knall und auch kein explosiver Rülpser wie die, auf die Jackson Lamb spezialisiert ist, sondern ihr eigener Name, ausgesprochen von einer Stimme aus einem anderen Leben, Cath-
erine?
Wer ist da?, fragte sie sich. Freund oder Feind?
Als ob solche Unterscheidungen wichtig wären.
»Catherine Standish?«
Diesmal erfasste sie der Schauer der Erkenntnis, und für einen Moment schien ihr Geist zu blinzeln, obwohl sie keine Miene verzog. Sie versuchte, eine Erinnerung heraufzubeschwören, die wie hinter Milchglas Gestalt annahm. Dann klärte sich die Sicht, und das Glas, durch das sie schaute, war der Boden eines Cocktailglases, jetzt leer, aber mit einem dünnen Film bedeckt.
»Sean Donovan«, sagte sie.
»Du erinnerst dich an mich.«
»Ja. Natürlich.«
Weil er kein Mann war, den man so einfach vergaß – groß und breitschultrig, mit einer Nase, die zweimal gebrochen war – eine gerade Zahl, wie er einmal gescherzt hatte, sonst würde sie noch schiefer aussehen –, und obwohl er sein inzwischen graumeliertes Haar länger trug als in ihrer Erinnerung, war es immer noch geradezu militärisch kurz. Seine Augen hingegen waren noch genauso blau, wie sollte es auch anders sein, doch selbst im verblassenden Licht erkannte sie, dass sie heute Abend das gewittrige Blau seiner düsteren Momente hatten und nicht den Ton eines Septemberhimmels. Groß und breit hatte sie bereits registriert; er war sicher doppelt so massig wie sie. Ein seltsames Paar mussten sie abgeben, wie sie hier in der blauen Stunde standen: er ganz offensichtlich ein Krieger und sie in einem bis zum Hals zugeknöpften Kleid mit Spitze an den Ärmeln und Schnallenschuhen.
Da es angesprochen werden musste, sagte sie: »Ich wusste gar nicht, dass du …«
»Dass ich draußen bin?«
Sie nickte.
»Schon seit ’nem Jahr. Dreizehn Monate.« Auch seine Stimme hatte sich in ihre Erinnerung eingebrannt; dieser Hauch eines irischen Tonfalls. Sie war noch nie in Irland gewesen, aber manchmal hatte sich ihr Kopf bei seinen Worten mit sanften grünen Bildern gefüllt.
Wobei der Alkohol natürlich geholfen hatte.
»Ich könnte dir ganz genau sagen, wie viele Tage es sind«, fügte er hinzu.
»Muss hart gewesen sein.«
»Du hast keine Ahnung«, sagte er. »Du hast nicht die geringste Ahnung.«
Darauf wusste sie nichts zu erwidern.
Sie standen reglos da, und das war in ihrem Beruf nicht ratsam. Sogar Catherine Standish, die nie im Außeneinsatz gewesen war, wusste das.
Er las es an ihrer Haltung ab. »Du wolltest in diese Richtung?«
Dabei zeigte er auf die Kreuzung Old Street.
»Ja.«
»Ich begleite dich, wenn ich darf.«
Und das tat er, einfach so, als wäre ihre Begegnung das, was sie zu sein schien: ein zufälliges Treffen an einem Sommerabend, während der Tag allmählich seinen Glanz verlor; ein alter Freund (wenn man ihn als solchen bezeichnen konnte) traf zufällig auf eine Freundin und wollte den Moment der Trennung noch ein wenig hinauszögern. In einer anderen Zeit, dachte Catherine, und vielleicht sogar in einigen Winkeln von dieser hier hätte er sie beim Gehen untergehakt, was süß und ein wenig kitschig gewesen wäre, aber vor allem verlogen. Denn Catherine Standish – die nie im Außeneinsatz gewesen war – wusste auch dies: Zufällige Begegnungen konnten an vielen Orten und mit vielen Menschen geschehen, aber nie ausgerechnet hier, zwischen zwei Schnüfflern.
In einer Bar in der Nähe von Slough House sinnierte Roderick Ho über Frauen.
Das hatte er in letzter Zeit oft getan, und zwar aus gutem Grund. Zunächst einmal, weil alle dachten, Roddy und Louisa Guy hätten längst zusammenkommen sollen. Louisas Affäre mit Min Harper war Geschichte, und wenn das Internet Ho eines gelehrt hatte, dann, dass Frauen Bedürfnisse hatten. Er hatte ebenfalls gelernt, dass es immer jemanden gab, der selbst auf die lächerlichsten Betrügereien hereinfiel. Wollte man auf einem Message Board einen Shitstorm heraufbeschwören, genügte es, etwas leicht Kontroverses über 9/11, Michael Jackson oder Katzen zu posten – yep: In gewisser Weise hatte das Internet Ho zu dem Mann gemacht, der er war. Roddy war ein autodidaktischer Einwohner Großbritanniens im 21. Jahrhundert und wusste sich entsprechend zu verhalten.
Die Schlampe war reif, das war seine Interpretation.
Die Schlampe war fällig.
Er brauchte nur noch die Hand auszustrecken und sie zu pflücken.
Doch auch wenn die Theorie neun Zehntel des Spiels ausmachte, hatte er doch Probleme mit dem verbleibenden Rest. Er sah Louisa fast jeden Tag und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, in der Küche aufzutauchen, wenn sie Kaffee kochte, aber sie deutete seine Signale immer wieder falsch. Er hatte sogar angemerkt, und zwar schon vor über einer Woche, dass es doch sinnvoll wäre, wenn sie gleich Kaffee für zwei kochte, da sie doch beide von dem gleichen Bedürfnis nach Koffein getrieben würden, aber das war völlig an ihr vorbeigegangen, und sie kehrte nach wie vor mit nur einer Tasse zurück in ihr Büro. Ihr mangelndes Verständnis von Balzritualen war geradezu lächerlich und zwang ihn, etwas ratlos, nach Wegen zu suchen, um sich auf ihr Niveau herabzulassen.
Ho mochte Kaffee nicht einmal. So viel war er bereit auf sich zu nehmen!
Es gab natürlich Strategien, auf die er gestoßen war oder von denen er gehört hatte: Sei freundlich, sei aufmerksam, hör zu. Mein Gott noch mal – lebten diese Leute noch in Holzhütten? Solcher Quatsch dauerte ewig, und Louisa wurde schließlich nicht jünger. Was Ho anging, so hatte er offen gesagt auch seine Bedürfnisse, und obwohl das Internet die meisten von ihnen stillte, wurde er allmählich ein wenig angespannt. Louisa Guy war eine sensible Frau, und es gab Männer, die versuchen könnten, das auszunutzen. Zum Beispiel hielt er River Cartwright durchaus für fähig, sein Glück zu versuchen, und obwohl Cartwright ein Idiot war, könnte eine sensible Frau zweifellos für so etwas empfänglich sein, besonders eine, die Signale nicht zu deuten wusste.
Also dachte sich Ho, er könnte vielleicht ein wenig praktische Hilfe gebrauchen. Deshalb saß er jetzt mit Marcus Longridge und Shirley Dander, die sich das Büro neben seinem teilten, in dieser Kneipe.
»Und, habt ihr in letzter Zeit mal mit Louisa gesprochen?«, fragte er.
Marcus Longridge grunzte.
Die beiden waren die Neuzugänge bei den Slow Horses, und deshalb redeten sie wohl nicht so viel. In Slough House herrschten keine starren hierarchischen Strukturen, aber es war ziemlich klar, dass, abgesehen von Lamb in seinem Büro ganz oben, Roddy Ho der wichtigste Mann war – der Laden lief mit Grips, nicht mit Muskeln. Daher mussten ihn diese beiden als ihren natürlichen Vorgesetzten betrachten und reagierten entsprechend eingeschüchtert. Ho wäre es an ihrer Stelle genauso ergangen. Er trank einen Schluck von seinem alkoholfreien Lager und versuchte es erneut.
»Gar nicht? Weder in der Küche noch sonstwo?«
Wieder grunzte Marcus.
Marcus war schon über vierzig, wie Ho wusste, aber dennoch durfte man ihn nicht unterschätzen. Er war groß, dunkelhäutig, verheiratet und hatte definitiv mindestens einen Menschen getötet. Nichts davon konnte Ho jedoch von seiner Einschätzung abbringen, dass Marcus ihn, Ho, wahrscheinlich für eine jüngere Version von sich selbst hielt. Es musste doch nützliche Erfahrungen geben, die er bereitwillig weitergeben würde, und aus diesem Grund hatte er sich Marcus für einen Männerabend ausgesucht. Ein paar Bierchen, ein paar Witzchen, und dann würde man sich näherkommen. Dieses Stadium zu erreichen war jedoch ein harter Kampf, solange Shirley Dander auf der anderen Seite von Marcus saß wie ein bösartiger Hydrant. Er hatte keine Ahnung, warum sie mitgekommen war, aber durch sie war die Atmosphäre verkrampft.
Sie hatte eine Packung Chips aufgerissen und vor sich ausgebreitet wie eine Picknickdecke, doch als er sich bedienen wollte, hatte sie ihm auf die Hand geschlagen. »Hol dir deine eigenen.« Sie stopfte sich jetzt etwa fünfzehn Prozent der Gesamtmenge in den Mund, und nachdem sie das getan hatte, kaute sie kurz und fragte: »Worüber?«
Ho warf ihr einen Blick zu, der bedeutete: Das ist ein Männergespräch!
»Was ist los?«, fragte sie. »Hast du deine Limo in den falschen Hals gekriegt?«
»Das ist keine Limo.«
»Na klar.« Mit ein paar Schlucken von ihrem definitiv nicht alkoholfreien Lager spülte sie die Chips runter und kehrte zum Thema zurück. »Worüber sollten wir mit Louisa reden?«
»Na, du weißt schon. Alles Mögliche.«
Shirley fragte: »Soll das ’n Witz sein?«
Marcus starrte in sein Bier. Er trank Guinness, und Ho hatte minutenlang gegrübelt, mit welchem witzigen Kommentar er bemerken könnte, dass Marcus und sein Bier die gleiche Farbe hatten – Alltagskomik –, wartete aber noch auf den richtigen Moment. Der bald kommen könnte, wenn Shirley endlich die Klappe hielt.
Doch das tat sie nicht.
»Das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Was meinst du damit?«, fragte er zurück.
»Louisa. Du denkst, du hättest bei ihr Chancen?«
»Wie kommst du denn darauf, dass ich …«
»Ha! Das ist ja irre! Du glaubst im Ernst, du hättest Chancen bei Louisa?«
Marcus sagte: »Oh, mein Gott, ich erschieß mich«, ohne sich explizit an einen der beiden zu wenden.
Nicht zum ersten Mal in seinem Leben fragte sich Roderick, ob seine Menschenkenntnis noch ausbaufähig war.
Sean Donovan sagte: »Du arbeitest nicht mehr im Park.«
Da dies keine Frage war, antwortete Catherine nicht und sagte stattdessen: »Ich bin froh, dass du wieder draußen bist, Sean. Ich hoffe, es geht jetzt aufwärts.«
»Seit damals ist viel Wasser die Themse runtergeflossen.«
Das sagte er jedoch mit einem Ausdruck, als hätte er viel Zeit damit verbracht, auf der Brücke darauf zu warten, dass die Leichen seiner Feinde vorbeitrieben.
Sie näherten sich der Kreuzung, an der sich ein paar Fahrzeuge stauten, hauptsächlich Taxis. Durch die Fenster des gegenüberliegenden Pubs konnte sie Köpfe erkennen, die sich beim Reden und Lachen bewegten. Es war kein Pub für eingefleischte Säufer, nur für Gelegenheitstrinker. Sie nahm Sean Donovan an ihrer Seite sehr bewusst wahr, seine durchtrainierte Soldatenstatur. Obwohl schon weit über fünfzig, sah man ihm an, wie muskulös und fit er war. Er musste im Knast mit Gewichten trainiert und in seiner Zelle Liegestütze, Sit-ups und andere Kraftübungen gemacht haben, um seine Muskeln zu stärken.
Mehrere Busse hintereinander rollten vorbei. Catherine wartete, bis ihr Dröhnen abebbte, und sagte: »Ich muss jetzt los, Sean.«
»Kann ich dich nicht zu einem Drink überreden?«
»Ich trinke nicht mehr.«
Er pfiff leise. »Ganz schön hart …«
»Ich komme zurecht.«
Das war einerseits die Wahrheit, andererseits auch nicht. Meistens stimmte es. Doch es gab schwierige Phasen, an frühen Sommerabenden – oder in späten Winternächten –, in denen sie sich von ganz allein betrunken fühlte, als wäre sie rückfällig geworden, ohne es zu merken, und sei beim Aufwachen wieder in ihrem alten Leben gelandet, in dem sie damit weitermachte. Trinken. Wodurch alles ins Wanken geraten würde und vielleicht nie wieder ins Lot.
Ein Drink würde nicht unbedingt einen Rückfall auslösen. Aber er würde sie zu einer Person machen, die sie nie wieder sein wollte.
»Dann eben eine Tasse Kaffee.«
»Ich kann nicht.«
»Ach, komm schon, Catherine. Wie lange ist es jetzt her? Und wir haben uns schließlich mal … nahegestanden.«
Catherine wehrte sich gegen diese Erinnerung.
»Sean, ich bin immer noch beim Service. Ich darf nicht mit dir gesehen werden. Das Risiko kann ich nicht eingehen.«
Sie bedauerte den Satz, sobald sie ihn ausgesprochen hatte.
»Ach, ich bin also ein Risiko für dich? Nur nicht die Finger schmutzig machen, was?«
»Tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Es ist vielmehr so, dass ich dich einfach nicht um mich haben kann. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Nicht wegen … deiner Probleme. Es liegt an mir, daran, wie ich bin. Was ich bin.«
»Meine Probleme!« Er lachte und schüttelte den Kopf. »Du klingst wie meine Mutter, Gott hab sie selig. ›Deine Probleme!‹ So was hat sie zu einer trauernden Witwe oder einem frechen Kind gesagt. Feine Unterschiede hat sie nie gemacht.«
Schon wieder dieser Ausdruck. Unterschiede machen.
»Ich bin froh, dass es dir gutgeht, Sean.«
»Du siehst auch toll aus, Catherine.«
Vielleicht lag es an ihrem jeweiligen Zustand, dass sie sich gegenseitig versichern mussten, wie passabel sie noch waren.
»Dann mach’s gut.«
Die Ampel war gerade auf Grün gesprungen, so dass Catherine sofort die Straße überqueren konnte. Auf der anderen Seite blickte sie sich nicht um, wusste aber, dass sie, wenn sie es täte, sehen würde, wie er sie beobachtete, und obwohl man die Farbe seiner Augen auf diese Entfernung nicht erkennen konnte, würden sie immer noch im gewittrigen Blau seiner dunkleren Momente funkeln.
»Du siehst aus, als könntest du Gesellschaft gebrauchen.«
Louisa antwortete nicht.
Unverdrossen rutschte der Mann auf den Hocker neben ihr. Ein Blick in den Spiegel sagte ihr, dass er einigermaßen attraktiv war – vielleicht Mitte dreißig, jung geblieben; gekleidet war er in einen anthrazitfarbenen Maßanzug mit aufwendig blau-gold gemusterter Krawatte, so weit gelockert, dass man den Freigeist darunter erahnen konnte. Seine Brille hatte einen dünnen schwarzen Rahmen, und Louisa hätte ihren nächsten Wodka darauf gewettet, dass die Gläser nur aus Glas waren. Nerd-Chic. Aber sie machte sich nicht die Mühe, das zu überprüfen.
»Du bist jetzt seit siebenunddreißig Minuten hier und hast nicht ein einziges Mal zur Tür geschaut.«
Er legte eine Kunstpause ein, damit sie die Brillanz dieser genauen Zeitangabe besser wertschätzen konnte, die Schärfe seiner Beobachtung. Sie saß hier seit siebenunddreißig Minuten und erwartete niemanden. Er hatte zweifellos ihre Drinks gezählt und wusste, dass sie bei ihrem dritten war.
Jetzt lachte er leise.
»Du bist also der stille Typ. Davon gibt es hier nicht viele.«
›Hier‹ bedeutete südlich des Flusses, aber nicht weit genug südlich, um von Maßanzügen und stilvollen Krawatten verschont zu werden. Louisa war mit dem Bus hergefahren, da sich das Wetter geändert hatte und der Geruch von Asphalt und heißem Staub schwer in den Straßen lag. Ihre Wohnung hatte sich kleiner denn je angefühlt, als wäre sie in der Hitze geschrumpft. Alles darin schien zu pulsieren. Wenn sie nach Hause kam, wurde sie ständig daran erinnert, dass sie lieber woanders wäre.
»Aber weißt du was? Wunderschöne Frau, geheimnisvoll und schweigsam – das wirkt anziehend auf einen Mann wie mich. Das gibt mir die Chance, mich im besten Licht zu zeigen. Also, ich sag dir was, wann immer du reagieren möchtest, tu dir keinen Zwang an. Lächle oder nicke einfach, wie du willst. Ich bin schon damit zufrieden, deinen Anblick zu bewundern.«
Louisa hatte geduscht und sich umgezogen und trug jetzt ein Jeanshemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine schwarze Skinnyjeans und dazu goldene Sandalen. Die blonden Strähnen in ihrem Haar waren neu, ebenso wie die blutrot lackierten Fußnägel. Er lag nicht ganz falsch. Sie wusste genau, dass sie keine schöne Frau war. Aber sie war sich sicher, dass sie wie eine aussah.
Außerdem: Es war ein heißer Augustabend mit kalten Getränken an einer Bar. Jeder konnte schön aussehen, wenn der Rahmen stimmte.
Sie hob ihr Glas, und das Eis klingelte verheißungsvoll.
»Also, ich arbeite in der Unternehmensberatung, Business Solutions. Kunden, die hauptsächlich Import-Export betreiben, und heute Morgen ist ein richtig dicker Fisch auf meinem Schreibtisch gelandet, zweieinhalb Millionen High-spec-Tablets aus Manila und der Papierkram ein einziger Scheißhaufen …«
Und so quasselte er weiter. Er hatte ihr keinen Drink angeboten – er wollte es so timen, dass er seinen eigenen kurz vor ihr leerte, dann der Bedienung hinter der Bar ein Zeichen gab, Wodka-Limette, viel Eis, und dann mit seiner Story fortfuhr, als wolle er über das kleine Wunder hinweggehen, das er soeben vollbracht hatte.
So oder so ähnlich lief es immer.
Louisa legte einen Finger auf den Rand ihres Glases und fuhr darüber, strich sich dann eine Haarlocke hinter das Ohr. Der Mann redete immer weiter, und sie wusste, ohne sich umzusehen, dass seine Kumpels an einem Tisch an der Tür saßen, auf ein Zeichen für Erfolg oder Misserfolg lauerten und in jedem Fall lachen würden. Wahrscheinlich machten sie auch in »Business Solutions«. Es schien eine Berufsbezeichnung zu sein, die sich so ziemlich in jede Richtung ausdehnen ließ.
Ihr eigener Tag, der wie jeder andere der letzten zwei Monate verlaufen war, hatte im Vergleich zweier Volkszählungsergebnisse aus den Jahren 2001 und 2011 bestanden. Ihre Zielstadt war Leeds, ihre Altersgruppe achtzehn bis vierundzwanzig Jahre, und was sie suchte, waren Personen, die von der Bildfläche verschwunden oder wie aus dem Nichts erschienen waren.
Sie wusste noch, dass sie gefragt hatte: »Aus einer bestimmten Sprachgruppe?«
»Ethnisches Profiling ist moralisch verwerflich«, hatte Lamb gemahnt. »Ich dachte, das wäre allgemein bekannt. Aber ja, es sind die Kameljockeys, auf die Sie sich konzentrieren sollten.«
Personen, die verschwunden oder plötzlich aufgetaucht waren. Davon gab es natürlich Hunderte, von denen die meisten grundsolide Gründe hatten, und die meisten anderen hatten potentiell grundsolide Gründe, doch die Analyse dieser Gründe war eine absolut nervtötende Arbeit. Sie konnte die Zielpersonen nicht direkt kontaktieren, daher musste sie sich ihnen über Umwege nähern: Sozialversicherung, Fahrzeugzulassung, Nebenkosten, medizinische Daten, Internetnutzung: alles, was eine Papierspur oder einen Fußabdruck hinterließ. Und so weiter und so fort – es glich weniger der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen als vielmehr der Suche nach einer neuen Anordnung des Heuhaufens, Halm für Halm, wobei man jeden nach Länge und Breite sortieren und sie in die gleiche Richtung legen musste … Sie wünschte, sie würde auch in Business Solutions machen. Das aktuelle Projekt schien hauptsächlich unnötige Probleme zu verursachen.
Und das war der springende Punkt. Kein Mensch verließ Slough House am Ende eines Arbeitstages und fühlte sich, als hätte er zur Sicherheit der Nation beigetragen. Man verließ es, als wäre das eigene Gehirn durch einen Entsafter gepresst worden. Louisa träumte manchmal, in einem Telefonbuch gefangen zu sein. Der Schlamassel, der sie zu den Slow Horses gebracht hatte, war gravierend gewesen – ein verbockter Überwachungseinsatz, der zu massivem Schusswaffengebrauch geführt hatte –, aber allmählich war sie wirklich genug gestraft. Nur ging es gerade darum, dass keine Strafe je genug war. Eigentlich konnte sie selbst das Ende festlegen, ihre Strafe beenden und weggehen, wann immer sie Lust dazu hatte. Und auch das wurde von ihr erwartet: dass sie aufgab und kündigte. Doch genau wie für die anderen war es das Letzte, was sie tun würde. Etwas, das Min gesagt hatte – nein, nicht an Min denken. Wie auch immer: Selbst wenn sie nicht offen darüber redeten, wusste sie, dass alle gleich empfanden. Abgesehen von Roderick Ho, der ein zu großes Arschloch war, um diesen Job als Strafe zu erkennen, was, da er für sein Arschloch-Sein bestraft wurde, ganz passend schien.
Doch währenddessen fühlte sich ihr Gehirn an wie durch einen Entsafter gepresst.
Der Mann redete immer noch, vielleicht erreichte er sogar den Höhepunkt seiner Anekdote, doch Louisa wusste so sicher wie das Amen in der Kirche, dass sie die Geschichte, worauf auch immer sie hinauslief, nicht hören wollte. Ohne sich ihm zuzuwenden, legte sie eine Hand auf sein Handgelenk. Es funktionierte wie eine Fernbedienung: Sein Redefluss brach abrupt ab.
»Ich trinke noch zwei von denen«, sagte sie. »Wenn du dann noch hier bist, gehe ich mit dir nach Hause. Aber in der Zwischenzeit halt verdammt noch mal die Klappe, okay? Kein Wort. Das ist der Deal.«
Er war klüger, als es bisher den Anschein gehabt hatte. Wortlos winkte er dem Barkeeper zu, deutete auf Louisas Glas und hob zwei Finger.
Louisa blendete ihn aus und widmete sich ihrem Drink.
Ich erschieß mich, dachte Marcus erneut, sagte es aber diesmal nicht laut.
Shirley amüsierte sich prächtig über die Vorstellung, dass Ho glaubte, er hätte Chancen bei Louisa. »Das ist ja phantastisch! Haben wir ein Schwarzes Brett? Wenn nicht, brauchen wir unbedingt eins!« Mit den Fingern malte sie eine Kreuzschraffur in die Luft. »HashtagverblendetesmännlichesWesen.«
Die Kneipe lag auf der anderen Seite des Barbican Centre, und Ho dachte, Marcus hätte sie vorgeschlagen, weil es seine Stammkneipe war, wo er sich mit seinen Freunden traf, doch in Wirklichkeit war Marcus noch nie zuvor dort gewesen und hatte sie genau aus diesem Grund ausgewählt. Es war die Art von Bar, von der er gewettet hätte, dass keiner seiner richtigen Freunde jemals einen Fuß hineinsetzen würde, so dass die Wahrscheinlichkeit, von einem von ihnen in Gesellschaft von Roderick Ho gesehen zu werden, minimal war.
Andererseits hatten ihn die Geldwetten überhaupt erst hierhergebracht, so dass er das Glücksspiel vielleicht lieber seinlassen sollte.
Ein riesiger Fernseher an der Wand war auf einen Nachrichtensender eingestellt. Das Schlagzeilenband lief zu schnell, als dass man ihm folgen konnte, aber das Foto erkannte jeder sofort: blauer Anzug, gelbe Krawatte, kunstvoll zerzaustes, aufgeplustertes Haar und ein plumpes Grinsen, hinter dem sich – man musste ein Idiot oder ein Wähler sein, um es nicht zu bemerken – so viel Egoismus verbarg, dass es einen Hai abgeschreckt hätte. Es war der brandneue Innenminister, also Marcus’ neuer Chef und auch Shirleys und Hos – nicht, dass sich Peter Judd auch nur im Geringsten für dieses Arbeitsverhältnis interessiert hätte. Um seine Aufmerksamkeit zu erregen, musste man Beziehungen zu den Royals, eine TV-Show oder vergrößerte Brüste haben (»angeblich«). Er bewältigte den Spagat zwischen Medienhure und politischem Schwergewicht und hatte längst den Sprung vom Arschkriecher zum Zielobjekt der Arschkriecher geschafft. Die Öffentlichkeit bezirzte er mit peinlich-lustigen Auftritten, und politischen Einfluss gewann er durch das von Hollywood sanktionierte Diktum, dass man seine Feinde am besten ganz in seiner Nähe hält. Das war die eine Sichtweise auf ihn, aber die alten Westminster-Hasen waren sich einig, dass er keine größere Bedrohung für den Premierminister hätte sein können, wenn er auf den Bänken der Opposition gesessen hätte. Was, wenn die Opposition gute Chancen bei der nächsten Wahl gehabt hätte, zweifellos der Fall gewesen wäre.
Um eine gängige Einschätzung zu zitieren: ein Widerling.
Und um eine neue zu prägen, murmelte Marcus: »Weißer Schwachkopf.«
»Hatespeech!«, warnte Shirley.
»Natürlich ist das Hatespeech. Ich hasse ihn wie die Pest!«
Shirley blickte zum Fernseher, zuckte mit den Achseln und sagte: »Ich dachte, du wärst einer der wenigen treuen Parteianhänger.«
»Bin ich auch. Aber er ist es nicht.«
Ho schaute von einem zum anderen, als hätte er vollkommen den Faden verloren.
Shirley richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihn. »Also, wann hat das angefangen, diese fixe Idee, möglicherweise bei Louisa landen zu können?«
Ho sagte: »Ich habe die Zeichen gelesen.«
»Du kannst doch nicht mal das ›Willkommen‹ auf einem Fußabstreifer lesen, und da bildest du dir ein, du könntest eine Frau verstehen?«
Ho zuckte mit den Schultern. »Die Schlampe ist reif«, sagte er. »Die Schlampe ist bereit.«
Shirley verpasste ihm eine Ohrfeige mit dem Handrücken, dass ihm die Brille von der Nase flog.
Marcus sagte: »Dann geht die nächste Runde wohl auf mich.«
Freund oder Feind?
Es gab kein Zurück mehr, jeder aus dieser Phase ihres Lebens war ein Feind.
Catherine wohnte in St. John’s Wood, hatte aber nicht vor, direkt dorthin zu fahren. Sie legte eine falsche Spur, ganz intuitiv – Alkoholiker lernen Täuschung. Also ging sie nach Norden, ungefähr in Richtung des Stadtteils Angel; eine Frau mit einem Ziel, aber ohne besondere Eile. Jeder, den sie traf, war dreißig Jahre jünger und hatte ungefähr so viel Stoff am Leib, wie an ihren Kleiderärmeln vernäht war. Manche warfen ihr verwunderte Blicke zu, entweder wegen des einen oder wegen des anderen, aber das interessierte sie nicht. »Freund oder Feind« deckte nicht alle Eventualitäten ab. Diese Fremden waren keines von beiden, und sie hatte andere Dinge im Kopf.
Sean Donovan war ein Feind, denn jeder aus dieser Zeit ihres Lebens war ein Feind, aber er war ein anständiger Mann, sofern Catherine ihrem Gedächtnis trauen konnte. Er war ein Soldat, und obwohl das Tempus falsch war – Sean Donovan war Soldat gewesen, Sean Donovan war nachweislich und aus unehrenhaften Gründen keiner mehr –, so blieb es doch die genaueste Beschreibung, die Catherine einfiel: Man brauchte ihn nur anzusehen. Er war inzwischen Mitte fünfzig; unter normalen Umständen hätte er jetzt auf dem Exerzierplatz die Parade abnehmen und politischen Größen als Berater dienen sollen. Man konnte ihn sich gut vor Kameras vorstellen, wie er die letzte Militäraktion rechtfertigte. Doch als er das letzte Mal vor einer Kamera erschienen war, wurde er in Handschellen von einem Militärgericht abgeführt: der fahrlässigen Tötung durch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr für schuldig befunden, verurteilt zu fünf Jahren Haft.
Für Catherine hatte das eher den Status einer Zeitungsmeldung als eines persönlichen Schocks gehabt. Sie war inzwischen trocken, und zum Prozess des Entzugs gehörte es, die hinter sich zu lassen, die ihr beim Trinken Gesellschaft geleistet hatten. Dazu gehörten auch Männer wie Sean Donovan, der nur einer von vielen war; kein besonders wichtiger, zumindest nicht wichtiger als jeder andere Mann aus dieser Zeit, aber andererseits war es durchaus eine lange Liste.
Sie überquerte eine Straße. Davon wurde ihr ein wenig schwindelig; nicht durch das Überqueren an sich, sondern weil sie aus ihrer Erinnerung auftauchen musste, um sich darauf zu konzentrieren. Es fiel ihr schwer, in ihre Vergangenheit zurückzublicken. Es war nicht angenehm. Aus irgendeinem Grund kam ihr ein Bild von Jackson Lamb in den Sinn, wie er zurückgezogen in seinem düsteren Büro hockte, aber es verschwamm wieder. Sicher auf der anderen Seite angekommen, riskierte sie einen Blick zurück. Sean Donovan folgte ihr nicht. Das hatte sie auch nicht ernsthaft erwartet. Zumindest hatte sie nicht erwartet, dass sie ihn dabei bemerken würde.
Er war Teil ihrer Vergangenheit, aber abgesehen davon wusste sie nicht mehr viel. An ihr eigentliches Liebesspiel, wenn man es so nennen konnte, hatte sie keine Erinnerung. In jenen Tagen wurde ihre unmittelbare Zukunft nach zwei Drinks zu einer Tabula rasa, auf der alles, was darauf gekritzelt wurde, innerhalb weniger Augenblicke nach dem Erscheinen gelöscht wurde. Er hätte ihr Sonette schreiben oder Arien transkribieren können, und ihr wäre es gleichgültig gewesen. Wobei sie wusste, dass er das nie getan hatte; es war kumpelhafter Sex gewesen, wie immer, und damals war er für sie genauso gut wie jeder andere gewesen, Hauptsache, sie hatte jemanden zum Festhalten, wenn sie in die Dunkelheit glitt. Gedichte und Opern waren nicht erforderlich. Eine Flasche genügte.
Doch während sie tatsächlich viele vergessen hatte, die sie kaum wahrgenommen hatte, nicht mal, während sie in ihr waren, war Sean Donovan wenigstens ein- oder zweimal am Morgen noch da gewesen. Er trank selbst gern einen über den Durst und war so freundlich gewesen vorzugeben, er wäre genauso schlimm dran wie sie. Mann, hab ich einen Schädel heute Morgen! Wir haben es ganz schön krachen lassen. Aber sie hatte einen Filmriss gehabt und er nur einen draufgemacht. Sie spielte bereitwillig mit, das tat sie damals immer. Wenn sie früher anders gewesen wäre, fragte sich Catherine jetzt, wenn sie nicht getrunken hätte, hätten sie beide dann eine Chance gehabt? Aber darauf gab es keine Antwort.
Sie war nicht weit von einer U-Bahn-Station entfernt. Von dort aus würde sie sich auf den Weg nach Hause machen, aber vorher holte sie ihr Handy aus der Tasche und rief jemanden an. Sofort sprang die Sprachbox an. Sie hinterließ keine Nachricht.
Sie steckte das Handy wieder ein und ging weiter die Straße entlang.
Hundert Meter hinter ihr stand ein schwarzer Lieferwagen, den Motor im Leerlauf.
Shirley sah zu, wie Roderick Ho auf dem Boden nach seiner Brille suchte, und fragte sich, ob es richtig gewesen war, ihm derart eine zu verpassen. Ein Schlag mit dem Handrücken zeigte Wirkung, vor allem auf solche kleinen Schleimscheißer; hätte sie mehr Kraft aufgewendet und die Hand zur Faust geballt, hätte sie ihm die Nase brechen können. Nachdem sie ihn vorher schriftlich über diese Absicht informiert hätte, wenn ihr danach zumute gewesen wäre. Aber vorgewarnt hätte in Hos Fall nicht unbedingt gewappnet bedeutet. Selbst mit Warnung hätte er eins auf die Nase gekriegt, nur hätte er sich vorher auch noch eingeschissen.
Leichte Sorgen bereitete ihr jedoch, dass ihr Ausbruch sie nicht zu beruhigen schien.
Im Allgemeinen bedeutete körperliche Gewalt, dass ein Ventil geöffnet und Endorphine ausgeschüttet wurden, so dass man anschließend dieses süße High spürte, irgendwas zwischen Schmerz und Streicheleinheit – eigentlich hätte sie Hos bescheuertes Herumtasten mit einem großen, breiten Grinsen im Gesicht beobachten müssen, so weit besänftigt, dass sie ihm sogar geholfen hätte, auch wenn das undankbare kleine Schwein es nicht zu schätzen wüsste. Stattdessen war sie immer noch gereizt bis aufs Blut und hätte ihm gerne noch eine verpasst. Was sie natürlich tun könnte, aber das würde vielleicht die Stimmung ein wenig trüben.
Marcus saß nicht an der Theke; er musste aufs Klo gegangen sein, es sei denn, er hatte sich durch die Seitentür weggeschlichen. Das musste eine Versuchung für ihn gewesen sein, aber so, wie die Dinge standen, würde er es nicht wagen.
Heute Morgen hatte er zu ihr gesagt: »Weißt du, was dieser kleine Scheißer macht?«
Es gab eine Menge kleiner Scheißer, die er hätte meinen können, aber ganz oben auf der Liste stand unweigerlich immer Roderick Ho.
»Cyberstalking? Bei dir?«
»Das sowieso. Schlimmer.«
»Hat er dich verpfiffen?«
»Noch nicht. Aber er hat mir damit gedroht.«
»Scheißkerl!«
»Du weißt ja noch nicht mal die Hälfte. Rate mal, was der Preis für sein Schweigen sein soll.«
Jetzt dachte Shirley, sie hätte vielleicht besser nicht gelacht, als er es ihr sagte.
»Ein Abend im Pub? Das ist alles?«
»Ich würde ihm lieber Geld geben.«
»Ha, das ist ja der Hammer! Mach dir Notizen. Ich will alles wissen!«
»Gar nicht nötig. Du kommst auch mit.«
»Träum weiter.«
»Denn wenn nur Ho und ich alleine gehen, wer weiß, wo das Gespräch dann hinführt? Wenn wir mit Sport und Politik durch sind, könnten wir am Ende über unsere Kollegen reden. So was wie, du weißt schon, welche von ihnen sich früh davonschleichen, wenn sie glauben, dass es niemand mitkriegt, und wer seine schmutzigen Tassen im Waschbecken stehenlässt.«
»Fesselnd.«
»Und wer Koks schnupft.«
Shirley ließ ihren Stift fallen. »Das machst du nicht!«
»Ich komme ja gar nicht dazu. Jedenfalls nicht, wenn du auch dabei bist.«
»Das ist Erpressung.«
»Was soll ich sagen? Ich habe vom Meister gelernt.«
Und so saß sie hier, so saßen sie beide hier und erduldeten die Gesellschaft von Roderick Webhead Ho. Kein Wunder, dass sie so …
Nein, sie wollte den Begriff »überspannt« nicht verwenden.
Shirley war in der vergangenen Woche beim Zahnarzt gewesen, und beim Blättern in einem Lifestyle-Magazin im Wartezimmer war sie auf einen dieser Tests gestoßen: Wie überspannt sind Sie?, und hatte im Geiste die Fragen beantwortet. Ärgern Sie sich über Vordrängler in Warteschlangen, auch wenn Sie es nicht eilig haben? Natürlich, schließlich ist das eine Frage des Prinzips, oder? Andere Fragen schienen geradezu entworfen zu sein, um sie zu reizen. Sie finden heraus, dass Ihr Partner sich mit seiner Ex auf einen Drink getroffen hat, »um der alten Zeiten willen«. Sie brauchte den Rest gar nicht zu lesen. Das sollte beweisen, wie »überspannt« sie war? Shirley fand, da wurde doch nur gesunder Menschenverstand abgefragt. Sie hatte das Magazin gegen die Tür geschleudert und der Zahnarzthelferin, die gerade den Kopf hereinsteckte, einen Heidenschreck eingejagt. Fünf Minuten später bekam sie es zurück, als die Helferin ein wenig übereifrig mit der Munddusche hantierte.
Ach, und was sollte das überhaupt? Okay, sie pfiff sich ab und zu mal eine Nase rein, aber wer tat das nicht? Ihr sollte niemand erzählen, Marcus hätte sich nie eine Line vom guten alten Schnee reingezogen – Marcus war ein Tactical gewesen, einer von der Truppe, die Türen eintritt, und wenn man dieses Adrenalin einmal geschmeckt hatte, wollte man doch garantiert wieder so ein High haben, stimmt’s? Er hatte behauptet, er würde das nie tun, aber natürlich würde er es niemals zugeben. Außerdem nahm Shirley das Zeug auch gar nicht regelmäßig. Es war ein Wochenend-Spaß für sie, streng begrenzt nur von donnerstags bis dienstags.
Mit einem Rumms setzte sich Roderick Ho wieder hin. Seine rechte Wange war flammend rot, und seine Brille hing schief.
»Warum hast du das gemacht?«
Sie seufzte schwer.
»Weil es sein musste«, sagte sie, halb zu sich selbst, und wünschte, sie wäre woanders.
Wahrscheinlich aber nicht unbedingt dort, wo River Cartwright war.
River war in einem Krankenhauszimmer und stand an einem Fenster, bei dem jeder Versuch, es aufzuschieben, zwecklos war. Der Rahmen war schon vor Jahren übermalt worden, damals, als die nationale Gesundheitsbehörde NHS noch gelegentlich einen Klecks Farbe spendierte, und selbst wenn es sich hätte öffnen lassen, wäre die eindringende Luft dick wie Suppe gewesen, so salzgeschwängert, dass sie einen Film in der Kehle gebildet und Sehnsucht nach einem Glas Wasser erzeugt hätte. River klopfte gegen die Scheibe und blickte hinunter auf einen überdachten Weg. Das Geräusch bildete einen kurzen Kontrapunkt zum Piepsen irgendeines der Apparate neben dem Bett, auf dem eine allmählich schwindende Gestalt lag. Sie übte keinen größeren Einfluss auf die Umgebung aus als in den vergangenen Monaten – wie viele das waren, wusste River nicht mehr genau.
»Du fragst dich wahrscheinlich, was ich so gemacht habe«, sagte River. »Du weißt schon, während du hier rumgelegen und dich geschont hast.«
Auf dem Nachttisch stand ein Ventilator, aber der kaum flatternde Streifen, der an sein Gitter gebunden war, bewies, wie schwach er war. River hatte mehrmals versucht, ihn zu reparieren, indem er ihn ein- und ausschaltete. Da sich damit seine Heimwerkerkünste erschöpften, zog er den Besucherstuhl näher an den leisen Luftzug heran und ließ sich darauf sinken.
»Echt spannend, das sage ich dir.«
Die Gestalt auf dem Bett antwortete nicht, aber das war keine Überraschung. Bei seinen drei letzten Besuchen hatte River ebenso hier gesessen, manchmal schweigend, manchmal einseitige Gespräche führend, und auch da hatte es keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass die Person im Bett seine Anwesenheit registrierte. Überhaupt war das mit der »Anwesenheit« hier eine große Frage: River hätte gern gewusst, wo der Verstand war, solange der Körper dort lag; ob er durch die Korridore seines unterbrochenen Lebens wanderte oder durch einen von ihm selbst geschaffenen Albtraum trudelte; eine Dalí-Welt aus doppelgesichtigen Schakalen und vielköpfigen Schlangen.
»Es war vor deiner und meiner Zeit, aber jedenfalls gab es 1981 einen Streik im öffentlichen Dienst. Er zog sich monatelang hin. Kannst du dir das vorstellen? Welche Berge von Papierkram sich angesammelt haben? Alles musste in dreifacher Ausfertigung erledigt werden, und zwanzig Wochen lang passierte rein gar nichts … Wenn die Feuerwehrleute streiken, springt das Militär ein. Aber wen soll man rufen, wenn die Schreibtischhengste die Arbeit niederlegen?«
River war auch ein Schreibtischhengst. Wer würde seine Arbeit erledigen, wenn es ihn nicht gäbe? Er hatte eine plötzliche, ungebetene Vision, wie sein Geist durch Slough House schwebte und unerledigte Aufgaben durchblätterte.
»Wie dem auch sei, du weißt, worauf ich hinauswill. Jedenfalls wirst du es gleich verstehen, wenn du auch nur die geringste Ahnung davon hast, wie Jackson Lamb tickt. Denn weißt du, er liebt es, Aufgaben zu erfinden, die nicht nur langweilig und sinnlos sind und nicht nur von dir verlangen, monatelang Listen von Namen und Daten zu durchforsten auf der Suche nach Anomalien, von denen du nicht mal weißt, ob es sie überhaupt gibt, weil du nicht weißt, woraus sie bestehen … Nein, nicht nur das, was dich vor Langeweile verblöden lässt und deine Seele pixelweise tötet – nein, weißt du, was das Schlimmste ist? Das Allerschlimmste?«
Er erwartete keine Antwort. Erhielt auch keine.
»Das Allerschlimmste ist die unendlich kleine, aber trotzdem bestehende Möglichkeit, dass da tatsächlich etwas ist. Dass du, wenn du alles richtig machst und jeden Stein umdrehst, vielleicht wirklich etwas findest, was nicht gefunden werden wollte. Das ist genau das, wonach wir suchen sollen, oder? Wir bei den … Intelligence Services.«
Dem Geheimdienst, bei dem River in jungen Jahren angefangen hatte und damit in die Fußstapfen seines Großvaters getreten war. David Cartwright war eine Geheimdienst-Legende gewesen – River war eine Geheimdienst-Witzfigur, weil er während einer Übung zur Hauptverkehrszeit den Bahnhof King’s Cross lahmgelegt hatte und daraufhin nach Slough House verbannt worden war. Die Tatsache, dass er reingelegt worden war, war die eigentliche Pointe des Witzes, aber nicht viele Leute kannten sie, und River konnte nicht darüber lachen.
»Es geht um die Passbehörde«, sagte er schließlich. »Um den gigantischen Rückstand an Passanträgen, von denen Hunderte einfach abgenickt und durchgewinkt wurden, nachdem die Bürokraten ihre Arbeit wiederaufgenommen hatten. Es hätte doch sein können, dass jemand darauf spekuliert hat, stimmt’s? Vielleicht hat irgendjemand die Chance auf einen Ausverkauf von falschen Identitäten erblickt. Und welche bessere falsche Identität gibt es als einen echten britischen Pass? Der seitdem so oft verlängert wurde, dass er unantastbar ist.«
Die Maschinen zirpten und surrten, blinkten und piepsten, doch die Gestalt auf dem Bett regte sich nicht und sagte nichts.
»Manchmal wäre ich lieber an deiner Stelle«, sagte River.
Doch das meinte er mit ziemlicher Sicherheit nicht ernst.
Catherine sah den Van nicht. Aber sie sah den Soldaten in der Nähe des U-Bahn-Eingangs.
Er trug keine Uniform, sonst hätte sie ihm keinen zweiten Blick gegönnt – in London liefen immer irgendwelche Soldaten herum. Aber ihn verriet die Wachsamkeit, die man nach der Besetzung feindlicher Gebiete erwirbt, eine gewisse misstrauische Reglosigkeit. Damit war er nun schon der zweite heute Abend, was den letzten Rest Glauben an irgendwelche Zufallsbegegnungen vertrieb. Der Mann hielt eine aufgerollte Zeitung, um seine Hände zu beschäftigen, und schien weniger Wache zu stehen, als jede Einzelheit in seiner Umgebung zu kontrollieren. Er registrierte Bewegungen und achtete dabei auf Anomalien. Nein, Anomalien vielleicht weniger, korrigierte sie sich. Er achtete auf sie.
Wenn das der Fall war, hatte er sie bereits gesehen; und wenn nicht, dann spätestens jetzt, weil sie abrupt auf dem Absatz kehrtmachte. Keine kluge Taktik, aber sie war nie im Außeneinsatz gewesen, nie auf der Straße, und ihre einzige OP hatte sie, als sie die Mandeln rausbekam. Litt sie vielleicht an Paranoia? Nachdem sie mit der schlechten alten Zeit konfrontiert worden war, nachdem sie sich im nüchternen Zustand gefühlt hatte wie betrunken, war alles möglich …
Sie blickte nicht zurück, sondern konzentrierte sich stattdessen auf den Bürgersteig vor ihr. Ein schwarzer Van fuhr langsam vorbei, und sie musste einer Gruppe von Teenagern ausweichen, aber sie ging einfach immer weiter. Nur ein kleines Stück entfernt war eine Bushaltestelle, und wenn sie Glück hatte, kam gerade ein Bus. Falls einer kam, würde sie von dort aus Lamb noch einmal anrufen. Falls einer kam.
Die Straßen waren keineswegs verlassen. Leute in Büro-Outfit, andere in T-Shirts und Shorts; die Geschäfte waren noch geöffnet, obwohl Banken und Buchmacher und so weiter ihre Türen bereits geschlossen hatten. Kneipen und Bars dagegen hatte ihre weit geöffnet, so dass die Hitze zusammen mit einem Gewirr von Musik und Stimmen entweichen konnte. Der Kanal war nicht weit entfernt, und es war die Art von Sommerabend, an dem die jungen Leute dort Picknicks und Wein auf den Bänken teilten oder Decken auf Rasenflächen ausbreiteten, auf denen sie sich räkeln und einander in schläfriger Behaglichkeit Textnachrichten schreiben konnten. Catherine brauchte eigentlich nichts weiter zu tun, als laut um Hilfe zu rufen.
Doch was würde ihr das bringen? Man würde einen weiten Bogen um sie machen. Eine Frau, die in der Hitze einen Zusammenbruch erlitt: der kam man besser nicht zu nahe.
Sie riskierte einen Blick zurück. Kein Bus. Und niemand folgte ihr. Von dem Soldaten, falls er einer gewesen war, keine Spur, und auch Sean Donovan war nirgendwo zu sehen.
An der Bushaltestelle blieb sie kurz stehen. Der nächste Bus würde sie dorthin zurückbringen, woher sie gekommen war; er würde sie gegenüber von Slough House absetzen und den Abend zurückspulen bis zu dem Moment, als sie aus dem Hinterhof getreten war. Nichts von alldem wäre passiert, und am Morgen würde sie darauf wie auf einen kleinen Aussetzer zurückblicken; die Art von Bodenwelle, mit der rekonvaleszente Trinker umzugehen lernen. An der Kreuzung sprang die Ampel um, und der Verkehr floss wieder; sie hoffte auf einen Bus, aber das größte Fahrzeug war ein schwarzer Van, derselbe, der eben in die entgegengesetzte Richtung gefahren war. Catherine verließ die Bushaltestelle, ihr Herz schlug schneller. Ein Soldat, zwei Soldaten; ein schwarzer Van, der sie zu verfolgen schien. Manches war ein Echo aus ihrer Trinkervergangenheit. Anderes nicht.
Warum um alles in der Welt sollte es jemand auf sie abgesehen haben?
Sie verschob die Frage auf später. Erst mal musste sie verschwinden.
Bevor der herannahende Verkehr sie erreichte, rannte sie über die Straße.
Auf dem Weg zur Bar war Marcus in die Herrentoilette abgebogen, um ein paar Minuten allein zu sein, und da die Kabine frei war, hatte er sie besetzt, um darüber nachzudenken, was aus seinem Leben geworden war. In letzter Zeit – seit seinem Exil in Slough House natürlich, aber vor allem in den letzten zwei Monaten – fühlte sich alles an wie ein Griff ins Klo. Kein Wunder, dass er sich hier drinnen ruhiger fühlte als da draußen.
Damals, als alles noch so war, wie es sein sollte, hatte einer von Marcus’ Ausbildern ein Gesetz erlassen: Kontrolle ist das Entscheidende. Kontrolle über die Umgebung, Kontrolle über deinen Gegner. Und, am allerwichtigsten: Selbstbeherrschung. Marcus kapierte das oder dachte jedenfalls, er würde es kapieren, als er es zum ersten Mal hörte, stellte aber bald fest, dass es sich nur um die Kurzfassung handelte: Kontrolle bedeutete nicht nur, einen Deckel draufzumachen, sondern, diesen Deckel festzunageln. Es bedeutete, sich in eines dieser Soldatenwerkzeuge zu verwandeln, die sich zusammenklappen lassen, bis sie bloß noch aus dem Griff bestehen, ohne sichtbare Klinge, die nur bei Bedarf aufschnappt.
Die Sache mit dem Training war jedoch die – und Marcus war nicht der Erste, der das feststellte –, dass es einem Fähigkeiten vermittelte, die nur selten zum Einsatz kamen. Vieles, was er sich angeeignet hatte, zum Beispiel wie man sich achtundvierzig Stunden lang im Wald vergrub, war seitdem nicht mehr abgerufen worden. Er hatte einige Türen eingetreten und vor nicht allzu langer Zeit ein Magazin zielgenau in einen Menschen gepumpt, aber im Großen und Ganzen war seine Laufbahn anspruchslos gewesen. Und jetzt Slough House, das Ersticken sämtlicher Ambitionen, die er je gehabt hatte … Der Kontrollfaktor war das Einzige, was ihn aufrecht hielt. Jeden Tag nagelte er sich fest, tat, was ihm aufgetragen wurde, als ob sich das auf lange Sicht als lohnenswert erweisen könnte. Und das ungeachtet dessen, was ihm Catherine Standish gleich zu Beginn gesagt hatte, nämlich dass jeder lahme Gaul wusste, dass es kein Zurück gab, nur dass jeder insgeheim dachte: Außer vielleicht für mich …
Und Kontrolle war auch bei seiner Spielsucht ein wichtiges Element – der Kontrollverlust war es, der ihm den Kick versetzte. Egal, was er sich einredete: Es war ein Drahtseilakt, dass er nur die Kontrolle über die Umgebung aufgab, dabei aber stets die Kontrolle über sich selbst behielt – Grenzen setzte, Schranken runterließ. Doch in Wahrheit war es jedes Mal, wenn er ein Casino betrat, ein Ausflug ins Unbekannte. Was bis vor kurzem keine Rolle gespielt hatte, denn bis vor kurzem hatte er kaum je verloren.
Es waren die Maschinen, die ihm das Genick gebrochen hatten, diese verdammten Roulettemaschinen, die scheinbar über Nacht bei den Buchmachern aufgetaucht waren. Mit einarmigen Banditen hatte er nie Probleme gehabt, denn bei denen war der Name Programm. Diese Dinger raubten einen immer aus bis aufs Hemd. Aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund war die Roulettemaschine verlockender, verführerischer … Man fing mit ein paar Münzen an, und es war erstaunlich, wie nah du dem Gewinn kommen konntest, ohne tatsächlich zu gewinnen, also setzte man ein paar Münzen mehr ein und gewann. Damit fielen alle Hemmungen. Sobald man gewonnen hatte, war man schnell wieder zurück am Ausgangspunkt, allerdings mit etwas weniger Geld … Er hatte mit Vegas-Profis Poker gespielt und war als Sieger vom Tisch aufgestanden; hatte Außenseiterwetten auf Pferde abgeräumt, die lebendiges Hundefutter waren, und dann wurde er von einer Scheißmaschine ausgenommen und fütterte sie mit Zwanzigern, als handelte es sich um seinen Erstgeborenen. Er hatte mal behauptet, er sei der schlimmste Alptraum des Casinos: ein Spieler, der nach der Uhr spielte. Ich gehe um zehn, egal, ob ich gewonnen oder verloren habe. Doch jedes Mal, wenn er auf die Uhr schaute, war sie um eine halbe Stunde weitergesprungen, und jedes Mal war sein nächster Zahltag weiter entfernt.
Er hatte vom Ersparten gezehrt. Hatte sich dabei ertappt, wie er die Kreditwerbung in der U-Bahn studierte, mit Zinsen, die sich auf viertausend Prozent pro Jahr addierten. Cassie würde ihn umbringen, wenn er sich nicht zuerst selbst erschoss.
Am schlimmsten war, dass er während der Bürozeiten eine Aufholjagd versucht und sich auf Casinoseiten eingeloggt hatte, um die Mittagsverluste wettzumachen, und dass er dabei von Scheiß-Roderick-Ho gestalkt worden war, dem Fahrtenschreiber von Slough House. Deshalb war er heute Abend Hos Trinkkumpan und hatte nur die Kokserin Shirley Dander als Verstärkung. Ja, die Toilette war der richtige Ort für ihn, aber er konnte nicht ewig hierbleiben. Er erhob sich und kehrte zurück zur Bar.
Als er sich wieder zu seinen Kollegen gesellte, fragte Shirley gerade Ho, ob er überhaupt wüsste, was er da redete. »›Schlampe‹? Du kannst von Glück sagen, dass ich dir nur eine Ohrfeige verpasst habe.«
Erleichtert wandte sich Ho an Marcus. »Was sagst du dazu, Dog?« Womit er auf die »Dogs« anspielte, die Vollstrecker des Geheimdienstes.
»Hast du mich gerade ›Dog‹ genannt?«
Shirley hob die Hand, nur aus Spaß, um zu sehen, wie Ho zusammenzuckte. »Pass bloß auf, was du sagst!«
»Hat er mich gerade ›Dog‹ genannt?«
»Ich glaube, das hat er.«
Marcus riss Ho die Brille von der Nase und warf sie auf den Boden. »Ich bin ein Hund? Du bist ein Hund! Los, hol!«
Während Ho erneut auf dem Boden herumkroch, sagte Marcus zu Shirley: »Ich wusste gar nicht, dass du mit Louisa befreundet bist.«
»Bin ich auch nicht. Aber ich würde Ho nicht mal mit einer Milchziege verkuppeln.«
»Frauensolidarität.«
»Ganz genau.«
Sie stießen mit ihren Gläsern an.
Als Ho sich wieder hinsetzte, hielt er seine Brille mit zwei Fingern auf der Nase fest. »Was sollte das denn?«
Marcus schüttelte den Kopf. »Ich kann’s nicht fassen, dass du mich ›Dog‹ genannt hast.«
Ho warf Shirley einen kurzen Blick zu, bevor er sagte: »Hast du die Bedingungen unserer, äh, Vereinbarung vergessen?«
Marcus atmete durch die Nase aus. Es war fast ein Schnauben. »Okay«, sagte er. »So sieht’s aus. Wir verhandeln die Bedingungen neu. Hier ist der Deal. Wenn du auch nur ein Wort über diese Casinoseiten verlierst, breche ich dir jeden einzelnen Knochen in deinem feigen Körper.«
»Ich bin kein Feigling.«
»Konzentrier dich auf die gebrochenen Knochen. Haben wir uns verstanden?«
»Ich bin kein Feigling!«
»Ich breche dir trotzdem die Knochen.«
»Dann brich sie mir eben. Aber ich bin kein Feigling!«
»Du setzt deine Grenzen wirklich seltsam. Weißt du, was das Problem mit dir ist?« Marcus lief jetzt warm und wollte endlich alles loswerden. »Du machst nichts, nie. Du hockst bloß in deinem Büro rum und surfst auf deinen Computern rum wie, äh, wie ein verdammter Nerd! Tag für Tag durchwühlst du unzählige sinnlose Informationen, nur um dieses Arschloch Jackson Lamb zufriedenzustellen.«
»Das machst du doch auch.«
»Ja, aber ich hasse es.«
»Aber du machst es trotzdem.«
Shirley schüttelte den Kopf.
Marcus erklärte: »Du bist ein Trottel, Ho. Das ist alles, was du bist, und alles, was du je sein wirst. Eine Frau wie Louisa wird dir nie einen zweiten Blick gönnen und auch keine andere Frau, bevor du nicht mit deiner Kreditkarte wedelst. Ich habe dieses Problem nicht. Und weißt du, warum? Bevor ich abgeschoben wurde, war ich im Einsatz, ich habe richtig gearbeitet. Hart gearbeitet. Aber du hast im Leben bisher nichts anderes gemacht als diesen Scheiß, und den machst du auch noch gerne!«
Ho sagte: »Und, was willst du mir jetzt damit sagen?«
»Nicht zu fassen! Tu was! Das will ich dir sagen. Du willst ein Zeichen setzen, du willst Leute beeindrucken? Dann musst du etwas tun! Egal was, aber sitz nicht einfach nur vor einem Bildschirm und verhackstücke … Daten!«
Marcus hätte das letzte Wort nicht angewiderter ausspucken können, wenn es nicht mit Informationen, sondern mit Körperflüssigkeiten zu tun gehabt hätte.
Er stand auf. »Ich gehe. Alle Knochen einzeln, denk daran. Und wenn es das Einzige ist, was du aus diesem Gespräch mitnimmst. Jeder Knochen einzeln.«
»Trinken wir nicht noch einen?«
Shirley zeichnete wieder in die Luft. »Hashtag-Thema verfehlt.«
»Hör auf damit«, sagte Marcus. Er warf einen Blick auf sein halbleeres Bier, zuckte mit den Achseln und ging zur Tür.
Shirley streckte die Hand aus, nahm vorsichtig Hos Brille, klappte sie zusammen und ließ sie in Marcus’ Guinness fallen. »Da«, sagte sie.
Ho öffnete den Mund, um etwas zu sagen, änderte aber klugerweise seine Meinung.