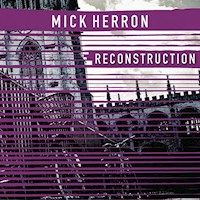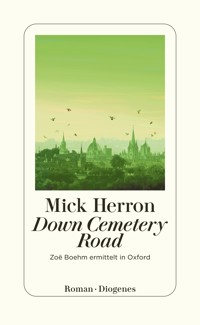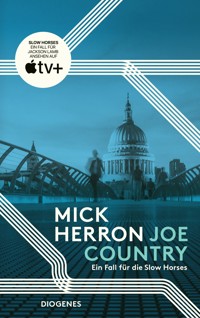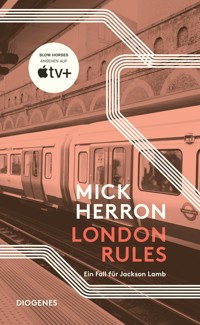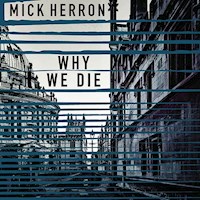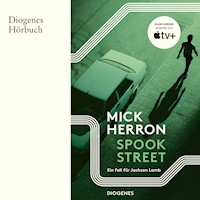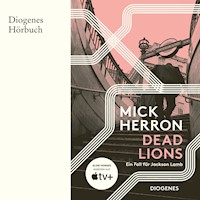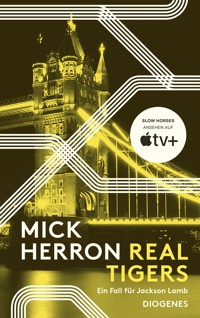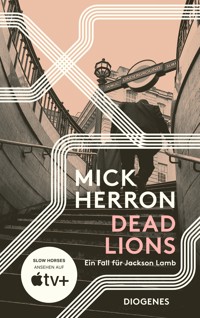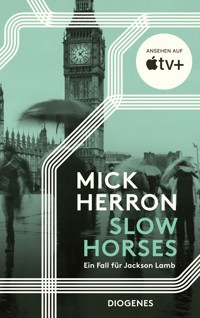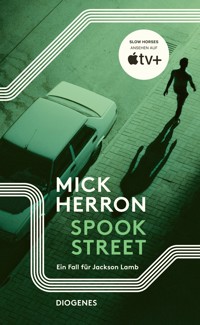
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jackson Lamb
- Sprache: Deutsch
River Cartwright ist einer der Abservierten des MI5. Sein Großvater dagegen, einst Nummer 2 des britischen Inlandgeheimdienstes, ist heute alt und vergesslich und deshalb ein potenzielles Risiko, aber nicht hilflos. Als eines Abends ein Fremder an seiner Tür steht und sich als sein Enkel ausgibt, erschießt er ihn sofort. Der echte Enkel findet in den Taschen des Toten eine Fahrkarte nach Frankreich – zufällig in den Ort, in dem sein Großvater immer »Urlaub« gemacht hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mick Herron
Spook Street
Ein Fall für Jackson Lamb
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer
Diogenes
Für Juliet und Paul
(anstatt eines Hochzeitsgeschenks)
1
So sah also der Frühling in London aus: die Frauen in knielangen, blau-weiß gestreiften Kleidern; die Männer mit dunklen Jacken über Pullovern in Pastelltönen. Beide Geschlechter trugen Umhängetaschen mit mehr Klappen und Verschlüssen als nötig, die der Frauen entweder rot oder schwarz, die der Männer maskulin-büffellederbraun, und auch Mützen sah man gelegentlich, neben Stirnbändern – vergessen wir die Stirnbänder nicht. Stirnbänder in Regenbogenstreifen ließen die Frauen übereifrig erscheinen, als ob sie zu begierig nach der Mode ihrer Jugend griffen, wohingegen die wirklich jungen Leute das gleiche Accessoire scheinbar nonchalant trugen. An den Füßen Sandalen oder Flipflops, die Gesichter voller Zufriedenheit, und die Körpersprache fing stumm und ausdrucksstark zugleich einen einzigen Moment des Wohlbefindens ein und strahlte ihn in alle Richtungen aus. Die frühlingsfrisch ausstaffierten Schaufensterpuppen waren von allen Seiten beleuchtet, ein Klavier produzierte zu ihrem Vergnügen melodiöses Gedudel im Hintergrund, ein Miniatur-Wasserfall trommelte einen unerschütterlichen Takt, und der hagere Samit Chatterjee beobachtete das alles mit halb zusammengekniffenen Augen, wachsam und misstrauisch.
Draußen zog sich der erste Arbeitstag des Jahres mühselig dahin und wuchtete seinen aufgeblähten, verkaterten Wanst auf die Mittagszeit zu. Im Inneren der Shopping Mall Westacres dagegen – einem höhlenartigen Vergnügungszentrum des Einzelhandels an den westlichen Ausläufern Londons – wurde schon der nahende Frühling gefeiert. Kaum hatte dieser begonnen, würden die Schaufenster jedoch bereits die Atmosphäre von sommerlichen Wochenendausflügen verströmen. Im Jahrbuch der Szenen war auf einer bereits umgeblätterten Seite der Jahreswechsel mit Schlitten, Schals und putzigen Rotkehlchen dargestellt worden, aber die Realität war kompromisslos, und das Leben jenseits der Schaufenster hatte wenig Ähnlichkeit mit dem der Schaufensterpuppen dahinter. Dort stapften die müden Käufer von einem Geschäft zum nächsten, was wegen des glitschigen, nassen Bodens gar nicht ungefährlich war; hier ruhten sich die Erschöpften auf dem Betonsims rings um den Springbrunnen aus, in dessen Becken ein schaumverkrusteter Styroporbecher am Rand dümpelte. Dieser Brunnen bildete das Herzstück, an dem Gänge aus allen Himmelsrichtungen zusammentrafen, und früher oder später kam jeder, der Westacres besuchte, daran vorbei. Daher ergab es sich ganz von selbst, dass Samit sich meist hier aufhielt, um die Passanten besser beobachten zu können.
Allerdings hegte er für sie wenig Sympathie. Wenn Westacres ein Tempel war, wie das Einkaufszentrum manchmal bezeichnet wurde, dann gingen seine Anhänger ziemlich lax mit den religiösen Vorschriften um. Wahrhaft Gläubige würden keine Essensreste in das Taufbecken ihrer Kathedrale werfen, und niemand, der die Grundsätze seiner Religion wirklich hochhielt, leerte noch vor halb zehn morgens einen Sixpack Strongbow und kotzte anschließend auf den Boden seiner Kirche. Als gläubiger Muslim verabscheute Samit die Praktiken, deren Zeuge er täglich wurde, doch als Mitglied von Westacres’ engagiertem Team der Community Regulation Officers – oder Security Guards, wie sie sich selbst nannten – verzichtete er darauf, die himmlische Verdammnis auf die Gottlosen herabzurufen, und begnügte sich damit, Müllsündern gegenüber strenge Verwarnungen auszusprechen und die Betrunkenen vom Gelände zu eskortieren. In der übrigen Zeit erklärte er Suchenden den Weg, half, umherirrende Kleinkinder zu finden, und einmal – er dachte noch oft daran – hatte er einen Ladendieb verfolgt und dingfest gemacht.
An diesem Nachmittag gab es keine solche Abwechslung. Die Luft war feucht und stickig, ein Kratzen in Samits Hals kündigte eine Erkältung an, und er fragte sich, wo er wohl eine Tasse Tee schnorren könnte – als er sie kommen sah: drei Jugendliche, die sich durch den östlichen Gang näherten. Einer trug eine große schwarze Reisetasche. Samit vergaß seinen rauhen Hals. Zu den großen Paradoxa des Einkaufszentrums gehörte es, dass zugunsten von Profit und Wohlstand die Jugendlichen hereingelockt werden mussten, sie aber um der Harmonie und des lieben Friedens willen nicht hier herumlungern sollten. Idealerweise sollten sie reinkommen, ihr Geld loswerden und sich wieder verziehen. Wenn also Jugendliche zu dritt auftauchten und eine schwarze Reisetasche mit sich trugen, musste man von bösen Absichten ausgehen. Oder sich zumindest auf übermütigen Quatsch gefasst machen.
Samit sah sich forschend um und entdeckte zwei weitere Gruppen, die die nördliche Passage herunterkamen, die eine bestand aus jungen Frauen, für die die Welt ein Quell unendlicher Heiterkeit zu sein schien, die andere ein buntgemischter Haufen in tiefhängenden Jeans und Sneakers ohne Schnürsenkel, von dem das übliche jamaikanische Patois der in London geborenen Teenager widerhallte. Aus Richtung Westen genau das Gleiche: herbeiströmende Teenager, jede Menge von ihnen, und plötzlich schienen es nicht mehr einzelne Gruppen zu sein, sondern es war eine Massenansammlung, die von einer einzigen Intelligenz gesteuert wurde. Zwar waren immer noch Ferien, und man musste mit einem erhöhten Aufkommen von Jugendlichen rechnen, aber … Im Zweifelsfall meldest du dich, hatte man Samit gesagt. Und dies war ein Zweifelsfall: nicht nur die Jugendlichen, die schiere Zahl der Jugendlichen – es wurden immer mehr –, sondern die Art, wie sie auf ihn zusteuerten; als würde Samit Chatterjee Zeuge der ersten Anfänge einer neuen Bewegung werden; vielleicht des Umsturzes dieses Konsumtempels, den er hier zu bewachen hatte.
Vom Sog mitgerissen, trafen jetzt seine Kollegen ein. Samit winkte energisch und löste sein Funkgerät in dem Moment vom Gürtel, als das erste Trio mitten in der Arena stehen blieb und seine Reisetasche auf dem Boden abstellte. Während er die Sprechtaste drückte, öffneten sie die Tasche und enthüllten ihren Inhalt. Und als er sprach, ging es los: Genau in dem Moment zog die ganze Menge – Dutzende von Kids, die den Brunnen umringten, die Geschäftseingänge blockierten und auf dem Brunnenrand herumkletterten –, ausnahmslos alle, so schien es, ihre Jacken und Mäntel aus. Darunter kamen fröhlich leuchtende Shirts zum Vorschein, alle in grellen Primärfarben und wilden Mustern, und dann drückten die Jungs auf die Knöpfe des Retro-Ghettoblasters, den sie ausgepackt hatten, und das ganze Einkaufszentrum wurde von lautem, lautem Lärm geflutet, einem tiefen Bass-Beat.
Living for the sunshine, woah-oh
Und sie tanzten alle, schwenkten die Arme über dem Kopf, hoben die Beine, wackelten mit den Hüften – niemand hatte Tanzunterricht gehabt, so viel war sicher, aber diese Kids wussten, wie man Spaß hat, und genau den hatten sie.
I’m living for the summer
War das nicht ein tolles Gefühl? Ein Flashmob, erkannte Samit. Vor acht bis zehn Jahren war das ein Riesending gewesen, und nun wurde es von einer neuen Generation wiederentdeckt. Samit hatte schon einmal einen miterlebt, in der Liverpool Street: Er hatte am Rand gestanden und hätte gerne mitgemacht, aber irgendetwas – was? Teenagerscham – hatte ihn davon abgehalten, und er hatte nur als Beobachter zugesehen, wie die Menge in fröhlicher, geplanter Spontaneität aus sich herausging. Diese hier fand allerdings unter seiner Aufsicht statt und hätte gestoppt werden sollen, aber im Augenblick konnte er nichts unternehmen – nur Hunde und Megaphone hätten dieser Sache Einhalt gebieten können. Sogar die Erwachsenen wurden übermütig und wippten im Takt zum sommerlichen Beat; einer von ihnen, mitten im Trubel, knöpfte seinen Mantel auf. Und für einen unüberlegten Moment wurde auch Samit, trotz der Kälte, trotz der Nässe, von der überschäumenden Lebensfreude mitgerissen, und fast gegen seinen Willen verzog er die Lippen, ob zu einem Lächeln oder um den Refrain mitzusingen – living for the sunshine, woah-oh, hätte nicht einmal Samit selbst sagen können, und er musste eine Hand vor den Mund legen, um seine Reaktion zu verbergen. Mit dieser Bewegung verdeckte er seine Zähne, anhand derer er später identifiziert wurde.
Denn die Explosion, als sie kam, ließ wenig unversehrt. Sie zertrümmerte Knochen und pulverisierte alles Leben in der Nähe zu verkohlten Bröseln. Fenster wurden zu Schrapnells, und der Brunnen zischte, als brennende Brocken von Mauerwerk, Ziegeln, Plastik und Fleisch hineinregneten. Ein wütender Feuerball verschluckte sowohl die Musik als auch die Tänzer und sandte eine Welle aus Hitze und Luftdruck aus, die alle vier Passagen hinunter wallte, während die Frühlingspuppen in ihrer makellosen Kleidung hinter einer Erinnerung aus Glas fortgeschleudert wurden. Es dauerte Sekunden, doch es hörte nicht auf, und diejenigen, die zurückblieben – Eltern und Familien, Geliebte und Freunde –, würden dieses Datum für immer als einen Tag unbeantworteter Anrufe und nicht abgeholter Autos in Erinnerung behalten; als einen Tag, an dem etwas Schreckliches, so hell wie die Sonne, am falschen Ort erglühte und sein unauslöschliches Bild in das Leben derer einbrannte, die es dort fand.
ERSTER TEILHell wie die Sonne
2
Hitze steigt bekanntlich auf, aber nicht immer ohne Anstrengung. In Slough House wird ihr Aufstieg von Klackern und Gurgeln begleitet: das hörbare Tagebuch einer erzwungenen und schmerzhaften Passage durch schiefe Rohre. Wenn man das Leitungssystem aus dem Gebäude herauspräparieren und als freistehendes Exoskelett betrachten könnte, wäre es überall undicht und feucht: ein arthritischer Dinosaurier mit schiefen Gelenken, bei dem Brüche unsauber verheilt sind, die Gliedmaßen ein unstimmiges Durcheinander, fleckige und rostige Extremitäten, die kaum noch Wärme verströmen. Und der Kessel, das Herz dieses Ungetüms, würde weniger schlagen als vielmehr in einem Trip-Hop-Rhythmus flattern. Seine gelegentlichen Ausbrüche von Enthusiasmus produzieren heiße Explosionen an unwahrscheinlichen Stellen; sein unregelmäßiger Puls ist das Ergebnis von Lufteinschlüssen, die unbedingt entweichen wollen. Noch mehrere Türen weiter hört man das Rumpeln dieses antiquierten Heizungssystems, und es klingt wie das Klopfen eines Schraubenschlüssels auf ein Eisengeländer, wie eine verschlüsselte Nachricht, die von einer verschlossenen Zelle zur anderen übermittelt wird.
Es ist ein Energie verschwendendes, unbrauchbares Drecksding, aber andererseits ist dieses gesamte schäbige Bürogebäude – in der Nähe der Barbican-U-Bahn-Station, in der Aldersgate Street im Stadtteil Finsbury – auch nicht gerade für seine Effizienz bekannt, weder in puncto Ausstattung, noch was das Personal angeht. In der Tat könnten seine Bewohner genauso gut selbst mit Schraubenschlüsseln auf Rohre einhämmern, in Anbetracht ihrer Kommunikationsfähigkeiten, doch an diesem kalten Januarmorgen, zwei Tage nach dem schrecklichen Anschlag in der Westacres-Mall, der über vierzig Menschenleben gefordert hat, sind im Slough House andere Geräusche zu hören. Ausnahmsweise nicht in Jackson Lambs Zimmer: Von allen Insassen des Hauses ist er zwar derjenige, der am besten auf die marode Heizungs- und Sanitäranlage eingestimmt ist, da ihm selbst innerliches Glucksen und plötzliches warmes Rülpsen nicht fremd sind, aber im Moment ist sein Büro leer und sein Heizkörper die einzige Quelle des Lärms. Im Zimmer gegenüber – bis vor ein paar Monaten das von Catherine Standish, jetzt das von Moira Tregorian – findet zumindest eine Unterhaltung statt, wenn auch notwendigerweise einseitig, denn Moira Tregorian hat den Raum derzeit für sich allein: Ihr Monolog besteht aus einzelnen, betonten Silben – ein »Oh!« hier, ein »Nein!« dort –, durchsetzt mit dem einen oder anderen vollständigen Satz – »Was soll ich damit?«, und: »Was ist das für ein Mist?« Ein jüngerer Zuhörer würde vielleicht annehmen, dass Moira diese Fragmente in ein Telefon spricht, doch in Wirklichkeit sind sie an die Unterlagen auf ihrem Schreibtisch gerichtet, Unterlagen, die sich in Catherine Standishs Abwesenheit angesammelt haben, und zwar auf eine Art und Weise, die von organisatorischen Prinzipien, ob chronologisch, alphabetisch oder allgemein, völlig unberührt sind, da sie von Lamb dort abgelegt wurden, dessen Ordnungsfimmel notorisch unterentwickelt ist. Eine Menge Blätter, und jedes hat irgendwo seinen Platz, und herauszufinden, welcher von den vielen möglichen Orten das sein könnte, ist heute Moiras Aufgabe, ebenso wie sie es gestern war und morgen sein wird.
Selbst wenn er es absichtlich getan hätte, hätte sich Lamb kaum eine passendere Einführung in das Leben unter seinem Kommando ausdenken können, hier in dieser administrativen Besenkammer des Geheimdienstes; doch um bei der Wahrheit zu bleiben, hat Lamb die Dokumente weniger in Moiras Obhut gegeben als sie vielmehr aus seiner eigenen verbannt, aus den Augen, aus dem Sinn – seine Lösung für unerwünschten Papierkram. Moira, die erst seit zwei Tagen in Slough House arbeitet und Jackson Lamb noch nicht kennengelernt hat, hat bereits beschlossen, dass sie ein ernstes Wort mit ihm reden wird. Und während sie bei diesem Gedanken heftig nickt, knurrt der Heizkörper wie eine demente Katze, was sie so erschreckt, dass sie die Papiere, die sie in der Hand hält, fallen lässt und sie gleich hastig aufrafft, damit sie nicht wieder durcheinandergeraten.
Unterdessen dringen vom unteren Stockwerk aus andere Geräusche nach oben: ein Gemurmel aus der Küche, das Sprudeln eines Wasserkochers und das Brummen eines geöffneten Kühlschranks. In der Küche stehen River Cartwright und Louisa Guy, beide mit einer Tasse heißen Tees in der Hand, und Louisa hält einen Monolog über die Irrungen und Wirrungen, die mit dem Kauf ihrer neuen Wohnung einhergehen. Sie liegt ziemlich weit außerhalb, wie es erschwingliche Londoner Wohnungen zu tun pflegen, aber ihre Beschreibung von der Größe, dem Komfort und der Aufgeräumtheit zeugt von einer neuen Zufriedenheit, über die River sich aufrichtig freuen würde, wenn er nicht andere Sorgen im Kopf hätte. Dabei knarrt die ganze Zeit über hinter ihm die Tür zu seinem Büro an einem quietschenden Scharnier, nicht weil sie gerade jemand benutzt, sondern ganz allgemein aus Protest über die lästige Zugluft überall in Slough House und im Spezielleren wegen des Aufruhrs ein Stockwerk weiter unten.
Doch auch wenn seine Tür unbenutzt bleibt, ist Rivers Büro nicht leer, denn sein neuer Kollege – seit etwa zwei Monaten ein Slow Horse – sitzt darin, zusammengesunken in seinem Stuhl, die Kapuze seines Hoodies über den Kopf gezogen. Abgesehen von seinen Fingern ist er vollkommen reglos, aber diese bewegen sich unaufhörlich. Die Tastatur ist zur Seite geschoben, und während ein Beobachter nichts weiter als einen fortgeschrittenen Fall von Zappeligkeit sehen würde, ist das, was J.K. Coe auf der abgewetzten Oberfläche seines Schreibtisches trommelt, eine stumme Nachahmung der Musik auf seinem iPod: Keith Jarretts improvisiertes Klavierstück bei dem Konzert in Osaka am 8. November 1976, einem der Sun-Bear-Konzerte. Coes Finger mimen die Melodien, die Jarrett an diesem Abend Tausende Kilometer weit weg vor vielen Jahren entdeckte; ein tonloses Echo des Genies eines anderen Mannes, und es dient einem doppelten Zweck: Coes düstere Gedanken zu vertreiben und die Geräusche zu übertönen, die ihm sein Kopf ansonsten vorgaukeln würde: das Geräusch von blutigem Fleisch, das zu Boden fällt, zum Beispiel, oder das Summen eines elektrischen Tranchiermessers, das von einem nackten Eindringling geschwungen wird. Aber all das behält er für sich, und was River und die anderen Insassen von Slough House angeht, betrachten sie J.K. Coe als ein Rätsel, ein in ein Geheimnis gehülltes Enigma in der Verpackung eines mürrischen, unkommunikativen Trottels.
Doch selbst wenn er jodeln würde, könnte man ihn bei dem Lärm in der Etage darunter nicht hören. Wobei der Krach nicht aus Roderick Hos Zimmer kommt. Von dort hört man nicht mehr als sonst – das Summen der Computer, das Tinnitus-Scheppern aus Hos iPod, der aggressivere Musik enthält als der von Coe, sein nasales Pfeifen, dessen er sich nicht bewusst ist, das gummiartige Quietschen seines Drehstuhls, wenn er sein Gesäß bewegt. Doch das eigentlich Überraschende an der Atmosphäre in Hos Zimmer ist – überraschend für jeden, der sich dort aufhielte, was niemand tut, weil es Hos Zimmer ist –, dass sie optimistisch ist. Fröhlich sogar. Als würde noch irgendetwas anderes als sein Überlegenheitsgefühl in diesen Tagen Roddy Hos Herz erwärmen, was praktisch wäre, wenn man bedenkt, dass sein Heizkörper nicht in der Lage ist, irgendetwas zu erwärmen, weder Herz noch sonst was: Er hustet jetzt, spuckt zischend aus seinem Ventil und spritzt Wasser auf den Teppich. Ho bemerkt es nicht, und er registriert auch nicht das darauffolgende Glucksen aus dem Leitungssystem – ein Geräusch, das Pferde, Löwen, Tiger aufscheuchen würde –, was jedoch weniger daran liegt, dass Ho ein übernatürlich cooler Typ wäre (wie immer er auch selbst darüber denkt), sondern dass er es einfach nicht hören kann. Was wiederum daran liegt, dass das Plätschern und Gluckern im Inneren des Heizkörpers, das Klopfen und Klicken der Rohre, das plätschernde Rasseln des Leitungsexoskeletts von den Geräuschen nebenan übertönt wird, wo Marcus Longridge Shirley Dander waterboardet.
»Würg-blörgh-argh-hust-blärgh!«
»Hab kein Wort verstanden.«
»Blearrrgh!«
»Entschuldige, heißt das …«
»BLARGH!«
»… Onkel?«
Der Stuhl, an den Shirley mit Gürteln und Tüchern gefesselt war, stand schräg an ihren Schreibtisch gelehnt und krachte beinahe zu Boden, als sie den Rücken durchbog. Ein lautes Knacken deutete auf einen ernsthaften Schaden hin. Im selben Moment klatschte der Waschlappen, der ihr Gesicht bedeckt hatte, auf den Teppich wie ein totes Meerestier auf einen Felsen. Shirley gab eine Weile lang ähnliche Geräusche von sich; wenn man hätte raten sollen, hätte man vermuten können, dass jemand versuchte, sich von innen nach außen zu wenden, ohne Werkzeug zu benutzen.
Marcus stellte leise pfeifend die Kanne auf den Aktenschrank. Etwas Wasser war auf seinen blassblauen Merino-pullover mit V-Ausschnitt gespritzt, und er versuchte, es wegzuwischen, mit dem üblichen Erfolg in solchen Fällen. Dann setzte er sich und starrte auf seinen Monitor, der schon längst auf Bildschirmschoner umgeschaltet hatte: ein schwarzer Hintergrund, auf dem ein orangefarbener Ball kreiste, der von den Ränder abprallte und nirgendwo ankam. Ja: Dieses Gefühl kannte Marcus genau.
Nach ein paar Minuten hörte Shirley auf zu husten.
Nach ein paar weiteren Minuten sagte sie: »Es war nicht so schlimm, wie du gesagt hast.«
»Du hast es weniger als sieben Sekunden ausgehalten.«
»Blödsinn. Das war ungefähr eine halbe Stunde, und …«
»Sieben Sekunden bis zu den ersten Lauten, die du ausgestoßen hast. Wie war das gleich? ›Blörgh? Blargh?‹« Er schlug mit der Hand auf die Tastatur, und der Bildschirmschoner verschwand. »Nicht unser vereinbartes Codewort, übrigens.«
»Aber du hast trotzdem aufgehört.«
»Was soll ich sagen? Ich werde weich.«
Ein Spreadsheet öffnete sich. Marcus konnte sich nicht sofort daran erinnern, was es darstellte. In letzter Zeit war in diesem Büro nicht viel gearbeitet worden.
Shirley befreite sich von Schals und Gürteln. »Du hast die Zeit nicht richtig gestoppt.«
»Ich habe sie einwandfrei gestoppt«, sagte er, mit Betonung auf ein-wand-frei. »Ich hab dir doch gesagt – niemand hält diesem Scheiß stand. Deshalb ist er ja bei den Vampiren so beliebt.«
Die Vampire waren diejenigen, deren Aufgabe es war, Steinen das Blut auszusaugen.
Shirley warf den nassen Waschlappen nach ihm. Ohne den Blick vom Monitor zu nehmen, fing er ihn mit einer Hand auf und verzog mürrisch das Gesicht, als das Wasser überallhin spritzte: »Vielen Dank auch.«
»Gern geschehen.« Sie trocknete ihre Haare mit dem Handtuch: Fünf Sekunden, und sie war fertig. »Und jetzt bist du dran.«
»Davon kannst du lange träumen!«
Sie streckte ihm die Zunge raus. Dann sagte sie: »Also. Bist du bereit, das durchzuziehen?«
»Hab ich doch gerade, oder?«
»In echt, meine ich. Und zwar bis zum bitteren Ende.«
Marcus blickte auf. »Wenn ich damit ein weiteres Westacres verhindern könnte, allerdings, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich würde es so lange tun, bis der Bastard mir alles erzählt. Von mir aus könnte er dabei ersaufen, wär mir egal.«
»Das wäre Mord.«
»Zweiundvierzig Jugendliche in einem Einkaufszentrum in die Luft zu jagen, das ist Mord! Einen mutmaßlichen Terroristen durch Waterboarding zu beseitigen ist eine Aufräumaktion.«
»Die Philosophie des Marcus Longridge, Band 1.«
»Trifft den Nagel auf den Kopf. Irgendjemand muss den Scheiß ja machen. Oder würdest du den Terroristen lieber laufenlassen, aus Angst, seine Menschenrechte zu verletzen?«
»Eben war er noch ein mutmaßlicher Täter.«
»Und du weißt genauso gut wie ich, was ›mutmaßlicher Täter‹ bedeutet.«
»Trotzdem hat er Rechte.«
»So wie diese Kinder welche hatten? Sag’ das mal ihren Eltern.«
Er wurde jetzt laut. Die beiden hatten sich daran gewöhnt, frei von der Leber weg herumzubrüllen, da Lamb in letzter Zeit nicht im Haus gewesen war. Was nicht hieß, dass er nicht jeden Moment auftauchen konnte – eine massige Gestalt, die unheimlich still die Treppe hinaufschlich, so dass das Erste, was man von seiner Anwesenheit mitbekam, sein Nikotinatem und sein grimmiger Blick waren: Amüsiert ihr euch? – aber bis es so weit war, fand Shirley, konnten sie genauso gut weiter schwänzen.
Sie sagte: »Ja, vielleicht. Andererseits finde ich nicht, dass man es sich so einfach machen kann.«
»Wenn du an vorderster Front stehst, wird vieles auf einmal sehr einfach. Ich dachte, das hättest du inzwischen begriffen. Wie dem auch sei«, sagte er und deutete auf den Stuhl, auf dem sie gesessen hatte, »bring den mal lieber in Hos Büro.«
»Warum?«
»Er ist kaputt.«
»Oh. Ach so. Meinst du, er verpfeift uns?«
»Nicht, wenn er Wert auf diesen Pennerflaum legt, den er Bart nennt«, sagte Marcus und strich kurz über seinen eigenen. »Wenn er uns an Lamb verpfeift, reiße ich ihm den vom Kinn.«
Wahrscheinlich nur ein Spruch, dachte Shirley, aber wer weiß, es konnte auch lustig werden.
Marcus war alles zuzutrauen.
Hätte er gewusst, dass er das Objekt der Gewaltphantasien seiner Kollegen war, hätte Roderick Ho es auf Eifersucht zurückgeführt.
Tatsache war, dass er phantastisch aussah.
Und das fand nicht nur er.
Er kam, wie immer, in bester Laune ins Büro: Schwebte wie ein Pfau in seiner nagelneuen Jacke (hüftlang, schwarzes Leder – wer kann, der kann!) ein und riss eine Dose Red Bull auf, die er sich reinzog, während seine Anlage hochfuhr. Aber das ging ihm echt langsam auf den Zeiger: An sein Equipment wurden oft höhere Ansprüche gestellt als an das des MI5, aber was soll man machen – Jackson Lamb erklären, dass größere Investitionen nötig wären, um Slough House technisch aus den Neunzigern zu zerren? … Er hielt einen Moment lang inne und ließ das Szenario vor seinen Augen ablaufen: »Jackson, Jackson, vertrau mir – die Anzugträger, Mann, die müssen das in den Griff kriegen. Mich zu bitten, mit diesem Mist zu arbeiten, ist wie, naja, sagen wir es mal so: Würdest du Paul Pogba bitten, mit einer Blechdose rumzukicken?« Und Lamb kichert, wirft die Hände in die Luft und sagt: »Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ich werde die Hohlköpfe im Park dazu bringen, Geld lockerzumachen …«
Das traf den richtigen Ton, entschied er.
Falls Lamb jemals wieder auftauchte, war das definitiv die richtige Strategie.
Inzwischen ließ er seine Fingerknöchel knacken, öffnete Amazon, schrieb eine Ein-Sterne-Rezension über ein beliebiges Buch und überprüfte dann seinen Bart im Spiegel, den er an der Schreibtischlampe befestigt hatte. Teuflisch stylisch. Hier und da wuchs ein rotes Haar zwischen den schwarzen, das konnte man auszupfen und notfalls mit der guten alten Küchenschere die Symmetrie wiederherstellen. So gut auszusehen erforderte nun mal einen gewissen Aufwand. Man musste kein Weltraumforscher sein, aber die meisten Schwachköpfe hier rafften es einfach nicht – abgesehen natürlich von River Cartwright.
Heh-heh-heh.
Cartwright war oben in der Küche und unterhielt sich mit Louisa. Es war noch nicht lange her, da hatte Roddy Louisa mit Samthandschuhen anfassen müssen. Sie hatte sich offensichtlich in ihn verguckt: peinlich, aber es war so. Wobei sie durchaus nicht hässlich war, im Gegenteil: Im richtigen Licht sah sie sogar gut aus, aber sie war alt, schon Mitte dreißig, und Frauen dieses Alters haftete oft ein Hauch von Verzweiflung an. Nur ein Moment der Schwäche ihnen gegenüber, und schon suchten sie Gardinen aus und schlugen ruhige Abende zu Hause vor. Doch Roderick Ho schwebte anderes vor: also sayonara, Babes. Als taktvoller Typ hatte er es geschafft, ihr klarzumachen, dass er, Rod, für sie tabu war und sie auf seine Rute verzichten musste, und zu ihrer Ehre musste man sagen, dass sie es ohne viel Aufhebens akzeptiert hatte, abgesehen von dem einen oder anderen wehmütigen Wäre-schön-gewesen-Blick. Unter anderen Umständen, so dachte er, hätte er ihr Angebot nicht ausgeschlagen – einer alleinstehenden Frau gelegentlich einen Ständer zu gönnen war ein Akt der Nächstenliebe –, aber ihr den Gefallen regelmäßig zu tun wäre zu weit gegangen, und ihr Hoffnungen zu machen wäre grausam gewesen.
Außerdem hätte ihm seine Tussi die Hölle heiß gemacht, wenn sie drauf gekommen wäre, dass er eine andere Frau tröstete.
Achtung: Singular.
Tussi, nicht »Tussis«.
Roddy Ho hat sich eine Freundin zugelegt.
Immer noch summend, immer noch bester Laune und immer noch phantastisch aussehend, kehrte Ho zu seinem Bildschirm zurück, krempelte im Geiste die Ärmel hoch und tauchte ins Dark Web ein, taub für das Glucksen seines Heizkörpers und das Schwappen in den Rohren, die sein Zimmer mit allen anderen Zimmern verbanden.
Was war das nun wieder für ein grässliches Geräusch?
Eine rhetorische Frage: natürlich, schon wieder der Heizkörper, der gurgelte wie eine Katze mit Durchfall. Moira Tregorian legte den zuletzt sortierten Stapel Papiere ab – aber was hieß schon »sortiert«; das war der Stapel »ohne Datum« –, hielt in ihren Bemühungen inne und begutachtete ihr neues Reich.
Ihr Büro befand sich im obersten Stockwerk; ihre Vorgängerin hatte Mr. Lamb am nächsten gesessen. Die persönlichen Dinge, die Catherine Standish zurückgelassen hatte (ihr Weggang war abrupt gewesen), befanden sich in einem mit Klebeband verschlossenen Karton: ihre privaten Stifte, ein gläserner Briefbeschwerer, eine volle Flasche Whiskey, eingewickelt in Seidenpapier – die Frau hatte ein Alkoholproblem gehabt, aber das war eben Slough House. Jeder hier hatte Probleme, oder das, was man heutzutage als »Probleme« bezeichnete. Moira nahm an, dass sie deshalb hierher versetzt worden war, um für das fehlende Rückgrat zu sorgen.
Überall Dreck, natürlich. Das ganze Gebäude machte einen verwahrlosten Eindruck; es schien in diesem Zustand zu schwelgen, als könnte ein Staubwedel hysterische Anfälle bei ihm auslösen. Das Kondenswasser beschlug die Fenster und sammelte sich in den Rinnen der Rahmen, wo sich Schimmel bildete. Wenn das so weiterging, würde das ganze Haus über ihnen zusammenkrachen … Hier wurde jedenfalls eine starke Hand gebraucht. Das hatte eindeutig Catherine Standishs Kraft überstiegen, aber wenn man sich einmal dem Alkohol hingegeben hat, kann es sowieso nur noch bergab gehen.
Moira war nicht entgangen, dass sich unter den Dokumenten auf ihrem Schreibtisch auch Standishs Entlassungspapiere befanden, die nur noch von Jackson Lamb unterschrieben werden mussten.
Nun gehörte es schon seit langem zu Moira Tregorians Credo, dass es der Papierkram war, der Schlachtschiffe über Wasser hielt: Die Admiräle mochten in ihren schicken Uniformen allesamt an Deck paradieren, doch ohne die richtigen Papiere kamen sie nicht mal aus dem Hafen raus. Moira war seit je eine Vorkämpferin für Recht und Ordnung gewesen, egal, wen sie vor sich hatte. In Regent’s Park hatten sogar die Königinnen der Datenbanken nach ihrer Pfeife tanzen müssen. Sie hatte dafür gesorgt, dass sie sich präzise an ihre Zeiten hielten und ihr Equipment regelmäßig gewartet wurde; dass die Pflanzen, auf die sie bestanden, entsorgt wurden, sobald sie abgestorben waren; dass das Büromaterial, das sie in Windeseile verbrauchten, wöchentlich aufgefüllt und ein Protokoll darüber geführt wurde, wer sich was nahm, denn Moira Tregorian war weder blind noch blöd. Post-it-Zettel mochten aus Papier sein, aber sie wuchsen nicht auf Bäumen. Und um zu beweisen, dass es kaum etwas gab, was sie nicht konnte, übernahm sie regelmäßig eine Schicht in der Leitstelle: Notrufe entgegennehmen und so weiter. Für sie war das alles kein Hexenwerk, aber sie war ja auch Büroleiterin und stolz darauf. Ein ordentliches Management war dringend nötig. Man brauchte sich bloß hier umzusehen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was sonst passierte. Und Chaos war die Wurzel allen Übels.
Ein weiteres Poltern von unten deutete darauf hin, dass das Chaos den Kampf um Slough House gewann. In Ermangelung eines anderen Verteidigers der Ordnung seufzte Moira tief und machte sich auf den Weg nach unten, um nachzusehen.
»Was meinst du, wie alt sie ist?«
»So Mitte fünfzig«, antwortete Louisa. »Also …«
»Ungefähr so alt wie Catherine«, sagte River.
»Hm-hm.«
»Fast eine Art Ersatz«, fuhr River fort. »Du weißt schon. Eine rein, eine raus.«
»… Hast du schon mit Shirley geredet?«
»Warum? Was hat sie gesagt?«
»Ach, egal«, sagte Louisa. Sie schüttelte den Kopf, nicht um sich selbst zu widersprechen, sondern weil ihr die Haare in die Augen hingen; sie trug sie jetzt länger und musste sie bei jeder Gelegenheit zurückstecken: beim Lesen, Arbeiten, Autofahren. Sie hatte die Strähnchen herauswachsen lassen und war wieder zu ihrem natürlichen Braun übergegangen. Der Ton würde sich aufhellen, wenn der Frühling kam, falls er Sonnenschein brachte; und wenn nicht, tja, dann konnte sie immer noch schummeln und ein bisschen Sonnenlicht aus der Flasche quetschen.
Im Moment schien der Frühling noch weit entfernt zu sein.
River sagte: »Ich sollte wohl mal mit der Arbeit weitermachen«, klang aber so, als hätte er andere Dinge im Kopf und würde um den heißen Brei herumschleichen.
Louisa fragte sich, ob er sie um ein Date bitten wollte und was sie sagen würde, wenn er es täte.
Ziemlich sicher nein. Sie hatte ihn im letzten halben Jahr ganz gut kennengelernt, und im Vergleich zu den anderen Insassen hier hatte er durchaus seine Vorzüge: Er war nicht verheiratet wie Marcus, kein Widerling wie Ho oder ein möglicher Psychopath wie sein neuer Bürokollege. Andererseits war er aber auch nicht Min Harper. Min war nun schon länger tot, als sie zusammengewesen waren, und sie wollte ihn bestimmt durch niemanden ersetzen, aber dennoch: Ein Date mit einem Kollegen rief unwillkürlich Vergleiche hervor. Das konnte nur böse enden. Ab und zu nach der Arbeit mal zusammen was trinken gehen war in Ordnung, aber alles darüber hinaus war tabu.
Das redete sie sich jedenfalls ein. Aber sie hielt es dennoch für ratsam, ihn schon abzuwimmeln, wenn es nur so aussah, als wollte er etwas in der Richtung andeuten.
»Hast du nachher noch was vor?«, fragte er.
»Ja, nein, was? Nachher?«
»Weil ich gerne mit dir über etwas reden würde, aber hier ist nicht der richtige Ort dafür.«
O fuck, dachte sie. Da haben wir’s.
»Entschuldigung, ist das ein privates Gespräch?«
Und hier war sie, Moira Tregorian, ein Name, den sich Louisa gestern fast den ganzen Tag lang versucht hatte einzuprägen. Immer wieder spaltete sich »Tregorian« in einzelne Silben auf und ordnete sich neu: Woher kam er, aus Cornwall? Sie wollte lieber nicht fragen, aus Angst, die Antwort könnte sie zu Tode langweilen. Die Leute wurden oft redselig, wenn es um ihre Herkunft ging.
»Nein, wir haben uns nur kurz ausgetauscht«, erwiderte River.
»Hmmm«, machte Moira Tregorian, und die beiden Jüngeren wechselten einen Blick. Keiner von beiden hatte bisher viel mit Moira gesprochen, und »Hmmm« war kein vielversprechender Anfang.
Sie war etwa Mitte fünfzig, klar, aber da endeten ihre Gemeinsamkeiten mit Catherine Standish auch schon. Catherine hatte etwas Geisterhaftes an sich gehabt und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, eine innere Stärke, die es ihr ermöglicht hatte, ihre Alkoholsucht zu besiegen oder zumindest den täglichen Kampf dagegen nicht aufzugeben. Weder River noch Louisa konnten sich daran erinnern, dass sie sich je über irgendetwas beklagt hatte, was angesichts ihres täglichen Umgangs mit Jackson Lamb auf eine buddhahafte Geduld hindeutete. Moira Tregorian mochte vieles sein, aber geisterhaft war sie jedenfalls nicht, und geduldig sah sie auch nicht gerade aus. Ihre Lippen waren geschürzt und ihre Wangen zitterten leicht, als hätte sich etwas in ihr angestaut. Abgesehen davon war sie etwa einssechzig groß, hatte ihr mausfarbenes Haar zu einem Mopp frisiert und trug eine rote Strickjacke, auf die Lamb vermutlich reagieren würde wie der sprichwörtliche Stier, falls er je wieder auftauchte. Lebhafte Farben waren ihm ein Graus; ihm würde davon übel, behauptete er, und sie machten ihn aggressiv.
»Denn mir scheint«, fuhr Moira fort, »dass Sie zwei Tage nach einem schweren Terroranschlag in unserem Land Besseres zu tun haben sollten. Schließlich ist das hier immer noch ein Arm des Geheimdienstes, stimmt’s?«
Tja, einerseits schon, andererseits aber auch nicht.
Slough House war eine Zweigstelle des Security Service, so weit, so gut, aber »Arm« war zu hoch gegriffen. »Finger« ebenfalls. Ein Finger konnte einen entscheidenden Knopf drücken oder am Puls des Geschehens liegen. Fingernägel dagegen: die schnitt man ab, warf sie weg und wollte sie nie wieder sehen. Von daher war Slough House ein Fingernagel des Service: geographisch ein gutes Stück von Regent’s Park entfernt und in sonstiger Hinsicht auf einem anderen Planeten. Slough House war der Ort, an dem man landete, wenn einem alle anderen Wege beim Geheimdienst versperrt waren. Dorthin wurde man geschickt, wenn sie einen loswerden, aber nicht entlassen wollten, weil man dagegen hätte Rechtsmittel einlegen können.
Und so stimmte es zwar, dass landesweit die höchste Sicherheitsstufe galt, aber es war noch nicht so weit gekommen, dass jemand ins Telefon schrie: »Holt mir die Slow Horses!«
Louisa sagte: »Wenn es etwas gäbe, was wir unternehmen könnten, würden wir es tun. Aber wir haben weder die Mittel noch die Informationen, um hier im Büro etwas Sinnvolles auszurichten. Und falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Uns schickt man nicht raus auf Einsätze.«
»Tja, na ja. Das ist auch gut so.«
»Deshalb lassen Marcus und Shirley Dampf ab. Bei Coe bin ich mir nicht sicher, aber ich vermute, dass er an seinem Schreibtisch vor sich hin döst. Und Ho striegelt wahrscheinlich seinen Bart. Und damit hätten wir dann alle.«
»Kommt Mr Lamb nicht?«, fragte Moira.
»Lamb?«
»Mr Lamb, ganz recht.«
River und Louisa warfen sich einen kurzen Blick zu. »Er ist in letzter Zeit nicht oft hier gewesen«, erklärte Louisa.
»Von daher …«, sagte River, begleitet von einer vagen Handbewegung. Von daher unterhielten sich Kollegen in der Küche und folterten sich gegenseitig in ihrem Büro. Kaum sei die Katze aus dem Haus, hatte Lamb mal bemerkt, kämen die Mäuse auf dumme Gedanken und krakelten laut nach demokratischer Freiheit. Woraufhin die Katze in einem Panzer zurückkam.
(»Ach, wie war das noch mal«, hatte River ihn einmal gefragt, »damals im Kalten Krieg – auf wessen Seite waren Sie da eigentlich?«)
»Tja, aber er hat mich zum Mittagessen eingeladen«, bemerkte Moira Tregorian.
In der darauffolgenden Stille rülpste der Heizkörper auf dem Treppenabsatz auf seltsam vertraute Weise, als wollte er sich einmischen.
»Ich glaub, mich hat grade der Schlag getroffen«, sagte Louisa schließlich. »Sie können unmöglich das gesagt haben, was ich meiner Meinung nach verstanden habe.«
River fragte: »Haben Sie Jackson schon kennengelernt?«
»Er hat mir eine E-Mail geschickt.«
»Heißt das nein?«
»Wir haben uns nicht persönlich getroffen.«
»Haben Sie von ihm gehört?«
»Ja, man hat mir erzählt, er sei ein bisschen … speziell.«
»Ihnen hat aber niemand gesagt, inwiefern?«
»Nein, das war nicht nötig …«
Louisa hakte nach: »Also, Sie haben ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber er hat Ihnen eine E-Mail geschickt und Sie zum Mittagessen eingeladen? Für wann?«
»Er hat nur ›bald‹ geschrieben.«
»Was Ihrer Meinung nach heute bedeutet.«
»Na ja … So habe ich es interpretiert.«
»Alle Mann auf Gefechtsstation«, murmelte River.
Sie ergriffen die Flucht, aber bevor sie in ihre jeweiligen Büros verschwanden, fragte River: »Und, alles klar wegen nachher?«
»Ja, nein, was? Nachher?«
»Nur kurz was trinken«, sagte River. »Ich wollte doch mit dir reden …«
Jetzt kommt’s, dachte Louisa.
»… Ich mache mir Sorgen um meinen Großvater.«
Obwohl der Regen aufgehört hatte, spritzten bei jedem Windstoß noch einige Tropfen aus den Blättern an die Fensterscheiben, und die Dachrinne über der Veranda, die mit Laub verstopft war, floss über. In der Allee hatte sich eine Lagune gebildet, die den Grünstreifen rechts und links überschwemmte, und im Dorf hatte ein geplatztes Hauptrohr die Straße für anderthalb Tage unbefahrbar gemacht, das Wasser drang auf seine übliche, unerbittliche Weise durch den Asphalt. Feuer konnte man bekämpfen und sogar halbwegs zähmen; Wasser bahnte sich seinen Weg, wo immer es hinwollte. Es brauchte hundert Jahre, um einen Felsen abzutragen, konnte denselben Felsen jedoch auch anheben und ihn in anderthalb Minuten drei Kilometer weit mitreißen. Es veränderte auch die Landschaft, so dass er, wenn er bei Tagesanbruch aus dem Fenster schaute, im Schlaf an einen anderen Ort versetzt hätte sein können; das ganze Haus war in ein Reich verfrachtet worden, in dem Bäume aus der Tiefe emporwuchsen und ein Heckengeflecht die Oberfläche von Seen streifte. Verwirrt von der Andersartigkeit, konnte man die Orientierung verlieren. Was das Letzte war, was man sich wünschte, denn eines Tages würde es das Letzte sein, was mit einem geschah.
Es war wichtig, den Überblick darüber zu behalten, wo man sich befand.
Zu wissen, welches Datum war, war ebenso wichtig.
Ein Glück, dachte David Cartwright – Rivers Großvater, der O.B. –, dass ich ein gutes Gedächtnis für Zahlen habe.
Es war der 4. Januar. Das Jahr, wie immer, das aktuelle.
Sein Haus lag in Kent; ein altes Haus mit großem Garten, in dem er nicht mehr so viel tat, seit Rose gestorben war. Der Winter bot ihm ein Alibi: Ich kann es kaum erwarten, wieder draußen zu sein, mein Junge. Es gibt nichts Besseres, als in der Erde zu graben! Zufällig hatte er gerade im Garten gearbeitet, als er River zum ersten Mal begegnet war. Komische Art, seinen Enkel kennenzulernen, der zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre alt war. Damals hatte er Rivers Mutter die Schuld daran gegeben, aber solche klaren Urteile erschienen ihm mittlerweile weniger eindeutig. Er band seine Krawatte, während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen; er beobachtete seine Hände im Spiegel, wie sie komplizierte Bewegungen ausführten, die nicht vom bewussten Verstand gesteuert wurden. Manche Dinge tat man am besten, ohne nachzudenken. Eine Tochter großzuziehen gehörte, wie sich herausgestellt hatte, nicht dazu.
Die Krawatte schien gut zu sitzen. Ein gewisses Niveau musste einfach sein. Man las von alten Kerlen in urinbefleckten Cordhosen, die ihre Westen verkehrt herum anzogen und denen der Sabber über das Kinn lief.
»Sollte es mit mir mal so weit kommen«, hatte er River mehr als einmal eingeschärft, »erschieß mich wie einen alten Gaul.«
»Ist klar, wie einen Gaul«, hatte River trocken geantwortet.
Verdammt, so nannten sie sie dort in Slough House. Die Lahmen Gäule. Damit war er dem jungen Mann auf die Füße getreten und hatte ihn daran erinnert, was er alles verbockt hatte.
Nicht, dass seine eigene Karriere ganz makellos verlaufen wäre. Wenn es zu seiner Zeit ein Slough House gegeben hätte, wer weiß? Vielleicht hätte er selbst sein Berufsleben in tödlicher Frustration verbracht; gezwungen, auf der Ersatzbank zu hocken und anderen dabei zuzusehen, wie man sie auf den Schultern um das Spielfeld trug. Ehrenrunden und so weiter. Das hatte der Junge natürlich gedacht; dass sich alles um Tapferkeit und Ruhm drehte – in Wahrheit ging es nur um Fleisch und Blut. Orden verdiente man sich nicht im Sonnenschein, und im Dunkeln lauerten viele darauf, einem in den Rücken zu fallen. Es war ein dreckiges Geschäft, und vielleicht war der Junge ohne das alles besser dran, obwohl man ihm das natürlich nicht sagen durfte, sonst wäre er kein Cartwright gewesen. So wie Rivers Mutter, die David Cartwright jahrelang schmerzlich vermisst hatte, ohne es irgendjemandem gegenüber zuzugeben; nicht einmal Rose hatte es gewusst.
… All diese Gedanken, und er stand immer noch hier im Flur. Was hatte er bloß vorgehabt? Kleine Momente des Vergessens kamen und gingen so unmerklich, dass sie kaum eine Spur hinterließen. Er wollte ins Dorf gehen. Er musste sich mit Brot und Speck und so weiter eindecken. Vielleicht kam sein Enkel später noch vorbei, und er wollte etwas zu essen im Haus haben.
Sein Enkelsohn hieß River.
Bevor er ging, musste er jedoch noch einmal überprüfen, ob seine Krawatte saß.
So, wie man mit der Zunge immer wieder an einem wunden Zahn pult, kehrte das Gespräch in Marcus’ und Shirleys Büro immer wieder zu Roderick Ho zurück – genauer gesagt, zu der völlig unwahrscheinlichen, auf das Ende der Zeiten hindeutenden Anspielung, dass er nicht mehr Single war.
»Meinst du, er hat wirklich eine Frau gefunden?«
»Könnte sein. Es ist erstaunlich, was manche Leute so alles rumliegen lassen.«
»Wer weiß, vielleicht ist es eine Transe oder so. Der würde das gar nicht kapieren.«
»Sogar Ho …«
Shirley sagte: »Im Ernst, glaub mir. Er wäre der Letzte, der’s merkt.«
»Okay, okay«, sagte Marcus. »Aber er scheint voll dabei zu sein.« Er warf einen säuerlichen Blick in den Flur und zu Hos Büro auf der anderen Seite. »Er behauptet, er wäre jetzt treu.«
»Wahrscheinlich meint er mehrfach.«
Marcus, der keinen Sex mehr gehabt hatte, seitdem das Auto seiner Frau gepfändet worden war, stöhnte.
Louisa hatte vor drei Minuten durch die Tür gespäht, um sie vorzuwarnen, dass Lamb möglicherweise im Anmarsch war. Seitdem starrten die beiden auf ihre Bildschirme und boten ein einigermaßen glaubwürdiges Bild beschäftigter Sachbearbeiter, abgesehen davon, dass Shirley noch nass war. Marcus’ Monitor pulsierte vor seinen Augen. Obwohl er nun schon seit einiger Zeit in Slough House war, hatte er sich noch nicht an die Routinen gewöhnt: Geist und Körper abschalten, ein Automat werden, willkürliche Daten verarbeiten. Ausgebrannte Fahrzeuge, darum ging es auf seinem Spreadsheet: ausgebrannte Autos und Lieferwagen – kein ungewöhnlicher Anblick in britischen Städten. Letzte Woche noch hatte er selbst einen gesehen, auf einem Supermarktparkplatz; eine schwarze Hülle, die in einer Lache aus rußigen Rückständen hockte. Der Wagen war wahrscheinlich nach einer Spritztour dort abgestellt und angezündet worden, die einfachste Art, Beweise zu vernichten. Die Kids, die ihn geklaut hatten, meinten wohl, dass die Polizei darauf brannte, ihre Gangsta-Ärsche mit Hilfe der CSI zu identifizieren und DNA auf den Sitzen zu sichern und Fingerabdrücke vom Lenkrad zu nehmen. Da war es nur logisch, das Baby abzufackeln und zuzusehen, wie es in der Hitze knackte und sich verzog.
Doch was, wenn es nicht so einfach war, wie es schien?, wollte Lamb wissen. (Wichtige Anmerkung: Lamb wollte das gar nicht wissen – Lamb war es egal. Lamb hatte nur gerade eine weitere Möglichkeit entdeckt, die Zeit eines Slow Horse zu vergeuden.) Was, wenn diese kleinen Feuerteufel nicht einfach nur ihre gestohlenen Autos anzündeten, sondern mit Möglichkeiten experimentierten, Autos in die Luft zu jagen – den Explosionsradius berechneten oder den potentiellen Schaden maßen, den unterschiedliche Nutzlasten anrichten konnten? Und so wurde Marcus, dessen Rolle im Leben darin bestanden hatte, Türen einzutreten, gezwungenermaßen zum Analytiker umgeschult; er starrte auf einen Bildschirm, auf dem die Brandstiftungen an Fahrzeugen im Zeitraum von fünf Jahren nach Marke, Ort, verwendetem Brandbeschleuniger und einem Dutzend anderer Variablen aufgeschlüsselt wurden … Es bestand immerhin die Möglichkeit, dass Lamb recht hatte – jeder, dem der Gedanke abwegig erschien, brauchte nur den Fernseher einzuschalten und sich anzusehen, wie die Forensiker in Schutzanzügen die Asche von Westacres durchwühlten. Aber wie auch immer: Das war nicht der Teil des Prozesses, in den Marcus hätte involviert sein sollen. Er war eigentlich derjenige, den man rief, wenn sich ein Verdächtiger mit Geiseln in einem Hochhaus verschanzt hatte. Derjenige, den sie in Kevlar kleideten und einen Schornstein hinunterließen: Fröhliche Weihnachten, ihr Arschlöcher!
Steuerung, Alt, Delete.
Der Heizkörper gurgelte laut und unterbrach seinen Gedankengang; zumindest bedeutete es, dass Wärme im Gebäude kursierte, was wiederum bedeutete, dass jemand die Rechnungen bezahlte. Ganz im Gegensatz zu Marcus. Marcus sammelte derzeit in einer Schublade Rechnungen: Letzte Mahnungen für Strom und Gas. Cassie sprach bereits davon, die Kinder zu nehmen und »für eine Weile« zu ihrer Mutter zu ziehen, und das, obwohl sie gar nichts von den unbezahlten Rechnungen wusste – die Pfändung ihres Autos hatte das Fass zum Überlaufen gebracht.
»Du hast versprochen, dass du es im Griff hast!«
Seine Spielsucht, meinte sie.
»Du hast gesagt, dass du einen Schlussstrich gezogen hast, dass du aufgehört hast und kein Geld mehr zum Fenster rauswirfst. Du hast es mir versprochen, Marcus!«
Und er hatte es auch so gemeint, aber er konnte einfach nicht verhindern, dass ihm das Geld zwischen den Fingern zerrann. Geld hatte einen eigenen Willen und reagierte noch weniger auf Überredungsversuche als Cassie.
Er dachte: Ich bin zu einem dieser Männer geworden, die tot mehr wert sind als lebendig. Und von uns gibt es mehr, als man meinen könnte. Nicht nur auf die Köpfe der Dschihadisten draußen in der Pampa, die Kamelfleisch fressen und in Löchern schlafen, sind Millionen von Dollars ausgesetzt: Es sind auch wir Übrigen. Wir hart arbeitenden dämlichen Säcke, verschuldet bis über beide Ohren, eine haushohe Hypothek am Hals und Rechnungen, dass man damit die Wände tapezieren könnte. Uns bleibt im Monat kaum genug Geld für eine Tasse Kaffee, aber wir schultern die Raten für astronomische Lebensversicherungen. Würde ich jetzt tot umfallen, würde die Versicherung all meine Probleme lösen. Das Haus wäre abbezahlt, und es bliebe genug übrig, um den Kindern das Studium zu finanzieren. Die optimale Lösung, außer, dass ich tot wäre. Aber früher oder später passiert das sowieso, warum also nicht gleich hier an meinem Schreibtisch? Er sollte Cassie gegenüber mal einen Witz darüber machen, nur würde sie wahrscheinlich nicht lachen. Und keine noch so dicke Kevlar-Schicht schützte vor der Enttäuschung einer Frau.
Ein Knall – Faust auf Tastatur – weckte ihn aus seiner Träumerei. Shirley hatte Hardware-Probleme und löste sie auf ihre übliche Art.
»Musst du nachher noch zum AFM?«, fragte er.
»Wer will das wissen?«, knurrte sie.
»Niemand«, antwortete Marcus und tippte einen Moment lang wahllos auf seiner eigenen Tastatur herum, als ob er durch die Veränderung der Zahlenreihen auf seinem Bildschirm auch die Tatsachen ändern könnte, mit denen er konfrontiert war: nicht nur die zerstörten Autos eines halben Jahrzehnts, sondern auch sein eigener schwindender Nettowert – die Schulden schnappten immer höher, immer bösartiger nach ihm, und seine Fähigkeit, ihnen zu entkommen, wurde von Tag zu Tag geringer.
Wenn er zu Fuß ins Dorf wollte, würde er seine Gummistiefel brauchen. Gestern hatte er nach kaum fünfzig Metern umkehren müssen – mit schlappenden Schritten war er die Einfahrt hinaufgeschlurft und hatte die Hausschuhe anschließend in den Mülleimer geworfen, durchnässt und unbrauchbar. Na ja, ein Augenblick der Zerstreutheit, aber keiner hatte etwas bemerkt. Das war einer der Vorteile, wenn man so abgeschieden wohnte, obwohl man nie sicher sein konnte, dass man nicht von Wieseln beobachtet wurde.
»Weißt du, was ich mit ›Wieseln‹ meine?«
River vergaß selten etwas. David Cartwright hatte ihn gut ausgebildet.
»Wenn man ein Wiesel entdeckt, tut man so, als hätte man es nicht gesehen«, antwortete River.
»Aber Wiesel sieht man sowieso nicht.«
»Man sieht sie nie«, stimmte River zu. »Aber man weiß, dass sie da sind.«
Denn die Zeichen, die sie hinterließen, waren Legion. Das platte Gras, wo sie gekniet hatten; der abgebrochene Zweig, der ihnen die Sicht versperrt hatte. Zigarettenstummel in einem ordentlichen Haufen. Wehe, du lässt den Jungen alte Kippen aufsammeln!, hatte Rose geschimpft. Aber es war eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, dass der Junge lernte, auf der Hut zu sein, denn wenn die Wiesel einen erst einmal im Visier hatten, war es teuflisch schwer, sie abzuschütteln.
Ein guter Morgen für ein Training. Außerdem plantschen alle Jungs gerne in Pfützen rum, also – ein Gummistiefel an, den anderen zum Reinschlüpfen gekippt – rief er River zu, er solle mitkommen, eine Runde spazieren gehen. Aber während seine Worte noch durch das leere Haus schallten, merkte er, dass etwas nicht stimmte: Das war nicht die Stimme, die er gehabt hatte, als River noch ein Junge gewesen war. Und Rivers Kindheit war vorbei; die Tage, an denen er ihn über Wiesel und Kobolde, die Mythen und Legenden der Spook Street aufgeklärt hatte, lagen länger zurück als Roses Tod …
David Cartwright schüttelte den Kopf. Die Phantasie eines alten Mannes – eine Erinnerung stieg an die Oberfläche wie eine Luftblase von einem Frosch. Er lachte vor sich hin, als er den Fuß in den zweiten Gummistiefel steckte. Wenn der Junge jemals erfuhr, dass er diese unachtsamen Momente hatte, würde er keine Ruhe mehr geben. Außerdem waren Wiesel nicht mehr das, was sie mal waren. Heutzutage benutzten sie Drohnen und Satellitenbilder; sie platzierten winzige Kameras in deinem Haus. Jede deiner Bewegungen wurde aufgezeichnet.
Als er die Gummistiefel angezogen hatte, richtete er sich auf. Ein bisschen Bewegung, das war jetzt genau das Richtige. Es stimmte schon, dass es in letzter Zeit Augenblicke gegeben hatte, in denen er sich Sorgen um seinen Verstand gemacht hatte. Es kam vor, dass er nachmittags eindöste, ein verzeihlicher Lapsus bei einem alten Kauz, und voller Panik erwachte: Das Feuer brannte im Kamin, die Lampe verbreitete weiches Licht, alles war so, wie es sein sollte, und doch war da dieses Pochen in seiner Brust: Was war geschehen, während er geschlafen hatte? Mauern konnten einstürzen. Alles Mögliche war schon unter Brücken zum Vorschein gekommen. Es war eine Erleichterung, wenn er feststellte, dass die Welt, in der er aufgewacht war, noch immer dieselbe war wie die, die er verlassen hatte.
Aber das war nicht immer der Fall, nicht wahr? Und manchmal gab es ja tatsächlich Katastrophen. Erst vor zwei Tagen dieser Selbstmordanschlag in einer Londoner Shopping Mall – wie nannten sie es? Einen Flashmob … Der schwärzeste aller schwarzen Witze; ein Flashmob, der in Flammen aufging und all diese jungen Leben zerstörte. Als er vor seiner Haustür stand, empfand David Cartwright es einen Moment lang als einen persönlichen Verlust, etwas, das er hätte verhindern können. Und dann verblasste das Verlustgefühl, und Rose sagte ihm, er solle unbedingt seine Barbour-Jacke anziehen, nicht diesen schrecklichen alten Regenmantel. Und er solle seinen Regenschirm mitnehmen, nur für alle Fälle.
Schlüssel in der Tasche. Gummistiefel an den Füßen. Worüber hatte er nachgedacht, irgendetwas Schreckliches? Es zog an ihm vorbei wie Rauch, nichts, woran er anknüpfen konnte. Er schlüpfte in seinen Regenmantel – mit der Barbour-Jacke hatte er das Gefühl, so zu tun, als sei er vom Lande – und ließ seinen Regenschirm wie eine Fledermaus an seinem Haken hängen. Dann ging er zur Tür hinaus.
Im Büro über dem von Marcus und Shirley hämmerten andere Finger: Ihre Bewegungen waren fließend, die Tastatur imaginär, die Noten, denen sie folgten, scheinbar zufällig, aber immer auf der Suche nach der zugrunde liegenden Melodie; einer Melodie, die etwa dreißig Minuten lang nachhallte, sich aufbaute und wiederholte, deren Themen zunächst verhalten, manchmal holprig waren, sich aber schließlich offenbarten. Und währenddessen geschah nichts anderes. Das war für Jason Kevin Coe das Verlockende daran: die saubere weiße Seite, die sie in seinem Kopf aufschlug, und die Alpträume, die dort eingebrannt waren, vorübergehend auslöschte.
Wir haben das Gefühl, dass Sie … nicht glücklich mit Ihrer Arbeit sind.
Er konnte sich nicht erinnern, wie er diese Frage beantwortet hatte, die eigentlich gar keine war. Seinem Gefühl nach hatte er einfach nur dagesessen, während die Finger auf seinem Schoß zuckten. Auf der Suche nach einer Melodie, die in seinem Kopf herumschwirrte.
Coe wusste nicht genau, wann das angefangen hatte. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen, improvisierte Klavierstücke in stummer Pantomime nachzuspielen; es war eher so, dass er sich dabei ertappt hatte, oder besser: dass ihn andere dabei ertappt hatten. Er hatte in einem Bus gesessen, der sich in ruckartigem Stop-and-go durch die verstopfte Regent Street bewegte, als er bemerkte, wie die junge Frau neben ihm von ihm abrückte und beunruhigte Blicke auf ihn und seine Finger warf, die auf einer nicht existierenden Tastatur klimperten. Bis zu diesem Moment hatte er die Musik in seinem Kopf nicht mit der Bewegung seiner Hände in Verbindung gebracht. Er trug nicht die Ohrstöpsel seines iPod, die Musik war einfach in ihm drin, etwas, worauf er sich in Momenten der Angst stützte, zu denen inzwischen, wie er wenig überrascht feststellte, auch die Stop-and-go-Fahrt in einem überfüllten Bus auf der Regent Street zählte.
Wir haben uns gefragt, ob eine Versetzung nicht vielleicht in Ihrem Interesse wäre.
Immer dieses »wir«, das die Vielzahl der Kräfte unterstrich, die eine Phalanx gegen ihn bildeten. Wobei es nicht die Personalabteilung des Geheimdienstes war, die ihm schlaflose Nächte bereitete.
Heute trug J.K. Coe ein T-Shirt unter seinem grauen Kapuzenpullover und dazu eine am Knie zerrissene Jeans. Es war schon eine Weile her, dass er etwas anderes getragen hatte. Er hatte sich seit drei Tagen nicht rasiert, und obwohl er unbestreitbar sauber war – er duschte zweimal täglich (öfter, wenn es die Zeit erlaubte), verfolgte ihn immer ein Hauch von etwas, das knapp außerhalb seiner Riechfähigkeit zu schweben schien. Manchmal befürchtete er, dass es der Geruch von Scheiße war. Doch im Grunde wusste er, dass es Angst war; der Geruch seiner eigenen, schlimmsten Erinnerung, als er nackt an einen Stuhl gefesselt war, während ein anderer Mann, ebenfalls nackt, ihn mit einem elektrischen Tranchiermesser bedrohte. In seinen Träumen, in seinen schlaflosen Alpträumen, durchlebte er, was hätte passieren können; wie das Metall sein Fleisch durchschnitt, wie seine Eingeweide klatschend auf die Plastikplanen fielen, die auf dem Boden ausgebreitet waren. Wenn seine Finger nicht nach Musik suchten, wanderten sie zu seinem Magen, verschränkten sich über seinem Bauch, versuchten krampfhaft im Inneren zu halten, was hätte herausgeschnitten werden können.
All das hatte sich zu Hause abgespielt, in seiner Wohnung im fünften Stock. Er hatte sie gekauft, als er im Bankwesen gut verdiente, bevor er diese Karriere satt gehabt hatte, kurz bevor auch alle anderen ihrer überdrüssig waren und die Leute begannen, Banker zu betrachten, als müsse man sie alle in einen Sack stecken und draufhauen. Gerade noch mal davongekommen, hatte er damals gedacht, nachdem er sich auf sein Studienfach besonnen und eine Stelle in der Abteilung für psychologische Untersuchungen des Geheimdienstes angenommen hatte, wo er hoffte, etwas Nützliches tun zu können. Ein bescheidener Wunsch; er war nicht mehr karrieregeil.
Slough House könnte besser zu Ihnen passen, unserer Meinung nach. Es gibt dort weniger … Aufregung.
In den Wochen und Monaten nach seiner Folter war Coe der meisten Dinge überdrüssig geworden. Das Essen verlor seinen Geschmack, und Alkohol brachte ihn zum Erbrechen, lange bevor er irgendeine betäubende Wirkung entfalten konnte. Hätte er Zugang zu Gras oder etwas Stärkerem gehabt, hätte er es probiert, aber der Erwerb illegaler Substanzen erforderte soziale Interaktion; Interaktion mit Menschen, von denen er sich vorstellte, dass sie … »Aufregung« bedeuteten. Er konnte nicht lange lesen, ohne wütend zu werden. Musik war alles, was ihm blieb. Coe hatte noch nie in seinem Leben Klavier gespielt, und es war fraglich, ob seine Finger in die richtige Richtung liefen, wenn die Noten in seinem Kopf die Tonleiter hinaufkletterten; trotzdem war er hier, verbannt nach Slough House mit den anderen Versagern der Geheimdienstwelt, dazu verurteilt, sich mit aussichtslosen Projekten abzuplagen, ohne dass ein Ende in Sicht war. Stattdessen machte er ungehörte Musik auf einem unspielbaren Instrument und fand dabei wenn nicht Frieden, so doch zumindest ein gewisses Maß an Vergessen.
Von der anderen Seite des Büros aus beobachtete River Cartwright ihn teilnahmslos. Wenn er bei den Slow Horses irgendetwas gelernt hatte, dann, dass man manchen Menschen nicht helfen konnte – manchmal musste man sie ertrinken lassen. Und genau das schien J.K. Coe zu tun: zu ertrinken, ohne mit den Armen zu rudern, an einem Schreibtisch Halt suchend, der ihn niemals über Wasser halten würde. Welches Ufer er auch immer anpeilte, er würde es entweder dorthin schaffen oder nicht. Bis es so weit war, würde River ihn in Ruhe lassen.
Außerdem hatte er seine eigenen Probleme.
An der Kreuzung, wo die Auffahrt auf die schmale Straße traf, lag der Große See, ein jährliches Ereignis, das durch mangelhafte Entwässerung verursacht wurde. David Cartwright umging ihn unsicher, einen vorsichtigen Schritt nach dem anderen, entlang dessen, was von der Bordsteinkante übrig geblieben war: kaum mehr als eine Reihe schmaler Trittsteine. Die Hecke erzitterte, als er sie streifte, und ein halber Liter Wasser ergoss sich in seinen Stiefel, verflixt! Aber jetzt war er vorüber und stand wieder auf festem Boden. Er winkte zum Nachbarhaus hin, obwohl dessen Fenster dunkel waren, und passierte mit schmatzenden Schritten das Bushäuschen, wo eine Zeitung in der Nässe auf dem Boden klebte. Zerrissene Bilder elterlicher Trauer schrien zu ihm auf. Eine Straßenlaterne flackerte unstet, aus, an.
Die Allee schlängelte sich ins Dorf, um die Häuser herum, während der Fußweg durch den Wald direkt dorthin führte. Ein Schwinggatter aus Holz, halb verdeckt von einer Hecke, war der Durchgang. Pass auf, wo du hintrittst, mahnte Rose. Der Weg war mit Laub bedeckt, an manchen Stellen in einer dicken Schicht, aber auf tückischem Boden war er schon immer vorsichtig gewesen; das hatte er auf seinem Weg durch die Geschichte gelernt. Man lebte sein Leben von Tag zu Tag, dachte der O.B., aber Tage waren bloße Splitter der Zeit, kein sinnvolles Maß. Die plötzlichen Ereignisse, die uns mit ihrer Helligkeit blenden, wurzeln in den langsamen Wendungen der Jahrzehnte. Bis heute konnte er hinter den Schlagzeilen der Presse Gestalten aus der Vergangenheit ausmachen, wie Raubtiere, die man durch trübe Gewässer hindurch erspäht. Zwanzig Jahre im Ruhestand, und er wusste immer noch, wenn ihm Wiesel auf der Spur waren. Das Haus seiner Nachbarn sollte um diese Zeit nicht verlassen sein: Die Putzfrau müsste da sein, und es war unwahrscheinlich, dass sie im Dunkeln staubsaugte. Und die flackernde Straßenlaterne: Zweifellos war an ihrem Innenleben herumgepfuscht worden, um ein Überwachungsgerät einzubauen.
Er wartete. Von all den Geräuschen im Wald, all dem feuchten Rascheln und heimlichen Kratzen, hielt nicht eines inne, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich auf seine Abwesenheit zu konzentrieren. Alles ging weiter, wie es war. Aber das hatte er auch nicht anders erwartet. Dies waren keine Amateure.
»Aber wenn man weiß, dass es eine Falle ist«, sagte der Junge, »sollte man sie dann nicht meiden?«
»Nein. Sie sollen glauben, dass du sie gar nicht bemerkst. Und dann, wenn sie das erste Mal blinzeln – husch! –, bist du weg.«
Er blinzelte – husch! –, und auch River war weg.
Die Bäume rauschten finster. Jemand ahmte den Ruf eines Vogels nach, und ein anderer pfiff zurück. Der O.B. wartete, aber das war’s vorerst gewesen. Vorsichtig, aufmerksam auf Fangstricke zwischen den Blättern achtend, ging er auf das Dorf zu.
»Was meinst du, ist er ein Problem oder ein Versager?«
»Von wem redest du jetzt?«
»Mr Luftklavier.«
Marcus tat so, als würde er über die Frage nachdenken. Manchmal war es am einfachsten, Shirleys Gedankengang zu folgen. Wenn Lamb nicht da war, wurde sie hibbelig, als ob seine Abwesenheit gefeiert werden müsste; und da Shirleys Definition von Feiern weit gefasst war, war alles, was nicht mit verbotenen Substanzen zu tun hatte, auf jeden Fall die bessere Wahl.
»Willst du mir das näher erklären?«, fragte er.
»Na ja, du und ich, wir sind Probleme. Du hast deine Spielsucht …«
»Das ist keine Sucht!«
»Und ich leide anscheinend unter ›mangelnder Affektkontrolle‹.«
»Du hast einem Kerl die Nase gebrochen, Shirl.«
»Er hat es drauf angelegt.«
»Er hat dich um ein paar Pfund angehauen.«
»Das ist dasselbe.«
»Für ›Kinder in Not‹.«
»Er war als Kaninchen verkleidet, verdammt noch mal! Ich habe angenommen, er sei gefährlich.«
»Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum du nicht im Gefängnis bist«, räumte Marcus ein.
»Pah, die hätten mich überhaupt nicht erwischt, wenn diese nervigen Kinder nicht gewesen wären.«
Die es gefilmt und auf YouTube gestellt hatten. Dass der Typ als Kaninchen verkleidet war, hatte tatsächlich als strafmildernd gegolten, und außerdem war die Beamtin, die Shirley in Gewahrsam nahm, an diesem Vormittag selbst dreimal von Spendensammlern belästigt worden, so dass die Anklage wegen Körperverletzung am Ende unter der Bedingung fallengelassen wurde, dass Shirley sich zu einem AFM-Kurs anmeldete.
Anger Fucking Management. Zweimal die Woche, in Shoreditch.
(»Lös bloß keinen neuen Trend aus«, warnte sie Marcus, als er es herausfand. »Ich habe mal einen Idioten durch Shoreditch geführt, und so hat das alles mit den Hipstern angefangen.«)
»Und River und Louisa sind Versager, nehme ich an«, sagte er jetzt.
»Hm, weiß nicht.«
»Catherine war ein Problem. Min war ein Versager.«
»Und Ho ist ein Arschloch, aber es gibt immer Ausnahmen. Also, was ist Jasper Konrad? Das würde ich gerne wissen. Und was hat es mit dem Luftklavier auf sich?« Sie ahmte seinen Tick nach und klimperte auf einem nicht vorhandenen Instrument rauf und runter. »Für wen hält der sich, Elton John?«
»Wenn du wissen willst, was er in seinem Kopf hört, frag ihn. Aber mach mich nicht verantwortlich, wenn die Stimmen ihm sagen, er soll dich zerstückeln.«
»Stimmt, er sieht echt gefährlich aus. Schmeißt bestimmt mit Wattebällchen.« Sie hörte mit dem imaginären Klimpern auf. »Aber eins sage ich dir«, fuhr sie fort. »Wenn ich River wäre, würde ich mir Sorgen machen.«
»Inwiefern?«
»Ein noch einigermaßen junger Weißer, abgefuckt und voller aufgestauter Aggressionen. So einen haben wir schon. Nicht, dass nach Catherine auch noch River ausgetauscht wird.«
Marcus erwiderte: »Ideen hast du …«
»Wart’s nur ab. Mal sehen, wer recht behält.«
Sie hämmerte wieder auf ihrer Tastatur herum, ihrer richtigen, und Marcus hatte keine Ahnung, ob sie Aggressionen abbaute oder eine E-Mail schrieb.
Er unterdrückte einen Seufzer und machte sich wieder an die Arbeit.
Als er das Ende des Fußwegs erreichte, kam ein Auto die Straße entlang. Bei seinem Anblick wurde es langsamer, schien anhalten zu wollen und beschleunigte dann wieder. Er drehte sich extra nicht um und sah ihm nicht hinterher – schließlich wollten sie ihn zu einer Reaktion provozieren. Besser sein Pulver trocken halten. Und ganz wehrlos war er nicht, wie sie noch schmerzlich feststellen würden.