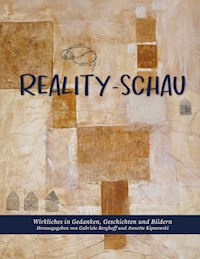
Reality-Schau E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist wirklich? Was ist echt? In einer Welt, in der alternative Fakten und Verschwörungstheorien ihr Unwesen treiben, sind das drängende Fragen. 32 Autorinnen und Autoren haben für diesen Band Stellung bezogen und greifen in Essays und Kurzgeschichten vielfältige Facetten unserer Zeit auf, in der es auf klaren Verstand und schöpferische Fantasie mehr denn je ankommt. Zu jedem Beitrag haben bildende Künstlerinnen und Künstler Werke beigesteuert, die ganz eigene Aussagen haben und doch den Betrachter dazu einladen, Bezüge zu den Texten herzustellen. Eine Reality-Schau im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Gabriele Berghoff, Annette Kipnowski
Vorwort
IN ECHT
Edith Sauerborn: Schattenspiele (2009)
Gabriele Berghoff
Höhlenmenschen
Jochen Kipnowski: Traumzeit (2008)
Detlef v. Elsenau
Traumpfade
Barbara Hoock: Bausatz für einen Engel (2007)
Nicole Hobusch
Einblicke
Lilo Brockmann: Waldstück (2015)
Michael Johannes B. Lange
Die Rolle seines Lebens
Annette Kipnowski: Tunnelblick (2013)
R. W. Dahl
Realitäten
Horst Rellecke: Caterpillar (1992)
Dagmar Berg
Imperativ
Eddy Pinke: Kopflos (2011)
Sonja Dohrmann
Körperwelten
Lilo Brockmann: Huschl (2002)
Elisabeth Morscheck
... zu spät
Barbara Hoock: Ohne Titel (1990)
Crispin Scholz
Falschsager
Willi Reiche: Siebsternsonne (1998)
Ronja Lukas
By(e) Myself
Eddy Pinke: Landschaft (2001)
Ursula Forthaus
Die Bedeutung des Frühneuenglischen für die Gegenwart
Horst Rellecke: Von Altamira bis zum Mars (1990)
Hanns-Michael Sennewald
Geschichte und Zukunft
Annette Kipnowski: Fliehende Worte (2008)
Karen Schröder
Corona-ABC
Annette Kipnowski: Skinscan (2015)
Anselm Vogt
Authentizität und identitäre Diversität – Purismus im Namen des Echten
LET THE SUNSHINE IN
W. Iliev: Freiheit (2015)
Gabriele Berghoff
Zur Sonne, zur Freiheit!
Horst Becker: Wann besuchen wir die Oma? (2005)
Alexandra Anvari
Schwarzer Kaffee
Ursula Adrian-Rieß: Ohne Titel (2012)
Franziska Johann
Training für Optimisten und alle, die es werden wollen
Barbara Hoock: Die sieben Raben (2017)
Annette Kipnowski
Pessimisten
Daniel Bedzent: Ohne Titel (2017)
Franziska Johann
Was wir erkennen
Ursula Adrian-Rieß: Ohne Titel (2012)
Gwendolin Simper
Sonnenstrahlen
HEIMATGEFÜHLE
Heide Drever: Nach Hause (2014)
Gabriele Berghoff
Back to the roots
Barbara Hoock: Seiltänzer (2010)
Monika Nelles
Heimat
Willi Reiche: Oh my deer (2015)
Burkhard Schwering
Heimatkunde
Heide Drever: Herbstblüten (2009)
Reiner Klüting
Kann Demokratie Heimat sein?
Lilo Brockmann: Brückentor (1999)
Silvana E. Schneider
Trakls Dichterheimat oder Leben im Dazwischen
Jochen Kipnowski: Migration (2007)
Wolfgang Schriek
Heimatgefühle? Schicksal, Erinnerung und Identität in deutschsprachiger Erzählprosa russischer und ukrainischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller
Kurt Dziubek: Unbehaust (2011)
Marianne Ullmann
Offene Fenster
UNGEHEUER IST VIEL
Horst Becker: Blutiges Messer (2012)
Gabriele Berghoff
Nichts ist ungeheurer als der Mensch
Jockel Reisner: Der Meister (2000)
Anselm Vogt
Vertrauen und Zweifel
Jochen Kipnowski: Icy (2008)
Alexa Rudolph
Kalt
Daniel Bedzent: Leiche im Keller (2017)
Cleo A. Wiertz
Künstlerische Freiheit
Horst Becker: Selbstporträt (2012)
Anja Dlauhy
Grenzen
Barbara Hoock: Ohne Titel (2003)
Gudrun Güth
Bin ich, ist er nicht
PARLEZ-MOI D'AMOUR
Cornelia Enax-Höppke: Hör auf Amor (2013)
Gabriele Berghoff
Eros
W. Iliev: Komm (1993)
Selma Hereitani
Komm
Jochen Kipnowski: Lasun (2003)
Sonja Dohrmann
Ultimatum
Lilo Brockmann: Sommernacht am Atlantik (2009)
Anna-Lena Eißler
Sommernacht
Katja Zander: Elbufer (2020)
Angela Schwarz
Lettre d’amour
Eva Herborn: Die Berührung der Landschaft (2017)
Elisabeth Morscheck
Wenn
Ljiljana Nedovic-Hesselmann: Stream of consciousness (2021)
Wunibald Müller
Ich will nur noch lieben
Vorwort
Reality-Schau heißt: Zeigen, was ist. Das Echte, Authentische, Wirkliche. Unsere Schau ist das Gegenteil des bekannten TV-Formats: Wir bieten keine Show, sondern wollen hinter die Kulissen schauen, alternative Fakten und Manipulation entlarven und unseren Lesern und Betrachtern Bilder vor Augen führen, die sie »echt« berühren und zum Nachdenken anregen. Die zahlreichen Autorinnen und Autoren, die unserem Aufruf gefolgt sind (insgesamt 70), haben sich der Aufgabe, WIRKliches in ihren Texten darzustellen, auf sehr unterschiedliche Weise genähert. Philosophische Essays, in denen Faktizität, Authentizität, gesellschaftlicher und historischer Wandel, Demokratie- und Wissenschaftsverständnis diskutiert werden, wechseln sich ab mit Kurzgeschichten und Lyrik, die einen anderen Zugang zum Thema eröffnen. Ob Fotosession am Matterhorn, Körperkult im Fitnessstudio, Liebesabenteuer im Campingbus, Konkurrenzkampf am Fernsehset oder Einblick in eine sensible Dichterseele: Alle Beiträge zeigen einen Ausschnitt aus einer mal liebenswerten und mal abstoßenden Welt, mal auch aus einer Welt, die uns ratlos zurücklässt. Einer Welt, die uns immer wieder vor die Frage stellt, was in ihr wahr, was falsch ist. Antworten bietet mal die Fantasie, mal der analytische Verstand. Unsere Sammlung versucht, auf beide Weisen Einblicke in Wirkliches zu ermöglichen.
Als roter Faden dient dabei Platons Höhlengleichnis, in dem es um Schatten und Licht, Wahrheitsliebe und Erkenntnis, aber auch um Borniertheit und Gewalt geht.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren für die Beiträge zu diesem Projekt, auch denen, deren Texte wir aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Sammlung aufnehmen konnten. Es freut uns, dass wir neben anerkannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Deutschland, Österreich und Frankreich sowie Essayisten, die in der akademischen Philosophie beheimatet sind, auch zwei U20-Autorinnen zu Wort kommen lassen dürfen.
Das Besondere an dieser Anthologie ist, dass die Texte verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern vorgelegt wurden mit der Bitte, »passende« Bilder dazu auszuwählen. So enthält unsere Sammlung nicht nur sprachliche Beiträge, sondern auch viele Abbildungen von Werken aus der bildenden Kunst. Es handelt sich dabei nicht um Illustrationen, sondern um Werke mit eigenständigen Aussagen.
Texte können in unterschiedlicher Weise Assoziationen, Gedanken und Gefühle evozieren, aber bei Bildern ist der Interpretationsspielraum noch bedeutend größer. Sie bilden im Allgemeinen nicht einfach eine Wirklichkeit ab, sondern bieten eine Interpretation der Realität an.
Nein, nicht eine ... viele Interpretationen.
Gerhard Richter formuliert es so:
»Ein Bild stellt sich dar als das Unübersichtliche, Unlogische, Unsinnige. Es demonstriert die Zahllosigkeit der Aspekte, es nimmt uns unsere Sicherheit, weil es uns die Meinung und den Namen von einem Ding nimmt. Es zeigt uns das Ding in seiner Vielbedeutigkeit und Unendlichkeit, die eine Meinung und Ansicht nicht aujkommen lassen.«
Gerhard Richter: Texte, Schriften, Interviews, Briefe. Verlag W. König, Köln 2008, S. 32
Oder halten wir es mit Salvadore Dalí:
»Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes.«
Wir danken allen bildenden Künstlerinnen und Künstlern, die das Projekt unterstützt und uns ihre Werke zur Verfügung gestellt haben.
Gabriele Berghoff und Annette Kipnowski
IN ECHT
Edith Sauerborn: Schattenspiele (2009)
Holzskulpturen, geschwärzt
Gabriele Berghoff
»Wenn sie sich untereinander unterhalten könnten, da würden sie wohl glauben, die wahren Dinge zu benennen, wenn sie von den Schatten sprechen, die sie sehen.«
Aus dem Höhlengleichnis in Platon: Der Staat
Höhlenmenschen
Zeigt eine Reality Show die Realität oder einen Schatten von Realität oder völlig Unwirkliches?
Man könnte letzteres meinen, wenn man an das Unterhaltungsformat denkt, in dem Menschen wie du und ich, mit geringem oder höherem Bekanntheitsgrad, ihr Leben vorführen oder eben nur so tun, als führten sie ihr Leben vor. Dass die Zuschauer in Wirklichkeit eine von vorn bis hinten inszenierte Fiktion zu sehen bekommen, scheinen viele nicht zu durchschauen oder bereitwillig zu übersehen.
Leider gibt es viel Show auch außerhalb der Unterhaltungsbranche. Wir haben allen Grund, unseren Augen und Ohren zu misstrauen. Fake news, fake accounts, falsche Freunde und falsche Wimpern: Wir begegnen Lug, Trug und Täuschung auf Schritt und Tritt. Nie war der Descartes’sche genius malignus so omnipräsent: In der digitalen Welt übernimmt er gerade die Herrschaft und lässt uns über die Frage rätseln, wie wirklich denn das Metaversum ist, in dem wir uns selbstvergessen in einer Scheinwelt bewegen und andere mit unseren Fantasien und Wünschen echtes Geld verdienen oder noch nicht einmal das; denn wie real ist eigentlich Kryptowährung?
Mit der Frage nach dem, was Sein und was Schein ist, befasst sich bereits Platon. In der »Politeia«, seinem Werk über den Staat, lässt er Sokrates ein Gleichnis erzählen, in dem gefesselte Menschen auf eine Wand schauen, auf der ein Film abläuft. Natürlich wusste Platon noch nichts von Kino, Netflix oder YouTube, aber das Prinzip war ihm geläufig. Wenn die Präsentation gut ist, halten die Menschen sie für Wirklichkeit. Sie weinen und lachen, entrüsten sich, fürchten sich und sind ganz gebannt von dem, was man ihnen vorsetzt. Und erschreckend viele finden nicht wieder heraus aus der Fiktion. Die wildesten Verschwörungstheorien erscheinen ihnen plausibel. Dem Demagogen glaubt man. Die Filterblase hält dicht. Es gibt viele Höhlen, die die Menschen gefangen halten, zu Platons Zeiten wie heute.
Nun lässt der antike Philosoph im Höhlengleichnis einen der Gefesselten losbinden, und – wenig verwunderlich – der so Befreite wehrt sich kräftig. Es hätte keiner Fesseln bedurft, um die Höhlenmenschen an ihren Plätzen zu halten. Jede Richtungsänderung schmerzt. Zu viel Licht blendet die Augen. Zu verstehen, dass die Realität eine andere ist als das bisher für einzig richtig erachtete Brimborium, ist im wahrsten Sinne des Wortes desillusionierend. Nur unter Zwang lässt sich der Losgebundene nach oben zerren und schaut hinter die Kulissen, dorthin, wo der Projektor bedient wird. Bei Platon sind es Geräte und »Statuen von Menschen und anderen Lebewesen«, die vor einem Feuer vorbeigetragen werden, sodass ihre Schatten an die Höhlenwand projiziert werden. Doch obwohl die Ursache für alle Schatten, mit anderen Worten die zugrunde liegende Technik, nun für den Befreiten deutlich sichtbar sein müsste, weigert er sich, die Tatsachen anzuerkennen. Für ihn sind und bleiben die Schatten wirklicher als die Verursacher derselben. In der virtuellen Welt fühlt er sich zu Hause. Dort kennt er sich aus. Dort sitzen seine Freunde. Dort will er bleiben. Die Welt der realen Gegenstände wirkt auf ihn bedrohlich und falsch. Wer hier agiert, führt womöglich Übles im Schilde.
Platon sagt, es gehe in seinem Gleichnis um Bildung und Unbildung. Das ist leicht nachzuvollziehen. Die ungebildeten Höhlenbewohner ergötzen sich an der Reality-Show und wollen ansonsten in Ruhe gelassen werden. Bildung bedeutet schmerzhafte Abkehr von gewohnten Sicht- und Denkweisen. Dafür bietet sie Erkenntnisse über Ursachen, Wirkungen und Zusammenhänge. Sie deckt Irrtümer auf und lehrt, zwischen echt und falsch zu unterscheiden. Aber das ist offenbar nicht für jeden erstrebenswert.
Beachtenswert ist auch, dass die Gegenstände, die in der Höhle vor dem Feuer umhergetragen werden, allesamt Artefakte sind. Nicht etwa echte Menschen oder Tiere werfen die Schatten, sondern deren von Menschen geschaffenen Abbilder. Dazu allerlei Gerätschaften. Mit anderen Worten: Es geht um Technik und Kunst. Platon ist an dieser Stelle die Unterscheidung von physis und technë wichtig. Er erfindet eigens ein Mäuerchen, damit sichergestellt ist, dass die Menschen, die die Artefakte umhertragen, nicht gesehen werden können, nicht einmal als Schatten.
Die Höhlenmenschen erfreuen sich also an den Abbildern von Abbildern, und selbst der Befreite, der die Gegenstände selbst betrachten kann, ist noch lange nicht am Ziel seines Bildungswegs.
Platon war kein besonderer Freund von Kunst. In seinem Staat ist für Dichter, Maler und andere »Nachahmer« kein Platz. Dennoch fungieren im Höhlengleichnis Kunstwerke als Meilensteine auf dem Bildungsweg. Sie verweisen auf etwas, das es außerhalb der Höhle wirklich gibt: eine lebendige Natur und alle Wunder des Kosmos.
Kunstbetrachtung ist auch heute nicht jedermanns Sache. Nicht alle Werke bilden erkennbar Natürliches oder Gegenständliches ab. Dennoch oder gerade deswegen verweisen sie auf eine Realität jenseits des Sichtbaren und wirken auf den Betrachter ein, der sich nicht selten, wie unser Höhlenbewohner, kopfschüttelnd abwendet, weil seine Sehgewohnheiten andere sind.
Was machen wir also mit den Höhlenmenschen? Binden wir sie los und zerren sie ans Licht? Oder überlassen wir sie ihrem Vergnügen vor dem Bildschirm und gehen selbst unserer Wege?
Letzteres wäre bequemer und deutlich weniger aggressiv. Diese Form von laissez faire setzt aber voraus, dass die Höhlenmenschen harmlose Irre sind, die niemandem etwas zu leide tun. Tatsächlich ist Irrationalität aber gefährlich. Zu viele gibt es, denen klare Erkenntnisse suspekt sind und die lieber im Verschwommenen herumdeuteln, darunter auch die, die das Corona-Virus für eine Erfindung von Bill Gates halten und die Impfung für eine Methode, die Bevölkerung durch Unfruchtbarkeit zu reduzieren. Wer zu bequem, zu feige oder zu verblendet ist, um den realen Problemen dieser Welt ins Auge zu sehen und um vernünftige Lösungen zu ringen, gefährdet sich und andere. Und das gilt nicht nur für Corona-Leugner.
Sehen wir also erst einmal zu, dass wir unsere eigene Verblendung überwinden und die Höhle hinter uns lassen. Wenn es uns gelingt, unsere Mitbewohner mitzunehmen, umso besser.
Jochen. Kipnawski: Traumzeit (2008)
Acryl auf Leinwand
Detlef v. Elsenau
Traumpfade
Die meisten von uns erinnern sich daran, wo sie sich bei der Erstberichterstattung zu dramatischen weltpolitischen Ereignissen, wie etwa dem 11. September 2001, Tschernobyl oder Fukushima gerade befanden oder was sie gerade taten. Und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, da sich die Dramatik und die damit zusammenhängenden Bilder den meisten von uns ins Gehirn gebrannt haben. Erstaunlich ist, dass ich mich in gleicher Weise an einen Moment erinnere, der auf den ersten Blick nicht im Ansatz von einer ähnlichen Dramatik geprägt war. Es war der Auftritt von Kellyanne Conway, der Beraterin des seinerzeitigen US-Präsidenten Donald Trump am 22. Januar 2017 während eines Interviews in der amerikanischen Polit-Talksendung »Meet the Press«. Ganz offensichtlich löste dieses Ereignis ähnliche traumatische Reaktionen bei mir aus. Dabei war der Auslöser doch nur ein neuer Begriff: »Alternative Fakten«.
Aber sowohl die durch diese Worte ausgelöste kognitive Dissonanz als auch die Art und Weise, wie dieser in sich selbst widersprüchliche Begriff der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, berührten mich offensichtlich in besonderer Weise. Ungerührt und offensichtlich bar jeden Schamgefühls, ja sogar schelmisch grinsend spuckte Frau Conway dieses Wortgebilde, scheinbar eher spontan als geplant, in die Welt. Es war der Versuch, die ganz offensichtliche Lüge Sean Spicers, des damaligen Pressesprechers des Weißen Hauses, über die Größe der Publikumsmenge während Trumps Amtseinführung vor dem Kapitol zu rechtfertigen. Während in einer ersten Reaktion mein Amüsement über diese Realsatire dominierte, beschlich mich doch schon sehr bald das ungute Gefühl, dass hier mehr passiert war, als nur ein mehr oder weniger dreister, eher kindlich-frech er Versuch, angesichts der Offensichtlichkeit der Tatsachen dem Eingeständnis der eigenen Unaufrichtigkeit, solange es eben geht, auszuweichen. »Alternative Fakten« wurden im Anschluss hieran tatsächlich faktisch. Nicht nur der Begriff ging in Windeseile in unsere Sprache, sondern auch in das Bewusstsein vieler Menschen ein. Ich fühlte mich in meiner Sorge damals durch den Bundespräsidenten bestätigt, der öffentlich auf dem evangelische Kirchentag 2017 auf die Gefahr hinwies, dass der Glaube an die Existenz alternativer Fakten den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bedrohe.
Aber spaltet dieses Phänomen wirklich unsere Gesellschaft, ist es wirklich das Problem für uns? Gehört es nicht vielmehr zu den konstitutiven Merkmalen unserer pluralistischen Gesellschaft, dass unsere Welt im Kleinen wie im Großen von verschiedenen Menschen und Gruppen zum Teil völlig unterschiedlich wahrgenommen wird? Ist es nicht so, dass das konstruktivistische Verständnis individueller Wahrnehmung von Wirklichkeit heute längst zum Mainstream wissenschaftlicher Positionen zählt?
Die Erzählungen der verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft, was für Realität gehalten wird und was nicht, werden lauter und dringen aufgrund der Existenz der modernen Medien nun schneller und tiefer in unser Bewusstsein ein. Die Vorstellung, die Erde sei flach, regt nun nicht mehr nur die Fantasie der mehr oder weniger intellektuellen Leserinnen und Leser von Terry Pratschets Scheibenwelt-Romanen an, sondern stellt offensichtlich die Grundlage der Weltauffassung einer – wenn auch kleinen – Gruppe von Menschen dar und hat für sie absolute Wahrheitsqualität. Auf der anderen Seite ernennen sogenannte Reichsbürger für ihre selbstdefinierten Hoheitsbereiche Regierungen, zu deren Kabinetten mitunter sogar Postminister zählen. Sie entwerfen und verbreiten die Erzählung, das Fehlen eines formellen Friedensvertrages nach dem zweiten Weltkrieg bedeute, dass die Bundesrepublik Deutschland als souveräne Nation gar nicht existiere, es sich bestenfalls um eine GmbH handele und betrachten dieses als unumstößliche Wahrheit. Verschwörungsmythen, so krude und abwegig sie auch immer sein mögen, finden ihre Öffentlichkeit und werden in inflationärer Weise mit dem Begriff Narrativ belegt und dadurch irgendwie auch geadelt. Denn obwohl Jean-François Lyotard am Ende der 1970er-Jahre eigentlich die großen Erzählungen der Weltreligionen oder auch die modernen Gesellschaftstheorien meinte, hat dieser Begriff die akademische Sphäre längst verlassen, ist in allgegenwärtigem und unterschiedslosem Gebrauch und vermittelt irgendwie den Eindruck, dass was auch immer irgendjemand erzählt, gleichermaßen Bedeutung und Wahrheitswert habe. Es scheint, als hätten Narrative die Fakten abgelöst, als seien die Erzählungen der einzelnen Gruppen für unser Zusammenleben wichtiger als Gesetze und Gesellschaftsordnungen, als gäbe es außerhalb unserer subjektiven Wahrnehmung keine Wahrheiten, die in intersubjektiv gleicher Weise der Erfahrung der Einzelnen zugänglich sind.
Aber dennoch sei die Frage noch einmal gestellt: Ist das alles für unsere Gesellschaft wirklich ein Problem, das den Zusammenhalt nachhaltig gefährdet und uns Sorgen bereiten muss? Ist das Geschichtenerzählen nicht vielmehr urmenschlich, fest in unserer DNA verankert, da Geschichten seit Menschengedenken dazu dienen, die in Generationen gemachten Erfahrungen und das zum Teil leidvoll erworbene Wissen unserer Vorfahren für nachfolgende Generationen aufzubewahren und weiterzugeben?
Diese leidenschaftliche Beziehung zu Erzählungen hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte keineswegs abgekühlt. Heute verdient sich ein ganzer Industriezweig goldene Nasen damit, eine Erzählung nach der anderen, portioniert in Folgen und Staffeln, zu produzieren und auf dem Markt gegen harte Währung anzubieten. Und wir bezahlen dafür, offensichtlich gerne und massenhaft. Denn Erzählungen unterhalten uns, sie vermitteln die Illusion, selbst Teil einer Geschichte sein zu können. Die Erzählung von anderen wird zunehmend unsere eigene Geschichte. Dass dabei verschiedene Erzählungen in Konflikt geraten können, scheint dabei anthropologisch und psychologisch durchaus erklärbar zu sein.
So bietet etwa das schismogenetische Konzept, von Gregory Bateson in den 1930er-Jahren entwickelt, auch für die heutigen Verhältnisse eine ziemlich plausible und überaus menschliche Erklärung an. Bateson identifiziert im Verhältnis einzelner Gruppen zueinander immer wieder auftretende wettbewerbsartige soziale Verhaltensmuster, die darauf abzielen, sich gegenseitig zu übertreffen. Diese Prahlereien entwickeln dann häufig ihre eigene Dynamik. Es kommt immer wieder zu Aufschaukelungsprozessen. Eskalieren dann solche Prozesse durch das Dominanzbestreben und -verhalten einzelner Gruppen, gerät dieser ursprünglich symmetrische Prozess in eine Schieflage. Watzlawick sieht hierin allerdings weniger eine einseitige Machtausübung als vielmehr das Ergebnis einer missverständlichen und missverstandenen Kommunikation. Er beschreibt die Situation dadurch, dass beide Parteien von unterschiedlichen »Interpunktionen« des Prozessverlaufs ausgehen.
Bezogen auf unsere aktuelle Situation bedeutet das also, dass die Entstehung immer neuer und abstruser Erzählungen das Ergebnis des urmenschlichen Triebes ist, sich Geschichten zu erzählen, auch um sich dabei gegenseitig zu übertreffen. Warum sollte uns also die Existenz sich zum Teil heftig widersprechender Erzählungen in unserer Gesellschaft Sorgen bereiten? Sind es nicht nur Kommunikationsstörungen, die durch eine professionell angelegte Metakommunikation behoben werden können? Oder müssen wir uns wirklich auf eine beziehungsweise wenige Erzählungen einigen, damit unsere Gesellschaft nicht auseinanderbricht?
Hier könnte uns ein Blick in die Menschheitsgeschichte weiterhelfen. Schon die Aborigines, die bereits vor 50.000 Jahren den australischen Kontinent besiedelten und damit die älteste noch lebendige Kultur unserer Erde darstellen, hatten erkannt, dass es Erzählungen gibt, die unter keinen Umständen verändert werden dürfen, da sie für das Überleben der Gemeinschaft unverzichtbar sind. Das Wissen über die sicheren, lebenserhaltenden Wege bei den Wanderungen durch ihren Kontinent wurde durch Gesang von Generation zu Generation weitergetragen. Durch ihre gesungenen Traumpfade hatten die Aborigines eine zwar unsichtbare, dafür aber sehr präzise Landkarte zur Verfügung, die es ihnen möglich machte, während ihrer Walkabouts durch ihren Kontinent sichere Nahrungsquellen zu finden, genauso wie Wasser, Schutz vor den Kräften der Natur oder heilige Orte. Es galt nur zu verhindern, dass sich diese Road Map durch die Weitergabe von einer Generation zur nächsten veränderte. Dem zu tradierenden Wissen wurde eine rhythmische Struktur gegeben, die einprägsam ist und Veränderungen sofort spürbar werden lässt. Wie effektiv diese Maßnahme ist, erkennt man zum Beispiel auch leicht daran, dass diejenigen von uns, die einst Latein lernten, noch nach 50 Jahren mehr oder weniger problemlos die meisten Präpositionen aufzählen können, denen der Ablativ folgt: a, ab, ex, e, cum und sine, pro und prae ...
Gibt es für unsere pluralistische Gesellschaft auch derartige Narrative, die nicht verändert werden dürfen und die wir konsequent in ihrer Funktion als Richtungsweiser vor Veränderungen bewahren müssen, da sie für das Fortbestehen unserer Gesellschaft unverzichtbar sind?
Sicherlich werden sich die meisten Mitglieder unserer Gesellschaft schnell darauf einigen können, dass die Garantie der persönlichen Freiheit das zentrale Element dieser Basiserzählung darstellt. Allerdings ist dieser Begriff so abstrakt, dass er selbst den Demagogen in der Geschichte wie in der Gegenwart immer schon dazu dienen konnte, die Massen unter dem Banner des Kampfes um Freiheit in ihre Versklavung zu führen. Das Basisnarrativ unserer demokratischen Gesellschaft findet in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland seine äußere Form. Es verbindet den abstrakten Freiheitsbegriff mit ganz konkreten normativen Aussagen, die darauf zielen, die individuelle Freiheit in einen untrennbaren Zusammenhang mit Gleichheit zu bringen und die diesen unauflöslichen Zusammenhang letztlich mit der Würde des einzelnen Menschen begründen. Schon die sprachliche Abfassung dieses Zusammenhangs im Art. 1 unseres Grundgesetzes macht unmissverständlich deutlich, dass es sich dabei nicht um eine Gesetzesnorm, sondern um eine unveränderliche Wahrheit handelt, eine Wahrheit, die ihre Gültigkeit völlig unabhängig von gesellschaftlichen oder parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen, Sichtweisen, Blickwinkeln und Realitätswahrnehmungen erfährt.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zu dieser Wahrheit gibt es keine Alternative. Es gibt zwar eine Vielzahl von mitunter heftig widerstreitenden Meinungen darüber, wie wir es schaffen können, Freiheit und Gleichheit zu gewährleisten. Solchermaßen antagonistische Positionen zuzulassen und sogar zu fördern, stellt den Wesenskern unserer pluralistischen Gesellschaft dar. »Alternative Fakten« allerdings sind keine Meinungen, nicht einmal eine alternative Interpretation der Realität. Sie sind vielmehr der Versuch, unliebsame Realitäten zu leugnen, indem sie behaupten, dass es keine intersubjektiv erfahrbaren, allgemein gültigen Realitäten gebe. Sie stellen mithin keinen Beitrag zum demokratischen Diskurs dar, sondern sind vielmehr auf dessen Zerstörung gerichtet. Die Existenz eines durch wissenschaftliche Erkenntnis und menschliche Vernunft begründeten und begründbaren Referenzrahmens individueller wie gesellschaftlicher Kommunikation wird vehement bestritten. Alle Versuche der Metakommunikation über die Gültigkeit eines solchen Rahmens werden in Wort und nicht selten auch in Tat bekämpft und letztlich unmöglich gemacht. »Alternative Fakten« sind kein harmloses Angebot, Dinge anders zu sehen, sind nicht der Ausdruck einer Kommunikationsstörung; sie sind eine gezielte und aggressive Strategie der Veränderung und Entwertung unseres Basisnarrativs. Sie zerstören unsere »Traumpfade«.
Es geschah erstmals am 22. Januar 2017. Und es hört nicht auf. Es wird höchste Zeit; dass wir uns Sorgen machen!
Barbara. Hoock: Bausatz für einen Engel(2007)
Installtation
Nicole Hobusch
Einblicke
»Was haben wir?«
Sophie bemüht sich, Schritt zu halten. Etwas atemlos blickt sie auf die Zettel auf ihrem Klemmbrett, blättert um. Die Seiten geraten in Bewegung, als sie scharf um die Kurve eilen, abbiegen in den Gang mit dem auffälligen, roten On-Air-Zeichen.
»Tanja, 45 Jahre, sie ist Kassiererin ...«
»Sie ist arbeitslos.« Roberta wirft ihr einen Seitenblick zu. Ihre schreiend rot gefärbten Haare wippen über ihrer Schulter. »Das kommt besser.«
»Okay.« Sophie zückt den Kugelschreiber, streicht »Kassiererin« durch, schreibt »arbeitslos« darüber.
»Weiter!«
»Ihr Mann ...«
»Ex.«
»Gut. Ihr Ex-Mann heißt Stefan ...«
»Stefano.«
»Ich weiß nicht.« Sophie runzelt die Stirn. »Er sieht nicht südländisch aus. Er ist blond, hat aber kaum noch Haare, also ...«
»Stefano. Seine Eltern waren Italien-Fans. Aber wir sprechen es deutsch aus, das verpasst ihm den richtigen Touch.« Roberta lächelt und nickt zufrieden. »Was ist ihr Konflikt?«
»Stefan, ’tschuldigung, Stefano trinkt zu viel. Tanja ist damit nicht sehr glücklich.«
»Oh ja!« Roberta sieht sie an. Ihre Augen leuchten. »Er war zwei Jahre lang trocken, dann der Rückfall. Der Jobverlust droht, er verwahrlost zusehends, ständiges Konfliktpotenzial in der Beziehung. Die Kinder leiden.«
»Dann müssen wir noch Kinder organisieren.«
»Irgendwer wird ja wohl Kinder haben.« Roberta stößt die Tür zur Regie auf. »Hat einer von euch Kinder?«
Tom blickt auf. Hastig nimmt er seinen Kaffeebecher vom Mischpult. Ein Tröpfchen hüpft über den Rand und landet auf einem der Regler. »Ich habe zwei. Sind grad’ in der Kita.«
»Super!« Roberta klatscht in die Hände. »Kann deine Frau sie abholen und herbringen?«
»Wieso?«
»Wir brauchen sie.« Mit Blick nach rechts sagt sie: »Gebt in der Maske Bescheid, damit sie die beiden herrichten. Sie müssen richtig ranzig aussehen.«
Die Assistentin nickt pflichtbewusst. Oder war sie nur eine Praktikantin? Sophie hat ihren Namen vergessen. Diese jungen Dinger kommen und gehen im Wochentakt.





























