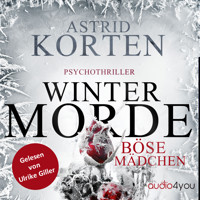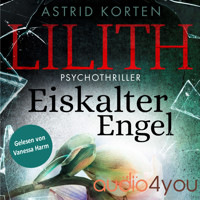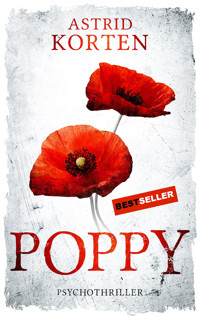4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Erste Stimmen: ***** Düster, atmosphärisch & fesselnd ***** Dunkle Stimmen, die nicht mehr schweigen wollen ***** Rebecca bürgt für Qualität ***** Äußerst atmosphärisch, tiefgründig, fesselnd - Psychothrill vom Allerfeinsten ***** Ich spüre jetzt noch den Hauch des Flüsterns in Buchan Manor ***** Ein Meisterwerk des psychologischen Grauens. Atmosphärisch, düster, absolut fesselnd ***** Düster, mit Gänsehautfeeling Ein altes Anwesen an der tosenden See. Die Wände flüstern. Die Schatten sind geduldig. Bis unter dem Staub vergangene Schreie erwachen. An der rauen Küste Schottlands liegt Buchan Manor, ein einsames Anwesen, dessen Mauern den Wind festhalten – und die Schatten derer, die darin verloren gingen. Als die Psychologin Fiona Ross mit ihrem Mann in das Schloss zieht, ahnt sie nicht, dass in den nächtlichen Gängen ein Flüstern lauert, das nur sie zu hören scheint. Zwischen vergilbten Briefen, verborgenen Kammern und Träumen, die zu real werden, tritt eine Gestalt aus der Vergangenheit hervor: Maisie, ein Dienstmädchen, das im Jahr 1917 um das Leben ihrer Schwester kämpft und in die Gewalt des charismatischen, gefährlichen Baron Campbell gerät. Was als Hoffnung beginnt, wird zu einem finsteren Spiel aus Besitz, Obsession und Schweigen. Ein alter Zeitungsausschnitt über Rebecca, Campbells erste Frau, entfacht Fionas Misstrauen. Je tiefer sie in das Netz aus Lügen und verschwundenen Frauen eintaucht, desto stärker verwischen die Grenzen zwischen damals und heute. Schon bald fragt sie sich: Wer waren Maisie und Rebecca? Warum ruft Buchan Manor ihre Namen? Je näher Fiona der Wahrheit kommt, desto unheilvoller nimmt das Anwesen Gestalt an und zeigt sein wahres Gesicht: Unter dem Staub liegt Blut, die Farbe vergangener Schreie. Ein Psychothriller voller Dunkelheit, Geheimnisse und einem Flüstern, das nicht verstummt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
R E B E C C A
Schatten über Buchan Manor
Ein altes Anwesen an der tosenden See.
Die Wände flüstern. Die Schatten sind geduldig.
Bis unter dem Staub vergangene Schreie erwachen.
An der rauen Küste Schottlands liegt Buchan Manor, ein altes Anwesen, das den Wind in seinen Mauern hält, seine Geheimnisse bewahrt und die Schatten derer, die darin verloren gingen.
Als die Psychologin Fiona Ross mit ihrem Mann in das Schloss zieht, hofft sie auf Ruhe und einen Neuanfang. Sie ahnt nicht, dass in den nächtlichen Gängen ein Flüstern lauert, das nur sie zu hören scheint.
Zwischen alten Briefen und aufwühlenden Träumen tritt eine Gestalt aus der Vergangenheit hervor: Maisie Simon, eine junge Frau, die 1917 in Aberdeen um das Leben ihrer Schwester kämpft. Als sie eine Anstellung bei Lord Campbell annimmt, scheint Rettung in Sicht. Doch was als Hoffnung hinter den Mauern von Buchan Manor beginnt, wird zu einem dunkles Spiel aus Kälte, Obsession und Schweigen.
Ein vergilbter Zeitungsartikel über Rebecca, Campbells erste Frau, weckt Fionas Misstrauen. Während sie versucht, die Stimmen der Vergangenheit zu deuten, beginnen Zeit und Wirklichkeit zu zerfließen. Sie fragt sich, wer diese Frauen waren, was sie verband und warum das Haus noch immer ihre Namen flüstert?
Je näher Fiona der Wahrheit kommt, desto unheilvoller nimmt das Anwesen Gestalt an und zeigt sein wahres Gesicht: Unter dem Staub liegt Blut, die Farbe vergangener Schreie.
Ein Psychothriller voller Dunkelheit, Geheimnisse und einem Flüstern, das nicht verstummt.
Prolog
Aberdeen, Gefängnis Craiginches, Januar 1918
Maisie
Eine schwere Tür fällt mit einem Knall hinter mir zu.
„Weitergehen.“
Die Stimme des Gefängniswärters ist ein kalter Stoß in den Rücken. Er drückt mich in einen langen, schmalen Gang des Gefängnis Craiginches. Beton links, Beton rechts, die Decke so niedrig, als wolle sie mir den Atem nehmen. Die Luft steht alt und feucht, riecht nach Stein, Rost und Moder. Keine Fenster; nur Gaslampen in starren Abständen, deren Schein mehr Schatten gebären als Licht. Irgendwo tropft es wie im Galgentakt, das ein „Hier hört dich niemand“ verkündet.
Die Handschellen schnüren mir die Handgelenke ein. Die Metallfessel pocht mit meinem Puls. Ich habe noch nie gut mit beengten Räumen umgehen können. Die Enge kriecht mir in den Hals; der Raum kippt, als hätte jemand die Welt gekippt. Alles wirkt einen Hauch daneben: ein Albtraum, der nicht nachgibt. Ich zwinge Luft in die Lungen, zähle innerlich bis vier, halte, lasse wieder los. Die Panik steht schon in der Tür, aber ich stelle ihr den Fuß: nicht jetzt. Nicht hier.
Der Gefängniswärter öffnet die Gittertür. Das Quietschen des Metalls hallt lange nach. Ich bleibe stehen. Der Geruch nach Eisen, kaltem Stein und etwas Süßlichem hängt in der Luft. Dahinter wartet ein Käfig aus Eisenstangen. Darin stehen zwei Frauen, kräftig gebaut, breitschultrig, das Haar streng zu Knoten gezwungen. Ihre dunkelblauen Uniformen wirken makellos, fast unheimlich sauber. An den breiten Ledergürteln hängen Schlüsselbunde, die bei jeder Bewegung leise klimpern, und Knüppel, schwer und abgewetzt vom Gebrauch.
Ich spüre, wie mein Herz gegen die Rippen schlägt. Mir ist schwindelig, aber meine Hände finden keinen Halt. Die Jüngere starrt an mir vorbei, als wäre ich Luft. Die Ältere hebt langsam den Kopf, ihre Augen sind kalt und müde zugleich. Sie wirft einen flüchtigen Blick aufs Klemmbrett, dann auf mich: abschätzend, ohne jedes Interesse, doch der kurze Moment genügt, um klarzumachen, wer hier das Sagen hat.
Ich senke den Blick, nicht aus Gehorsam, sondern um meine Angst zu verbergen.
„Maisie Simon? Geboren am 8. November 1898 in Aberdeen?“, fragt sie mit tiefer Stimme.
„Ja.“
Erst als ich den Gefängniswärter neben mir nicken sehe, wird mir klar, dass die Frage nicht an mich, sondern an ihn gerichtet ist.
Während der Gefängniswärter mir die Handschellen abnimmt, stellt sie sich vor mich hin. Sie verschränkt die Hände hinter dem Rücken, hebt das Kinn und sieht mich mit einem Blick an, der zwischen Missbilligung, Verachtung und Belustigung schwankt.
Ich erkenne in ihren Augen, was sie vor sich sieht: keine hübsche 20-Jährige, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt, aber gut erzogen ist. Was sie sieht, ist eine junge Frau mit zerzaustem Haar und Flecken auf Rock und Bluse. Eine Diebin. Ein Flittchen. Eine Verrückte. Abschaum, der aus der Gesellschaft herausgeschnitten werden muss.
Sie riecht meine Angst. „Zieh dich aus!“, befiehlt sie.
Ausziehen? Mit einiger Verzögerung begreife ich, was von mir verlangt wird. Mit unsicheren Bewegungen knöpfe ich meine Jacke auf und ziehe mich aus. Als ich in meinem Korsett und in Unterhose vor ihr stehe, brüllt sie: „Den Rest auch! Beeile dich!“
Ich gehorche. Sekunden später stehe ich nackt vor ihr. Die Wärterin blickt einen Moment lang überrascht auf meinen runden Bauch, der unter meinem Hemd zum Vorschein kommt. Ich schlinge meine Arme um mich herum im vergeblichen Versuch, meine Blöße zu bedecken, während drei Paar Augen auf mich gerichtet sind. Meine nackte Haut überzieht sich mit Gänsehaut.
Sie zieht einen Handschuh über. „Dreh dich um!“
Wie erstarrt bleibe ich stehen.
„Dreh dich um und beug dich vor!“ Ihre Hand greift bedrohlich nach dem Knüppel, der um ihre Hüfte baumelt. Ich beuge mich vor, soweit es mein Bauch zulässt und spüre, wie sie sich hinter mich kniet und meine Pobacken spreizt. Kalte, gummiartige Finger dringen hart vor. Ich richte meinen Blick auf den Betonboden. Ekel und Scham durchströmen mich. Ich möchte mich von dieser Umgebung abschotten, von der totalen Demütigung. In mir selbst verschwinden und nichts mehr fühlen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit wirft sie mir einen beigefarbenen Baumwoll-Overall hin. „Anziehen!“
Meine Hände zittern, während ich den Anzug anziehe. Der grobe Stoff scheuert über meinem wachsenden Bauch und juckt wie Brennnesseln. Die Knöpfe gehen nur mit Mühe zu und stehen unter Spannung. Kaum habe ich den letzten Knopf geschlossen, greifen wieder Hände zu. Kaltes Metall um die Handgelenke, ein Klicken, das wie Hohn klingt.
„Los. Vorwärts.“
Wie ferngesteuert lasse ich mich zwischen den beiden Frauen durch das enge Labyrinth der Gänge treiben; am Ende passieren wir eine schwere Metalltür, die mit einem dumpfen Grollen nachgibt. Dahinter öffnet sich eine Halle, kalt und hoch wie ein Schlund: eine Kuppeldecke, in der das Licht verloren geht, steile Treppen, die sich zu Galerien hinaufziehen, Etage um Etage, mindestens vier. Jeder Schritt hallt nach, als zählte das Gemäuer mit.
Sie treiben mich die Treppe hinauf bis in den dritten Stock. Der Holzboden ächzt und gibt unter ihren stampfenden Schritten einen Hauch nach; ich halte den Blick starr nach vorn, nur nicht über das Geländer in die Tiefe.
Vor uns erstreckt sich eine endlose Reihe mintgrün gestrichener Holztüren mit dunklen Eisenbeschlägen. In der Mitte der Reihen bleibt der Wärter stehen und öffnet eine Tür.
„Das ist dein neues Zuhause“, sagt die jüngere Wärterin beinahe freundlich. Genau das macht es schlimmer. Sie stößt mich über die Schwelle und nimmt mir die Handschellen ab.
Durch ein schmales Gitterfenster fallen Streifen grauen Tageslichts in die Zelle. Sie ist kaum mehr als zweieinhalb Meter breit. Auf beiden Seiten der Zelle steht ein einfaches Holzbett. Auf dem rechten Bett liegt eine Frau mit langen, dunklen Haaren und hat ihr Gesicht der Wand zugewandt.
„Nimm dich in Acht vor der da. Sie hat zwei Mitgefangene getötet, weil ihr danach war, verstehst du?“ Sie schenkt mir ein boshaftes Lächeln.
Stille. Das Monster bleibt liegen.
„Hey, Ally, du bekommst eine Mitbewohnerin. Ihr werdet euch blendend verstehen. Sie ist wie du: seelische Verwesung, Fäulnis“, sagt der Wachmann.
Ally murmelt unverständlich vor sich hin, ohne uns zu beachten. In der Mitte des Raumes steht ein Holzeimer, aus dem ein Uringeruch aufsteigt.
Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein.
Der Wachmann nennt monoton die Hausregeln: „Es gelten feste Schlafenszeiten. Nach dem Abendgebet um halb zehn wird das Licht
ausgeschaltet…“
Er faselt über Zwangsarbeit, die Isolationszelle, das Herstellen von Wäscheklammern und den Aufenthalt im Innenhof, aber meine Gedanken sind träge und zähflüssig. Das stakkatoartige Gerede geht größtenteils an mir vorbei.
Ich möchte schreien, dass ich hier nicht hingehöre. Dass alles ein schrecklicher Irrtum ist. Er sollte hier sitzen, nicht ich. Doch kein Laut kommt über meine Lippen. Die Tränen bleiben, wo sie sind.
Die Tür schlägt zu, Eisen auf Holz, dumpf hallt das Echo in der Dunkelheit. Kälte schneidet durch den Raum, als ich auf das harte Bett sinke. Nur Niedergeschlagenheit und Verzweiflung bleiben. Schwer, lautlos, unausweichlich.
Bilder meines alten Lebens flackern auf. Ein Leben, das außerhalb der Mauern dieses Gefängnisses hinter mir liegt, das mir in diesem Moment wie eine fremde Dämmerwelt erscheint.
Ich horche. Da … da ist es wieder, das Flüstern, alt wie das Gemäuer. Selbst hier im Craiginches. Es ist ein Flüstern, das mir sagt: Niemand entkommt Buchan Manor. Es begann lange vor meiner Zeit. Es begann mit Rebecca.
Kapitel 1
Ein halbes Jahr zuvor
Donnerstag, 28. Juni 1917 - Maisie
„Es tut mir leid für dich, Miss Maisie“, sagt der Marktverkäufer und wischt sich mit einem karierten Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Die Sonne steht tief und ihr Licht spiegelt sich auf seinem kahlen Schädel. „Ich habe keine Kartoffeln mehr. Ich bin ausverkauft.“
Er macht eine hilflose Geste in Richtung seines Handwagens, in dem nur noch ein paar Zwiebeln liegen, die nach Fäulnis riechen. Den matten Schalen nach zu urteilen, liegen sie schon lange dort. Aber in Aberdeen kümmert das niemanden mehr: lieber verdorbene Lebensmittel als gar keine.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und lasse den Blick durch die Riverside Road schweifen, als ob die Lösung für die Nahrungsmittelknappheit zwischen den Häusern, den Wagen und den zahlreichen Schatten liegen würde.
Hinter mir wächst die Schlange der Wartenden. Frauen mit eingefallenen Gesichtern und leeren Augen, die Hände fest um ihre Körbe geklammert und ein paar Dienstmädchen in den typischen weißen Kleidern, wie ich eines trage. Zwei abgemagerte Jungen, barfuß und vom Straßenstaub grau, spielen Fangen. Ihre Mutter beobachtet sie aus der Türöffnung ihrer Alkovenwohnung, die Schürze verschmutzt, die Augen müde.
„Aber die Kartoffeln sind nicht für uns“, wage ich schließlich zu sagen. „Sie sind für die Familie Munro. Ich arbeite dort als Dienstmädchen.“
Der Gemüsehändler hält für seine feinen Kunden immer Ware zurück. Er prahlt oft damit, dass die Munros zu seiner Kundschaft zählen, und ich habe zu oft gesehen, wie er ihnen die Preise nach Laune hochtreibt.
Was Mrs. Munro nicht weiß, dass stets ein paar Kartoffeln in meine Schürzentasche wandern, wenn ich abends nach Hause gehe. Nur wenige, aber gerade genug, damit für sechs hungrige Mäuler mehr als nur dünne Suppe auf dem Tisch steht.
„Tja, meine Liebe“, sagt der Händler und zuckt mit den Schultern.
„Selbst wenn du für King George V. persönlich einkaufen würdest, ich habe keine Kartoffeln. Alles ist ausverkauft. In ganz Aberdeen findest du keine mehr.“
Er sagt es mit einem Ausdruck unschuldiger Gleichgültigkeit, als wäre es ein Naturgesetz, dass die Armen leer ausgehen, während die Reichen sich satt essen dürfen. Hinter mir erhebt sich ein empörtes Murren.
„Was sagen Sie da?“ Die Frau hinter mir tritt vor. Ihre Stimme zittert vor Wut. „Willst du mir jetzt verdammt noch mal sagen, dass du wieder keine Kartoffeln für uns hast?“
Der Gemüsehändler zuckt zusammen, fasst sich dann aber schnell. Er beugt sich zu ihr hinunter und senkt seine Stimme zu einem Verschwörerton. „Das hast du nicht von mir“, flüstert er, „Am Ufer der Dee liegt ein Kahn der Deutschen voller Kartoffeln. Unsere Kartoffeln wurden alle auf dem Schwarzmarkt an diese verdammten Kriegstreiber verkauft.“
„Bist du jetzt völlig verrückt geworden?“, ruft sie so laut, dass es die ganze Straße versteht und dreht sich zur Schlange um. „Hört ihr das?! Alle Kartoffeln wurden an diese verdammten Bastarde verkauft und wir sollen hungern!“
Ein Chor empörter Stimmen erhebt sich hinter mir. Die Luft vibriert vor Zorn.
„Wo liegt dieses Boot?“, fragt eine andere Frau mit heiserer, vor Erregung bebender Stimme.
Obwohl der Krieg sich jenseits unserer Grenzen abspielt, hat er längst unaufhaltsam nach uns gegriffen. Man sieht ihn in den ausgemergelten Gesichtern der Menschen. In ihren leeren Vorratsschränken. Der Hunger wütet durch die Gassen. Auch zu Hause essen wir jede Woche weniger. Seit Jahresbeginn gibt es kein Brot mehr und seit einigen Wochen auch keine Kartoffeln. Wir leben von Reis, manchmal von ein paar Rüben oder Möhren, wenn wir sie uns leisten können. Nicht alle haben so viel Glück.
Die Reichen, wie die Familie Munro, umgehen die Rationierung mühelos. Mit genug Geld lässt sich jede Regel beugen, jedes Gewissen beruhigen.
Die bedrohliche Atmosphäre veranlasst mich, eilends zu verschwinden. Mit meinem leeren Einkaufskorb verlasse ich die Riverside Road und mache mich auf den Weg nach Munro Manor. Ein Spaziergang von etwa einer Viertelstunde.
Am Kai des Flusses liegen mehrere Boote und Kähne vertäut. Einige von ihnen haben unter Planen eine Ladung verborgen. Man kann nicht erkennen, was darunter liegt. Vielleicht Kartoffeln. Vielleicht aber auch etwas anderes. Ich kann nicht ausschließen, dass der Gemüsehändler gelogen hat, aber seine Worte klangen ehrlich, das Flackern in seinen Augen war echt.
Eine graue Ratte huscht zwischen den Müllhaufen hindurch, die in der Sommersonne dampfen und verrotten. Der süßliche Gestank hängt wie ein unsichtbarer Schleier in der Luft. Der Lumpensammler zieht an mir vorbei: ein hagerer Mann mit rußverschmiertem Gesicht, der laut singend einen Karren voller alter Stofffetzen hinter sich herzieht. Die Holzräder rattern über die Pflastersteine, dumpf, gleichmäßig, wie ein Herzschlag aus Metall und Holz. Ich hebe die Hand zum Gruß.
Fünf Jahre sind vergangen, seit meine Mutter, meine Schwester Isla, meine Brüder Rory und Ewan und ich unser kleines Haus im beschaulichen Ort Skene verlassen haben, um bei Großmutter im Aberdeener Ortsteil Hardgate unterzukommen.
Hardgate… Ein Viertel, das seinem Namen alle Ehre macht, wenn man die grauen Eschen liebt, die wie gebrochene Rippen aus dem Kopfsteinpflaster ragen. An den ständigen Lärm dort habe ich mich überraschend schnell gewöhnt. Tagsüber hallen Kinderstimmen durch die Gassen, begleitet vom Kreischen der Mütter, die ihre Sprösslinge herbeirufen oder sich im breiten Aberdeen-Dialekt austauschen. Nachts sind es die betrunkenen Männer, die torkelnd nach Whisky rufen und nach Betten suchen, die nicht unbedingt ihre eigenen sind.
Woran ich mich nie gewöhnen werde, ist der Gestank von Hardgate. Er steigt aus der Kanalisation, dem Unrat in den Gassen und den Häusern selbst auf. Ein stechender, schwerer Gestank, der im Sommer unerträglich wird. Achtlos auf die Straße geworfene Fischköpfe, Kartoffelschalen und Essensreste bilden eine schmierige, graubraune Schicht auf dem Kopfsteinpflaster. Man läuft jeden Tag über die Sünden der Stadt.
Nach zehn Minuten lasse ich den Schmutz unseres Viertels hinter mir und trete in eine, wie von einer Membran umgebene, stillere Welt: den Tullos-Park und das gepflegte Anwesen Munro Manor.
Die Morgensonne taucht alles in warmes, goldenes Licht, das auf dem Teich glitzert. Eine Gruppe Enten zieht schnatternd vorbei, das Wasser kräuselt sich in feinen Ringen. Eine sanfte Brise weht, zupft an meinem Haar und zieht dunkelrote Strähnen aus dem Knoten. Ich
stecke sie hastig unter die Haarnadeln zurück. Eine Geste, die zur Gewohnheit geworden ist.
Mit dem leeren Einkaufskorb am Arm öffne ich die schwere Tür von Munro Manor. Das alte Messingschloss antwortet mit einem vertrauten Klick, das in der stillen Halle widerhallt. Seit drei Jahren arbeite ich hier als Dienstmädchen.
Hamish Munro ist ein Mann mit unbewegtem Gesicht und durchdringendem Blick, ein angesehener Richter, der Recht über Aberdeens Schurken spricht. Mrs. Munro verbringt ihre Tage mit Teestunden und der Planung von Abendgesellschaften, die in den besseren Kreisen Aberdeens als gesellschaftliche Höhepunkte angesehen werden.
Von mir wird erwartet, dass ich nicht nur putze, sondern die Abende der Munros in kleine Triumphe verwandle: makellose Soireen, die man noch wochenlang im Flüsterton lobt. Jede Falte im Tischtuch, jedes Glas, jede Blume muss stimmen. Der kleinste Fehler wäre ein Makel, der sich in meinem Leben niederschlagen würde.
Die morgendliche Kälte der Straße steckt mir noch in den Knochen, doch hier, in diesem Haus, herrscht eine andere Art von Frost: unsichtbar, kontrolliert, durchdringend und manchmal böse. Ich streife den Staub von meiner Schürze und atme tief durch.
Der Flur glänzt makellos, selbst das Licht scheint sich der strengen Ordnung dieses Hauses zu fügen. Der Duft von Politur und Parfüm hängt noch in der Luft. Über den weißen Marmorboden erreiche ich die Küche und stelle auf der Arbeitsplatte den Korb ab. Das Klirren des feinen Porzellans hallt kurz nach, bevor es in der Stille versinkt.
Hinter der Küchentür liegt der Hof, so präzise angelegt und gepflegt wie das moderne Art-déco-Interieur im Inneren. Als ich die Tür öffne, weht eine sanfte Sommerbrise herein, der den Duft von geschnittenem Gras mit sich trägt. Ich mahle frischen Kaffee. Das leise rhythmische Knirschen der Bohnen klingt wie ein Takt, der mich an die Arbeit bindet und zugleich beruhigt.
Aus dem Salon, der an die Diele grenzt, dringen Stimmen gedämpft herüber: die des Richters, tief und ruhig, die seiner Frau schrill, wie das Klimpern von Porzellan.
„Bleib heute lieber im Haus, Amalia“, sagt Richter Munro. „Es wird gemunkelt, dass der Pöbel von Hardgate plant, die Boote zu stürmen. Man vermutet, dass dort Lebensmittel für das Militär gehortet werden. Und du weißt, wie schnell so etwas außer Kontrolle gerät. Die Polizei wird die Armee einsetzen. Sie wollen die ganze Stadt belagern.“
„Du meine Güte!“ Mrs. Munro klingt empört, doch mehr aus gesellschaftlicher Sorge als aus Furcht. „Kann das Abendessen mit den McNeils denn heute Abend überhaupt stattfinden?“
„Wenn die Armee alles im Griff behält, sollten sie kommen können. Ich gehe jetzt ins Gericht, Liebling.“
Ich höre Schritte auf dem Marmorboden. Richter Munro tritt in den Flur und bleibt kurz vor der Küchentür stehen.
„Guten Morgen, Miss Maisie.“
Sein Blick ruht für einen Moment auf mir, kühl, prüfend, fast zu lange.
„Guten Morgen, Sir.“
Ich wende mich rasch ab und drehe den Hebel der Kaffeemühle. Das Knirschen der Bohnen übertönt den Schlag, mit dem die Haustür ins Schloss fällt. Dann klicken Absätze über die Fliesen. Gleichmäßig. Entschlossen.
In der Tür erscheint Mrs. Munro. Sie trägt ein eisblaues Sommerkleid mit weißer Spitzenstickerei. Das glänzende braune Haar ist kunstvoll hochgesteckt, die Lippen in einem satten Rot, wie frisches Blut auf weißem Porzellan. Sie wirkt um Jahre jünger als meine Mutter. Die gleiche Generation, aber ein anderes Leben. Keine Sorgenfalten, kein Schatten unter den Augen, nur der kühle Glanz einer Puppe, die niemals schläft.
Sie betritt die Küche. Der Duft ihres Parfüms verdrängt für einen Moment den Kaffeeduft. Ihr Blick fällt auf den leeren Einkaufskorb.
„Du weißt doch, dass ich heute Abend ein Abendessen für die McNeils gebe. Warum wurden keine Kartoffeln gekauft, Maid?“
Obwohl ich seit drei Jahren in diesem Haus arbeite und schon oft darauf hingewiesen habe, dass ich Maisie heiße, nennt sie mich weiterhin Maid. Irgendwann habe ich aufgehört, es sie darauf hinzuweisen.
„Es tut mir leid, Mrs. Munro.“ Ich wiederhole, was der Gemüsehändler mir gesagt hat. „Es gibt keine Kartoffeln mehr. Sie wurden angeblich von der deutschen Armee aufgekauft.“
Ihre Lippen verengen sich zu einem dünnen, rotglänzenden Strich. „Das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du dem Gemüsehändler gesagt, dass die Kartoffeln für uns sind?“
Ich nicke. „Ja, es tut mir leid, Mrs. Munro.“
Sie seufzt, ein Laut irgendwo zwischen Resignation und theatralischer Verzweiflung.
„Ich könnte Reis zubereiten“, schlage ich vorsichtig vor.
„Reis?“ Ihre gezupfte Augenbraue hebt sich. „Billigen Reis für
meine Gäste?“ Sie lacht leise, ein tonloses Geräusch, das mir über den Rücken kriecht. „Mr. McNeil ist Notar. Seine Frau ist Vorsitzende des Damenclubs. Reis mag in deinen Kreisen vielleicht genießbar sein, Maid, aber wir servieren ihn nicht.“
Ich warte, bis ihr Tonfall abebbt und zwinge mich zu einem Lächeln.
„Das Wetter ist wunderschön, Mrs. Munro“, sage ich ruhig. „Ich könnte den Reis in einen kalten Salat einarbeiten. Dazu das Huhn, den Fasan und die Pasteten von gestern, alles kalt serviert. Wenn ich den Tisch im Garten decke, ließe sich daraus ein leichtes Sommerdinner machen.“
Sie trommelt mit den Fingerspitzen gegen die Lippen. In ihren Augen flackert Eitelkeit. „Mrs. McNeil hat selbst noch nie eine Gartenparty gegeben…“
Langsam breitet sich ein berechnendes, selbstzufriedenes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. „Ja, Maid, das ist eine originelle Idee. Warum bist du nicht früher darauf gekommen?“
Ich senke den Blick. Draußen rauscht der Wind durch die Bäume. Für einen Moment scheint es, als würde tief im Haus etwas leise antworten.
„Ich möchte, dass du den Gartentisch mit der Leinentischdecke deckst“, fährt sie fort. „Und das Tafelsilber schön polierst. Und frische Blumen, nichts Wildes, du weißt, was ich meine.“ Sie zieht einen Klappspiegel aus ihrer Handtasche, prüft ihren Lippenstift. „Los, los an die Arbeit. Heute gibt es viel zu tun. Ich nehme den Kaffee im Salon. Und danach kannst du gleich den Parkettboden in der Eingangshalle wachsen.“
„Natürlich, Mrs. Munro.“ Ich lächle. Breit. Freundlich. Mein Gesicht fühlt sich dabei an wie eine Maske, die langsam bröckelt.
Meiner Schwester Isla glaubt, dass ich mir wünsche, dass mich alle mögen. Manchmal wünschte ich, ich wäre mehr wie sie. Isla ist furchtlos, trotzig, mit einem Herzen, das keine Angst kennt. Aber ich bin nicht so mutig. Es ist mir zur zweiten Natur geworden, die Wünsche und Stimmungen anderer zu erspüren, ihre Blicke richtig zu deuten und immer das zu tun, was von mir erwartet wird.
Ich arbeite für wenig Geld viele Stunden, aber wir sind auf das Einkommen angewiesen. Von Isla, die als Tagelöhnerin bei den Frasers auf dem Gutshof arbeitet, weiß ich, dass Mrs. Munro schon darüber nachgedacht hat, mich zu entlassen. Nicht weil sie mit meiner Arbeit unzufrieden wäre, sondern weil ihr die Blicke ihres Mannes nicht entgangen sind. Isla hat gehört, dass er eine Affäre mit einer jüngeren, hübschen und ehrgeizigen Frau gehabt haben soll. Ein Skandal, über den in den besseren Kreisen getuschelt wurde. Seitdem duldet Mrs. Munro keine weibliche Bedienstete mehr, die schöner oder jünger als vierzig ist. Ich bin mit 19 Jahren die Ausnahme.
Isla erzählte auch, dass Mrs. Munro sich bei Mrs. Fraser über mich beklagt habe. „Dieses Mädchen bettelt geradezu um Aufmerksamkeit. Es ist, als hätte sie Honig an ihrem Hintern.“
„Ach, meine Liebe, du weißt doch, wie Männer sind. Sie ist zweifellos hübsch, aber sie ist nur eine Dienstmagd. Und das weiß auch Hamish. Du könntest problemlos eine flämische Dienstmagd einstellen, sie sind billiger, fügsamer, ersetzbar. Man hört, dass diese armen Dinger schon für die Hälfte des Lohns arbeiten.“
„Aber bald ist der Krieg vorbei“, soll Mrs. Munro geantwortet haben, „und dann gehen sie wieder nach Hause.“
Seitdem ich von der Unterhaltung erfahren habe, halte ich mich von meinem Dienstherrn fern. Ich meide seine Blicke, seine Nähe, sein Parfüm. Auch sorge ich dafür, dass Mrs. Munro mit meiner Arbeit vollkommen zufrieden ist. Und schweige wie ein Grab über die Zeitschriften mit den Aufnahmen und Zeichnungen nackter Frauen, die ich manchmal beim Staubwischen im Arbeitszimmer des Richters zwischen den Gerichtsakten finde. In diesem Haus weiß ich eines sicher: Nicht alles, was glänzt, ist sauber. Und manches Übel lässt sich nicht wegpolieren.
Es ist kurz nach sieben, als Mrs. Munro in ihrem burgunderroten Abendkleid den Garten betritt. Der Stoff schimmert im Abendlicht wie dunkler Wein. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, beinahe lautlos, wie die einer Schauspielerin, die schon hundertmal dieselbe Szene gespielt hat.
Sie bleibt am Rand des Gartens stehen und lässt den Blick über den gedeckten Tisch gleiten. Auf der weißen Leinentischdecke stehen ein Stapel Porzellanteller und ein Korb mit Silberbesteck. In der Mitte drei Vasen mit bunten Wildblumen, deren Stängel noch vom Tau feucht sind. Dazwischen das kalte Hühnchen, der Reissalat, der Fasan, Obst, Pasteten, Fisch. Alles sorgfältig auf Silberschalen arrangiert. Das Wasser und der Wein funkeln in Kristallkaraffen, als hätten sie eigenes Licht.
Sie neigt leicht den Kopf, ihr Mund zieht sich kaum merklich zusammen. Dann greift sie nach der mittleren Vase und ordnet die Wildblumen neu. Langsam, akribisch. Ihre Finger bewegen sich mit der Präzision einer Chirurgin.
„Du hast mich nicht enttäuscht, Maid“, sagt sie schließlich.
„Das freut mich, Mrs. Munro.“
Ein Hauch von Zufriedenheit liegt in ihrer Miene. „Du kannst jetzt gehen. Morgen früh um acht Uhr erwarte ich dich wieder bei der Arbeit.“
Als ob ich jemals zu spät käme.
„Natürlich, Mrs. Muno. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.“
Ich will mich gerade abwenden, als ich ein fernes Raunen höre, undeutliche Stimmen, dann ein Schrei, der durch die warme Abendluft schneidet. Ein dumpfes Klopfen folgt, rhythmisch, wie das Hämmern gegen Holz. Der Lärm wird durch die Entfernung gedämpft und verliert an Schärfe, aber nicht an Gewicht. Er schwebt über den gepflegten Garten wie ein Schatten, der nicht hierhergehört.
Mrs. Munro hebt kurz den Kopf. Ihre Augen treffen meine. Für einen Moment verstehen wir uns wortlos, hören und ignorieren es.
Dann verabschiedet sie mich mit einer knappen Handbewegung.
„Bis morgen, Maid.“
Ich verneige mich leicht und wende mich zum Gehen. Hinter mir raschelt ihr Kleid, als sie sich an den Tisch setzt.
Der Garten liegt friedlich da, makellos, hell, geordnet. Nur in der Ferne hallt das dumpfe Pochen weiter, wie ein Herz, das nicht zu diesem Haus gehört.
Ich schließe die Haustür hinter mir und blinzele in das trübe Licht der Abenddämmerung. Etwa hundert Schritte hinter dem Haus bleibe ich stehen und blicke auf Buchan Manor, das jenseits des Flusses im Duthie-Park liegt, wie ein Trugbild im Abendlicht. Etwas rührt sich im dunklen Teich links vom Schloss.
Plötzlich zucke ich zusammen. Nein, das kann nicht sein. Ich reibe mir die Augen, schaue noch einmal hin, stolpere. Für einen Moment glaube ich, am Rand eines Abgrunds zu stehen. Feine Risse ziehen sich durch die Erde, spreizen sich, verästeln und öffnen sich zu einem gähnenden Spalt, als wollte die Welt selbst mich verschlucken.
Das Mondlicht schimmert auf der Haut des Teiches. Ein kaltes, bleiches Licht, das über das trübe Wasser gleitet und sich tief hineintastet, fast bis zum Grund. Es riecht nach nasser Erde, nach Fäulnis, nach Verwesung.
Langsam steigt Nebel aus dem Teich empor, schwebend, lautlos, gespenstisch. Für einen Herzschlag lang zeichnet sich im Dunst ein
körperloses Wesen im weißen Nachthemd ab, blass wie Mondlicht. Ihre Haut schimmert fahl wie Porzellan im Mondlicht. Rotbraune Schlieren wickeln sich um ihr Gesicht wie Fäden.
Ein Laut bricht aus mir heraus. Kein Schrei, kein Wort, nur ein heiserer Aufschrei. Er zerspringt in der feuchten Luft, trägt über den Rasen hinauf zum Schloss. Ich glaube, drei tiefe Atemzüge zu hören und schließe die Augen. Eine Gestalt in einem weißen Nachthemd? Wie ist das möglich?
Die Kühle der Nacht wirkt besänftigend und ich öffne die Augen wieder. Kein Geist, keine Frau im Nachthemd. Meine Fantasie hat mir mal wieder einen Streich gespielt. Doch irgendetwas stimmt nicht. Dinge bewegen sich, trudeln und sinken wie Plankton im Teich.
In Munro Manor entfernen sich Schritte. Ich höre das Knirschen des Kieses, das Quietschen des Flügeltors. Dann ist alles wieder ruhig.
Meine Augenlider flattern. Ich blicke wieder zu Buchan Manor. Dort, im Schatten der hohen Fenster, steht eine Gestalt. Reglos. Dunkel. Sie starrt auf den Teich hinab … und auf mich.
Ich fliehe.
Kapitel 2
Buchan Manor, Donnerstag, 22. Dezember 2022
Fiona
Am Horizont taucht Buchan Manor auf, das altehrwürdige Schloss der Familie Campbell, das sich mit stiller Majestät gegen den eisblauen Himmel erhebt, die Türme schwarz umrissen im kalten Winterlicht.
Vor uns windet sich die Auffahrt, wie seit Jahrhunderten, in sanften Kurven den Hügel hinauf. Der Weg ist breit und gepflegt, doch über ihm hängt das widerspenstige Erbe der Natur. Ein Ast schwingt tief über die Straße, streift beinahe die Windschutzscheibe, als wolle er prüfen, wer es wagt, diesen Weg hinaufzufahren. Die Familie Campbell hat sich hier einst gegen die Wildheit der Landschaft gestemmt. Doch mit langen, klammernden Fingern tastete sich die Natur unermüdlich und listig mit einem stillen Triumph weiter über den Weg und erdrosselte jeden Versuch.
In der Ferne drängt der Wald in finsterer Dichte bis an die Grenze des Anwesens heran. Seine knotigen Wurzeln ragen schwarz und hässlich wie Totenkrallen aus dem gefrorenen Boden empor. Klammernd greifen die langen Äste ineinander, als suchten sie nach Leben, das sich ihnen entgegenstellt, um es lautlos zu ersticken. Zwischen ihnen wächst namenloses Unkraut: wild, trotzig, unbezwingbar.
Die Zufahrt ist heute ein breites steinernes Band, kein schmaler Faden mehr wie einst. Der Kies ist verschwunden, ersetzt durch glatte Platten, die das Gewicht der Jahre tragen. Buchen säumen den Weg, ihre grauweißen, nackten Stämme geneigt wie in einer stillen Zwiesprache. Ihre Zweige verschlingen sich in bizarrer Umarmung und bilden ein Gewölbe über uns, ein Bogengang aus Ästen, der an das Kirchenschiff einer längst vergessenen Kapelle erinnert. Hier und dort leuchten Hortensienbüsche, deren blaue und rosafarbene Blüten selbst im Frost ein letzter Hauch von Sommer sind, ein atemberaubender, fast schmerzlicher Kontrast in dieser winterstarren Welt.
Ich habe nicht erwartet, dass die Auffahrt so lang sein würde. Und dann stehen wir plötzlich vor dem Schloss aus braunroten Ziegeln, umgeben von
einem breiten Burggraben und der Zugbrücke.
Mein Herz hämmert in der Brust. Etwas Altes, Unruhiges regt sich
in mir, als stiegen längst versunkene Erinnerungen empor. Tränen brennen in meinen Augen, doch ich kann nicht sagen, ob sie aus Freude oder Furcht kommen.
„Ein Neuanfang für uns, Fiona.“ Callums Stimme bricht die Stille.
Er legt seine Hand auf mein Bein, ehe er den Wagen parkt. Zu beiden Seiten breitet sich die Landschaft aus: der Wald, der Fluss Dee, der Duthie-Park, alles liegt unter einem feinen Schleier aus Frost, als ruhe die Welt in einem einzigen, kristallenen Atemzug.
„Ein Neuanfang“, wiederhole ich leise. Das Wort schmeckt nach Hoffnung und nach Angst. Ein neuer Ort. Neue Energie. Vielleicht auch ein neues Ich. Zumindest hoffe ich das.
Callum zieht die Handbremse an. Wir steigen aus. Der Wind schneidet mir ins Gesicht, kalt und scharf. Für einen Moment bleibt mein Atem wie gefroren in der Luft hängen.
Eine hölzerne Zugbrücke führt über das trübe Wasser zur Freitreppe, hinauf zu einer Tür, so groß, dass sie die Menschen kleiner erscheinen lässt, als sie sind. Schwarze Fensterläden erinnern an geschlossene Augen. Efeu windet sich um die Mauern. Das Anwesen wirkt trostlos, verlassen und doch lebendig auf eine Weise, die mich frösteln lässt.
Seit Callums Eltern vor zwei Jahren gestorben sind, waren wir nur einmal hier. Danach beschlossen wir, es zu verkaufen. Doch außer ein paar neugierigen Interessenten, die nur das „Gespensterschloss“ sehen wollten, kam nie jemand ernsthaft infrage. Und jetzt werden wir selbst hier wohnen.
Noch bevor wir die Zugbrücke betreten, höre ich Stimmen. Ich halte inne. Ein silbergrauer Kombi steht halb verborgen hinter den Eichen. Es raschelt im Unterholz. Plötzlich taucht ein Mann mit Mikrofon auf, dicht gefolgt von einem Kameramann.
„Callum! Fiona! Nur ein paar Fragen!“
Ich atme scharf aus. „Großartig“, murmle ich. „Das ging ja schnell.“
Callum richtet sich auf, zieht das vertraute Lächeln auf, das für die Öffentlichkeit bestimmt ist. In Sekunden verwandelt er sich von dem Mann an meiner Seite in den Callum McDonald, den strahlenden Moderator, den alle lieben.
„Guten Tag, meine Herren. Bitte fassen Sie sich kurz.“
Der Reporter, jung, ehrgeizig, mit makellosem Lächeln, spricht in die Kamera: „Wir stehen vor Buchan Manor, dem Familiensitz des bekannten TV-Moderators Callum McDonald und seiner Frau Fiona Ross, Psychologin und Bestsellerautorin. Nach dem brutalen Überfall
im September ziehen die beiden heute hierher, zurück zu Callums Wurzeln in der Region Aberdeen. Fiona, wie geht es Ihnen heute?“
Das Mikrofon ist so nah, dass ich fast das kalte Metall an meinem Gesicht spüre. Ich zwinge mich zu einem Lächeln.
„Körperlich geht es mir gut und auch seelisch finde ich langsam zurück in den Alltag.“
„War der nächtliche Überfall bei Ihnen zu Hause der Auslöser für den Umzug?“
„Zum Teil, ja.“ Ich senke den Blick, spüre, wie sich die Worte in mir verhaken.
Fünf Männer in Sturmhauben. Lederhandschuhe. Blut auf dem weißen Marmor meiner Küche. Es war nicht persönlich, sagten sie. Sie wollten nur das Geld. Ich war nur im Weg.
Ich habe mir das unzählige Male gesagt, aber es hat nicht geholfen.
Die Spuren sind längst beseitigt, meine Rippenbrüche verheilt. Doch der Geruch von Metall und Angst ist noch immer in mir. Und in der Nacht sehe ich ihre kalten Augen durch die Masken.
Als der Makler anrief und sagte, dass Buchan Manor noch immer leer stehe, war das wie ein Zeichen. Meterdicke Mauern. Sicherheit. Distanz. Ein Ort, an dem die Welt draußen bleibt.
Callum legt den Arm um mich, dreht sich zum Reporter. „Es war die Summe vieler Dinge“, sagt er ruhig. „Für mich ist es Heimkehr. Für Fiona ein Neuanfang. Wir blicken nach vorn.“
Sein Ton ist perfekt. Warm. Berechnend. Ich erkenne ihn kaum wieder.
„Danke“, sagt der Reporter, als die Kamera ausgeht. Dann, leiser: „Ganz ehrlich, Fiona, wie geht es Ihnen wirklich?“
Sein Blick ist … neugierig.
„Es geht mir gut“, antworte ich schnell.
„Sie sehen großartig aus.“ Ein Satz, so glatt, dass er mir fast wehtut.
Mein Haar hängt schlaff, ich habe Schatten unter den Augen, die kein Make-up mehr überdeckt. Was für ein Heuchler.
Ich lächle trotzdem. „Danke. Wenn Sie nichts dagegen haben … wir möchten jetzt rübergehen.“
Wir überqueren die Zugbrücke. Das Holz knarrt unter unseren Schritten, das Echo hallt bis zum Wasser der Dee. Hinter mir surrt die Kamera ein letztes Mal. Sie filmt, wie wir zur Tür hinaufsteigen.
Als die Journalisten abziehen, holt Callum den Schlüssel hervor und steckt ihn ins Schloss. Die Tür gibt nach mit einem langen, klagenden Knarren. Ein muffiger, abgestandener Geruch schlägt mir entgegen.
Staub, feuchte Wände, altes Holz. Der Geruch der Zeit.
Drinnen ist es kaum wärmer als draußen. Mein Atem bildet kleine Wolken, während ich die Hände aneinander reibe. Ich beschließe, die Jacke anzubehalten.
Der Vorraum ist schmal und dunkel, die Wände mit brauner Holzvertäfelung verkleidet. Kein Tageslicht. Nur das matte Glitzern der Messingbeschläge an der Tür. Ich streiche mit den Fingern über das Walnussholz. Es ist glatt, kalt, fast ölig. Wie viele Hände dieses Holz wohl vor mir berührt haben? Hände von Menschen, die hier gelebt, geliebt haben und gestorben sind.
Callum betätigt den Lichtschalter. Der alte Kronleuchter an der Decke erwacht zögernd zum Leben. Sein Licht ist schwach, gelblich, doch es reicht, um den Raum zu füllen. Ich sehe dicke Teppiche, schwere Möbel. In der Ecke eine Ritterrüstung, im Schatten ein ausgestopfter Bär: Relikte aus Jahrhunderten, die geblieben sind, als wäre niemand je fortgegangen.
Ich gehe allein weiter. Callum begibt sich in die Küche. Der Schneeregen hat die Fenster des Westflügels blind gemacht; das Glas zittert in seinen Rahmen, als würde etwas dagegen atmen. Etwas zieht mich nach vorn, Schritt für Schritt, bis ich vor der Tür des grünen Salons stehe. Ein dünner Streifen Licht sickert darunter hervor.
Ich lege die Hand auf die Klinke. Sie ist eiskalt. Als ich die Tür öffne, ächzt das Holz unwillig. Der Raum liegt im Halbdunkel. Nur die Stehlampe beim Kamin wirft einen trüben Schein auf den Boden. Schatten kauern in den Ecken wie Gestalten, die sich nicht entscheiden können, ob sie sich zeigen sollen.
Und dann sehe ich es.
Das Porträt, darunter der Name Rebecca.
Die junge Frau schaut direkt in meine Richtung, ihr Blick ist freundlich und sanft, ihre Haltung stolz und selbstbewusst. Das Licht trifft ihr Gesicht auf eine seltsame Weise, die den Betrachter unweigerlich anzieht. Ich trete näher. Mein Herz pocht. Rebeccas Augen scheinen meinem Blick in einer leisen, bewussten Bewegung zu folgen. Kaum wahrnehmbar und dennoch so deutlich, dass mir das Blut stockt.
Ein Gefühl bringt mich noch näher an das Bild. Und da, im dünnen Abstand zwischen uns, spüre ich es: eine Erwartung, die sich seit Jahren staut. Geduld, die nur den Toten eigen ist. Mein Atem wird flach.
„Du … hast auf mich gewartet …?“ Die Worte kommen kaum hörbar über meine Lippen.
Die Stehlampe flackert, ein Sonnenstrahl flammt kurz durch das Fenster, kriecht über den Rahmen und lässt das Gold einen Herzschlag lang aufglühen. Und im dunklen Glas über Rebeccas Augen zeichnet sich Hoffnung ab.
Ein Hauch streift meinen Nacken. Ich mache einen Schritt zurück, aber mein Blick bleibt an Rebeccas Augen hängen.
„Ja, ich sehe es dir an“, flüstere ich.
In dem Moment erlischt das Licht vollständig. Der Raum versinkt in Dunkelheit. Und hinter mir, ganz nah, spüre ich einen Luftzug.
Kapitel 3
Aberdeen, 1917
Maisie
Etwa dreißig Meter weiter, unter den rauschenden Linden am Ufer der Dee, drängt sich eine wütende Menge um eines der Boote, die am Kai vertäut liegen. Frauen, Dutzende von ihnen, vielleicht achtzig, vielleicht mehr. Ihre Gesichter glühen, ihre Schürzen sind zerschlissen, ihre Augen brennen vor Hunger und Empörung.
„Unsere Kartoffeln an diese verdammten Deutschen verkaufen? Wie könnt ihr es wagen! Aberdeen hungert, ihr Diebe!“
Die Stimmen schwellen zu einem einzigen Aufschrei an, wild und schrill wie der Wind, der vom Meer her über den Fluss peitscht. Auf dem Achterdeck steht ein einzelner Polizist unsicher auf der schwankenden Ladung, die unter einer grünen Plane verborgen liegt. Er bläst schrill in seine Pfeife, schwingt drohend den Säbel, ruft vergeblich nach Verstärkung.
„Zurück, ihr Weiber! Verschwindet, hab ich gesagt!“ Seine Worte gehen im Tumult unter.
Wie ein aufgebrachter Schwarm kreisen die Frauen um das Boot, eine Welle aus Röcken, Stimmen und verzweifeltem Mut. Ich erkenne Nachbarinnen, Mütter aus unserem Viertel, Frauen, die sonst gebeugt durch die Straßen gehen, mit gesenkten Blicken und stiller Resignation. Jetzt aber stehen sie aufrecht, ihre Wut lodert wie Feuer. Eine von ihnen klettert über den Kai, streckt die Hand nach der Reling aus.
„Her mit den Kartoffeln! Wir müssen unsere Kinder ernähren, verdammt noch mal!“
Der Polizist hebt den Säbel, seine Stimme überschlägt sich. „Zurück! Sofort! Wer noch einen Schritt wagt, landet im Gefängnis!“
Doch er verliert das Gleichgewicht, stolpert rücklings und stürzt auf das Deck. Der Säbel klirrt, die Mütze fliegt im hohen Bogen davon und treibt auf dem schwarzen Wasser.
„Klettert!“, ruft eine vertraute Stimme.
Mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen. Isla.
Meine Schwester drängt sich nach vorn, ihre dunkelroten Haarsträhnen haben sich aus dem Dutt gelöst und tanzen im Wind. Ihre
weiße Dienstuniform ist mit Schlamm bespritzt. Entschlossen krempelt sie den Rock hoch und springt aufs Boot. Andere folgen ihr, eine Woge aus Mut und Wut. Der Polizist versucht sich aufzurichten, greift nach seinem Säbel, doch Isla stößt ihn mit einer überraschenden Wucht vom Deck. Ein Schrei zerreißt die Luft, dann das gedämpfte Rauschen, mit dem das Wasser den Mann aufnimmt.
„Schnell!“ Die Frauen reißen die Plane fort. Unter ihr liegen Dutzende Säcke, prall gefüllt mit Kartoffeln. „Nehmt, was ihr tragen könnt! Beeilt euch!“
In der Ferne hallt ein Ruf. Soldaten tauchen auf, kaum achtzig Meter entfernt, braungrüne Uniformen im trüben Licht. „Halt! Stehen bleiben!“
In diesem Moment entdeckt mich Isla. „Maisie! Hier, nimm!“ Sie balanciert zwei Säcke, springt vom Boot und läuft auf mich zu.
„Bist du verrückt?“, zische ich. „Wenn sie dich erwischen, verlierst du deine Stelle und dann hungern wir alle!“
„Ich kann nicht tatenlos zusehen!“
„Stehen bleiben!“, rufen die Soldaten. Warnschüsse peitschen durch die Luft, das Echo zittert über dem Wasser.
„Verteilt euch!“, ruft Isla. „Los!“
Die Menge bricht auseinander. Eine Frau stolpert, Kartoffeln rollen über das Pflaster, dumpf und schwer. Ich helfe ihr auf und schnappe mir einen der Säcke. Dann laufe ich weiter, bleibe dicht hinter Isla. Das Gewicht zieht an meinen Armen, reißt an meinen Schultern.
„Hierher!“, keucht Isla.
Das Stampfen der Stiefel hallt in den engen Gassen wider. Noch ein Schuss. Adrenalin schießt durch meine Adern, mein Herz hämmert bis in die Kehle, mein Atem geht stoßweise. Wir hetzen durch Hinterhöfe, vorbei an dunklen Durchgängen, in denen der Geruch von Kohle und nasser Erde hängt. Hinter uns das Echo der Verfolger. Bedrohlich und unerträglich nah.
„Ich kann nicht mehr!“, keucht Isla.
„Nur bis zur Ecke!“, keuche ich zurück. „Dann sind wir fast zu Hause!“
„Geh du!“, presst sie hervor.
Ich blicke mich hastig um. Überall Müll, alte Kisten, ein Haufen verfaulter Abfälle.
Ich reiße die Kisten beiseite, öffne eine schmale Lücke. „Versteck dich!“
Isla lässt sich an der Wand hinuntergleiten, die Kartoffeln fest umklammert. Ich hocke mich neben sie, ziehe die
Kisten und den Müll über uns. Der beißende Geruch steigt mir in die Nase, beißt in den Augen.
Um das Keuchen zu dämpfen, lege ich mir die Hand auf den Mund. Eine Ratte huscht über unsere Füße, ein grauer Schatten im Dunkeln. Ich wage kaum zu atmen. Dann Schritte. Zwei Soldaten stürmen in die Gasse.
„Hier entlang!“, ruft einer.
Sie bleiben direkt vor unserem Versteck stehen. Ich sehe ihre Stiefel durch einen Spalt.
„Sie müssen hier sein“, sagt der eine, seine Stimme scharf wie Glas. Der andere lacht kurz, unsicher. „Verdammt, was stinkt hier so?“
Dann eine neue Stimme, brüchig, aber fest: „Sucht ihr die Mädchen mit den Kartoffeln?“
Mrs. Stendhall. Unsere Nachbarin, die alles sieht und nichts vergisst.
„Ja, zwei Dienstmädchen“, ruft der Soldat.
„Die sind da drüben entlanggerannt“, antwortet sie ohne Zögern.
Ich halte den Atem an. Dann Schritte, die Männer entfernen sich. Das Echo ihrer Stiefel verhallt.
„Die Luft ist rein“, sagt Mrs. Stendhall leise.
Vorsichtig krieche ich aus dem Versteck. Der Sack in meinen Armen scheint doppelt so schwer geworden zu sein. Mrs. Stendhall steht im Halbdunkel, grinst, ihre wenigen Zähne blitzen gelb im fahlen Licht.
„Gut gemacht, Mädels“, sagt sie.
„Danke, Mrs. Stendhall.“
„Na macht schon. Wenn ich zehn Jahre jünger wär, hättet ihr mich vorne auf dem Boot gesehen.“ Ihr Blick gleitet gierig zu den Kartoffeln.
Ich reiche ihr den Sack. Sie greift hinein, lässt einige Knollen in ihre Schürze gleiten. „Danke, Mädchen. Ich werd sie mir schmecken lassen.“
„Tun Sie das. Komm, Isla. Wir müssen sie verteilen.“
„Nicht jetzt. Hier wimmelt es von Soldaten“, keucht Isla.
Ich antworte nicht. Ich weiß, dass sie recht hat. Aber Mut misst man nicht daran, was man wagt, sondern daran, ob man überlebt.
Wir eilen die Hardgate hinauf, vorbei an Buchan Manor, dessen Fenster im Abendlicht wie goldene Augen brennen. In den hohen Fenstern spiegelt sich das Mondlicht und für einen Augenblick meine
ich, eine Bewegung hinter dem Glas zu erkennen, eine Silhouette, kaum greifbar, still, beobachtend.
Ich bleibe stehen, blinzle gegen das Licht. Doch der Schatten ist verschwunden, als wäre er nie da gewesen. Nur die Spiegelung des Himmels bleibt, leuchtend und leer.
Eine Windböe zerrt an meinem Rock, streicht über mein Gesicht, bringt den Geruch von Salz und kaltem Stein mit sich. Die Luft zwischen uns und dem Haus scheint dichter zu werden, schwerer, als würde das Schloss selbst uns betrachten. Eine Gänsehaut kriecht mir über den Nacken. Dann kehrt Stille ein. Eine Stille, so vollkommen, dass sie fast schmerzt.
Irgendwo knarrt ein Fensterladen.
Kapitel 4
Maisie
Ein feiner Wind weht vom Ufer der Dee, als wir den schmalen Weg entlanglaufen. Über dem Fluss liegt ein silbriger Schleier, der das Wasser wie Glas erscheinen lässt. Isla trägt den Sack auf der Schulter, ihr Atem geht stoßweise. Das leise Rascheln der Kartoffeln klingt beruhigend, fast wie ein Herzschlag.
Als wir an Buchan Manor vorbeikommen, zieht mich das Haus erneut in seinen Bann. Es steht auf einer Anhöhe im Duthie-Park, umgeben von einem Eisenzaun, dessen Spitzen sich gegen den bleiernen Himmel abzeichnen.
„Komm schon, Maisie“, murmelt Isla, doch ihre Stimme klingt unsicher.
Ich reiße den Blick los, und doch bleibt das Gefühl, dass uns etwas folgt, das älter ist als das Haus selbst. Wir biegen in die Gasse, die zu unserem Viertel führt. Das Pflaster ist uneben und feucht, die Luft riecht nach Rauch und Flusswasser. Über den Dächern kreisen Möwen, ihr Ruf klingt klagend, fast menschlich.
„Siehst du das?“, flüstert Isla und bleibt stehen.
Ich folge ihrem Blick. Hinter den kahlen Ästen einer Eiche flackert ein bernsteinfarbenes Licht. Es scheint aus einem der oberen Fenster von Buchan Manor zu kommen, aus einem Arbeitszimmer, das seit Jahren leer steht.
„Das ist ein richtiges Spukschloss“, behauptet Isla leise. „Meine Kollegin Betsy ist mit einem Diener in Buchan Manor befreundet. Er behauptet, dass die Zimmer im rechten Flügel leer stehen, seit die erste Lady Buchan gestorben ist. Aber manchmal hört er dort oben Schritte, obwohl alles verriegelt ist. “
Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Wir gehen weiter. Das Licht bleibt, als würde es uns folgen, schwach, aber stetig. Erst als wir die nächste Straßenecke erreichen, erlischt es plötzlich. Kein Windstoß, kein Schatten, nur Dunkelheit.
„Vielleicht war es nur eine Reflektion“, sage ich, ohne selbst daran zu glauben.
Isla antwortet nicht. Sie zieht den Mantel enger um die Schultern und blickt noch einmal zurück. Ein dumpfer Schlag hallt über die Dächer, in der Ferne wird eine Tür zugeschlagen. Dann wieder Stille.
Kurz darauf steigen wir die schmalen Holzstufen zu unserer Zweizimmerwohnung hinunter.
„Hallo, Mama.“ Ich stelle den Sack Kartoffeln neben die Küchenzeile.
„Hallo, Mädchen.“
Mama steht am Herd und rührt in einem Topf mit Reis. Unsere Wohnung liegt im Souterrain eines alten Hauses, das bis unters Dach von Familien bewohnt wird. Zu viele Menschen, zu wenig Platz. Wer eintritt, steht sofort mitten im Raum: Küche, Toilette, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer in einem. Rechts von der Küchenzeile sind zwei Alkoven in die Wand eingelassen. Unter dem kleinen Kreuzfenster steht der Holztisch mit sechs Stühlen, die noch aus unserem Haus in Skene stammen. Über der Küchenzeile hängt Omas gesticktes Bild: Zuhause ist es am schönsten. Sie hatte darauf bestanden.
Hinter dem Hauptraum liegt das kleine Schlafzimmer, das Mama mit Großmutter teilt. Die Decke ist so niedrig, dass selbst ich den Kopf einziehen muss. Neben dem Eingang steht ein Eimer mit Deckel, unsere Toilette. Der Geruch ist süßlich und stechend, eine Mischung aus Fäulnis und Scham. Nur freitags kommt der Müllmann, den die Aberdeener spöttisch „Kanalgräber“ nennen.
Mama hantiert in der Küchenzeile, Rory und Ewan sitzen mit gewaschenen Händen am Tisch und spielen Dame. Großmutter starrt vor sich hin. In letzter Zeit ist sie nur noch körperlich hier, ihr Geist wandert durch Nebel, dorthin, wo Vater und Großvater sind.
„Was ist mit euch passiert?“ Mama hebt den Kopf. „Ihr stinkt zum Himmel.“
Dann sieht sie die Säcke. „Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr beim Überfall auf das Boot dabei wart? Die Polizei wird gleich kommen!“
„Mach dir keine Sorgen, Mama.“ Isla sinkt auf den Stuhl neben Rory, verschiebt einen Stein auf dem Brett. „Weißt du, wie viele Frauen das waren? Die können uns unmöglich alle verhaften.“
Mama trocknet die Hände am Geschirrtuch, wirft einen Blick in die Säcke. „Ich bin nicht einverstanden, dass ihr stehlt“, schimpft sie, füllt aber gleichzeitig Wasser in einen Topf, greift nach einem Messer und setzt sich an den Tisch. „Ihr wisst, was die Bibel dazu sagt.“
Isla rollt mit den Augen. „Diese Kartoffeln wurden uns gestohlen, Mama. Wir holen uns nur zurück, was uns gehört.“
„Von dir hätte ich das nicht erwartet, Maisie. Du bist die Älteste.
Du solltest es besser wissen.“
Mama sieht mich an, als hätten wir eine Bank ausgeraubt. Meine Füße schmerzen in den zu kleinen Schnürstiefeln, die mir die Kirche gegeben hat. Ich ziehe sie aus, setze mich neben Großmutter.
„Es sind nur Kartoffeln, Mama“, sage ich, als müsste ich mich selbst überzeugen. Doch ich erinnere mich an den Stadtrat, der angekündigt hat, „gegen die brutale Kriminalität am Fluss Dee härter vorzugehen“. Niemand spricht vom Hunger.
Mama zuckt die Schultern, schält weiter. „So geht das nicht. Wir sind arm, aber anständig. So habe ich euch nicht erzogen.“ Die Schalen fallen in langen Locken auf Zeitungspapier.
Ich warte auf Islas bissige Antwort, doch sie bleibt aus. Ihr Gesicht ist bleich, die Wangen glühen, ihre Atmung ist flach.
„Geht es dir nicht gut, Isla?“
„Doch, doch.“ Sie hustet in die Faust.
Mama legt ihr die Hand auf die Stirn. „Du glühst ja, Kind! Du hast Fieber.“
„Ach was“, seufzt Isla. „Es ist heiß heute, und ich bin mit einem Sack Kartoffeln gerannt. Ich bin nur verschwitzt.“
„Du hustest schon seit Tagen, Isla“, sage ich.
Mama nickt. „Ich möchte, dass du zum Arzt gehst.“
Isla winkt ab. „Es ist nur eine kleine Grippe.“
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. „Grippe? Mitten im Sommer?“
„Warum nicht?“, murmelt sie.
Mama lässt eine geschälte Kartoffel in den Topf gleiten und lächelt schwach. „Isla ist eigensinnig. Das liegt an ihren schottischen Wurzeln.“
Meine Mutter stammt aus einem kleinen Dorf im Norden Schottlands. Ihre Eltern besaßen dort einen Gutshof, so wurde es mir erzählt. Gesehen habe ich ihn nie.
Als sie meinen Vater kennenlernte und ihn heiraten wollte, lehnten meine reformierten Großeltern die Verbindung entschieden ab. Nicht nur, weil mein Vater Katholik war, sondern weil seine Eltern eine Kneipe am Dee führten. Für sie war das Schande genug.
„Eine Tochter aus gutem Haus“, sagten sie, „heiratet nicht in eine Familie, die ihr Geld mit Seeleuten und Huren verdient.“ Von da an herrschte Schweigen.
Meine Eltern zogen nach Skene. Mein Vater fand Arbeit als Büroangestellter bei einer Schiffsbaufirma, anständig, bescheiden, aber
nicht genug, um meine Großeltern umzustimmen. Zehn Monate nach der Hochzeit wurde ich geboren, eineinhalb Jahre später Isla und erst sieben Jahre danach die Zwillinge Rory und Ewan.
Als mein Vater starb, schrieb Mama ihren Eltern erneut. Der Brief kam nicht zurück, aber eine Antwort blieb aus.
Großmutter tobte. „Wie kann man sein eigenes Kind so im Stich lassen?“
„Das sind stolze Schotten, Mama“, antwortete meine Mutter nur leise.
Selbst als sie Jahre später Onkel Allister heiratete und meine Großeltern zur Hochzeit einlud, blieb es still. Kein Brief, kein Wort. Auch nicht, als sie erneut Witwe wurde.
Manchmal sehe ich sie am Fenster stehen, den Blick in die Ferne gerichtet, dorthin, wo die See liegt. Ich glaube, wenn ihre Eltern jetzt vor der Tür stünden, würde sie sie ohne Zögern in die Arme schließen.
„Maisie ist wie ich“, sagt sie oft. „Wir hassen Streit. Wir wollen immer, dass Frieden herrscht.“
Vielleicht hat Isla recht. Vielleicht wollen wir einfach zu sehr gemocht werden.
Ein dumpfer Schlag hallt durch die Wohnung. Er ist nicht laut, aber in dem niedrigen Raum vibriert er durch die Wände. Mama hält inne, das Messer in der Hand. Ein Tropfen Wasser fällt vom Schälmesser auf den Boden.
„War das…?“ Sie sagt den Satz nicht zu Ende.
Wieder ein Klopfen, diesmal deutlicher, drei feste Schläge. Rory und Ewan sehen sich erschrocken an. Isla versucht, ruhig zu bleiben, doch ihre Finger krallen sich um die Stuhlkante. Mama steht langsam auf, wischt sich die Hände am Schürzenrand ab.
„Bleibt hier“, sagt sie leise.
Ich stehe ebenfalls auf. „Vielleicht ist es nur Mrs. Stendhall, die Nachbarin“, flüstere ich.
Doch in Wahrheit glaube ich das nicht. Das dritte Klopfen ist schwer, fordernd. Kein Nachbar klopft so. Mama geht zur Tür. Der Eimer neben dem Eingang schwankt leicht. Sie legt die Hand auf den Riegel, zögert, dann öffnet sie.
Zwei Männer stehen am Eingang. Uniformen, braun-grün, das Licht der Laterne spiegelt sich auf ihren Knöpfen.
Der Ältere hebt eine Augenbraue. „Mrs. Simon?“
Mama nickt, ihre Stimme kaum hörbar. „Ja?“
„Wir suchen zwei Frauen, rothaarig, Dienstmädchen. Man hat sie bei einem Diebstahl am Hafen gesehen.“ Eine Pause. „Können wir eintreten?“
Isla stößt leise den Atem aus. Mama sagt nichts. Mein Herz hämmert.
„Natürlich“, sagt sie schließlich, und ihre Stimme ist so ruhig, dass sie mir Angst macht.
Zehn Minuten später fällt die Tür wieder hinter ihnen ins Schloss, dumpf wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Ich halte immer noch den Atem an. Erst, als ihre Schritte auf der Treppe verhallen, merke ich, dass ich meine Hände zu Fäusten geballt habe.
„Was hast du gesagt, Mama?“ frage ich heiser.
Sie dreht sich zu mir um. Ihre Schultern sind eingesunken, die Schürze feucht vom kalten Abwaschwasser.
„Dass ich keine Ahnung habe, wovon sie reden und meine Töchter mit hohem Fieber im Bett liegen“, antwortet sie leise.
„Und sie haben dir geglaubt?“
Sie nickt zögernd. „Ich denke schon.“
Isla steht noch immer am Tisch, bleich, den Blick auf die Tür gerichtet, als würde sie erwarten, dass sie sich gleich wieder öffnet.
„Sie wissen, wo wir wohnen“, flüstere ich. „Sie werden wiederkommen.“
Mama presst die Lippen zusammen, geht zum Herd und rührt im Topf, als könne sie mit dieser Bewegung die Normalität heraufbeschwören. Der Löffel klappert gegen das Blech.
„Dann werden wir eben warten“, sagt sie. „und hoffen, dass sie andere finden, die sich schlechter verstecken.“
Ich sehe zu Isla hinüber. Sie steht reglos da, die Hände flach auf dem Tisch. Draußen ertönt eine ferne Sirene. Der Geruch von feuchtem Stein und kaltem Rauch dringt durch das kleine Fenster herein.
Ein Unbehagen zieht sich durch meine Brust. Keine Angst, eher eine Ahnung. Etwas hat begonnen in dieser Nacht am Fluss.
Kapitel 5
Maisie
In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Das Wasser tropft leise in den Eimer neben der Tür. Der Wind streicht mit langen Fingern über das Mauerwerk, als wolle er hineingelangen. Der Reis auf dem Herd ist längst kalt geworden. Nur das Ticken der Uhr über der Küchenzeile füllt geduldig, unnachgiebig den Raum.
Isla atmet unruhig im Alkoven, wirft sich hin und her. Ihre Wangen glühen. Hin und wieder entweicht ihr ein leises Stöhnen. Mama hat feuchte Tücher auf ihre Stirn gelegt, doch sie helfen kaum. Ich sehe, wie der Schein der kleinen Petroleumlampe ihr Gesicht golden färbt und wie Schweißperlen auf ihrer Oberlippe glänzen.
Ich setze mich ans Fenster, öffne es einen Spalt. Kalte Nachtluft dringt herein. Draußen liegt Aberdeen still und schwer. Die Häuser ducken sich unter die Dunkelheit, nur vereinzelte Lichter glimmen in den Fenstern. Über dem Fluss zieht sich Nebel zusammen, dichte, bewegliche Schwaden kreisen die Stadt ein.
Mein Blick wandert unwillkürlich nach oben zu dem Teil des Hügels, auf dem Buchan Manor steht. Selbst von hier unten, zwischen den engen Häusern des Arbeiterviertels, kann ich die Turmspitzen erkennen – schwarz und scharf gegen den Himmel gezeichnet. Kein Licht brennt, kein Rauch steigt auf, und doch habe ich das Gefühl, dass dort etwas wach ist. Ebenso gestern, als ich einen Laut vernahm, kaum hörbar, wie Schritte über alte Dielen. Ich halte den Atem an. Vielleicht war es nur Einbildung. Oder der Wind.
Gerade als ich das Fenster schließen will, huscht ein Schimmer über eines der Turmfenster. Kein heller Schein, nur ein matter, goldener Hauch, wie von einer fernen Kerze und dieselbe Spiegelung, die ich am Abend zuvor gesehen habe.
Ich neige mich hinaus, um besser sehen zu können. Mein Herz klopft. Das Licht bewegt sich, flackert, als würde jemand damit durch den Raum gehen. Doch ich sehe keinen Schatten, kein Gesicht, nur ein kurzes Aufflackern und Verlöschen, ein Atemzug hinter den schweren Vorhängen. Und dann, für den Bruchteil eines Augenblicks, spiegelt sich im Glas der schwache Umriss einer Frau in einem weißen Nachthemd, still, beinahe durchsichtig, als bestünde sie nur aus Erinnerung.
Ich blinzle, dann ist die fort. Nur Dunkelheit bleibt zurück.
„Maisie?“
Ich fahre herum. Mama steht hinter mir, das Gesicht halb im Dunkeln. Ihr Haar ist gelöst und fällt ihr über die Schultern. „Was machst du da?“
„Das Licht“, flüstere ich. „In Buchan Manor. Siehst du es?“