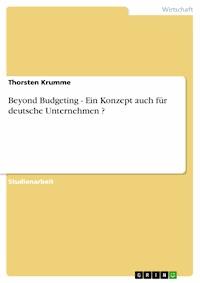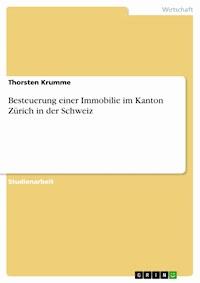0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,7, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen, Sprache: Deutsch, Abstract: In den nächsten Jahren stehen zahlreiche Übertragungen von Unternehmensvermögen an, die durch die Gründergeneration der Nachkriegszeit geschaffen wurden. Dies hat zur Folge, dass sich sowohl die Bedeutung als auch das Aufkommen der vermögensbezogenen Erbschaftsteuer weiter erhöhen wird. Der Anteil der Erbschaftsteuer an den Gesamtsteuereinnahmen betrug im Jahr 2005 zwar nur ca. 1 %, es ist aber ein stetiger Anstieg des Erbschaftsteueraufkommens von 773 Mio. € im Jahr 1985 über 1.814 Mio € im Jahr 1995 auf 4.097 Mio € im Jahr 2005 zu beobachten. Auch wenn eine Vielzahl von erheblichen Privatvermögen vererbt wird, ist zu beobachten, dass sich in der Mehrzahl der Fälle der gewichtigste Teil der vererbten mittleren und großen Vermögen aus unternehmerischem Vermögen zusammensetzt. Mit der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft gibt es immer mehr Steuerpflichtige, die Auslandsvermögen in Form von Grundbesitz oder Unternehmensvermögen haben. Die Bruttoauslandsaktiva deutscher Unternehmen und Privatpersonen betrug im Juni 2003 ca. 1,6 Billionen €. Bei einem deutschen Unternehmen mit Vermögen im Ausland besteht bei der Vererbung die Gefahr, dass durch den Übergang des unternehmerischen Vermögens neben der deutschen Erbschaftsteuerpflicht auch eine ausländische Steuerpflicht entsteht. Hieraus kann eine Doppelbesteuerung des Vermögens resultieren, die negative finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen für die Erben und die Fortführung des Unternehmens haben kann. Im Rahmen der internationalen Erbschaftsteuerplanung ist die Wahl der Rechtsform des Unternehmens ein wichtiges Gestaltungsinstrument, weil die Rechtsformwahl eines deutschen Unternehmens neben der Höhe der inländischen Erbschaftsteuerbelastung auch die Entstehung einer ausländischen Erbschaftsteuerpflicht für das übergehende Unternehmensvermögen beeinflusst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 4
Page 1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
In den nächsten Jahren stehen zahlreiche Übertragungen von
Unternehmensvermögen an, die durch die Gründergeneration der Nachkriegszeit geschaffen wurden1. Dies hat zur Folge, dass sich sowohl die Bedeutung als auch das Aufkommen der vermögensbezogenen Erbschaftsteuer weiter erhöhen wird2. Der Anteil der Erbschaftsteuer an den Gesamtsteuereinnahmen betrug im Jahr 2005 zwar nur ca. 1 %, es ist aber ein stetiger Anstieg des Erbschaftsteueraufkommens von 773 Mio. € im Jahr 1985 über 1.814 Mio € im Jahr 1995 auf 4.097 Mio € im Jahr 2005 zu beobachten3.
Auch wenn eine Vielzahl von erheblichen Privatvermögen vererbt wird, ist zu beobachten, dass sich in der Mehrzahl der Fälle der gewichtigste Teil der vererbten mittleren und großen Vermögen aus unternehmerischem Vermögen zusammensetzt4. Mit der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft gibt es immer mehr Steuerpflichtige, die Auslandsvermögen in Form von Grundbesitz oder Unternehmensvermögen haben5. Die Bruttoauslandsaktiva deutscher Unternehmen und Privatpersonen betrug im Juni 2003 ca. 1,6 Billionen €6.
Bei einem deutschen Unternehmen mit Vermögen im Ausland besteht bei der Vererbung die Gefahr, dass durch den Übergang des unternehmerischen Vermögens neben der deutschen Erbschaftsteuerpflicht auch eine ausländische Steuerpflicht entsteht. Hieraus kann eine Doppelbesteuerung des Vermögens resultieren, die negative finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen für die Erben und die Fortführung des Unternehmens haben kann.
1Vgl. Klein-Blenkers, ZEV 2001, S. 329.
2Vgl. Arlt, Internationale Erbschaft- und Schenkungsteuerplanung, S. 1.
3Vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Januar 1994, S. 72 und Monatsbericht Juni 2006, S. 54.
4Vgl. Crezelius, Unternehmenserbrecht, S. 1.
5Vgl. Plewka/Watrin, ZEV 2002, S. 253.
6Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2004, Tabelle 24.6: Vermögensstatus der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Ausland , S. 765.
Page 2
Im Rahmen der internationalen Erbschaftsteuerplanung ist die Wahl der Rechtsform des Unternehmens ein wichtiges Gestaltungsinstrument, weil die Rechtsformwahl eines deutschen Unternehmens neben der Höhe der inländischen Erbschaftsteuerbelastung auch die Entstehung einer ausländischen
Erbschaftsteuerpflicht für das übergehende Unternehmensvermögen beeinflusst.
In dieser Arbeit sollen die Auswirkungen auf die deutsche und die ausländische Erbschaftsteuerbelastung eines international tätigen Unternehmens aufgezeigt werden, die aus der Rechtsformwahl resultieren können. Aufgrund der Vielzahl der Einflussfaktoren auf die Erbschaftsteuerbelastung und der Vielzahl der ausländischen Steuersysteme gibt es bei einem international tätigen Unternehmen keine Rechtsform, die als „die“ erbschaftsteuerlich optimale Rechtsform bezeichnet werden kann. Anhand der Länderbeispiele Schweiz und Österreich soll analysiert werden, welche Rechtform aus erbschaftsteuerlicher Sicht für ein Unternehmen in Deutschland gewählt werden sollte, das in der Schweiz oder in Österreich unternehmerisches Vermögen besitzt.
Zunächst wird in der vorliegenden Arbeit auf die Grundlagen der internationalen Erbschaftsteuerplanung eingegangen. Nach der Begriffsbestimmung werden die Ziele und Gestaltungsprobleme der internationalen Erbschaftsteuerplanung aufgezeigt. Es erfolgt eine Abgrenzung der Rechtsformwahl als
Gestaltungsinstrument gegenüber anderen Instrumenten.
Im dritten Abschnitt wird auf die Besteuerung der unterschiedlichen Rechtformen im deutschen Erbschaftsteuergesetz eingegangen, um dadurch die
Belastungsunterscheide der verschiedenen Rechtsformen aufzuzeigen, die sich durch die Wertermittlung und die Bewertungsvergünstigungen ergeben können. Zudem wird ein Überblick über die persönlichen Freibeträge und den Steuertarif gegeben.
Um die mögliche ausländische Erbschaftsteuerbelastung eines deutschen Unternehmens mit Vermögen im Ausland abschätzen zu können, werden im nächsten Abschnitt die Grundlagen der Erbschaftsteuergesetze der Schweiz und Österreichs erläutert. In der Schweiz wird die Erbschaftsteuer nicht auf
Page 3
Bundesebene, sondern auf Ebene der Kantone erhoben. Es erfolgt daher exemplarisch eine Betrachtung des Erbschaftsteuergesetzes des Kantons Zürich.
Im fünften Abschnitt wird auf die Ursachen der internationalen Doppelbesteuerung und die möglichen unilateralen und bilateralen Maßnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eingegangen. Hierbei werden die Grundlagen der von Deutschland mit der Schweiz und Österreich geschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Erbschaftsteuern erläutert. Zudem werden die möglichen Qualifikationskonflikte aufgezeigt, die bei einer Übertragung von Personengesellschaften entstehen können.
Aufbauend auf die vorgenannten Abschnitte erfolgt in den Abschnitten sechs (Schweiz) und sieben (Österreich) die Analyse, wie die Rechtsformwahl als Instrument der internationalen Erbschaftsteuerplanung genutzt werden kann. Zunächst wird auf die Zuteilung der Besteuerungsrechte in Abhängigkeit der Rechtsform der deutschen Spitzeneinheit eingegangen und es erfolgt eine Analyse der rechtsformabhängigen Besteuerungsunterschiede. Hierauf aufbauend werden Gestaltungsempfehlungen für die Rechtsformwahl eines deutschen Unternehmens mit Vermögen in der Schweiz und Österreich gegeben. Die vorliegende Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
1.2 Abgrenzungen
Es werden folgende Annahmen für die Bearbeitung der vorliegenden Arbeit getroffen:
•Bei dem Erblasser und den Erben des Unternehmensvermögens handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, die auch in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Eine Wohnsitzverlagerung der beteiligten Personen ins Ausland kommt nicht in Betracht. Es wird im Rahmen dieser Arbeit von einem Familienunternehmen ausgegangen, bei dem natürliche Personen durch Eigentumsrechte maßgeblichen Einfluss ausüben können, da börsennotierte Großunternehmen die
Page 4
Erbschaftsteuerbelastung einzelner Kleinaktionäre bei ihren unternehmerischen Entscheidungen weitgehend unberücksichtigt lassen7.
•Das Unternehmen verfügt über in- und ausländisches Vermögen und hat seinen Sitz bzw. die Geschäftsleitung in Deutschland. Das ausländischen Vermögen des Unternehmens befindet sich in der Schweiz oder in Österreich. Das Vermögen des Familienunternehmens wird erst nach dem Tod des Unternehmers unentgeltlich auf die Nachfolger übertragen, so dass schenkungsteuerliche Aspekte im Rahmen dieser Arbeit nicht zu beachten sind.
•Bei der Durchführung der internationalen Erbschaftsteuerplanung sind auch die relevanten zivilrechtlichen Vorschriften zu beachten8. Ebenso sind bei einer Übertragung von Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften gesellschaftsvertragliche Gestaltungen zu beachten, weil hierdurch bestimmt wird, unter welchen Voraussetzungen die Gesellschaftsanteile vererbt werden können9. Auf die vorgenannten zivilrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen wird im Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher eingegangen.
•Die Wahl der Rechtsform wird nicht nur von erbschaftsteuerlichen, sondern auch von ertragsteuerlichen Überlegungen beeinflusst10. Im Umfang dieser Arbeit wird aber nur auf die erbschaftsteuerlichen Konsequenzen der Rechtsformwahl eingegangen.
•Die Bundesregierung plant zur Zeit eine Reform der Erbschaftsteuer. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf die geplante Erbschaftsteuerreform nicht näher eingegangen, weil die Art und Weise sowie der Umfang der Erbschaftsteuerreform noch nicht hinreichend bekannt ist11.
7Vgl. Watrin, Erbschaftsteuerplanung internationaler Familienunternehmen, S. 11.
8Vgl. Arlt, Internationale Erbschaft- und Schenkungsteuerplanung, S. 15.
9Vgl. Streck/Schwedhelm/Olbing, Deutsches Steuerrecht 1994, S. 1444 u. 1448.
10Vgl. Heinz, GmbH-Rundschau 2001, S. 488.
11Vgl. Hannes/Onderka/von Oertzen, ZEV 2006, S. 131.
Page 5
2 Internationale Erbschaftsteuerplanung
2.1 Begriffsbestimmungen
Der Generationenwechsel in einem Unternehmen bedarf einer erbschaftsteuerlichen Planung, weil der mit der Erbschaftsteuer verbundene Liquiditätsabfluss erhebliche finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen auf den einzelnen Steuerpflichtigen und sein Unternehmen haben kann12. Die Erbschaftsteuerplanung ist eine Teilaufgabe der umfassenden Steuerplanung eines Unternehmens13. Bei der Erbschaftsteuerplanung handelt es sich nicht nur um eine strategische Unternehmensplanung, sondern auch gleichzeitig um eine Finanz- und Lebensplanung der beteiligten natürlichen Personen14. Die Steuerplanung kann als ein Prozess des Formulierens steuerpolitischer Ziele, des Untersuchens der Steuerwirkungen von Handlungsalternativen und der Auswahl sowie der Realisierung der steueroptimalen Alternative verstanden werden15.