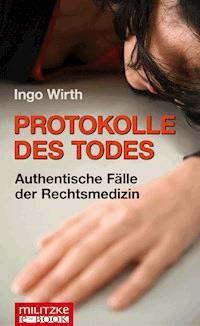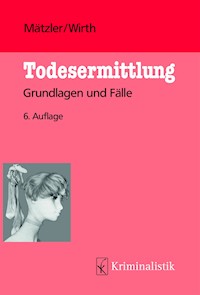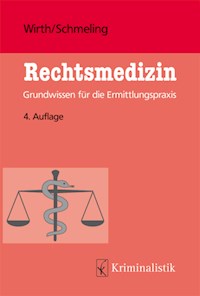
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kriminalistik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Grundlagen der Kriminalistik
- Sprache: Deutsch
Der Inhalt: Es ist das Anliegen des Buches, dem Ermittlungsbeamten wie auch dem Juristen für ihre praktische Tätigkeit die notwendigen Grundkenntnisse aus dem medizinischen Spezialfach Rechtsmedizin zu vermitteln. Das Wissen ist erforderlich, um Möglichkeiten und Grenzen rechtsmedizinischer Arbeitsweisen verstehen zu können. Der Schwerpunkt liegt auf der Auswertung rechtsmedizinischer Befundberichte für Ermittlungszwecke und dem Zusammenwirken von Ermittlern und Rechtsmedizinern im Interesse der Rechtssicherheit. Die kriminalistisch bedeutsamen Aufgabengebiete der Rechtsmedizin werden allgemeinverständlich dargestellt. Der Inhalt orientiert sich an den Anforderungen der Ermittlungspraxis und wurde mit dieser Neuauflage entsprechend aktualisiert. Beschrieben werden unter anderem Sterben, Tod und Leichenuntersuchung, Ursachen gewaltsamer Todesfälle, tödliche Verkehrsunfälle, Vergiftungen und psychoaktive Substanzen, Identifizierung unbekannter Toter, körperliche Untersuchung lebender Personen und rechtsmedizinische Spurenanalyse, insbesondere DNS-Analytik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rechtsmedizin
Grundwissen für die Ermittlungspraxis
Von
Prof. Dr. med. Dr. phil. Ingo WirthBerlin
und
Prof. Dr. med. Andreas Schmeling, M. A.Institut für Rechtsmedizin Universitätsklinikum Münster
Mitbegründet vonProf. Dr. med. Hansjürg Strauch †
4., neu bearbeitete Auflage
www.kriminalistik.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-7832-0755-2
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.kriminalistik.de
www.cfmueller.de
© 2020 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Der Band „Rechtsmedizin. Grundwissen für die Ermittlungspraxis“ erscheint 20 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung nun in 4. Auflage. Mit dieser Bilanz darf das spezielle Konzept des Buches, dem Ermittlungsbeamten und auch dem Juristen die nötigen Grundkenntnisse aus der Rechtsmedizin zu vermitteln, als erfolgreich bezeichnet werden.
Für die vorliegende Neuauflage war wiederum die rasche Entwicklung in einigen Teilgebieten des Faches zu berücksichtigen. Nach wie vor erweist sich der Fortschritt in der Molekularbiologie als außerordentlich förderlich für die rechtsmedizinische Spurenuntersuchung. Hierbei sind insbesondere die weiter erhöhte Aussagekraft der DNS-Identifizierung und die verfeinerten Techniken für die Analyse von Problemspuren zu nennen. Auch im Vergiftungskapitel waren zahlreiche Ergänzungen erforderlich. Von den neuen psychoaktiven Substanzen, die Jahr für Jahr den illegalen Drogenmarkt überschwemmen, haben sich einige besonders rasch verbreitet. Diese Drogen mussten hinsichtlich ihrer Konsumformen, Wirkungen und Gefahren beschrieben werden, um deren Erkennung im polizeilichen Alltag zu ermöglichen. Nicht zuletzt konnten zu den Folgen äußerer Gewalteinwirkung einige neue Erkenntnisse hinzugefügt werden. Durchweg wurden auch die einschlägigen rechtlichen Regelungen aktualisiert und ergänzt.
Es bleibt unser erklärtes Ziel, mit diesem Band das Zusammenwirken von Ermittlern und Rechtsmedizinern im Interesse der Rechtssicherheit weiter zu fördern.
Berlin und Münster, im Januar 2020
Ingo WirthAndreas Schmeling
Vorwort zur ersten Auflage
Das Zusammenwirken des Kriminalisten mit dem Rechtsmediziner hat sich besonders bei der Untersuchung von Tötungsdelikten und verdächtigen Todesfällen seit Langem bewährt. Um effektiv miteinander zu arbeiten, müssen beide über Grundkenntnisse aus dem jeweils anderen Spezialfach verfügen. Für den Kriminalisten ist es wichtig, sich über Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsmedizin zu informieren. Dazu soll der vorliegende Band dienen. Sein Inhalt orientiert sich an den praktischen Belangen kriminalistischer Ermittlungstätigkeit. Deshalb weicht die Gliederung zwangsläufig von solchen rechtsmedizinischen Lehrbüchern ab, deren Konzept dem Gegenstandskatalog für das Examen von Medizinstudenten folgt.
Einige Aufgabenbereiche der Rechtsmedizin, die sich nicht unmittelbar aus dem Strafrecht ableiten, konnten unberücksichtigt bleiben. Beispielsweise wurden das komplexe Gebiet der Vaterschaft, die ärztliche Rechts- und Berufskunde und die Versicherungsmedizin nicht aufgenommen. Die Bezüge zum Recht und zur Kriminaltechnik brauchten nur angedeutet zu werden, weil der Kriminalist über entsprechende Kenntnisse verfügt. Auf Fallbeispiele wurde weitgehend verzichtet. Den Vorrang erhielt die systematische Darstellung der Grundlagen und typischer Erscheinungsbilder. Durchweg wurde versucht, auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der DNS-Analytik hinzuweisen.
Bei weiteren Aufgabenbereichen der Rechtsmedizin wie Toxikologie und Psychopathologie, die sich inzwischen zu umfangreichen Spezialgebieten entwickelt haben, beschränkt sich die Darstellung auf einen Überblick. Für die genannten Fächer gibt es eigene Lehrbücher, von denen einige im Literaturverzeichnis aufgeführt sind. Auch die übrigen Literaturangaben betreffen grundlegende und oft ausführliche Werke mit vertiefenden Informationen für den speziell Interessierten. Zur Illustration wesentlicher Abläufe und Befundmuster konnte vielfach auf die informativen Zeichnungen aus dem „Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin“ von Albert Ponsold zurückgegriffen werden. Ergänzend sind rechtsmedizinische Atlanten zu empfehlen, die charakteristische Spurenbilder am Körper als Folgen äußerer Gewalteinwirkung zeigen.
Das Anliegen des Buches ist es, dem Kriminalisten rechtsmedizinisch relevante Zusammenhänge aufzuzeigen. Dadurch soll das Miteinander von Kriminalisten und Rechtsmedizinern im Interesse einer erfolgreichen Ermittlungstätigkeit weiter gefördert werden.
Berlin, im März 2000
Ingo WirthHansjürg Strauch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur ersten Auflage
Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
I.Rechtsmedizin und Kriminalistik
II.Tod und Leichenuntersuchung
1.Ablauf des Sterbens
2.Frühe Leichenveränderungen
2.1Totenflecke
2.2Totenstarre
2.3Erkalten der Leiche
3.Späte Leichenveränderungen
3.1Fäulnis und Verwesung
3.2Tierfraß
3.3Konservierende Leichenveränderungen
4.Ärztliche Leichenschau
4.1Feststellung des Todes
4.2Schätzung der Todeszeit
4.3Feststellung der Todesursache
4.4Beurteilung der Todesart
4.5Personalienfeststellung bei der Leichenschau
4.6Ausstellen der Todesbescheinigung
4.7Meldepflichten
5.Kriminalistische Leichenuntersuchung
6.Gerichtliche Leichenöffnung
III.Vitale Reaktionen
1.Allgemeine Vitalreaktionen
2.Örtliche Vitalreaktionen
3.Wundaltersschätzung
IV.Gewaltsamer Tod
1.Stumpfe Gewalt
1.1Verletzungen der Haut
1.2Verletzungen von Knochen und Muskeln
1.3Verletzungen innerer Organe
1.4Kopfverletzungen
1.5Sturz aus der Höhe
1.6Faustschläge und Fußtritte
1.7Reanimationsverletzungen
2.Pfählungsverletzungen
3.Scharfe Gewalt
3.1Stichverletzungen
3.2Schnittverletzungen
3.3Hiebverletzungen
4.Ersticken
4.1Erwürgen
4.2Erdrosseln
4.3Erhängen
4.4Andere Erstickungsmechanismen
5.Tod im Wasser
6.Schuss
7.Elektrizität
8.Hohe Temperaturen
9.Niedrige Temperaturen
10.Nahrungsmangel
V.Vergiftungen
1.Begriffe und rechtliche Bestimmungen
2.Vorkommen und Verteilung
3.Toxikokinetik
4.Giftnachweis
5.Anorganische Gifte
5.1Blausäure und ihre Salze
5.2Kohlenmonoxid
5.3Schwefelwasserstoff
5.4Metallgifte
5.4.1Arsen
5.4.2ThalliumThallium
5.4.3Blei
5.4.4Quecksilber
5.5Nitrate und Nitrite
5.6Säuren und Laugen
5.6.1Säuren
5.6.2Laugen
6.Organische Gifte
6.1Alkohole
6.1.1Ethanol
6.1.2Methanol
6.2Illegale Drogen
6.2.1Cannabinoide
6.2.2LSD
6.2.3Heroin
6.2.4Cocain
6.2.5Amphetaminderivate
6.3Medikamente
6.4Desinfektionsmittel
6.4.1Formaldehyd
6.4.2Phenole
6.4.3Chlor
6.4.4Jod
6.5Lösungsmittel
6.6Schädlingsbekämpfungsmittel
6.6.1Herbizide
6.6.2Insektizide
6.6.3Rodentizide
6.7Pflanzliche Gifte
6.8Tierische Gifte
6.9Nahrungsmittel
7.Doping
8.Kriminalistische Aspekte bei Vergiftungen
VI.Illegaler Schwangerschaftsabbruch
VII.Neugeborenenleichen
VIII.Tod im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen
IX.Plötzlicher Tod aus natürlicher Ursache
1.Plötzliche Todesfälle im Erwachsenenalter
2.Plötzlicher Tod im frühen Kindesalter
X.Identifizierung unbekannter Toter
1.Rechtsmedizinische Identifizierungsmethoden
1.1Leichenschau und Leichenöffnung
1.2Odontologischer Vergleich
1.3Röntgenbildvergleich
1.4Knochenuntersuchung
2.Leichenzerstückelung und Leichenbeseitigung
3.Leichenidentifizierung nach Katastrophen
3.1Erste Etappe: Bergung von Leichen und Leichenteilen
3.2Zweite Etappe: Datenerhebung
3.3Dritte Etappe: Datenvergleich
XI.Rechtsmedizinische Untersuchung biologischer Spuren
1.Forensische DNS-Analytik
2.Blut
3.Sekrete
4.Haare
5.Körpergewebe und Ausscheidungen
5.1Haut
5.2Weichteilgewebe
5.3Knochen und Zähne
5.4Ausscheidungen
XII.Tödliche Verkehrsunfälle
1.Straßenverkehr
1.1Fußgängerunfall
1.2Insassenunfall
1.3Zweiradunfall
2.Bahnverkehr
3.Luftverkehr
4.Schiffsverkehr
XIII.Körperliche Untersuchung lebender Personen
1.Ärztliche Untersuchungsmethoden
2.Verletzungen als Folgen fremder Gewalteinwirkung
3.Sexuelle Gewaltdelikte
4.Kindesmisshandlung
5.Selbstbeschädigung
6.Altersschätzung
7.Drogenabhängigkeit
XIV.Strafrechtlich bedeutsame Aspekte der Psychopathologie
1.Vernehmungsfähigkeit
2.Gewahrsamstauglichkeit und Haftfähigkeit
3.Schuldfähigkeit
4.Unterbringung
XV.Kurze Geschichte der Rechtsmedizin
1.Akademische Lehre
2.Wissenschaftsentwicklung
3.Fachzeitschriften
4.Fachgesellschaft
5.Rechtsmedizinische Praxis
Literaturverzeichnis
Brinkmann, B., Madea, B. (Hrsg.): Handbuch gerichtliche Medizin, Bd. 1, 2004.
Brinkmann, B., Raem, A. M. (Hrsg.): Leichenschau. Leitlinien zur Qualitätssicherung, 2007.
Eisen, G. (Hrsg.): Handwörterbuch der Rechtsmedizin, Bd. 1–3, 1973–1977.
Forster, B. (Hrsg.): Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen, 1986.
Forster, B., Ropohl, D.: Medizinische Kriminalistik am Tatort. Ein Leitfaden für Ärzte, Polizeibeamte und Juristen, 1983.
Gaedke, J., Diefenbach, J., Barthel, T. F.: Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts. 12. Aufl., 2019.
Grassberger, M., Schmid, H.: Todesermittlung. Befundaufnahme und Spurensicherung. 2. Aufl., 2014.
Grassberger, M., Türk, E. E., Yen, K. (Hrsg.): Klinisch-forensische Medizin. Interdisziplinärer Praxisleitfaden für Ärzte, Pflegekräfte, Juristen und Betreuer von Gewaltopfern, 2013.
Hammer, U., Büttner, A.: Leichenschau. Differenzialdiagnostik häufiger Befunde, 2014.
Henßge, C., Madea, B.: Methoden zur Bestimmung der Todeszeit an Leichen, 1988.
Hildebrand, E., Hitzer, K., Püschel, K.: Simulation und Selbstbeschädigung unter besonderer Berücksichtigung des Versicherungsbetrugs, 2001.
Hunger, H., Dürwald, W., Tröger, H. D. (Hrsg.): Lexikon der Rechtsmedizin, 1993.
Kimpel, T.: Leichensachen und Leichenöffnung. Eine strafprozessuale Studie zu den §§ 159, 87 ff. StPO unter besonderer Berücksichtigung von Kriminalistik und Geschichte, 1986.
Kneubuehl, B. P., Coupland, R. M., Rothschild, M. A., Thali, M. J. (Hrsg.): Wundballistik. Grundlagen und Anwendungen. 3. Aufl., 2008.
Kojda, G.: Pharmakologie/Toxikologie systematisch. 2. Aufl., 2002.
Konrad, N., Huchzermeier, C., Rasch, W.: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Rechtsgrundlagen, Begutachtung und Praxis. 5. Aufl., 2019.
Krause, D., Schneider, V., Blaha, R.: Leichenschau am Fundort. Ein rechtsmedizinischer Leitfaden. 4. Aufl., 1998.
Leopold, D. (Hrsg.): Identifikation unbekannter Toter. Interdisziplinäre Methodik, forensische Osteologie, 1998.
Lohs, K., Elstner, P., Stephan, U. (Hrsg.): Fachlexikon Toxikologie. 4. Aufl., 2009.
Madea, B. (Hrsg.): Die ärztliche Leichenschau. Rechtsgrundlagen, Praktische Durchführung, Problemlösungen. 4. Aufl., 2019.
Madea, B. (Hrsg.): Rechtsmedizin. Befunderhebung, Rekonstruktion, Begutachtung. 3. Aufl., 2015.
Madea, B., Brinkmann, B. (Hrsg.): Handbuch gerichtliche Medizin, Bd. 2., 2003.
Madea, B., Mußhoff, F., Berghaus, G. (Hrsg.): Verkehrsmedizin. Fahreignung, Fahrsicherheit, Unfallrekonstruktion. 2. Aufl., 2012.
Mätzler, A., Wirth, I.: Todesermittlung. Grundlagen und Fälle. 5. Aufl., 2016.
Mallach, H. J.: Geschichte der Gerichtlichen Medizin im deutschsprachigen Raum, 1996.
Maresch, W.: Atlas der Gerichtsmedizin, 1988.
Marquardt, H., Schäfer, S. G., Barth, H. (Hrsg.): Toxikologie. 4. Aufl., 2019.
Meissner, C., Kaatsch, H.-J. (Hrsg.): Gift und Giftmord, 2015.
Mueller, B. (Hrsg.): Gerichtliche Medizin. 2. Aufl., 1975.
Müller, J. L., Nedopil, N.: Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht. 5. Aufl., 2017.
Naeve, W.: Gerichtliche Medizin für Polizeibeamte, 1978.
Petersohn, F.: Gerichtliche Medizin I. Grundwissen für den Kriminalisten. 2. Aufl., 1982.
Petersohn, F.: Gerichtliche Medizin II. Bearbeitung von Leichensachen. 2. Aufl., 1982.
Pollak, S., Saukko, P.: Atlas der Rechtsmedizin. CD-ROM, 2003.
Ponsold, A. (Hrsg.): Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. 3. Aufl., 1967.
Prokop, O., Göhler, W.: Forensische Medizin. 3. Aufl., 1975.
Prokop, O., Radam, G.: Atlas der gerichtlichen Medizin. 3. Aufl., 1992.
Reimann, W., Prokop, O., Geserick, G.: Vademecum Gerichtsmedizin. Für Mediziner, Kriminalisten und Juristen. 5. Aufl., 1990.
Ropohl, D.: Die rechtsmedizinische Rekonstruktion von Verkehrsunfällen, 1990.
Schäfer, A. Th.: Untersuchung und Spurensicherung bei Sexualdelikten, 1996.
Schleyer, F., Oepen, I., Henke, J. (Hrsg.): Humanbiologische Spuren. Sicherung, Nachweis und Analyse in Kriminaltechnik und forensischer Medizin, 1995.
Schneider, V.: Farbatlas der Rechtsmedizin, 1991.
Sellier, K.: Schußwaffen und Schußwirkungen I. Ballistik, Medizin und Kriminalistik. 2. Aufl., 1982.
Sellier, K.: Schußentfernungsbestimmung. 2. Aufl., 1988.
Tröger, H. D., Baur, C., Spann, K.-W.: Mageninhalt und Todeszeitbestimmung. Methodik und gerichtsmedizinische Bedeutung, 1987.
Ulsenheimer, K.: Arztstrafrecht in der Praxis. 5. Aufl.,, 2015.
Wirth, I., Schmeling, A.: Kriminelle Leichenzerstückelung. Phänomenologie und Untersuchungsmethodik, 2017.
Abbildungsnachweis
Die Autoren danken nachfolgend aufgeführten Kollegen und Verlagen für die Genehmigung zum Abdruck von Abbildungen.
[1]
Brückner, H.: Frakturen und Luxationen. 3. Aufl., Berlin: Verlag Volk und Gesundheit, 1978.
[2]
Forster, B. (Hrsg.): Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen. Stuttgart–New York: Georg Thieme Verlag/München: C. H. Beckʼsche Verlagsbuchhandlung, 1986.
[3]
Prof. Dr. med. C. Henßge, Essen.
[4]
Hunger, H., Dürwald, W., Tröger, H. D. (Hrsg.): Lexikon der Rechtsmedizin. Leipzig–Berlin–Heidelberg: Johann Ambrosius Barth/Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 1993.
[5]
Mueller, B. (Hrsg.): Gerichtliche Medizin. 2. Aufl., Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag, 1975.
[6]
Patscheider, H., Hartmann, H.: Leitfaden der Gerichtsmedizin. Bern–Stuttgart–Wien: Verlag Hans Huber, 1981.
[7]
Patscheider, H., Hartmann, H.: Leitfaden der Rechtsmedizin. 3. Aufl., Bern–Göttingen–Toronto–Seattle: Verlag Hans Huber, 1993.
[8]
Petersohn, F.: Gerichtliche Medizin II. Bearbeitung von Leichensachen. 2. Aufl., Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 1982.
[9]
Ponsold, A.: Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1950.
[10]
Ponsold, A. (Hrsg.): Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. 3. Aufl., Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1967.
[11]
Prokop, O.: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Berlin: Verlag Volk und Gesundheit, 1960.
[12]
Reimann, W., Prokop, O., Geserick, G.: Vademecum Gerichtsmedizin. 5. Aufl., Berlin: Verlag Gesundheit, 1990.
I.Rechtsmedizin und Kriminalistik
Die Rechtsmedizin, auch Gerichtliche Medizin genannt, gehört zu den ältesten Spezialfächern der Medizin und ist durch gemeinsame Aufgaben mit der Kriminalistik eng verbunden. Den Zusammenhang zwischen beiden Wissenschaftsgebieten verdeutlicht die Definition der Rechtsmedizin: Es ist diejenige medizinische Disziplin, „die in Lehre, Forschung und Praxis die Anwendung medizinischer Kenntnisse und Methoden zur Klärung rechtserheblicher Tatbestände zum Inhalt hat“.[1]
Der Rechtsmediziner ist ein Arzt, der nach dem Medizinstudium eine mehrjährige Weiterbildung zum Facharzt absolviert und mit einer Prüfung vor der zuständigen Ärztekammer abschließt. Aufgrund seiner Spezialkenntnisse wird er hauptsächlich für Polizei und Justiz als Sachverständiger tätig. Die Berufsbezeichnungen Rechtsmediziner und Gerichtsarzt werden oft synonym verwendet. Streng genommen, handelt es sich beim Gerichtsarzt jedoch um einen zur Wahrnehmung ärztlicher Tätigkeiten in gerichtlichen Angelegenheiten bestellten Arzt, der nicht zwingend Facharzt für Rechtsmedizin sein muss.
Bedingt durch die Vielfalt ihrer Aufgaben, berührt die Rechtsmedizin praktisch alle Fachgebiete der Medizin. Die Pathologie, speziell die Pathologische Anatomie als Lehre von den krankhaften Organveränderungen, steht der Rechtsmedizin am nächsten. Die Vertreter beider Fachgebiete führen Leichenöffnungen zur Feststellung der Todesursache aus. Dem Pathologen obliegt die Untersuchung natürlicher Todesfälle. Häufige Ursachen sind Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Die Begutachtung nichtnatürlicher Todesfälle ist Aufgabe des Rechtsmediziners. Zum nichtnatürlichen Tod gehören sämtliche durch äußere Gewalteinwirkung bedingte Todesfälle, beispielsweise durch Messerstiche, Erhängen oder Ertrinken, sowie die Vergiftungen.
Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren wesentlichen Unterschied. Der Pathologe arbeitet eng mit klinisch tätigen Ärzten, wie Chirurgen und Internisten, zusammen. Durch die Mitwirkung beim Erkennen und Behandeln von Krankheiten kommen seine Untersuchungsbefunde auch Lebenden zugute. Der Rechtsmediziner hingegen verwendet seine Untersuchungsergebnisse vorrangig für die Rekonstruktion des zum Tod führenden Geschehens. Dazu reicht die Feststellung der Todesursache allein nicht aus. Beispielsweise interessiert bei einem Kopfdurchschuss zwar auch die Frage, ob der Tod unmittelbar durch die Hirnverletzung oder mittelbar durch eine Bluteinatmung verursacht wurde. Viel wichtiger ist es aber, aus den Untersuchungsbefunden Hinweise auf die Schussentfernung, die Schussrichtung und die Handlungsfähigkeit des Getroffenen sowie Anhaltspunkte für eine Selbst- oder Fremdbeibringung abzuleiten. Folglich setzt die Tätigkeit des Rechtsmediziners eine kriminalistische Denk- und Arbeitsweise voraus.
Abhängig von der konkreten Aufgabenstellung werden in der Rechtsmedizin Erkenntnisse und Methoden anderer medizinischer Fachgebiete genutzt. Das gilt besonders für die Traumatologie, die Lehre von den Verletzungen. Die Forensische[2] Traumatologie als Teilgebiet der Rechtsmedizin beschäftigt sich mit dem Zustandekommen und den Folgen mechanisch verursachter Körperschädigungen. Der plötzliche natürliche Tod im Säuglings- und Kleinkindalter führt in den Bereich der Kinderheilkunde. Um Fälle von Abtreibung und verheimlichter Geburt begutachten zu können, muss Wissen aus dem Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe herangezogen werden. Schließlich treten vereinzelt Todesfälle im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen auf. Dann trägt die gerichtliche Leichenöffnung zur Aufklärung der Sachlage bei. Auch wenn der Rechtsmediziner den Todesfall nicht selbst untersucht hat, kann er mit einer Begutachtung nach Aktenlage beauftragt werden.
Manchmal reicht ärztliches Wissen allein nicht aus, um einen Fall vollständig aufzuklären. So kann der Rechtsmediziner aufgrund seiner Kenntnisse der menschlichen Anatomie aus einem Knochenfund all die Skelettteile herausfinden und bestimmen, die vom Menschen stammen. Die Zuordnung von Tierknochen dagegen nimmt der Veterinäranatom vor.
Auch mit den Naturwissenschaften steht die Rechtsmedizin in enger Beziehung. Das betrifft insbesondere die Chemie, denn der Giftnachweis im menschlichen Körper erfolgt vorwiegend mit chemischen Methoden. Das entsprechende Spezialgebiet heißt Toxikologische Chemie, die auch die Alkohol- und Drogenanalytik einschließt. Die Toxikologie ist die Lehre von den Giften und Vergiftungen. Als Teilgebiet der Rechtsmedizin werden die rechtlich bedeutsamen Aspekte von Vergiftungen unter der Bezeichnung Forensische Toxikologie zusammengefasst. Speziell bei Vergiftungen mit Medikamenten ergeben sich wiederum Berührungspunkte zu einem medizinischen Fachgebiet. Es handelt sich um die Pharmakologie, die Lehre von den Arzneimitteln.
Einige Gesetzmäßigkeiten aus der Physik bilden die Grundlage für das Verständnis der Knochenbruchmechanik sowie für die Erklärung von Verletzungen durch Schuss, Elektrizität und Strahlung. Den Wissensbestand der Zoologie nutzt der Rechtsmediziner unter anderem, um die Verursacher von Tierfraß an menschlichen Leichen herauszufinden. Wenn die Herkunft pflanzlicher Bestandteile des Mageninhalts Verstorbener bestimmt werden muss, sind Kenntnisse aus der Botanik notwendig.
Der Rechtsmediziner untersucht nicht nur Leichen, sondern muss auch Lebende nach Straftaten begutachten, beispielsweise nach Schlägereien, Sexualdelikten oder Kindesmisshandlungen. Das Gutachten stützt sich neben den rechtsmedizinischen Untersuchungsergebnissen je nach Sachlage auf Befunde aus anderen medizinischen Fachgebieten, wie Intensivmedizin, Chirurgie, Frauen- oder Kinderheilkunde. Es genügt jedoch nicht, vorhandene Verletzungen am Körper eines Opfers oder eines Tatverdächtigen lediglich festzustellen und nach medizinischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Vielmehr wird vom Rechtsmediziner erwartet, dass er bei der Begutachtung die im Strafrecht vorgeschriebenen Kriterien berücksichtigt. Das Gericht muss sich auf die gesetzesgemäße Interpretation der medizinischen Befunde verlassen können. Aus diesem Grund sind für den Rechtsmediziner fundierte Rechtskenntnisse, besonders des Strafrechts, unverzichtbar.
Die Anwendung medizinischen Wissens im Dienst der Rechtspflege schließt Probleme der Forensischen Psychiatrie ein. Dieses Fach hat seine historischen Wurzeln in der Rechtswissenschaft und in der Rechtsmedizin. Nach heutigem Verständnis ist die Forensische Psychiatrie ein Spezialgebiet der Psychiatrie, das sich mit den fachspezifischen Begutachtungsfragen und mit der Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher befasst. In der Begutachtungspraxis wird das Fach teils durch Psychiater, teils durch speziell ausgebildete Rechtsmediziner vertreten.
Die Grundlage psychiatrischer Beurteilung und psychiatrischen Handelns bildet die Psychopathologie. Wesentliche Aufgaben der Psychopathologie sind die Erkennung und Beschreibung einzelner psychischer Auffälligkeiten und deren Ordnung zu immer wieder beobachtbaren Symptomenkomplexen. Psychopathologische Exploration und Verhaltensbeobachtung gehören zu den grundlegenden Untersuchungsmethoden des forensisch tätigen Psychiaters.
Den wichtigsten Beitrag zur Kriminalistik leistet der Rechtsmediziner durch seine Mitwirkung bei Todesermittlungssachen. Im Idealfall beginnt die Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbeamten und Rechtsmediziner mit der Ereignisortuntersuchung, setzt sich fort bei der gerichtlichen Leichenöffnung mit der gemeinsamen Erörterung von Ermittlungsergebnissen und Obduktionsbefunden und reicht bis zur Bestätigung oder Widerlegung von Aussagen. Bei Tötungsverbrechen ist es unerlässlich, dass der Rechtsmediziner bereits am Tat- oder Fundort mit seinen Untersuchungen beginnt. Von ihm erwarten die Kriminalisten gleich an Ort und Stelle erste Aussagen zur Todeszeit, zur Todesursache und zum Hergang der Tat. Weitere wesentliche Informationen erbringt die gerichtliche Leichenöffnung. Dabei ist die Anwesenheit eines verantwortlichen Ermittlungsbeamten erforderlich. Aus dem Ergebnis der Leichenöffnung können sich Anhaltspunkte für die Rekonstruktion des Tathergangs, für eine weitere Suche und Sicherung von Spuren und Vergleichsmaterial sowie für Vernehmungen ergeben. Die Kenntnis der Tatortsituation erleichtert die Interpretation der Untersuchungsergebnisse und ist durch noch so gute Fotografien nicht zu ersetzen.
Die Rechtsmediziner teilen ihre Auffassung zum untersuchten Todesfall den Ermittlungsbeamten in einem Vorläufigen Gutachten mit. Vorläufig deshalb, weil darin nur der erste Eindruck wiedergegeben werden kann. Ein zusammenfassendes Gutachten ist erst nach Abschluss aller Zusatzuntersuchungen, vor allem mikroskopischer und toxikologischer Untersuchungen, und der kriminalistischen Ermittlungen möglich.
Heute stellt die Mitwirkung des Rechtsmediziners bei der Aufklärung von Tötungsverbrechen eine Selbstverständlichkeit dar. Mindestens genauso wichtig ist es aber, ihn bei unerwarteten und unklaren Todesfällen möglichst frühzeitig hinzuzuziehen. Nach wie vor bildet eine sachkundig und sorgfältig durchgeführte Leichenschau die entscheidende Voraussetzung für die Aufdeckung latenter Tötungsdelikte wie auch anderer nichtnatürlicher Todesfälle.
Für die rechtsmedizinische Rekonstruktion tödlicher Verkehrsunfälle ist die gerichtliche Leichenöffnung die wichtigste Untersuchungsmethode, aber allein nicht ausreichend. Um ein verwertbares rekonstruktives Ergebnis zu erreichen, sollte auf eine Besichtigung des Unfallortes und der Unfallfahrzeuge durch den Rechtsmediziner sowie auf seine Mitwirkung bei der Spurensicherung nicht verzichtet werden.
Im Rahmen der Todesermittlung ist es notwendig, die Identität des Verstorbenen zweifelsfrei festzustellen. Die Identifizierung von Leichen und Leichenteilen erfordert unter bestimmten Umständen die Anwendung rechtsmedizinischer Untersuchungsmethoden. Dabei werden traditionell Erkenntnisse aus der Anatomie, Anthropologie, Zahnheilkunde und Röntgendiagnostik genutzt. Die Identifizierung unbekannter Toter durch den Rechtsmediziner beschränkt sich nicht auf Einzelfälle, sondern er kommt auch nach Katastrophen mit einer Vielzahl von Leichen zum Einsatz.
Die Fortschritte der Molekularbiologie haben das Methodenspektrum von Rechtsmedizin und Kriminalistik außerordentlich erweitert. Aus der DNS-Forschung resultierten nicht nur für die Identifizierung unbekannter Toter neue Möglichkeiten. Weitaus stärker wurde die forensische Spurenuntersuchung durch die Einführung molekularbiologischer Verfahren bereichert. Aufgrund der zunehmenden Verfeinerung der spurenkundlichen Untersuchungsmethoden sind Rechtsmediziner und Kriminaltechniker immer mehr auf eine Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten angewiesen, so Biochemiker, Molekularbiologen, Humangenetiker, Biostatistiker, Biophysiker und Informatiker. Deshalb ist eine fachübergreifende Kooperation aller Beteiligten eine wesentliche Voraussetzung für den Untersuchungserfolg.
Gerade in der Spurenkunde bestehen vielfältige Berührungspunkte zwischen der Rechtsmedizin einerseits und der naturwissenschaftlichen Kriminalistik andererseits. Während die Suche und Sicherung von Spuren unstrittig als Aufgaben der Kriminaltechnik angesehen werden, gibt es für die Untersuchung und Begutachtung von Spurenmaterial kein solches Monopol. Bedingt durch die historische Entwicklung und abhängig von der Leistungsfähigkeit der beteiligten Institutionen, werden Spuren menschlicher Herkunft, hauptsächlich Blut, Sekrete, Haut und Haare, entweder in einer kriminaltechnischen Einrichtung oder in einem Institut für Rechtsmedizin ausgewertet. Für die Zuständigkeit in diesem Bereich bestehen nach wie vor kontroverse Ansprüche. Doch mehr denn je gilt, dass es die „Hauptsache ist, die Aufgabe gut zu erledigen, Nebensache, wem die Erledigung zukommt“.[3]
Wie das Beispiel DNS-Analytik zeigt, müssen neue Methoden und Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftsgebieten stets auf ihre Anwendbarkeit in Rechtsmedizin und Kriminalistik geprüft werden. So hat sich die ursprünglich für die Erforschung von Erbkrankheiten entwickelte Technik schon bald als überaus wertvoll für die forensische Spurenuntersuchung erwiesen.
Nicht zuletzt ergeben sich aus der Rechtspraxis häufig Problemstellungen, die eine wissenschaftliche Bearbeitung in der Rechtsmedizin erfordern. Bei manchen Todesfällen muss eingeschätzt werden, wann der Tod eines Menschen eintrat. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen der Abkühlung der Leiche und dem Zeitpunkt des Todeseintritts aufgezeigt, die eine Todeszeitschätzung erlauben. Solche rechtsmedizinischen Forschungen dienen ausschließlich einer kriminalistischen Zweckbestimmung. Die Forschungsergebnisse vergrößern den Fundus spezifischer Erkenntnisse und Methoden der Rechtsmedizin, über den in dieser Geschlossenheit kein anderes medizinisches Fachgebiet verfügt.
Die Rechtsmedizin ist Lehr- und Prüfungsfach im Medizinstudium. Somit erwirbt jeder Arzt rechtsmedizinische Grundkenntnisse, zumeist fehlen ihm aber Spezialwissen und praktische Erfahrungen. Für Studierende der Rechtswissenschaft gibt es an vielen Universitäten einen fakultativen rechtsmedizinischen Unterricht. Dem Kriminalbeamten wird vor allem in der Fortbildung rechtsmedizinisches Wissen vermittelt.
Wie dargestellt, leistet der Rechtsmediziner seinen fachspezifischen Beitrag zur Klärung unterschiedlicher rechtserheblicher Sachverhalte. Er kann jedoch durch seine Mitarbeit den Ermittlungsbeamten nur unterstützen. „Der Aufbau des Beweisgebäudes liegt allein in der Hand des Kriminalisten.“[4]
Anmerkungen
Schwerd, W. (1989): Gerichtliche Medizin und Kriminalistik. Z. Rechtsmed. 102: 423.
Forensisch bedeutet gerichtlich, abgeleitet von dem lateinischen Substantiv forum.
Kenyeres, B. (1940): Lokalaugenschein. In: Handwörterbuch der gerichtlichen Medizin und naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Hrsg. F. v. Neureiter, F. Pietrusky u. E. Schütt), Berlin: Springer, S. 458.
Meinert, F. (1959): Exekutive und Kriminaltechnik. Die Polizei 50: 142.
II.Tod und Leichenuntersuchung
1.Ablauf des Sterbens
2.Frühe Leichenveränderungen
3.Späte Leichenveränderungen
4.Ärztliche Leichenschau
5.Leichenuntersuchung, kriminalistischeKriminalistische Leichenuntersuchung
6.Gerichtliche Leichenöffnung
II. Tod und Leichenuntersuchung › 1. Ablauf des Sterbens
1.Ablauf des Sterbens
Die letzte Phase des Lebens wird als Agonie bezeichnet. Das allmähliche Nachlassen der Stoffwechselprozesse beim Kranken führt zu einem langsamen Erlöschen der Lebensvorgänge und ist im Allgemeinen gekennzeichnet durch Schwinden des Bewusstseins, röchelnde Atmung und schwächer werdenden, unregelmäßigen Puls. Weitere Zeichen des bevorstehenden Todes sind das Schlaffwerden der Muskulatur und das Erlöschen der Nervenreflexe. Als Folgen des Ausfalls zentraler Steuerungsmechanismen können unkoordinierte Bewegungen und Lautäußerungen auftreten. Diese Begleiterscheinungen des Sterbens werden nicht selten als Todeskampf fehlgedeutet.
Bei gewaltsamen Todesfällen, wie Abtrennung des Kopfes oder Sturz aus der Höhe, kann die Agonie sehr kurz sein.
Der Agonie folgt der Individualtod, mit dem das Leben eines Menschen endet. Atem- und Herzstillstand zeigen den sog. klinischen Tod an, der nicht zwangsläufig das Lebensende bedeutet. Gelingt die rechtzeitige Wiederherstellung von Atemfunktion und Herztätigkeit durch medizinische Maßnahmen, ist eine Rückkehr vom klinischen Tod zum Leben möglich (Reanimation). Andernfalls folgt durch den Kreislaufstillstand ein irreversibles Erlöschen der Hirnfunktionen. Bedingt durch den hohen Sauerstoffbedarf der Gehirnzellen, tritt die Schädigung des Gehirns schon nach wenigen Minuten ein, während andere Organe (Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Lungen, Nieren) eine längere Überlebenszeit besitzen und dadurch die Organentnahme für Transplantationen ermöglicht wird. Der vollständige und endgültige Ausfall der Hirntätigkeit ist gleichbedeutend mit dem Hirntod, der auch Individualtod genannt wird. Der Hirntod folgt dem klinischen Tod etwa 10 Minuten nach dem Kreislaufstillstand.
In Fällen einer primären Hirnschädigung (z. B. durch schwere Hirnverletzung oder spontane Blutung im Schädelinneren), die nicht sofort zum Tod führt, entwickelt sich eine fortschreitende Hirnschwellung. Der zunehmende Hirndruck führt letztlich zu einer Atemlähmung und zu einem vollständigen Stillstand der Hirndurchblutung. Lässt sich die Durchblutung nicht rechtzeitig wiederherstellen, kommt es zum Absterben des Gehirns. Die moderne Medizin ermöglicht es, auch bei abgestorbenem Gehirn Atemtätigkeit und Kreislauffunktion apparativ über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Aber „funktionell ist der Hirntote einem Enthaupteten gleichzusetzen“.[1] Diese Tatsache ist einem Angehörigen nicht leicht verständlich zu machen, denn er findet auf der Intensivstation einen gut durchbluteten, scheinbar atmenden Körper mit warmer Haut und fühlbarem Puls vor. Die Überwachungsgeräte zeichnen die Herztätigkeit auf und machen den Herzschlag hörbar. In einer solchen Situation entsteht irgendwann die Frage nach dem Abbruch der Behandlungsmaßnahmen, insbesondere dann, wenn sich die Organe des Hirntoten für eine Transplantation eignen. Für diese Entscheidung sind die klassischen Zeichen des Todes Atem- und Kreislaufstillstand ungeeignet. Die Feststellung des Todes basiert stattdessen auf dem zweifelsfreien Nachweis des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls (Hirntod). Der irreversible Hirnfunktionsausfall ist in diesem Zusammenhang definiert als „der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen“.[2]
Für die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls vor Organentnahme zur Transplantation gibt es strenge Richtlinien. Gefordert werden klinische Verlaufsbeobachtungen durch verschiedene Fachärzte sowie apparative Zusatzuntersuchungen. Das Verfahren ist also an ein entsprechend ausgestattetes Krankenhaus gebunden. Der irreversible Hirnfunktionsausfall lässt sich bei der üblichen ärztlichen Leichenschau nicht feststellen.
Außerhalb der Klinik hat die Definition des Individualtodes als Hirntod praktisch keine Bedeutung. In der weitaus überwiegenden Mehrzahl basiert die ärztliche Todesfeststellung auf dem Nachweis sicherer Todeszeichen. Wenn sich keine sicheren Todeszeichen feststellen lassen, kann ein sog. Scheintod vorliegen, bei dem es sich um einen Zustand äußerster Herabsetzung aller Lebensprozesse handelt, sodass Atmung und Puls ohne apparative Hilfsmittel nicht wahrnehmbar sind. Durch geeignete Behandlungsmaßnahmen kann die Wiederbelebung gelingen.
Dem Individualtod folgt das sog. intermediäre Leben. Während dieser Phase leben Organe und Gewebe entsprechend ihrer Sauerstoffmangelempfindlichkeit unterschiedlich lange weiter. Folglich ist auch die Wiederbelebungszeit der einzelnen Organe nach Eintritt des Kreislaufstillstands unterschiedlich lang, also die Zeitdauer, innerhalb der keine irreversiblen Organschäden auftreten. Als durchschnittliche Wiederbelebungszeiten werden für das Gehirn 4 bis 6 Minuten und für das Herz 15 bis 30 Minuten angegeben. Diese Zeiten verkürzen sich bei hohen Temperaturen und können bei niedrigen Temperaturen erheblich länger sein.
An einzelnen Geweben und Zellen, die noch nicht abgestorben sind, lassen sich während eines begrenzten Zeitraums durch entsprechende Reize supravitale Reaktionen auslösen. Solche, über das Leben hinausreichenden Reaktionen können in den ersten Stunden nach dem Individualtod zur Todeszeitschätzung herangezogen werden. Bewährt hat sich beispielsweise die Prüfung der Erregbarkeit verschiedener Muskeln.
Ablauf des Sterbevorgangs, nach [7]
[Bild vergrößern]
Das intermediäre Leben ist mit dem Absterben der letzten Körperzelle beendet. Es tritt der biologische Tod (Zelltod) ein, der auch als totaler oder absoluter Tod bezeichnet wird (Abbildung 1).
Die verschiedenen Todesbegriffe könnten zu der Ansicht führen, es gäbe mehrere Tode. Das stimmt nicht. Für jedes Lebewesen gibt es nur einen Tod. Die menschliche Existenz endet mit dem Individualtod.
Anmerkungen
Penning, R. (2006): Rechtsmedizin systematisch. 2. Aufl., Bremen–London–Boston: UNI-MED, S. 21.
Bundesärztekammer (2015): Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TPG für die Regeln zur Feststellung des Todes nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 TPG und die Verfahrensregeln zur Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG. Dt. Ärztebl. 112: A-1256.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 2. Frühe Leichenveränderungen
2.Frühe Leichenveränderungen
Ganz allgemein sind Leichenveränderungen solche Vorgänge, die nach Eintritt des Todes in Abhängigkeit von äußeren und inneren Einflussfaktoren gesetzmäßig ablaufen. Wesentliche äußere Bedingungen sind Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind sowie Bekleidung und Bedeckung des Körpers. Als innere Faktoren wirken sich vorrangig der Ernährungszustand und die Todesursache aus.
Die frühen Leichenveränderungen sind Totenflecke (Leichenflecke, Livores mortis), Totenstarre (Leichenstarre, Rigor mortis) und Erkalten (Leichenkälte, Algor mortis). Gleichfalls kurz nach dem Tod entstehen durch Verdunstung die Vertrocknungen, die an den Augen, an den Lippen, im Genitalbereich sowie an den Finger- und Zehenspitzen zuerst zu sehen sind.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 2. Frühe Leichenveränderungen › 2.1 Totenflecke
2.1Totenflecke
Die Totenflecke sind nach Eintritt des Todes entstehende Hautverfärbungen. Mit dem Aufhören der Herztätigkeit kommt der Blutkreislauf zum Stillstand. Das Blut sinkt infolge der Schwerkraft in die tiefer gelegenen Körperabschnitte und führt dort zu einer Senkungsblutfülle der Gefäße (Hypostase). Die prall gefüllten und erweiterten kleinen Blutgefäße werden als grau-violette Hautverfärbungen sichtbar. Das sind die Totenflecke, die sich zuerst kleinfleckig zeigen und dann allmählich großflächig auftreten. An den Körperstellen, wo die Leiche aufliegt, werden die Blutgefäße der Haut zusammengedrückt und sind dadurch blutleer. Folglich bleiben die Aufliegestellen von Totenflecken ausgespart und blass.
Die Totenflecke entstehen immer in dem Körperbereich, der dem Boden am nächsten ist (Abbildung 2). Bei Rückenlage finden sich die Totenflecke am Hinterkopf, im Nacken, auf dem Rücken sowie an den seitlichen Partien von Rumpf und Gliedmaßen. Ausgespart bleiben der obere Rückenbereich als sog. Schmetterlingsfigur, das Gesäß, die Waden, die Fersen und die Aufliegestellen beider Arme. Bei Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind die Totenflecke nicht sichtbar.
Totenflecke in Abhängigkeit von der Körperlage, aus [9]
[Bild vergrößern]
Liegt die Leiche auf dem Bauch, bilden sich die Totenflecke im Gesicht sowie an der Vorderseite des Rumpfes und der Gliedmaßen aus. Die Aufliegestellen sind entsprechend ausgespart. Bei einer hängenden Leiche entstehen die Totenflecke in der unteren Hälfte des Körpers und der Arme. Oft sind Hände und Füße besonders kräftig verfärbt. Durch Kopftieflage tritt eine intensive Totenfleckbildung im Kopf-Hals-Bereich ein.
Wenn eng anliegende Kleidungsstücke, wie Büstenhalter, Hosengummi oder Gürtel, sowie Kleider- und Hautfalten die Blutgefäße komprimieren, sind Aussparungen der Totenflecke möglich. Am Hals können ein fest sitzender Kragen oder Hautfalten eine Strangmarke vortäuschen. Vereinzelt zeichnen sich sogar Textilgewebsmuster innerhalb der Totenflecke ab. Die ausgesparten Stellen lassen manchmal auch die Beschaffenheit der Fläche erkennen, auf der die Leiche lag. So können Abbilder von Gräsern, Blättern oder Ästen ebenso sichtbar sein wie Abdrücke von Kanten oder Oberflächenstrukturen verschiedener Gegenstände.
Gelegentlich kommt es im Bereich der Senkungsblutfülle zum Platzen kleiner Blutgefäße. Dadurch entstehen dunkelrote bis violette, meist rundliche, punktförmige bis linsengroße Flecke in der Haut. Diese Blutaustritte werden als Vibices bezeichnet. Wie die Entwicklung der Totenflecke ist das Auftreten von Vibices abhängig von der Lage der Leiche. Bei Rückenlage können Blutaustritte im Schulter-Rücken-Bereich und bei Kopftieflage im Gesicht und in den Augen beobachtet werden. Auch unter der Kopfhaut und in den Halsweichteilen entstehen bei Kopftieflage Vibices. Bei Erhängten finden sich derartige Blutaustritte an Unterschenkeln und Füßen.
Solange die Blutsäule in den Gefäßen verschieblich ist, können die Totenflecke durch Umlagern der Leiche wandern. Wenn man die Leiche von der Rücken- in die Bauchlage dreht, bilden sich die Totenflecke an der nun unten befindlichen Körperseite neu aus und die ursprünglichen Flecke verschwinden vollständig. Ebenso lassen sich die Totenflecke mit dem Finger oder mit einem Instrument wegdrücken. Mit zunehmender Zeit nach dem Tod gehen die Umlagerbarkeit und die Wegdrückbarkeit verloren, weil das Blut eindickt und – begünstigt durch eine zunehmende Durchlässigkeit der Blutgefäßwände – auch Blutfarbstoff der zerfallenden roten Blutkörperchen in das Körpergewebe eindringt. Die Totenflecke werden dadurch fixiert und gehen später in die fäulnisbedingten Hautverfärbungen über.
Die ersten Totenflecke werden ungefähr 20 bis 30 Minuten nach Todeseintritt bei Rückenlage der Leiche im Nacken und in den seitlichen Halsregionen sichtbar, anfänglich als schwach ausgebildete Flecke, die an Intensität und Ausdehnung rasch zunehmen und ineinanderfließen. Auch die inneren Organe weisen im Bereich der Senkungsblutfülle Totenflecke auf. Nach etwa 5 bis 6 Stunden nimmt die Intensität nicht mehr wesentlich zu. Eine vollständige Umlagerbarkeit besteht bis etwa 6 Stunden nach dem Tod. Danach verschwinden die ursprünglichen Totenflecke nicht mehr gänzlich. Eine doppelte Totenfleckbildung an den abhängigen Körperpartien und an der Gegenseite nach Umlagerung der Leiche kann innerhalb von 6 bis 12 Stunden eintreten (Abbildung 3). Bei der Wegdrückbarkeit reichen die Angaben von 6 Stunden für ein vollständiges Verschwinden auf leichten Daumendruck bis 36 Stunden und mehr mit vollständiger Abblassung auf starken Druck mit Messer oder Pinzette.
Wandern der Totenflecke nach Wenden der Leiche, aus [6]
[Bild vergrößern]
Aus Farbe und Intensität der Totenflecke können vereinzelt Anhaltspunkte für die Todesursache abgeleitet werden. Durch Einwirkung niedriger Temperaturen entstehen hellrote Totenflecke, die sog. Kältetotenflecke. Auch bei Leichen, die in Kühlzellen gelagert werden, kann es zu einer Verfärbung kommen. Die Totenflecke sind dann immer zweifarbig. Die an die Aufliegestellen angrenzenden Abschnitte sind hellrot, die übrigen Anteile grau-violett. Hellrote Totenflecke treten ebenfalls bei Vergiftungen durch Kohlenmonoxid oder Blausäure auf. Eine schmutzig-graue bis braune Farbe zeigen die Totenflecke bei Vergiftungen mit Nitraten, Nitriten und Chloratverbindungen.
Sind die Totenflecke mehrere Stunden nach Todeseintritt nur spärlich ausgebildet oder fehlen, so weist das auf eine Blutarmut infolge krankhafter Ursache oder auf Verbluten nach innen oder außen hin.
Kriminalistisch bedeutsam sind die Totenflecke
•
als sicheres Zeichen des Todes,
•
zur Schätzung der Todeszeit,
•
mitunter als Hinweis auf die Todesursache und die Todesart sowie
•
gelegentlich zum Erkennen von Lageveränderungen der Leiche.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 2. Frühe Leichenveränderungen › 2.2 Totenstarre
2.2Totenstarre
Bei Eintritt des Todes erschlaffen sämtliche Muskeln des Körpers, so auch die Muskulatur des Gesichts. Demnach lässt der Gesichtsausdruck eines Verstorbenen keinen Rückschluss auf einen etwaigen qualvollen Sterbevorgang zu.
Alle Gelenke sind zunächst beweglich. Der Körper lässt sich in jede beliebige Lage bringen und ohne Schwierigkeiten be- oder entkleiden. Das Eintreten der Totenstarre ist kein sprunghafter Vorgang, sondern ein langsam beginnender und kontinuierlich zunehmender Prozess. Erst nach und nach entsteht eine Starre der gesamten Körpermuskulatur, die zu einer zunehmenden Bewegungseinschränkung in den Gelenken bis zur vollständigen Steifheit führt.
Die physikochemischen Vorgänge bei der Entstehung der Totenstarre sind komplex. Die entscheidende Bedeutung kommt dem Adenosintriphosphat (ATP) zu. Im lebenden Organismus wird die Energie für die Muskelkontraktion durch Umwandlung des ATP in Adenosindiphosphat (ADP) freigesetzt. Aus dem oxidativen Abbau von Zuckerverbindungen stammt dann wiederum die Energie zur Resynthese des ADP zu ATP. Das energiereiche ATP wirkt als sog. Weichmacher und führt zur Erschlaffung der Muskulatur. Abbau und Resynthese des ATP bleiben nach dem Tod im Gleichgewicht, solange der Energiestoffwechsel noch funktioniert. Dadurch ist die Muskulatur nach dem Tod zunächst schlaff. Wenn die Zuckerreserve der Muskeln aufgebraucht ist, kann kein ATP mehr resynthetisiert werden. Es entwickelt sich die Totenstarre durch Überführung der Muskeleiweiße von einem Sol- in einen Gelzustand.
Auch an den inneren Organen mit glatter Muskulatur und am Herzen tritt das Starrwerden ein. Es ist selbstverständlich nur bei der Leichenöffnung festzustellen. Äußerlich kann sich die Totenstarre von Samenbläschen und Prostata als Samenabgang nach dem Tod bemerkbar machen. Demzufolge lässt ein Samenabgang an der Leiche nicht zwangsläufig auf eine sexuelle Aktivität kurz vor dem Ableben schließen.
Da es sich bei der Muskelerstarrung um einen physikochemischen Prozess handelt, hängen Herausbildung und Dauer der Starre von verschiedenen Bedingungen ab. Wärme beschleunigt und Kälte verzögert das Entstehen und das Lösen der Totenstarre. Alle Vorgänge, die zu einer ATP-Verminderung im Muskelgewebe führen, beschleunigen den Starreeintritt (Rigor praecox). Das gilt insbesondere für eine starke Beanspruchung der Muskulatur vor dem Tod, beispielsweise bei Personen, die während oder bald nach einer großen körperlichen Anstrengung versterben, oder bei Sterbefällen, die mit Krämpfen einhergehen (z. B. Erstickungszustände, Stromtod, Vergiftung durch Strychnin, Wundstarrkrampf).
Ein Zusammenhang mit der Todesursache besteht auch insofern, als dass sich bei auszehrenden Krankheiten oder anders verursachtem Muskelschwund die Totenstarre nur schwach ausbildet. Bei hochbetagten Personen und bei kleinen Kindern, insbesondere Frühgeborenen, kann die Totenstarre ausbleiben oder kaum feststellbar sein.
Zu beachten ist, dass sich im Rahmen einer Unterkühlung noch zu Lebzeiten eine sog. Kältestarre ausbildet, die keinesfalls mit einer Totenstarre verwechselt werden darf. Die Totenstarre stellt somit nur in warmer Umgebung ein sicheres Todeszeichen dar.
Für die Reihenfolge des Auftretens der Totenstarre wird gewöhnlich die Regel nach Nysten angegeben. Die Erstarrung beginnt an der Kiefermuskulatur, breitet sich dann absteigend über Hals, Rumpf und Arme aus und ist schließlich an den Beinen feststellbar. Eine der Ausnahmen von dieser Regel ist die sog. Läuferstarre, die nach starker Beanspruchung der Beinmuskulatur an den Beinen beginnt und erst danach an den Armen entsteht.
Als Brechen der Totenstarre bezeichnet man das Wiederherstellen der Beweglichkeit durch einen mehr oder weniger großen Kraftaufwand an den Gelenken. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das erfolgt, kann die Starre erneut eintreten. Da nicht alle Muskelfasern gleichzeitig totenstarr werden, tritt nach dem Brechen die Versteifung in dem dazugehörigen Gelenk dann von Neuem ein, wenn zuvor noch nicht alle Muskelanteile erstarrt waren.
Die Lösung der Totenstarre wird durch die Selbstverdauung (Autolyse) der Muskeleiweiße bewirkt, später tritt die Leichenfäulnis hinzu.
Zum zeitlichen Ablauf des Eintretens und des Lösens sind stark abweichende Angaben in der Fachliteratur zu finden. Nach etwa 2 bis 4 Stunden kann die Totenstarre in den Kiefergelenken, nach etwa 8 bis 10 Stunden am ganzen Körper vollständig ausgeprägt sein. Ein Wiedereintreten nach Brechen ist innerhalb von 7 bis 8 Stunden nach dem Tod zu erwarten. Das Lösen der Totenstarre erfolgt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, bei hohen Temperaturen etwa nach 24 Stunden, bei niedrigen erst nach einigen Tagen.
In der älteren Literatur wird von Fällen sog. kataleptischer Totenstarre berichtet. Dabei soll das Starrwerden der Muskulatur unmittelbar nach dem Tod schlagartig eintreten, sodass die bei Todeseintritt eingenommene Körperhaltung fixiert wird. Bei einer kritischen Überprüfung der Fallberichte konnte dieses Phänomen nicht bestätigt werden.
Kriminalistisch bedeutsam ist die Totenstarre
•
als sicheres Todeszeichen und
•
für die Todeszeitschätzung.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 2. Frühe Leichenveränderungen › 2.3 Erkalten
2.3Erkalten
Beim Menschen werden Wärmebildung und Wärmeabgabe so reguliert, dass die Körpertemperatur um 37 °C konstant gehalten werden kann. Mit dem Eintritt des Todes entfällt die zentrale Steuerung, und die Wärmeproduktion hört allmählich auf. Die Abkühlung der Leiche setzt ein und dauert so lange an, bis die Umgebungstemperatur erreicht ist. Über die Haut erfolgt die Wärmeabgabe durch Abstrahlung, durch Ableitung an die umgebende Luft und an die Aufliegefläche sowie durch Verdunstung. Diese physikalischen Prozesse werden von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Die entscheidende Größe ist das Gefälle zwischen Körper- und Umgebungstemperatur. Die Körpertemperatur weicht in einigen Fällen vom Normwert ab. Bei fieberhaften Erkrankungen kann die Ausgangstemperatur höher und bei Unterkühlung niedriger als 37 °C liegen. Dicke Bekleidung und Bedeckung, gut isolierende Unterlagen und eine zusammengekauerte Körperhaltung verzögern die Abkühlung. Die langsamere Wärmeabgabe fettleibiger Leichen ist vorrangig auf den größeren Körperradius zurückzuführen und nicht nur durch die isolierende Wirkung des Fettgewebes zu erklären. Luftbewegung, hohe Luftfeuchte und ein begünstigendes Milieu (kaltes Wasser, gut wärmeableitende Unterlage) bewirken eine beschleunigte Abkühlung. Säuglinge und Kleinkinder kühlen besonders rasch ab, weil bei ihnen die im Verhältnis zur Körpermasse relativ große Körperoberfläche die Wärmeabgabe begünstigt.
Die Leichenabkühlung verläuft in drei Phasen, die sich grafisch als Sigmoidkurve der Mastdarmtemperatur darstellen lassen. In den ersten 2 bis 3 Stunden bleibt die Sterbetemperatur bestehen oder fällt nur geringfügig ab. Deshalb wird der Anfangsteil der Kurve als Temperaturplateau bezeichnet. Die initiale Hemmung der Abkühlung ist zurückzuführen auf einen Wärmeaustausch innerhalb des Körpers. Danach folgt ein nahezu geradliniges Absinken der Mastdarmtemperatur um rund 1 °C pro Stunde. Mit Verringerung des Temperaturgefälles zwischen Leiche und Umgebung verlangsamt sich die Abnahme der Körpertemperatur. Man spricht von terminaler Verzögerung als letzter Phase der Abkühlungskurve.
Kriminalistisch bedeutsam ist
•
die Leichenabkühlung für die Todeszeitschätzung und
•
die Leichenkälte als frühes Zeichen des Todes.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 3. Späte Leichenveränderungen
3.Späte Leichenveränderungen
Die späten Leichenveränderungen führen weitaus häufiger zu einer Zersetzung als zu einer Konservierung des Leichnams. Bei der Leichenzersetzung überwiegen die bakteriell bedingten Fäulnisprozesse. Nicht selten sind Insekten beteiligt. Vor allem durch Madenfraß kann in relativ kurzer Zeit eine Skelettierung entstehen. Abhängig von verschiedenen Voraussetzungen tritt eine natürliche Leichenkonservierung ein. Am häufigsten sind Mumifizierung und Fettwachsbildung. In der Praxis überwiegen die Fälle, bei denen verschiedene Leichenveränderungen in unterschiedlichen Stadien nebeneinander zu beobachten sind.
Der Ablauf der späten Leichenveränderungen kann von Leiche zu Leiche wie auch an ein und demselben Leichnam außerordentlich verschieden sein. So ist es möglich, dass einzelne Teile des Körpers durch Mumifizierung oder Fettwachsbildung konserviert werden, während der Rest eine fäulnisbedingte Zersetzung aufweist. Ebenso können die Abbauprozesse an einer Leiche unterschiedlich schnell voranschreiten. Kopf und Arme sind bereits skelettiert, Rumpf und Beine hingegen noch relativ gut erhalten, weil Kleidung oder andere Bedeckung diese Körperpartien vor stärkerer Zersetzung geschützt hat.
Den späten Leichenveränderungen geht die Autolyse voran. Es handelt sich um eine Selbstverdauung der Körpergewebe, die durch Zellenzyme bewirkt wird. Die Autolyse vollzieht sich an den inneren Organen unter anderem als Erweichung des Nebennierenmarks, der Magenwand und der Bauchspeicheldrüse.
Für die kriminalistische Praxis hat die Hauterweichung (Mazeration) von Neugeborenen eine gewisse Bedeutung. Gelegentlich endet eine Schwangerschaft mit dem Tod der Frucht in der Gebärmutter. Nach dem Absterben setzen die Autolyse sowie eine Hauterweichung durch das Fruchtwasser ein. Das äußere Erscheinungsbild der Mazeration einer Leibesfrucht darf nicht als Leichenfäulnis verkannt werden. Das würde zu einer erheblichen Überschätzung der Leichenliegezeit führen.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 3. Späte Leichenveränderungen › 3.1 Fäulnis und Verwesung
II. Tod und Leichenuntersuchung › 3. Späte Leichenveränderungen › 3.2 Tierfraß
II. Tod und Leichenuntersuchung › 3. Späte Leichenveränderungen › 3.3 Konservierende Leichenveränderungen
3.3Konservierende Leichenveränderungen
Eine natürliche Leichenkonservierung durch Mumifikation tritt dann ein, wenn die Austrocknung des Körpers schneller voranschreitet als die Leichenzersetzung durch Fäulnis. Diese Situation ist bei mageren Leichen in trockenem, luftigem Milieu gegeben. Einer Mitwirkung von Giften, Strahlen und Bakterien bedarf es nicht.
Bereits kurze Zeit nach dem Tod sind die ersten Vertrocknungserscheinungen an den Hornhäuten der Augen, am Lippenrot und an zarten Hautpartien wie Hodensack, Vorhaut und Schamlippen zu beobachten. Der Flüssigkeitsverlust der Gesichtshaut lässt die Bartstoppeln deutlich hervortreten, wie auch das Eintrocknen der Finger- und Zehenkuppen die Nägel länger erscheinen lässt. Weder Barthaare noch Nägel wachsen nach dem Tod weiter.
Mit zunehmender Mumifizierung nimmt die Haut eine braune Farbe und eine lederartig derbe Beschaffenheit an. Auch die Weichteile schrumpfen, sodass sich Muskel- und Sehnenstränge deutlich sichtbar unter der Haut abzeichnen. Insgesamt verringert sich durch den Wasserverlust das Körpergewicht erheblich. Eine Veränderung der Haarfarbe ist möglich. Am häufigsten entsteht ein rötlicher Farbton.
Mumifizierte Leichen sind in unseren Breiten am ehesten auf zugigen Dachböden, in Schuppen und Scheunen, in trockenen Gewölben und Grüften oder im Freien (im Wald Erhängte) zu erwarten. Eine vollständige Mumifikation erfordert einen längeren Zeitraum, mindestens mehrere Wochen. Häufiger sind Teilmumifizierungen, bei denen ein Mischbild verschiedener Leichenveränderungen vorliegt.
Gelangt eine auf natürliche Weise mumifizierte Leiche in ein feuchtes Milieu, quellen die Weichteile auf. Dadurch kann eine kürzere Leichenliegezeit vorgetäuscht werden.
Die kriminalistische Bedeutung der Mumifikation liegt darin begründet, dass
•
äußere Konturen erhalten bleiben und dadurch eine Identifizierung erleichtert werden kann,
•
bestimmte Verletzungen wie Strangfurchen, Stich-, Schnitt-, Hieb- und Schusswunden konserviert werden und
•
eine längere Liegezeit der Leiche angenommen werden muss.
Unter Fettwachsbildung versteht man eine Umwandlung der Weichteile, beginnend mit dem Körperfett, in eine grau-weiße, körnige, zuerst feucht-pastenartige, später trocken-gipsähnliche Masse mit ranzig-erdigem Geruch. Das Fettwachs (Adipocire) entsteht durch hydrolytische Spaltung des Körperfetts in Glycerol und Fettsäuren. Notwendige Bedingungen sind feuchtes Milieu, Luftabschluss und die Mitwirkung bestimmter Bakterien.
Die gebräuchliche Bezeichnung Fettwachs hat sich als chemisch falsch erwiesen. Das Umwandlungsprodukt enthält kaum Fett und kein Wachs, sondern besteht hauptsächlich aus gesättigten höheren Fettsäuren (vor allem Palmitin- und Stearinsäure). Es wird besser als Leichenlipid bezeichnet.
Bei Wasserleichen kann Fettwachs bereits nach wenigen Wochen auftreten, während es sich im feuchten Erdgrab erst im Laufe vieler Monate entwickelt. Die Fettwachsbildung zählt wie die Mumifizierung zu den konservierenden Leichenveränderungen. Daraus leitet sich dieselbe kriminalistische Bedeutung ab.
Wird ein Verstorbener alsbald nach dem Tod eingefroren, führt das ebenfalls zu einer Konservierung. Solche Eisleichen können unter natürlichen Bedingungen während Frostperioden, in Gletscherregionen und in Polargebieten entstehen.
Von Tätern wird der Konservierungseffekt des Einfrierens genutzt, um eine Leiche oder Leichenteile wenigstens zeitweilig beiseitezuschaffen.
Eine sog. Faulleichenkonservierung tritt ein, wenn sich der Leichnam oder Leichenteile längere Zeit in einer luft- und wasserdichten Umhüllung (z. B. Plastiksack, Folie, Beton) befinden. Unter diesen Bedingungen setzen die mikrobiellen Abbauprozesse zwar ein, kommen jedoch bald durch die Anhäufung von Stoffwechselendprodukten zum Stillstand.
Die Konservierung von Leichen im Moor wird durch Humin- und Gerbsäuren bestimmt. Begünstigende Bedingungen sind Kälte und Luftabschluss. Die einzelnen Körpergewebe unterliegen unterschiedlichen Veränderungen: Die Haut wird gegerbt, die Weichteile und die inneren Organe verwesen, die Knochen werden entkalkt und dadurch biegsam, färben sich schwarz und erinnern an Hartgummi.
Erfahrungsgemäß haben Moorleichen in der weitaus größten Anzahl der Fälle eine archäologische Bedeutung, doch ist eine kriminalistische Relevanz nicht von vornherein auszuschließen.
Durch Einwirkung von Salz in fester oder gelöster Form können Salzleichen entstehen (z. B. Tod im Salzbergwerk oder im Solebecken). Entscheidend ist der Wasserentzug des Körpers durch den hygroskopischen Effekt vieler Salze, am ehesten vergleichbar mit dem Pökeln.
Ergänzend soll die künstliche Leichenkonservierung erwähnt werden. Am bekanntesten sind die Balsamierungsrituale im alten Ägypten, aber auch heute noch werden durch verschiedene physikalische und chemische Verfahren (z. B. Tieffrieren, Paraffin- und Formalindurchtränkung, Plastination) Leichen und Leichenteile haltbar gemacht. Das kann erforderlich sein zur Aufbewahrung bei unklarer Identität, zur Überführung in andere Staaten oder für medizinische Präparatesammlungen.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 4. Ärztliche Leichenschau
4.Ärztliche Leichenschau
Die ärztliche Leichenschau ist durch landesrechtliche Bestimmungen geregelt. Folglich gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsvorschriften zum Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen. Nachfolgend kann nur eine länderübergreifende Darstellung grundlegender Aspekte der ärztlichen Leichenschau gegeben werden, wobei auf die wichtigsten Ausnahmen hingewiesen wird. Für Detailfragen sind unbedingt die gesetzlichen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
Mit den Bestimmungen zur Leichenschau verfolgt der Gesetzgeber mehrere Ziele:
•
Verhütung irrtümlicher Todesfeststellung (Feststellung des Todes durch einen Arzt),
•
Medizinalstatistik (Häufigkeit der einzelnen Todesursachen als Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungen),
•
Seuchenbekämpfung (Anzeigepflicht bei bestimmten Erkrankungen im Todesfall),
•
Rechtsinteressen (Erkennung polizeilich bzw. rechtlich relevanter Todesfälle).
Nach den Landesgesetzen muss in jedem Sterbefall ein Arzt eine Leichenschau durchführen und darüber eine ärztliche Bescheinigung ausstellen. Eine Ausnahme bildet Schleswig-Holstein. Dort darf auf einigen Inseln und Halligen auch eine andere geeignete Person zur Vornahme der Leichenschau ermächtigt werden.
Die obligatorische ärztliche Leichenschau wird gelegentlich auch als allgemeine Leichenschau bezeichnet. Um deren Ergebnis zu dokumentieren, werden Formulare verwendet, die unterschiedlich gestaltet sind. Diese Vordrucke können – je nach Bundesland – Todesbescheinigung, Leichenschauschein oder Totenschein heißen.
Die ausgefüllten Formulare müssen auf dem Standesamt zur Beurkundung des Sterbefalles vorgelegt werden. Erst danach darf die Bestattung erfolgen. Jede Leiche muss an einem dafür vorgesehenen Ort bestattet werden.
In allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern ist vor einer Feuerbestattung, bei der die Leiche verbrannt und die Asche meist in einer Urne beigesetzt wird, eine zweite (amtsärztliche) Leichenschau erforderlich. Eine solche Leichennachschau dient der Feststellung von Kennzeichen eines nichtnatürlichen Todes und zur Freigabe für die Einäscherung.
Die landesrechtlichen Regelungen verpflichten den Leichenschauarzt zu folgenden Feststellungen:
•
Tod,
•
Todeszeitpunkt,
•
Todesursache,
•
Todesart (natürlicher oder nichtnatürlicher Tod),
•
Personalien.
Darüber hinaus unterliegt der Leichenschauarzt bestimmten Meldepflichten.
Die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin hat „Regeln zur Durchführung der ärztlichen Leichenschau“ erarbeitet, die als Leitlinien für Ärzte veröffentlicht sind.[1]
Anmerkungen
AWMF-Leitlinien-Register, Nr. 054/002.
II. Tod und Leichenuntersuchung › 4. Ärztliche Leichenschau › 4.1 Feststellung des Todes