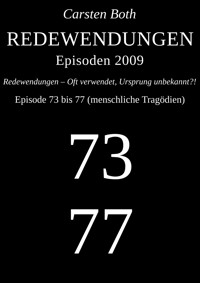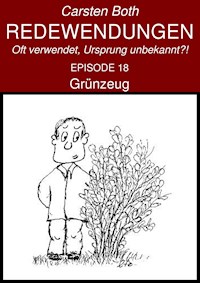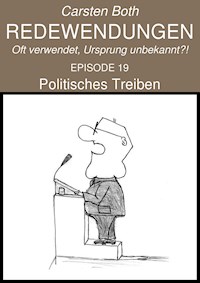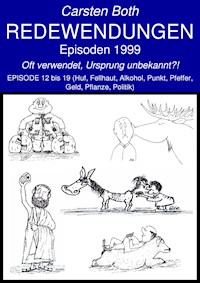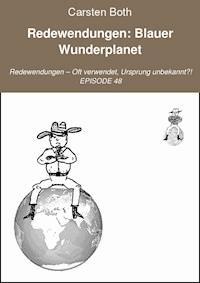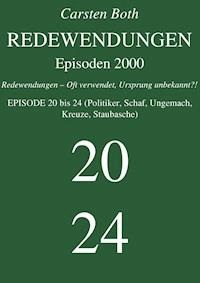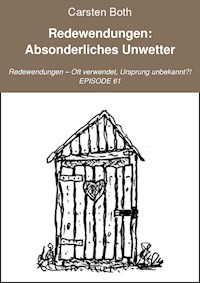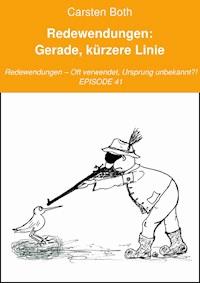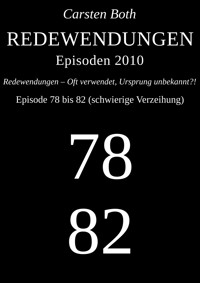
2,99 €
Mehr erfahren.
Behandelte Redewendungen: In der Kürze liegt die Würze / Schwamm drüber! / bei jemandem in der Kreide stehen/sein / in die Kreide gekommen/geraten sein / mit doppelter/zweifacher Kreide (an)schreiben/(ab)rechnen / jemandem etwas ankreiden / Die fünfte Kolonne / Fünfte Kolonne / (nur) alle Jubeljahre (einmal) / die beleidigte/gekränkte Leberwurst spielen/sein / jemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen/gekrochen / jemandem ist ein Floh über die Leber gehüpft / etwas auf der Leber haben / etwas frisst jemandem an der Leber / Was ist dir/dem/der denn über die Leber gelaufen/gekrochen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Episode 78: Short und spicy
Eine knappe Darstellung ist regelmäßig besser als eine ausführliche! Das ist ein Witz und zugleich Tenor des gefeierten Spruchs „In der Kürze liegt die Würze.“ Diese Überlebensweisheit des Analphabeten-Volkes wird auf Literatur und Vortrag, Diskussion und Argumentation bezogen, also auf alles, was mit Denken und Intellekt zu tun hat – der profane Rest kann dagegen gar nicht lang genug sein. Der Leitreim der Gedanken- und Wortlosen, die nicht mehr lesen wollen oder können, stammt wahrscheinlich aus der englischen Literatur: „The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark“ (1604) von William Shakespeare (1564-1616) hat für einige berühmte Phrasen gesorgt, so auch indirekt für die angeblich würzige Kürze. In der 2. Szene des 2. Aufzugs erläutert Oberkämmerer Polonius der Königin wie außergewöhnlich ihr Sohn sei:
Therefore, since brevity is the soul of wit, And tediousness the limbs and outward flourishes, I will be brief: your noble son is mad: ...
Im 1766 veröffentlichten ersten deutschen „Hamlet, Prinz von Dän(n)emark“, den Christoph Martin Wieland (1733-1813) Prosa-übersetzt hatte, hörte sich das noch nicht kurz, sondern weitschweifig an: „Demnach und alldieweilen dann die Kürze die Seele des Wizes, und Weitläufigkeit im Vortrag nur den Leib und die äusserliche Auszierung desselben ausmacht, so will ich mich der Kürze befleissen: Euer edler Sohn ist toll; ...“ In der 1778 unautorisiert verbesserten Gesamtausgabe „William Shakespear’s Schauspiele“ von Johann Joachim Eschenburg (1743-1820) fand sich der Witz-kurz-toll-Passus zurechtgestutzt wieder: „Darum, da Kürze die Seele des Witzes ist, und langwierige Weitläuftigkeit nur das Aeussere der Rede aufschmückt, so will ich kurz seyn. Euer edler Sohn ist toll, …“ Erst August Wilhelm Schlegel (1767-1845) berücksichtigte in seiner Hamlet-Übersetzung aus dem Jahr 1798 den später durch diese Passage erst geprägten Spruch leidlich:
Weil Kürze dann des Witzes Seele ist, Weitschweifigkeit der Leib und äußre Zierrath, Fass’ ich mich kurz. Eu’r edler Sohn ist toll, ...
Gertrude bemerkte übrigens auf die noch fortgesetzten Ausführungen nur kurz: „More matter, with less art.“, was Wieland unnötig lang mit „Mehr Stoff mit weniger Kunst, wenn es euch beliebig wäre.“ übersetzte, wohl Eschenburg mit „Mehr Sachen, und weniger Umschweife!“ und Schlegel wiederum kürzer mit „Mehr Inhalt, wen’ger Kunst.“ Diese königliche Anregung zur knapperen Inhaltsangabe trug sicherlich ergänzend zur Prägung der Wendung bei, die im Deutschen nicht „Die Kürze ist die Seele des Witzes.“ heißt, sondern unter Verlust der Witzseele gewürzt und gereimt wurde. Apropos deutschsprachige Verbesserungen: Übereifrige Theaterübersetzer haben den Redensart-prägenden ollen Polonius zum Oldenholm verdeutschdänischt; auf Vorschlag des österreichischen Lustspieldichters Franz Heufeld (1731-1795), dem allerdings 1772 unsere Kurzwitz-Textstelle ironischerweise zum Kürzungsopfer gefallen war.
Müßig und langatmig ist die Diskussion, ob die Deutschen den Spruch nun aus den eigenen Übersetzungen abgeleitet haben oder aus der englischen Original-Wendung „Brevity is the soul of wit.“ – mit Spice statt Seele. Beim eindeutschenden Reimen mit Würze ist der Verstand eh völlig verlorengegangen, denn der „Witz“ stand bei Shakespeare eher für dessen geistreiche Ausprägungen und nicht für die heute populären „funny jokes“. Aber die Verdummung hat selbst vor der altehrwürdigen englischen Wendung nicht haltgemacht: Das Kurz- und Dummhalten wird heutzutage lieber mit den KISS-Slogans „Keep it simple and stupid.“ und „Keep it short and simple.“ ausgedrückt – was man bei manchem Volk aufgrund ausgeprägter Bildungs- und Aufmerksamkeitsdefiziten schon gar nicht mehr braucht. Wann genau die Kurzfassung die deutsche Literatur und die Vorträge (als Redewendung) erobert hat, ist (mir) unbekannt. Das „Deutsche Sprichwörter-Lexikon“ (1870) kennt lediglich die zu kurze Fassung „Kürze hat Würze.“ – und verweist per Zusatz „Und ist die Seele des Witzes.“ auf die angebliche Hamlet-Abstammung. Im dritten Wander-Wälzer (1873) findet sich der zu spezifische Hinweis „Unsers Redens beste Würze besteht in beflissener Kürze.“ Auch auf die erst 1880 im fünften Band erschienene „Würze“ fiel dem Wander (postum) der Reim nicht ein, sondern lediglich der dreifach-tolle Spruch „Die Würze der Kürze kennt keine Schürze.“ sowie „Des Spieles Würze ist seine Kürze.“ Gleichwohl ging kein Jahrzehnt später Hufbeschlagslehrmeister Anton Lungwitz (1845-1936) beim Rezensieren der textkürzeren zweiten Auflage einer Pferdehufkrankheitsabhandlung in der „Deutschen Zeitschrift für Thiermedicin und vergleichende Pathologie“ (1889) von Altbekanntheit aus: „»In der Kürze liegt die Würze«, sagt ein altes Sprüchwort, …“ Zumindest um 1900 war das Kurzhalten längst gute Sitte, behauptete ein gewisser Wolf Ernst Hugo Emil Graf von Baudissin (1867-1926) nebst Gattin Eva Gräfin im Ratgeber „Spemanns goldenes Buch der Sitte“ (1901). In dieser „Hauskunde für Jedermann“ monierte der Adlige, der unter dem Pseudonym Freiherr von Schlicht vornehmlich Militärs persiflierte: „... »in der Kürze liegt die Würze« wird bei den Reden nicht immer beobachtet und namentlich bei Jubiläen werden Reden von zwanzig Minuten und mehr losgelassen.“ Und Zudringlichkeiten in der Eisenbahn sollte eine Dame kurz und würzig parieren: „Ein Blick sagt zuweilen viel mehr als viele Worte und in der Kürze liegt die Würze – die kürzeste Strafrede ist zugleich die strengste, zu viele Worte schwächen den Eindruck der Rede nur ab.“ Um es dementsprechend kurz zu machen: In der geforderten Kürze konnte ich nicht herausfinden, wer im deutschen Sprachraum zuerst diesen Lehrsatz der schlichten Verblödung als Qualitätsmerkmal propagiert hat – und die Würze wollte ich dieser Abhandlung nicht nehmen.
cbothrw78epubv0
Episode 79: Wisch und weg
Tilgung von Unansehnlichem kann so einfach sein: Schwamm drüber! Den verräterischen Staub flugs mit dem Spongin-Skelett hingerichteter Hornschwämme (Dictyoceratida) weggewischt, schon ist man wieder sauber. Wie noch immer bei der Körperhygiene konnten die sessilen Meerestiere einst ebenso zur Säuberung der Schuldentafel eingesetzt werden – in der Realität benutzte der Gastwirt jedoch wohl eher einfach den dreckigen Handballen oder den vollgerotzten Ärmel, wenn der zechende Bettelstudent denn endlich gezahlt hatte. Naturschwämme, deren Stromatoporen genannten Vorläufer ironischerweise die Kreide nicht überlebten, waren wohl doch zu wertvoll zum Tafelwischen. Der Gewöhnliche Badeschwamm (Spongia officinalis) wurde gar erst seinem Namen vollends gerecht, als er schon durch den synthetischen ersetzt werden konnte – und sich ordentlich waschen und nicht stinken zählte in den zurückliegenden Jahrhunderten sowieso niemals zum Allerwichtigsten. Dagegen war saufen, fressen und einkaufen ohne genügend Geld schon seit jeher beim ungewaschenen Volk beliebt, bei jemandem in der Kreide stehen oder sein dementsprechend auch. Die Wendungen, die zum Schreiben geeigneten feinstkörnigen Kalkstein, Schulden und (Kredit-)Betrug verbinden sind seit dem 15. Jh. belegt. In Gasthäusern und Krämerläden wurden einst die ausstehenden Forderungen an die Kunden mit Kreidenotizen auf Tafeln oder Wänden festgehalten, bis sie erfüllt und per Wisch buchhalterisch getilgt wurden. Die religiöse Zahlungsbereitschaft konnte auch unchristlich „mit Kreiden“ vertagt bis verjährt werden, wie der zu schlechter Letzt kopflose Täufer Ludwig Hätzer (um 1500-1529) zuvor noch im undatierten Liedchen „Erzürn dich nicht O frommer Christ“ anmerkte. „Kreiden streichen“ schlug Johannes Agricola (1494-1566) in seiner Teütschen Sprüchwörter-Sammlung von 1548 (lediglich) zur betrügerischen wie freundschaftlichen Entschuldung vor. Aber insbesondere bei den wenig christlichen Wirten steht so mancher Zecher seit Jahrhunderten in der Kreide, denn selbst heutzutage soll es noch Kneipiers geben, die (kurz vor der eigenen Insolvenz) anschreiben lassen! Als ob es bei insolventen Alkoholikern irgendetwas zu holen gäbe?! In Stielers „Teutschem Sprachschatz“ (1691) war der Kreditsüchtige noch nicht in, sondern „an eines Kreide“, in Gottscheds „Grundlegung einer Deutschen Sprachkunst“ tauchte „bey einem in der Kreide stehen“ ab der zweiten Auflage von 1749 auf. In Adelungs „Versuch eines Wörterbuches der hochdeutschen Mundart“ (1775) ist der Vorgang der Verschuldung beschrieben: „Bey einem in die Kreide gerathen, in die Schuld, in die Rechnung.“ – inklusive kostenloser Kneipen-Empfehlung: „Immer frisch auf die Kreide los trinken.“
Ist man erst einmal in die Kreide gekommen oder geraten, dann wird zu allem Unglück noch mancher Gläubiger skrupellos mit doppelter bzw. zweifacher Kreide (an)schreiben oder (ab)rechnen. Dazumal, als das Betrügen noch illegal war und nicht branchenüblich, kamen spezielle, doppelt angespitzte Kreidestücke zum Einsatz oder der ganz schlaue Wirt machte einfach ein X für ein U vor [siehe Episode 26]. Im Gastronomie-Schwank „Der gute und böse Wirt“ (1561) von Hans Sachs (1494-1576) bleibt es beim betrügerischen Kreiden mit ’nem römischen Strich mehr: