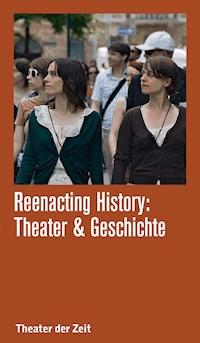
Reenacting History E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theater der Zeit
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Recherchen
- Sprache: Deutsch
The Battle of Gettysburg und das historische Gefecht der Völkerschlacht bei Leipzig, die Reenactments von Milo Rau und Janez Janša, Marina Abramović' "Seven Easy Pieces", "Gob Squad's Kitchen" und "Silent Walk" von Wirthmüller/Zanki: Mit dem Geschichtsboom seit der Jahrtausendwende ist die Wiederaufführung der Geschichte zu einem Paradigma der Erinnerungskultur und des Gegenwartstheaters geworden. Als populärkulturelle und künstlerische Praxis rückt das Reenactment in den Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit. "Reenacting History: Theater und Geschichte" stellt die Frage nach der Erscheinung und Erfahrung der Vergangenheit in den vielfältigen Formen des künstlerischen Reenactments und blickt dabei umfassend auf das Verhältnis von Theater und Geschichte. An zeitgenössischen Theaterproduktionen, Stücken sowie populären und künstlerischen Reenactments, an historischen Dramen und Aufführungspraktiken sowie philosophischen Konzepten untersuchen die Autorinnen und Autoren die prekäre Figur des "Dramas der Geschichte", gehen dem Verhältnis von Lebens- Geschichte und Szene nach und analysieren die Aufführung der Geschichte im Horizont eines Theaters der Wiederholung. Sie begreifen Theater als einzigartigen Ort der Aushandlung und Aneignung der Vergangenheit und erkunden "Geschichte in Zukunft" im Medium des Theaters. Der Band erscheint im Rahmen des DFG-Forschungsprojekt "Das Theater der Wiederholung" und einer Kooperation mit dem Theater an der Ruhr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reenacting History: Theater & Geschichte
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Reenacting History: Theater & Geschichte
Herausgegeben von Günther Heeg, Micha Braun, Lars Krüger und Helmut Schäfer In Kooperation mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig
Recherchen 109
© 2014 by Theater der Zeit
Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich im Urheberrechts-Gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
Verlag Theater der Zeit
Verlagsleiter / Publisher Harald Müller
Im Podewil | Klosterstraße 68 | 10179 Berlin | Germany
www.theaterderzeit.de
Redaktion: Andrea Hensel, Tamar Pollak, Eva Döhne, Marianne Seidler
Grafik: Bild1Druck, Berlin
Umschlagabbildung: Silent Walk von Britta Wirthmüller und Petra Zanki 2010. Gang durchs Leipziger Waldstraßenviertel © Douglas Abuelo
ISBN 978-3-943881-81-3
REENACTING HISTORY:THEATER & GESCHICHTE
Herausgegeben von Günther Heeg, Micha Braun,Lars Krüger und Helmut Schäfer
Vorwort
ERÖFFNUNG
Günther Heeg
Reenacting History: Das Theater der Wiederholung
Helmut Schäfer im Gespräch mit Günther Heeg
Theater und Geschichte – Genealogie einer Verflechtung
DRAMA/GESCHICHTE
Maximilian Grafe
„[…] aber sie hören nicht, dass jedes dieser Worte das Röcheln eines Opfers ist“
Der Körper in Dantons Tod und dessen Inszenierung durch Laurent Chétouane
Guido Böhm
Das ‚Drama der Geschichte‘ als sozialistisches Theaterereignis?
Fritz Bennewitz inszeniert Goethes Faust I und II am Nationaltheater Weimar 1965 und 1967
Lars Krüger
Die Verausgabung des ‚Dramas der Geschichte‘ in Heiner Müllers Der Bau
Tamar Pollak und Andrea Hensel
Literarische Zeugenschaft zwischen Fakt und Fiktion
Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel) und Jonathan Littells Die Wohlgesinnten
REENACTING HISTORY
Torben Ibs
Rituale der Erinnerung. Lichtfest Leipzig
Marcus Quent
Praktiken des Erinnerns. plan b: Monday Walks
Jeanne Bindernagel und Micha Braun
Mediale Rekonstruktionen
Zu historischem Ereignis und künstlerischem Reenactment in den Arbeiten von Thomas Harlan und Robert Kuśmirowski
Günther Heeg, unter Mitarbeit von Andrea Hensel, Elisabeth Kohlhaas und Tamar Pollak
Geschichte Aufführen: LeipzigÜberLeben
LEBENS-GESCHICHTE/LEBENSSZENE
Veronika Darian
Schauplätze des Lebens
Von well made lives, dem Alter und den Dingen
Vanessa Ganz
Zurück in die Zukunft
BioHistorioGraphie in andcompany&Co.s little red (play): ‘herstory’ oder: Was Lebensgeschichten über Vergangenheit, Gegenwart und Geschichtsnarrative in Deutschland erzählen
Sophie Witt
LebensSzene: Goethe mit Freud
Michael Wehren
Sieben Leben im Schnelldurchlauf
Anmerkungen zur Inszenierung zukünftiger Biographien in Gob Squads Before Your Very Eyes
Autorinnen und Autoren
Abbildungsnachweis
VORWORT
Mit dem Geschichtsboom seit der Jahrtausendwende erfährt das Reenactment als populärkulturelle und künstlerische Praxis eine ungeahnte Aufmerksamkeit. Schlachten-Reenactments wie The Battle of Gettysburg, die in den USA schon seit langem beliebt sind, finden auch in Europa in wachsendem Maße Anklang, wie jüngst die Nachstellung des historischen Gefechts der Völkerschlacht bei Leipzig zeigte. Reenactments von politischen Ereignissen, Auseinandersetzungen und Verbrechen wie Jeremy Dellers The Battle of Orgreave, das den britischen Bergarbeiterstreik 1984/1985 rekonstruiert, Rod Dickinsons Milgram Experiment oder Artur Żmijewskis Repetition, welches das Stanford-Prison-Experiment im osteuropäischen Kontext wiederholt, sowie Milo Raus Die letzten Tage der Ceauşescus, Hate Radio und Die Moskauer Prozesse stoßen auf ein interessiertes Publikum.
Aber auch die Wiederholung der Vergangenheit stärker reflektierende Arbeiten wie Elfriede Jelineks Theatertext Rechnitz (Der Würgeengel), eine Annäherung an ein Verbrechen der Kriegsendphase, Thomas Harlans Film Wundkanal mit dem SS-Obersturmbannführer Alfred Filbert als Hauptdarsteller, oder Janez Janšas Slovene National Theatre über die Verfolgung einer Roma-Familie lassen sich als Reenactments verstehen, genauso wie die Wiederaufführung der Montagsdemonstrationen in The Monday Walks von plan b oder der Silent Walk von Britta Wirthmüller und Petra Zanki durch das alte jüdische Viertel in Leipzig. Eine besondere Spezies unter den Reenactments stellen schließlich solche von künstlerischen Performances und Artefakten dar, wie etwa Marina Abramovićs Seven Easy Pieces, Gob Squad’s Kitchen, die Museums- und Sammlungsrekonstruktion Masyw kolekcjonerski von Robert Kuśmirowski oder Tanzreenactments wie Martin Nachbars Urheben Aufheben oder Fabian Barbas A Mary Wigman Dance Evening. Es gibt keinen Zweifel: Die Wiederaufführung der Geschichte im Reenactment ist zu einem Paradigma der Erinnerungskultur und des Gegenwartstheaters geworden.
Mit der Vielzahl und Vielfalt an Praktiken der wiederholenden Aneignung von Geschichte rückt das Reenactment verstärkt in den Fokus wissen schaftlicher Aufmerksamkeit. Für die Hinwendung zum neuentdeckten Paradigma der Geschichte und zur Praxis des ‚Geschichte Aufführens‘ steht allerdings vielerorts noch kein angemessenes begriffliches Instrumentarium bereit. Um hier Grund zu legen, stellen die Autorinnen und Autoren dieses Bandes die Frage nach der Erscheinung und Erfahrung der Vergangenheit in den unterschiedlichen Formen des Reenactments in den Kontext einer umfassenderen Untersuchung des Verhältnisses von Theater und Geschichte.
Im Fokus steht dabei eine doppelte Verflechtung von Theater und Geschichte: Zum einen in Gestalt des ästhetischen Historismus, in dem sich Theater und Geschichte verbinden, um die Kontinuität und Präsenz der Geschichte zu beglaubigen. Theatrale Künste des Vergegenwärtigens und Dramatisierens, des Erzählens, Einbildens und Affizierens sind darin unverzichtbar, um Geschichte als Sinnzusammenhang darzustellen, die Vergangenheit zu enthistorisieren und als Legitimationsgrund gegenwärtiger Mächte und Ordnungen zu behaupten. Der ästhetische Historismus ist kein Phänomen des 19. Jahrhunderts. In jeweils aktuellen Varianten seiner zentralen Figur des ‚Dramas der Geschichte‘ begegnet er uns in der Gegenwart in der Populärkultur ebenso wie im Theater, im Film und in der Wissenschaft.
Den zweiten Pol der Verflechtung von Theater und Geschichte bildet die Vorstellung von Geschichte als einem Theater der Wiederholung. Kennzeichnend dafür sind die Metaphern des Schauspiels, der Maskerade, der Posen und Kostüme, die uns bei Schriftstellern und Denkern wie Büchner, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Deleuze und Heiner Müller begegnen. Sie unterstreichen die Uneigentlichkeit und Sekundarität geschichtlicher Vorgänge und dekonstruieren den legitimatorischen Anspruch der Geschichtsbilder und Geschichtskonstruktionen. Gleichzeitig wird das Konzept des Theaters der Wiederholung der Historizität der Gegenwart gerecht, indem es diese als von allen Effekten der Wiederkehr und des Nachlebens anderer Zeitschichten und Zeiträume durchzogen begreift. Es ermöglicht so, Theater als einzigartigen Ort der Aushandlung und Aneignung der Vergangenheit in der Gegenwart zu begreifen und ‚Geschichte in Zukunft‘ im Medium des Theaters zu erkunden.
Reenacting History: Theater & Geschichte geht dieser doppelten Verflechtung von Theater und Geschichte nach. An zeitgenössischen Theaterproduktionen, Stücken sowie populären und künstlerischen Reenactments ebenso wie an historischen Dramen und Aufführungspraktiken sowie philosophischen Konzepten untersuchen die Autorinnen und Autoren die prekäre Figur des ‚Dramas der Geschichte‘, folgen dem Verhältnis von Lebens-Geschichte und Szene und beschreiben und analysieren die Theorie und Praxis des künstlerischen Reenactments.
Der Band ist aus einem Symposium und Vorträgen im Rahmen des DFG-Forschungsprojekts Das Theater der Wiederholung und einer Kooperation mit dem Theater an der Ruhr, Mülheim, hervorgegangen. Die Herausgeber danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finan zielle Unterstützung der Publikation. Zugleich gilt der Dank Andrea Hensel, Tamar Pollak, Eva Döhne und Marianne Seidler für ihre Mitarbeit bei der Einrichtung des Bandes.
Leipzig, im März 2014
Die Herausgeber
ERÖFFNUNG
Günther Heeg
REENACTING HISTORY: DAS THEATER DER WIEDERHOLUNG
Abschied von gestern
Ein Reenactment ist nach dem Verständnis der Liebhaber dieser populären Form der Geschichtsaneignung die Wiederaufführung eines genau umrissenen historischen Ereignisses, z. B. der Schlacht von Gettysburg, einer der blutigsten der amerikanischen Geschichte und Wendepunkt des amerikanischen Bürgerkriegs. In einem Reenactment der Schlacht kommt es darauf an, das historische Geschehen so detailgetreu wie möglich nachzustellen, in Uniformen, deren Materialien denen zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs entsprechen, und mit Gewehren, die exakt auf dem technischen Stand von damals sind. Der immersive Historismus dieser populären Praxis, das Versprechen des Eintauchens in die Zeit eines historischen Ereignisses, wurde jahrzehntelang von Seiten der Wissenschaft und Kunst belächelt oder kaum beachtet. Erst mit dem Geschichtsboom, der seit der Jahrtausendwende eine lang andauernde Hausse erlebt, wurde das Reenactment ein Gegenstand, eine Form und eine Praxis, mit der sich Künstler und Wissenschaftler bis in die Gegenwart beschäftigen und auseinandersetzen. Die Resultate der künstlerischen Reenactments, die in den vergangenen gut zehn Jahren entstanden sind, und der Grad der theoretischen Reflexion dieses Phänomens fallen äußerst unterschiedlich aus. Das hat zum einen zu tun mit der Nähe oder reflektierten Distanz der künstlerischen Praxis des Reenactments zu den angeführten Basisregeln der populärkulturellen Reenactments. Zum anderen mit vorherrschenden Theoremen und Konzepten des Darstellens in der (Theater)Wissenschaft, die in den vergangenen Jahren den Blick auf das Verhältnis von Theater und Geschichte versperrten und eine angemessene theoretische Befassung mit der künstlerischen Praxis des Reenactments behinderten.
Die künstlerische Praxis des Reenactments hat in den letzten Jahren in Teilen der wissenschaftlichen Rezeption, vor allem in Deutschland, den Status einer authentischen Erfahrung erlangt, wie er vor zwanzig Jahren der Performance zugeschrieben wurde. Das erscheint auf den ersten Blick paradox. Denn von den unterschiedlichen Entstehungsherden des künstlerischen Reenactments ist einer der bedeutendsten der einer immanenten Selbstkorrektur der Performancetheorie und -praxis. Peggy Phelans ontologische Festlegung der Performance als absolut präsentisch, nicht reproduzierbar und unwiederbringlich vergänglich1 wurde durch die vor zehn Jahren einsetzenden Reenactments von Performances2 und entsprechende theoretische Neuansätze entscheidend modifiziert. Life, once more und Performing Remains heißt es nun in Abkehr von der These von presence und disappearence der Performance programmatisch im Titel der Bände von Sven Lütticken3 und Rebecca Schneider4. Künstlerische Reenactments früherer Performances betreiben die historisch-praktische Kritik der Performancetheorie und leiten den Abschied von gestern ein. Zur Verabschiedung steht an der Mythos der Präsenz und der Performanz, der den Mainstream der Performance- und Performativitätstheorie in den vergangenen Jahren getragen hat. Dieser Abschied fällt offensichtlich nicht leicht. Denn für die Hinwendung zum neu entdeckten Paradigma der Geschichte und zur Praxis des ‚Geschichte Aufführens‘ steht vielerorts kein angemessenes begriffliches Instrumentarium bereit. Deshalb herrschen unter den Arbeiten, die in jüngster Zeit zur künstlerischen Praxis des Reenactments erschienen sind, Begriffe vor, die ihren angestammten Platz innerhalb der Metaphysik der Präsenz innehaben. Zu den prominentesten unter ihnen zählt der Begriff der ‚Vergegenwärtigung‘ und mehr noch der ‚Verlebendigung‘ des ‚toten‘ Vergangenen sowie die Propagierung von dessen ‚unmittelbarem körperlichen Erleben‘. Das sind Begriffe, die auch den Diskurs des ästhetischen Historismus prägen, der hierzulande gerade im Hinblick auf seine Bedeutung für die gegenwärtige affektive Gier nach Geschichte nicht aufgearbeitet ist.5 Ein dem Mythos der Präsenz verhaftetes Konzept des Reenactments ist daher nicht der Widerpart des Historismus, sondern dessen unfreiwillig-unreflektierter Komplize. Das gilt für die Praxis wie für die Theorie, die diesen Zusammenhang bislang zu wenig bedacht hat. Ein Großteil der künstlerischen Reenactments der jüngeren Vergangenheit lässt sich Kerstin Stakemeier zufolge als „performte(r) Historismus“ bezeichnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























