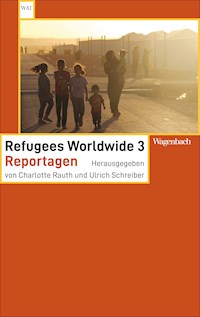
Refugees Worldwide 3 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob von Pakistan in die USA, von Libyen in die Niederlande, von Venezuela nach Argentinien oder von Kamerun nach Wales, die Fluchtgeschichten sind vielfältig und komplex, berührend und trotz aller Härten nicht frei von Hoffnung. Wenn Taqi Akhlaqi aus Kabul im Sommer 2021 berichtet oder Habib Abdulrab Sarori von der Lage im »Dschungel von Calais«, dann rückt in den Fokus, um was es beim Thema Migration wirklich geht. Matthias Nawrat hingegen wirft einen Blick in die Historie der Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Die sich häufenden Extremwetterereignisse zeigen, dass klimabedingte Migration eines der zentralen Themen der Zukunft sein wird. Wir sollten genau hinhören, hinschauen, lesen, mitfühlen und tätig werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Charlotte Rauth und Ulrich Schreiber
Mit freundlicher Unterstützung von
E-Book-Ausgabe 2022
© 2022 für die deutsche Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Julie August unter Verwendung einer Fotografie © Tom Ruebenach. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4345 7
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2850 8
www.wagenbach.de
Vorwort
Seit 2018, der Publikation des zweiten Bandes unserer Reihe »Refugees Worldwide«, ist die Zahl der vertriebenen Menschen weltweit weiter angestiegen und liegt inzwischen laut dem Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) bei über 84 Millionen (Stand Mitte 2021). Sosehr diese Zahl die Leserschaft zu bewegen vermag, so sehr bleibt sie zugleich ein Abstraktum, fernab jeglicher Lebensrealität, individueller Erfahrungen und Sichtweisen. In Anknüpfung an die ersten beiden Bände »Refugees Worldwide« (2017) und »Refugees Worldwide 2« (2018) ist das Ziel auch des dritten Bandes, einer verallgemeinernden und eurozentrisch geprägten Erzählung von Flucht und Migration entgegenzuwirken und einzelne Stimmen, ihre Erlebnisse und Gedanken zu Wort kommen zu lassen. Fünfzehn Autorinnen und Autoren lassen uns in ihren literarischen Reportagen teilhaben an ihren Geschichten, Träumen und Visionen, an ihrer je eigenen Auffassung von Zugehörigkeit und des politischen, medialen und gesamtgesellschaftlichen Umgangs mit Migration.
So schildert Taqi Akhlaqi den oft schmerzhaften Anfang in einem neuen Land anhand seines eigenen Weges von Iran nach Afghanistan und, nach der Machtübernahme durch die Taliban im Sommer 2021, weiter nach Deutschland. Vor dem Hintergrund seiner Familiengeschichte der Emigration setzt sich Matthias Nawrat mit den Fluchterfahrungen von Ayub und Farhad und ihren aktuellen Lebensbedingungen in Berlin auseinander. Mark Isaacs beschreibt wiederum die prekäre Rechtslage um den Aufenthaltsstatus von Eingewanderten in Australien anhand der Situation Akbar Jaffaries und Ali Jafaris, die bereits 1999 und 2008 von Afghanistan aus übersiedelten. Von Pakistan aus folgen wir Raza Ahmad Rumi, der in Lahore einem Mordanschlag entkam, in die USA und seinem Prozess des Ankommens in einer nordamerikanischen Kleinstadt im Kontext von institutionalisiertem Rassismus und der erstarkenden Black-Lives-Matter-Bewegung. Die Vereinigten Staaten sind für Pía, eine der von Inés Garland interviewten Venezolaner*innen, nur eine Zwischenstation; sie emigrierte infolge zunehmender alltäglicher Gewalt und fehlender Grundversorgung von Venezuela nach Argentinien. Physische Auswirkungen von Vertreibung, etwa durch eine fehlende Grundversorgung mit Medikamenten, thematisiert Jonathan Garfinkel anhand der Erfahrungen von Personen mit chronischen Krankheiten auf ihrer Flucht aus Syrien und dem Jemen. Und er beschreibt das Leid von Kindern indigener Gemeinschaften in Kanada im Zuge ihrer Zwangsumsiedlung durch die Regierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die persönlichen Erfahrungen Joudi Alhalabees auf dem Weg von Damaskus über Kairo nach Dortmund sowie deren Konsequenzen für ihren Bildungsweg sind Thema von Judith Kuckarts Reportage, während Matthieu Aikins die Situation afghanischer Geflüchteter in Begegnung mit internationalen, darunter südkoreanischen und amerikanischen, Missionaren in Athen beschreibt.
Im Gespräch mit Ra’id geht Jalal Barjas der Situation von aus Syrien migrierenden Menschen in Jordanien nach, wo traditionell eine aufgeschlossene Haltung ihnen gegenüber vorherrscht. Nach der Skizzierung eines historischen Verlaufs seit der italienischen Besetzung Libyens 1925 erzählt Razan Naim Elmoghrabi von ihrer eigenen Flucht vor dem Regime Muammar al-Gaddafis und den zunehmenden Restriktionen der Meinungsfreiheit in Libyen 2014. In ihre Reportage verwoben ist die Frage danach, wie ein neues Gedächtnis in ihrem niederländischen Exil aufgebaut werden kann; eine Frage, die auch Widad Nabi im Gespräch mit ihrer Mutter und weiteren Personen zwischen fünfzig und siebzig Jahren umtreibt, die den Großteil ihres Lebens in Syrien verbracht haben und nun in Berlin leben. Habib Abdulrab Sarori zeichnet die Wege Alwans und Hadschis aus dem Jemen und Eritrea über Libyen und Italien nach Frankreich nach, dort insbesondere die Lebensbedingungen in Calais in der Hoffnung auf eine Möglichkeit, nach Großbritannien weiterziehen zu können. Auf die Situation emigrierter Personen in Wales geht Eric Ngalle Charles näher ein anhand einer Darstellung der gewaltvollen Geschichte von Martha Mwamba Ngoro in Kamerun im Kontext der kolonialen Vergangenheit des Landes und ihrer politischen Auswirkungen bis heute.
Zuletzt finden wir uns wieder dort ein, wo die Erzählungen begonnen haben: Im Dialog reflektieren Omar Sheikh Dieh und Ben Mauk in Berlin darüber, was es heißt, eine Gemeinschaft zu verlassen, über das Selbstbild Deutschlands, seinen Umgang mit geflüchteten Personen und die gängige Festschreibung ihrer Existenz auf einen Herkunftsort und das Fluchtmoment. Wie eine Linie durchziehen diese und die voranstehenden literarischen Reportagen in diesem Band persönliche Antworten auf die Frage: Was bedeutet es für einen Menschen, zu flüchten oder geflohen zu sein?
Charlotte Rauth und Ulrich Schreiber im Dezember 2021
Die Welt ist ein ewiger Weg
Taqi Akhlaqi
Aus dem Persischen von Jutta Himmelreich
Als ich mein damaliges Leben, mein Zuhause erstmals hinter mir lassen und mich auf den Weg in ein anderes Land machen musste, hatte ich monatelang das Gefühl zu ersticken. Nachts wachte ich auf, weil ich husten musste, bis mir die Luft fast wegblieb, und tagsüber plagte mich ein Schmerz in der Brust, der mir bis in die Kehle kroch. Zugleich blieb mir keine Zeit, zur Ruhe zu kommen und ungestört über meine Probleme nachzudenken. Ich musste auf dem Weg in ein neues Leben möglichst normal und fröhlich wirken. Dabei war ich alles andere als normal und unbekümmert. Wie gern hätte ich, wenigstens ein paar Tage lang, ein Zimmer für mich allein gehabt, um, von den anderen unbemerkt, weinen zu können, in der Hoffnung, so den Schmerz in meiner Brust zu lindern. Leider hatten wir als achtköpfige Familie aber nur ein Zimmer, drei mal vier Meter klein. Ich hatte also keine Gelegenheit, mein verlorenes Leben zu beweinen. In meinem Tagebuch habe ich diese beklemmende Zeit in folgenden Satz gefasst: »Ich habe das Gefühl, unter Wasser zu atmen.«
Genau so war es. Die Luft war wie eine zähe Masse, ohne die geringste Spur von Sauerstoff. Ich war, von mir unbemerkt, ertrunken. Um am Leben zu bleiben und in der neuen Umgebung Luft zu bekommen, musste ich meine Lungen quasi über Nacht zu Kiemen machen. Ich glaube, es geht allen Geflüchteten so, dass sie um des schlichten Überlebens willen Körper und Geist transformieren müssen. Und weil sich diese Verwandlung in kürzester Zeit vollzieht, tut sie unsäglich weh.
Morgens wachte ich regelmäßig aus Träumen von meinem früheren schönen Leben auf, und sobald mir dann klar wurde, dass ich jetzt in einer anderen Welt war, weit von meiner bisherigen entfernt, bekam ich einen bitteren Geschmack im Mund und Herzkrämpfe vor Kummer. Weder konnte ich hinnehmen, dass ich alles verloren hatte, noch, dass es keinen Weg mehr zurück in mein einstiges Zuhause gab. Mein Gehirn versuchte, mir zu helfen, indem es mir Trugbilder zeigte, die Traum und Wirklichkeit miteinander vermischten. Es führte mich oft zurück in meine Lieblingsstraßen und an Lieblingsorte und gesellte mir meine Freunde und die geliebten Menschen an die Seite, die ich nie mehr wiedersehen konnte. Wie in Trance versenkte ich mich möglichst tief in diese Bilder. Zu gern hätte ich morgens länger geschlafen und weiter geträumt, aber das kam nicht infrage. Dem realen Leben war meine Traurigkeit einerlei, es musste einfach weitergehen. Mein Bauch forderte Essen, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern setzten ihre Hoffnungen in mich. Ich war der Erstgeborene und hatte gerade meinen Schulabschluss gemacht. An Universität und Studium war nicht zu denken. Ich musste die Ärmel hochkrempeln und Brot beschaffen. Langsam dämmerte mir, dass ich nicht nur meine Vergangenheit verloren hatte, sondern auch meine Zukunft. Meine Träume von gestern – lernen, studieren, glänzen – waren ausgeträumt. Stattdessen war ich in ein tiefes Loch gestürzt, aus dem ich nicht wieder rauskam, in einen stockdunklen Brunnen voller Wasser.
*
Es verwundert Sie vielleicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich Iran im Alter von achtzehn Jahren in Richtung meiner Heimat Afghanistan verlassen habe und diesen Ortswechsel als erste Flucht meines Lebens betrachte. »Weshalb dieser Aufbruch?«, mögen Sie fragen. Meine gesamte Kindheit und Jugend hatte ich in Iran verbracht. Ich bin dort zur Schule gegangen und groß geworden. Die iranische Gesellschaft, ihre Kultur, ihre Werte waren mir vertraut. Meine besten Freunde und die Lehrer, an deren Denk- und Lebensweise ich mich ausgerichtet hatte, waren Iraner. Über Afghanistan wusste ich im Grunde nichts mehr. Wenn ich zurückdenke, stelle ich fest, dass alle meine Erinnerungen von Iran geprägt sind. Weil Iran aber, rechtlich gesehen, nicht mein Land war, musste ich nach Afghanistan aufbrechen und hoffen, mir dort ein dauerhaftes Zuhause aufbauen zu können. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, obwohl ich sehr stark das Gefühl hatte, mein Zuhause aufzugeben.
Meine Geschichte gleicht der aller Flüchtenden der zweiten und dritten Generation, denen man es verwehrt, das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen sind, als ihr Heimatland zu bezeichnen, und die man nicht als offizielle Staatsbürger anerkennt. Und wenn sie in das Land ihrer Vorfahren zurückkehren, kommen sie auch dort nicht zur Ruhe, weil sie sich nicht zu Hause fühlen und entfremdet und orientierungslos umherirren. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass wir, einmal vertrieben, unser Herz an kein Haus mehr hängen, nie wieder irgendwo heimisch werden. Wir wissen, der Boden unter unseren Füßen ist instabil, und es wäre äußerst unklug, darin Wurzeln schlagen zu wollen. Das Zuhause wird zu kalten vier Wänden, zur seelenlosen Behausung, die nur als Schlafplatz dient, als Dach überm Kopf. Und die Kälte aus Dach und Wänden erfasst auch die Menschen auf der Flucht.
Erst als ich in Afghanistan angekommen war, fiel mir auf, dass ich so gut wie nichts über mein Land wusste. Toiletten, Badezimmer, Fenster, Größe und Form von Wohnräumen, die Art zu leben und selbst ethische und soziale Werte wichen stark von dem ab, was ich erwartet hatte. Während ich aus Iran Strom, Gas, fließendes Wasser und andere Annehmlichkeiten gewöhnt war, musste ich mich in Kabul an Holzöfen und staubige oder matschige Straßen gewöhnen. Ständig stieß ich auf verstörende, mir unbegreifliche Verhaltensweisen. So sah ich schon am Tag meiner Ankunft in Kabul zwei Männer an einem Straßenrand hocken und ungeniert an eine Mauer urinieren, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt. Tage später fielen mir Burkaträgerinnen auf, die in Gassen und Nebenstraßen hockten. Als sie sich erhoben, stellte ich befremdet fest, dass sie ihr Geschäft verrichtet hatten. Gewöhnungsbedürftig war auch, dass wir täglich nur vier Stunden Strom hatten, jeweils nach Sonnenuntergang. Danach lag Kabul in tiefer Finsternis, was hieß: keine Abendspaziergänge, kein Lesen, keine Telefonate über Literatur mehr. Abends bellten Straßenhunde mich in den Schlaf, und morgens weckten mich die Hahnenschreie in der Nachbarschaft.
Bei jedem meiner Behördengänge fiel sofort mein iranischer Akzent auf, die Angestellten trieben ihre Späße mit mir, nutzten meine Ahnungslosigkeit über die Funktionsweise des afghanischen Verwaltungsapparats aus, und selbst für so bescheidene Anliegen wie die Beglaubigung von Schulzeugnissen hetzten sie mich tage- und wochenlang von einem Amt zum anderen. Menschen, die bereit waren, meine Fragen zu beantworten oder mir den Weg durch das Gewirr dunkler, enger, feuchter Amtsflure zu weisen, fanden sich kaum. In meinem ersten Jahr in Kabul habe ich mich genauso allein, verloren und fremd gefühlt wie während all meiner Jahre in Iran. Ist das nicht merkwürdig? Eigentlich sollte man sich in seinem eigenen Land doch wohler fühlen als anderswo.
Über Jahre hinweg zogen nach dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 viele junge Afghaninnen und Afghanen aus den Nachbarländern ihrer Heimat zurück nach Afghanistan, weil sie helfen wollten, ihr Land zu erneuern. Sie wurden leider unentwegt diskriminiert. Für aus Iran zurückgekehrte Leute wie mich hatte man den Begriff Iranigak geprägt: Iranerchen. Diese Bezeichnung habe ich unzählige Male und von unterschiedlichster Seite gehört, meist mit verächtlich ironischem Unterton. Andere setzten ihn ätzend aggressiv als Schimpfwort ein. Wer sich als echten, authentischen Afghanen sah, weil er während der Kriegsjahre im Land geblieben war, begegnete afghanischen Staatsangehörigen mit Fluchterfahrung überheblich und machte bisweilen aus seinem Hass keinen Hehl.
Das hatte zur Konsequenz, dass mein ohnehin kompliziertes Verhältnis zu meinem Land Afghanistan noch komplizierter wurde. Trotzdem nahm ich mir vor, nicht zu verzweifeln, sondern im Land zu bleiben und mich im zerstörten Kabul zu behaupten. Ich habe in dieser Stadt geheiratet, bin Vater zweier Söhne geworden, habe Bücher gelesen, geschrieben, gearbeitet und ein Haus gebaut. Siebzehn Jahre lang habe ich mich nach Kräften mit allen Unwägbarkeiten arrangiert, bin durch Kabuls staubige Straßen spaziert, habe in eiskalten Wintern dafür gesorgt, dass genug Ofenholz im Haus war, ließ mir von der sengenden Sonne die Haut verbrennen, habe Kabuls Früchte gegessen, an den Brunnen der Stadt getrunken, mich unters Volk gemischt, sogar Freunde gefunden. Hier habe ich Erinnerungen gesammelt, hier habe ich gelernt, und hier bin ich gewachsen. Siebzehn Jahre lang! Kabul und ich sind im Laufe dieser Zeit gemeinsam groß geworden, wir haben uns gemeinsam verändert und Schwierigkeiten bewältigt. Wie zwei alte Freunde, Hand in Hand. Ich hatte sogar das Gefühl, hier endlich Fuß gefasst, in Kabuls Erde Wurzeln geschlagen zu haben. Ich brauchte diese Stadt, um zu wachsen, und sie brauchte mich. Unsere Beziehung wurde inniger und machte mir Mut, zu träumen, langfristige Zukunftspläne zu schmieden, bis am 15. August 2021 alles wieder kaputtging. Dämonen in Gestalt der Taliban suchten uns heim und übernahmen in einem Wimpernschlag alles. Kabul und ich sind zusammengestürzt. Wieder musste ich meine Wurzeln kappen und nach neuer Erde suchen, meine Blätter wurden gelb und welk. Wieder war alles zunichte!
*
Das Geschöpf, das wir Mensch nennen, von der Wissenschaft als Homo sapiens bezeichnet, brach vor rund sechzig- bis siebzigtausend Jahren, aus Afrika kommend, zu anderen Kontinenten auf und besiedelte allmählich den gesamten Erdball. Seitdem, und bis zum heutigen Tag, ist der Mensch nicht zur Ruhe gekommen. Er war entweder auf der Flucht vor Krisen und Katastrophen oder auf der Suche nach natürlichen Ressourcen und besseren Lebensgrundlagen, immer unterwegs. Demnach ist die Feststellung nicht abwegig, dass wir alle auf die eine oder andere Weise Flüchtende sind. Selbst wenn wir nicht Jahrhunderte weit zurückschauen, sagt uns die Geschichte, dass jeder Mensch sein Haus verlieren kann. So wie ich, für den es bis vor zwei Monaten unvorstellbar gewesen war, sein Haus in Kabul zu verlieren. Ein Blick auf die weltweite Corona-Pandemie zeigt, dass im vergangenen Jahr Millionen von Menschen plötzlich nicht zurück nach Hause konnten, weil sie unfreiwillig irgendwo festsaßen: die einen auf Ozeandampfern im Meer, andere in Hotels, wieder andere in den Bergen. Zu dem Zeitpunkt wusste niemand, wohin die Zukunft führen würde.
Nun stellt sich die Frage: »Wenn unsere Häuser so unsicher sind, weshalb hängen wir so sehr an ihnen?« Daraus folgt die nächste Frage: »Was ist ein Haus überhaupt?« Mit am treffendsten hat Thomas Mann diese Frage beantwortet, während seiner Jahre in Nordamerika: »Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir. Ich lebe im Kontakt mit der Welt, und ich betrachte mich selbst nicht als gefallenen Menschen.« So gesehen, wird Heimat nicht durch geografische Orte bestimmt, sondern durch Menschen. Ist das nicht eine poetische Vorstellung? Dass ein Land dich auf Schritt und Tritt umgibt wie eine unsichtbare Aura? In meinen Augen bestehen die Menschen vor allem aus ihrer Sprache. Auch wenn ich auf Persisch denke und über Kabul schreibe, bin ich nach wie vor ein kleines Afghanistan. Wie lange aber werde ich Klein-Afghanistan bleiben?
In den letzten Jahren habe ich viel geschrieben, aber auf Persisch nichts veröffentlicht. In der leider so bedrohlichen Atmosphäre der Angst im Land, die jeden anders Denkenden, jede anders Redende verschlingt, habe ich mich zurückgezogen und meine Texte in der Hoffnung verfasst und aufbewahrt, sie eines Tages einer Leserschaft zugänglich machen zu können. Dieser Tag aber kam nie. Persisch denken oder schreiben wurde täglich schwieriger. Mit der Ankunft der Taliban wurde die aufkeimende Meinungsfreiheit erstickt, und wieder wurde der Raum, in dem man atmen und sich öffnen kann, enger, die Luft immer dünner. Stetig steigt nun die Zahl verbotener Wörter, verbotener Themen, verbotener Bücher ins Unermessliche, bis Denken und Schreiben eines Tages vollends unmöglich sein werden. George Orwells Warnungen vor einem gnadenlos autokratischen System sind für uns längst über das Stadium einer Zukunftsvision hinausgelangt und, weithin sichtbar, zur objektiven Realität geworden.
Gibt es, trotz alledem, für einen Schriftsteller aus Afghanistan einen Hoffnungsschimmer am Horizont? Was nützt es mir, ein kleines Afghanistan zu sein oder weiterhin auf Persisch schreiben zu wollen? Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, auch meiner Sprache zu entsagen? Viele andere haben das getan. Atigh Rahimi schreibt auf Französisch, Khaled Hosseini auf Englisch, und allem Anschein nach sind beide erfolgreich und zufrieden. Die jüngere Generation afghanischer Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Lyrikerinnen und Lyriker flüchtet sich nicht nur ins Französische und ins Englische, sondern nimmt auch im Deutschen, im Schwedischen und in anderen europäischen Sprachen Zuflucht. Vielleicht sind die Worte, die ich hier schreibe, die letzten, die ich in meiner Muttersprache zu Papier bringe, und ich fange danach in einer anderen Sprache ein neues Leben an. Als ich Kabul hinter mir ließ, wurden die Wörter im Staub der Traurigkeit zertreten und so verdreht, dass sie sich nicht mehr zu korrekten Sätzen zusammenfügen ließen. Mir geht es wie ihnen. Vielleicht ist es jetzt Zeit für eine noch größere Flucht, Zeit, aus einer Sprache, in der ich fünfunddreißig Jahre lang gelebt habe, in eine andere Sprache aufzubrechen.
*
Letzte Woche besuchte mich ein Künstler, Fotograf. Er wollte ein paar Porträts von mir machen. Während er seine Werkzeuge inspizierte und einsatzbereit machte, tranken wir Tee und redeten über Kunst. Dabei gestand er mir: »Ich habe euch Schriftsteller immer beneidet. Ihr braucht nur einen Stift und Papier. Mehr nicht. Wir dagegen …« Lachend deutete er auf seine umfangreiche Ausrüstung. Sie können sich vielleicht denken, was ich ihm geantwortet habe: »Als Schriftsteller habe ich euch Fotografen, Maler, Filmemacher, Musiker, Bildhauer immer beneidet. Ihr erschafft eure Werke in Bildersprachen, die keiner Übersetzung in andere Sprachen bedürfen. Heutzutage kann man Bilder sofort rund um den Globus zeigen.«
Ich hatte meinen Satz kaum beendet, als mir ein Gedanke kam: Selbst bildende Künstler müssen ja in einer Sprache denken, planen, Entscheidungen treffen. Bleiben sie ihrer Muttersprache bis ans Ende treu, um ihre künstlerischen Ziele zu erreichen, oder gelangen sie im Laufe ihrer Karrieren an Punkte, an denen sie, warum auch immer, ihre Sprache zugunsten einer anderen aufgeben müssen? Mein Entschluss, in einer anderen Sprache zu schreiben, steht fest. Einfach ist das sicher nicht. Ich weiß, dass es vielleicht Jahre dauern wird, und das klingt zum jetzigen Zeitpunkt wenig erfolgversprechend. Es kann auch passieren, dass ich nach meiner Loslösung vom Persischen für den Rest meines Lebens orientierungslos umherschwebe, wie ein Astronaut, der im All aus seiner Raumkapsel gestiegen ist. Ich weiß auch, dass das Auswandern aus der Muttersprache mit Identitätsverlust einhergeht und man zu einem neuen, sich selbst unter Umständen fremden Wesen wird. Aber welche Alternative habe ich?
Ich kenne einen Autor, der auf Persisch und auf Deutsch schreibt. In Deutschland wird er geschätzt, in seinem eigenen Land gerichtlich verfolgt, drangsaliert, bedroht. Ein mir bekannter Kunstmaler hat seine Bilder verbrannt, als die Taliban anrückten, während er außerhalb Afghanistans Anerkennung und Käufer für seine Arbeiten findet. Was soll man mit einer solchen Heimat, solchen Mitmenschen, einer solchen Sprache machen? Einerseits kann man nicht aufhören, sie zu lieben, andererseits vergisst man die Wunden nicht, die sie geschlagen haben: eine verwickelte Beziehung, die du am liebsten beenden würdest, weil dein Leben ohne sie einfacher und leichter wäre. Eine Beziehung, die du aber nicht endgültig hinter dir lassen kannst, an der du gleichzeitig auch nicht festhalten und die du sicherlich nicht genießen kannst. Solche Wünsche helfen nichts, sie lindern deinen Schmerz nicht. In Wahrheit steckst du in diesem Zwiespalt fest.
Vielleicht werden wir, die Kriegsvertriebenen, niemals zur Ruhe kommen und uns ewig ver(w)irrt nur um uns selbst drehen. Wie Sisyphos. Was uns bleibt, sind die Gedanken an die kleinen Genüsse aus vergangenen Zeiten – Erinnerungen, die man mit viel Mühe und um den hohen Preis entsetzlicher Bitterkeit errungen hat.
Jetzt, da meine Zukunft nicht rosig aussieht, verkrieche ich mich in der nostalgischen Rückschau auf meine Vergangenheit. Es liegt zwar ein langer Weg hinter mir, aber er hat mich nirgendwo hingeführt. So wird es wohl weitergehen: vor mir ein langer Weg, ohne Ziel. Für einen Geflüchteten ist das die Welt, ein stetiger Prozess.
*
Das Leben Geflüchteter wird von zwei Gegebenheiten gezeichnet: vom Verlust der Menschenwürde und von dem langen Warten in Ungewissheit. Menschen, die bis gestern ein ganz normales Leben führten, morgens aufstanden, zur Arbeit gingen, lernten, studierten, Ersparnisse hatten, im Kreis von Familie und Kindern zu Abend aßen und anschließend Fußball und Filme schauten, kämpfen plötzlich ums nackte Überleben. Man sieht sie, in langen Schlangen stehend, auf Essen warten, sieht sie Stacheldrahtzäune überwinden, vor Polizisten fliehen, in Kisten und unter Bäumen nächtigen, sich an Lkws hängen, ihre Verwandten, selbst Kinder, in seeuntüchtigen Schlauchbooten auf hochgefährliche Reisen schicken. Einigen schwinden die Kräfte dabei in unfassbar kurzer Zeit.
Alle meine Angehörigen, außer mir und einem meiner Brüder, sind noch in Kabul: Vater, Mutter, drei Schwestern und zwei Brüder. Meine Geschwister würden Kabul nur zu gern verlassen und anderswo in Sicherheit leben. Aber für meine Eltern ist die Vorstellung, Haus und Hof aufzugeben und in die Fremde zu ziehen, der schrecklichste Albtraum. Vielleicht spüren sie, dass es ihnen an Kraft und Motivation mangelt, anderswo neu anzufangen. In den letzten zwei Monaten habe ich oft versucht, sie davon zu überzeugen, doch sie lassen sich nicht umstimmen. Mein Vater sagt: »Ich, mit meinem weißen Bart, kann Verachtung nicht ertragen. Wenn die anderen gehen wollen, sollen sie gehen.« Ich spüre, dass er das genau so meint, und halte ihm nichts entgegen.
Mir kommt eine längst vergangene Begebenheit in den Sinn. Ich bin zehn und zusammen mit meinem Klassenkameraden, auch Afghane, auf dem Weg zur Schule. In einer ruhigen Nebenstraße umzingeln uns ein paar Jugendliche, vierzehn, fünfzehn Jahre alt vielleicht, jedenfalls älter als wir, und versperren uns den Weg. Sie beschimpfen uns rassistisch: »Dreckige Afghanen!« Sie ohrfeigen und treten uns. Wir haben panische Angst, wünschen uns, dass die Schläge aufhören und wir unseren Weg fortsetzen können. Bevor sie uns schließlich ziehen lassen, kommt einer der Jungen ganz nah und spuckt uns beide an. Für uns ist aber die Hauptsache, dass sie uns gehen lassen, denn wenn wir zu spät zur Schule kommen, bereitet uns das zusätzlichen Stress. Als wir am Schultor ankommen, bemerke ich, dass mein Kamerad noch Spucke an der Schulter hat. Auf seiner Jacke prangt, unübersehbar, ein großer Placken Rotz. Wir müssen ihn wegwischen, haben aber weder ein Taschentuch noch etwas anderes zur Hand, und die Zeit drängt. Mein Freund weint vor Verzweiflung. Ich wische ihm mit meinem Jackenärmel die Spucke von der Schulter. Das ist so ekelhaft, dass ich mich fast übergeben muss, aber ich kann meinen Brechreiz niederringen und sage: »Sauber, siehst du. Lass uns reingehen.« Er hebt und senkt die Schultern und kommt schnell mit mir ins Schulhaus.
Diese Spucke habe ich aber nie wirklich wegwischen können. Sie haftete untilgbar auf meines Freundes Schulter und an meinem Jackenärmel. An jenem Tag habe ich begriffen, dass ich zu einem Ort namens Afghanistan gehöre, dass ich in Iran als Geflüchteter gelte und was Geflüchteter heißt. Vielleicht hatte jemand vor langer Zeit auch meinen Vater angespuckt, der nun, aus Angst vor einer weiteren Flucht, lieber die Taliban erträgt. Ich dränge ihn nicht. Meine Eltern haben das Recht, so zu leben oder zu sterben, wie sie es für richtig halten. Leben in Afghanistan bedeutet zurzeit den schleichenden Tod. Wenn man dort schon nicht leben kann, kann man dort zumindest sterben und inmitten von Freunden und Bekannten würdevoll beigesetzt werden.
Jetzt sehe ich, dass Afghanistan das immer war: ein Ort, an dem man sich beisetzen lässt. In den letzten siebzehn Jahren war ich immer auf Beerdigungen von Menschen, die im Ausland gestorben waren und auf ihren eigenen oder den Wunsch ihrer Angehörigen hin nach Kabul überführt wurden. Die Ehefrau eines Verwandten starb in Schweden an Krebs. Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens im Ausland verbracht hatte, wurden ihre sterblichen Überreste für teures Geld nach Kabul verbracht und auf einem schiitischen Friedhof bestattet. Im selben Jahr starb der Sohn der Frau in Schweden, an einer Überdosis Drogen. Sein Leichnam wurde ebenfalls nach Kabul überführt und an der Seite seiner Mutter beerdigt. Auch aus der Türkei und aus anderen Ländern wurden Verstorbene nach Afghanistan gebracht, meist auf ihrer Überfahrt von der Türkei nach Griechenland Ertrunkene, unter ihnen eine junge vierköpfige Familie, alle vier ohne Herzen und Nieren. Man hatte ihnen alles Verwertbare aus Brust und Bauch entnommen. Diese rast- und ruhelosen Menschen hatten sich auf einen Weg gemacht, kein Ziel erreicht und erst auf Kabuls Friedhöfen ihre letzte Ruhe gefunden. Und wenn du siehst, dass alle ihre Anstrengungen vergebens waren, dann fragst du dich: »War das all die Mühe wert?«
Die mehr Glück haben, indem sie ferne, menschliche, freie Gestade erreichen, schlendern durch Straßen, fahren in Zügen, besuchen Museen und Cafés, sitzen unter mächtigen alten Bäumen in Parks, machen – Becher mit Starbuckskaffee in Händen – Selfies, bebildern und schildern ihr gutes Leben. Es sei ihnen gegönnt! Zu schade nur, dass man diese freie Welt eingezäunt hat! Und die Zäune werden zahlreicher. An den Grenzen zu Griechenland, der Türkei, Iran, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan schießen mit Stacheldraht bewehrte Mauern wie Wildpilze dicht an dicht aus dem Boden und halten Asylsuchende auf. Dass fast alle Auslandsvertretungen in Kabul geschlossen sind, macht die Visabeschaffung unmöglich. Und selbst wenn Visa erteilt werden, nützt das kaum jemandem, weil niemand einen Pass hat. Die zuständige Behörde druckt seit geraumer Zeit keine Passdokumente mehr. Alle Grenzen sind geschlossen. Ein befreundeter Lyriker hat auf seiner Facebook-Seite gefragt: »Welche Häftlingsnummer hast du?«
Man konnte gar nicht so schnell schauen, wie plötzlich alle verschwunden sind und uns den Taliban ausgeliefert haben. Die machen aus unserem Land jetzt ein zweites Nordkorea. Aber nicht eine Regierung bekämpft die Taliban mehr. Die Welt wollte wohl nur, dass der Krieg aufhört. Bis gestern brachte der Krieg uns um. Ab heute vergießt der Frieden unser Blut.
Wenn du über den weltweit wertlosesten Pass verfügst, kann alle Welt dich beleidigen. Das heißt nicht unbedingt, dass alle das auch tun, nein. Viele zeigen sich von ihrer menschlichen Seite, behandeln dich freundlich und mit Respekt. Wenn sie dir aber das Leben schwer machen, dir sinnlose Fragen stellen, dich stundenlang warten lassen, dich anbrüllen wollen, dann bleibt ihnen das unbenommen. Sie wissen, dass keine Regierung sich für dich starkmachen will oder kann. Auch du weißt das und versuchst, nicht dünnhäutig zu reagieren, alles ungerührt über dich ergehen zu lassen und dir ein dickes Fell zuzulegen. Während mehrerer Auslandsreisen habe ich so was erlebt. Aber wissen Sie, welches Problem hier besteht? Es stellt sich kein Gewöhnungseffekt ein. Jede Beleidigung trifft dich so hart und unerwartet wie die allererste. Du sagst dir: »Es ist immerhin ihr Land. Nimm’s nicht allzu schwer.«
Aber wenn du siehst, dass es auch Menschen gibt, die sich in deinem eigenen Land so verhalten, mitten in Kabul, dann platzt dir der Kragen. Ein ganzes Jahr lang, vielleicht sogar länger, hing in der Straße, in der ich gewohnt habe, ein Plakat, auf dem in persischer Sprache zu lesen war: Australien wird Ihr Land nicht werden. Unter diesem Satz stand die Warnung, nicht auf dem Wasserweg nach Australien zu kommen. Daneben war ein General in Militäruniform platziert, um zu unterstreichen, wie ernst es der australischen Regierung war, und um den Leuten Angst einzujagen. In Form eines Werbespots wurde diese Botschaft zusätzlich im Fernsehen vermittelt, und sie tauchte auch ständig im Internet auf. Bald folgten ein, zwei andere Länder diesem Beispiel und hängten ebensolche Werbeplakate auf. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der afghanischen Bevölkerung vorgehabt hatten, auf illegalem Weg in diese Länder einzureisen, aber ich bin mir sicher, viele Millionen Menschen, die die Anzeigen gesehen haben, hatten nicht die Absicht, auszureisen. So was macht einen wütend, und dass man dagegen nichts tun kann, ist schrecklich bitter.
Aber, wie gesagt, nicht alle Menschen sind so, und manchmal begegnen dir auf der Flucht freundliche, großherzige, liebenswerte Menschen, die ihr Brot mit dir teilen, dir Obst in die Tasche stecken und dir die Hände schütteln. Und so hatte ich Glück, dass das Schicksal mir gewogen war und dafür sorgte, dass ich guten Menschen begegne. Ich gebe dem Kontrollbeamten am Flughafen meinen Pass. Er will auch die anderen Pässe sehen, den meiner Frau und die meiner beiden Söhne. Er fragt nach meinem Beruf. »Schriftsteller«, sage ich.
»Wie kommt man als Autor denn so zurecht?«
»Nicht schlecht.«
»Haben Sie Bücher veröffentlicht?«
»Ja, einen Erzählband, zufällig sogar in Deutschland.«
Er will den Titel wissen, ich nenne ihn. Unterdessen versieht er unsere Pässe mit Einreisestempeln und gibt sie mir zurück. Er lächelt, als er sagt: »Willkommen und viel Erfolg.«
Mir kommen die Tränen. Ich senke den Kopf, gehe weiter, durch die Glastür, die mir bedeutet, dass ich deutschen Boden betrete. Ich ziehe zwei kleine Koffer hinter mir her. Meine Söhne verfallen in Laufschritt vor Aufregung. Noch wissen sie nicht, was es heißt, durch diese Glastür gegangen zu sein. Ich schaue auf die Uhr meines Mobiltelefons. Es ist 12:45 an einem sonnigen Septembertag, und ich bin in Deutschland. Eine vertraute Geschichte: das Zuhause aufgeben, aufbrechen in ein anderes Land, wieder ganz von vorn anfangen.
Anders als vor siebzehn Jahren bin ich jetzt in einer Wohnung untergebracht, in der ich ein eigenes Zimmer habe. Ich betrauere das hinter mir liegende Leben, trauere um Kabul, um die siebzehn dort verbrachten Jahre. Und während eine Last von mir abfällt, meldet sich gleichzeitig der alte Schmerz in der Brust zurück. Ein deutscher Freund fragt mich: »Wie fühlst du dich?«
»Alles wäre gut, wenn nur die Nachrichten nicht wären.«
Physisch bin ich jetzt zwar in Berlin, im Geist aber noch immer in Kabul. In meinem Kopf reiht sich Frage an Frage: »Was wird in siebzehn Jahren sein? Wohin wird es dich dann verschlagen haben? Wie wird dein Leben aussehen? Willst du hier sterben und begraben werden, oder willst du, wie andere zuvor, für die Überführung deiner sterblichen Überreste nach Kabul sorgen?« Das Leben vergeht, ehe man sich’s versieht, aber wie man sterben und Ruhe finden wird, ist eine ernste Frage, die zu beantworten, so steht zu vermuten, mir noch Zeit bleibt. Meine Beziehung zu Afghanistan wird noch vertrackter als bisher. Vielleicht wird der Lauf der Zeit mir helfen, einen Teil dieses gordischen Knotens zu lösen. Ich muss meine Ungeduld zügeln, mich ablenken, ins Leben eintauchen, in einen Alltag hineinfinden, spazieren gehen, einkaufen, Deutsch lernen, schreiben. Ich muss Abstand gewinnen von den Nachrichten aus Afghanistan und mit offenen Augen entdecken, was vor mir liegt. Ich muss Deutschland so umarmen, wie Deutschland mich umarmt hat.
Nach Ablauf der häuslichen Quarantäne beschließe ich, meine Sorgen Sorgen sein zu lassen und einen ersten Spaziergang durch meine neue Nachbarschaft zu machen. Der Abend ist kalt, aber es ist noch nicht dunkel. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke zu und schnüre meine Schuhe. Die Straßenbeleuchtung ist eingeschaltet und wird mir den Weg weisen. Ich trete hinaus auf den Bürgersteig einer Stadt, in der mich niemand kennt. Ich atme die kalte Abendluft in tiefen Zügen ein. Sie ist sauber, aber sie scheint mir nicht zu gehören. Macht es mir zu schaffen, dass ich nicht an sie gewöhnt bin? Mein Herz schlägt heftiger, ich atme tiefer ein und aus. Es hilft nichts. Ich habe wieder das Gefühl, in Wasser gestürzt zu sein. Und dann weiß ich, wie mir geschieht. Meine nächste Metamorphose steht bevor, ich muss neue Kiemen ausbilden, wie damals, vor siebzehn Jahren. Unterwegs, beim Lesen der Straßennamen, spüre ich, wie meine innere Verwandlung bereits einsetzt: Wielandstraße, Hedwigstraße, Fregestraße …
Wie lange dauert eine Flucht?
Matthias Nawrat
1.
Im letzten Juli trafen wir uns mit einer Freundin im Himmelbeet, einem Gemeinschaftsgarten in unserem Berliner Kiez. Mit vegetarischer Quiche und der Flasche einer Hamburger Brauerei setzten wir uns auf Europaletten zwischen den Hochbeeten, in die hinterste Ecke an einen hohen Zaun, und unterhielten uns gerade darüber, was wir gemacht hatten, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen hatten, wie es in Warschau gewesen war – die Freundin hatte dort für die Deutsche Presse-Agentur gearbeitet –, da bemerkte ich, dass auf der Brache hinter meinem Rücken jemand vorbeiging. Kurz darauf drangen aus dem Gebüsch an der Hauswand Stimmen, jemand lachte, und einen Moment später kamen zwei Männer aus dem Gebüsch und gingen am Zaun entlang zurück zur Straße.
Der Tag war sonnig, über dem Beet vor uns summte eine Wespe. Eine knallorange Blüte hob sich über ein paar Ranken, die so hellgrün leuchteten, als spürten sie unsere gute Laune angesichts dieses einigermaßen normalen Treffens, wenngleich es draußen, mit genügend Abstand und regelmäßigem Einsprühen der Hände aus unserem Fläschchen mit Desinfektionsmittel stattfand. Wir unterhielten uns weiter, aber wenige Minuten später liefen wieder Personen hinter uns vorbei, und erneut hörte ich Stimmen im Gebüsch, jemand flüsterte, hustete. Dann gingen drei Jungs am Zaun entlang zurück zur Straße und entfernten sich aus unserem Sichtfeld. Eine Frau, die eines der Hochbeete wässerte, hatte die Szene beobachtet. Sie erklärte, dass dort im Gebüsch ein gut versteckter Ort zum Spritzen sei. Um die Ecke befinde sich am Rand des benachbarten Sportplatzes, direkt am Zaun zum Himmelbeet, ein Zeltlager. Da leben Leute, sagte sie.
Als wir eine halbe Stunde später aufbrachen, ging ich von außen am Zaun des Gemeinschaftsgartens entlang und stellte mich an den Sportplatz, auf dem ein paar Kinder Fußball spielten, versuchte, von hier aus etwas im Gebüsch zu erspähen. Ich konnte ein Stück silberne Plane erkennen, im Gras standen Töpfe, ein Plastikkanister. Am Zaun hingen ein paar Pullover, ein T-Shirt, eine Nylonjacke. Ich hätte mich gern genähert, aber ich traute mich nicht. Außerdem: Wer war ich denn? Der Retter der Welt?
Im Januar, ein halbes Jahr später, fiel plötzlich feuchter Schnee, er segelte uns auf einem Spaziergang ins Gesicht. Im Mauerpark hatten die Kinder mit ihren Schlitten grüne Streifen in den Hügel gefahren. Uns stieg der Berliner Nebel unter die Jacken und in die Krägen. Im Internet konnte man Aufnahmen aus dem Geflüchtetenlager in Lipa in Bosnien sehen, das vor Weihnachten abgebrannt war. Ein Mann, der während eines Interviews vor den Skeletten der Zelte steht, trägt einen Rucksack über der Schulter. Im Hintergrund steht eine Frau in Hausschuhen im Schnee. Am nächsten Tag machte ich mich zum Himmelbeet auf, das jetzt, im Winter, geschlossen war – ich umrundete die Brache und den Sportplatz, ging auf dem Tartanboden zum Gebüsch am Zaun, das jetzt kahl war und in das man hineinsehen konnte: Ein blauer Müllsack, aus dem eine Styroporplatte ragte, lag auf dem Boden. Am Zaun hing kein Kleidungsstück, kein Zelt stand mehr hier. Hinter dem Zaun schliefen die Hochbeete unter Planen, darauf nasser Schnee.
2.
Wir waren keine Geflüchteten, sagt meine Mutter, als ich sie zu ihren sechs Wochen im sogenannten Grenzdurchgangslager





























