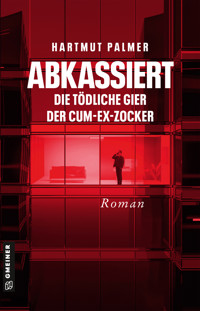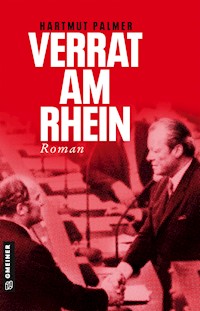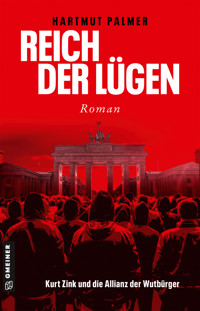
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Enthüllungsjournalist Kurt Zink
- Sprache: Deutsch
Wenige Tage nachdem er den Bonner Journalisten Kurt Zink getroffen und bei ihm seine Brieftasche vergessen hat, wird der pensionierte Polizist Siegfried Iserlohe ermordet in einem Wald bei Templin gefunden. Was wusste er über den Prinzen, der mit rechtsextremen Gesinnungsgenossen einen Putsch gegen die Regierung plante? Stecken Julius Plück und die Allianz für Deutschland dahinter? In der Brieftasche entdeckt Zink Hinweise, die ihn auf die Spur der Mörder führen - und in ein Reich der Lügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hartmut Palmer
Reich der Lügen
Kurt Zink und die Allianz der Wutbürger
Impressum
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © Firn / stock.adobe.com und paulsteuber / Pixabay
ISBN 978-3-7349-3404-9
Vorbemerkung
Die meisten Romanfiguren und auch die Handlung sind frei erfunden. Die fiktive Geschichte spielt allerdings vor einem realen, politisch-historischen Hintergrund. Ähnlichkeiten mit einigen lebenden Personen sind deshalb keineswegs zufällig, sondern beabsichtigt.
Prolog: Köln, Bundesamt für Verfassungsschutz
Den 11. November 2011, einen Freitag, wird Alexander Möller nie vergessen. Nicht nur, weil er an diesem Tag Maria kennenlernte, seine spätere Frau. Das auch. Unvergesslich ist ihm das Datum vor allem deshalb, weil er es – damals noch ein junger Spund – erstmals mit einer Geschichte auf die Titelseite der Kölner Boulevardzeitung BLITZ geschafft hatte. Zum ersten Mal stand auch sein Name unter der Schlagzeile.
Alexander Möller war mächtig stolz.
Die Geschichte, zu der ihm sogar sein Chefredakteur gratulierte, war deshalb so besonders, weil es eigentlich keine war. Dass am Elften im Elften in Köln und im Rheinland der Karneval anfängt, ist so selbstverständlich wie, dass man am 24. Dezember Heiligabend feiert.
Möller aber hatte es geschafft, aus dieser banalen Selbstverständlichkeit einen Knüller zu machen. Er hatte, wie es sein Freund, der ergraute und längst pensionierte Journalist Kurt Zink, viele Jahre später einmal etwas unfein ausdrücken wird, »aus Scheiße Funken geschlagen«.
Weil die Lokalredaktion am 10. November 2011 verzweifelt nach einem Aufmacher suchte, an diesem Tag in Köln aber absolut nichts los war, hatte Möller im Internet nachgeschaut, wann in den vergangenen Jahrhunderten in einem elften Jahr der Elfte im Elften zum letzten Mal auf einen Freitag gefallen war. Ergebnis: vor vierhundert Jahren, am 11. November 1611.
Die Geschichte, die er daraus bastelte, gefiel seinem Chefredakteur so gut, dass er sie – auch in Ermangelung anderer Sensationen – auf der ersten Seite des Boulevardblattes ankündigte: »Jahrhundert-Freitag in Köln – Super-Elf zum Karneval« lauteten die Zeilen. Sie waren etwas rätselhaft, klangen nach Fußball und nach Karneval, aber gerade wegen dieser Zweideutigkeit verkauften sie sich gut.
Auch Maria Ferber las die dicken Schlagzeilen, mit denen das Blatt auf einer Händlerschürze um Kundschaft warb. Sie saß im Auto vor einer roten Ampel und überlegte, was es mit dem »Jahrhundert-Freitag« und der »Super-Elf« wohl auf sich haben könnte. Sie ahnte nicht, dass sie den Autor der Geschichte, den Reporter Alexander Möller, noch am gleichen Abend im Weißen Holunder kennenlernen und später sogar heiraten sollte.
Überhaupt passierte an diesem Elften im Elften des Jahres 2011 einiges, was niemand voraussehen konnte.
Der Ministerialrat Dr. Heinrich Ebert, im Bundesamt für Verfassungsschutz seit ein paar Jahren Leiter des Referats »Rechtsextremismus«, wusste zum Beispiel nicht, dass die Entscheidung, die er an dem »Jahrhundert-Freitag« treffen musste, ihn schon bald das Amt kosten und ein Jahrzehnt später auch seinem Sohn Adolf Heinrich zumindest indirekt zum Verhängnis werden sollte.
Ebert hatte, wie nahezu die gesamte Belegschaft des Amtes, den Elften im Elften zum Brückentag erklärt und sich am Donnerstagabend in ein verlängertes Wochenende verabschiedet. Am späten Freitagnachmittag war er in seinem Dienstwagen mit Angelika, seiner Ehefrau, nach Brilon im Sauerland unterwegs, wo am Abend ein Fest-Kommers der Alten Herren der Bonner Burschenschaft Bonnensia steigen sollte. Er hat das Jubiläumstreffen der Alten Herren organisiert. Auf ihn werden sie schauen, wenn er den Kommers mit einer zünftigen Rede eröffnen und zum ersten Umtrunk den Bierkrug in die Höhe stemmen wird.
Seine Freunde nennen ihn »Heinz«, seine Vorgesetzten und die Sekretärinnen reden ihn mit »Herr Doktor« an. Er ist flink im Kopf, weiß immer, wo es langgeht, spürt, aus welcher politischen Richtung der Wind weht. Mit achtzehn hat er Abitur, mit fünfundzwanzig seinen Doktor gemacht. Kaum volljährig, war er in die Burschenschaft eingetreten, sehr schnell hatte er sich auf dem Paukboden seinen Schmiss geholt. Als er sich 1978 in Köln beim Bundesamt für Verfassungsschutz bewarb, wurde er – natürlich auch auf Empfehlung eines Alten Herrn seiner Verbindung – gern genommen.
Jetzt ist der Mann mit dem zerhackten Gesicht selbst ein Alter Herr und einflussreich. Er sitzt ohne Sakko am Steuer – gelb-braun karierte Hose, grünes Hemd, braunes Seidenhalstuch – und sieht aus wie ein fröhlicher Urlauber auf dem Weg in den Süden.
Aber Ebert ist kein bunter Vogel, kein jovialer, fröhlicher Menschenfreund. Kein gemütlicher Rheinländer, der gerne fünfe gerade sein lässt. Er bekämpft alles, was seiner Meinung nach links ist: die Achtundsechziger sowieso und natürlich Kommunisten, Sozialdemokraten und Grüne, die sich – so sieht er das – immer nur um arbeitsscheue Drückeberger, Sozialhilfeempfänger, Obdachlose und Drogensüchtige kümmern, nicht aber um die Mehrheit der schwer arbeitenden Deutschen. Er hasst Ausländer mit erkennbar afrikanischen Wurzeln, pöbelt gegen junge, männliche Muslime und beleidigt ihre verschleierten Frauen.
Es ist ihm egal, ob diese Menschen aus wirtschaftlicher Not oder weil sie politisch verfolgt wurden nach Deutschland gekommen sind. Allein die Hautfarbe und die fremde Religion machen sie verdächtig. Aus Eberts Sicht bedrohen sie »deutsches Blut« und »deutsches Wesen«, weil sie obendrein faul sind und ständig neue kleine Paschas in die Welt setzen.
Dies wird, davon war er schon in jungen Jahren überzeugt, irgendwann zu einem vollständigen Austausch der Bevölkerung führen. Sein Vater Adolf Ebert, 1918 geboren, Mitglied der Waffen-SS und bis zu seinem Tod ein unverbesserlicher Nazi, hätte gesagt: »Zu einer vollständigen Auslöschung der deutschen Rasse.« Dass es jetzt auch deutsche Frauen gibt, die erzwungenen Sex in der Ehe als Vergewaltigung werten und unter Strafe stellen lassen wollen, findet er abartig und unerträglich.
Der Verfassungsschützer Heinrich Ebert hat feste Ansichten, die sich mit den Ansichten derer decken, die er überwachen soll. Aber erst in einem halben Jahr wird man in den Zeitungen lesen, es sei unfassbar, dass ausgerechnet dieser Mann im Kölner Bundesamt für die Beobachtung des Rechtsextremismus zuständig war.
Noch fragt das keiner.
Noch zweifelt niemand, dass er genau der Richtige ist für diesen Job. Am wenigsten er selbst.
Weil der Tank zur Neige geht und seine Gattin gerne einen Kaffee trinken möchte, verlässt er schon kurz hinter Köln die Autobahn und steuert die Raststätte Aggertal an.
Während er tankt, klingelt sein Autotelefon.
Der V-Mann aus dem sächsischen Zwickau ist dran. Er klingt besorgt. In Zwickau ist etwas schiefgelaufen. Der Nationalsozialistische Untergrund ist aufgeflogen. In einer ausgebrannten Wohnung hat die Polizei Spuren der ermordeten Polizistin aus Heilbronn und ihrer kürzlich tot in einem Wohnwagen aufgefundenen mutmaßlichen Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gefunden. Der V-Mann fürchtet, dass deren Namen auch in den »Rennsteig«-Akten des BfV zu finden sind.
»Sie müssen unbedingt dafür sorgen«, sagt der V-Mann, »dass die Akten sauber sind, bevor der Generalbundesanwalt den Fall übernimmt.«
Ebert beruhigt ihn.
»Machen Sie sich keinen Kopf. Ich habe alles unter Kontrolle.«
Er hat es kommen sehen.
Als vor ein paar Tagen die beiden Nazimörder tot in ihrem Wohnwagen gefunden wurden, hat er sich sofort die sieben Ordner des Operativvorgangs »Rennsteig« kommen lassen. Er hat alle Seiten herausgenommen, auf denen die Namen der Toten und die ihrer Unterstützer standen. Niemand sollte wissen, wie eng die Kontakte waren, die das Bundesamt für Verfassungsschutz seit vielen Jahren zu den Neonazis in Thüringen, zum Heimatschutz hatte.
Ein Unterstützer der NSU-Mörder war besonders aktiv, ein junger Rechtsanwalt, der in Erfurt wohnte, aber angeblich aus dem Rheinland stammte. Unter dem Decknamen »Friedrich« tauchte er seit 2005 ständig in den Berichten der V-Leute auf. Er sei, hieß es in den Rennsteig-Akten, nicht nur Sympathisant und militanter Unterstützer des NSU-Mordtrios, sondern gelegentlich auch Informant des Kölner Bundesamts. Ebert hatte eine ganze Nacht gebraucht, ehe er sicher sein konnte, dass wirklich alle Hinweise auf den V-Mann aus allen sieben Ordnern getilgt waren.
Trotzdem ist er nach dem Anruf des V-Mannes aus Zwickau verunsichert. Hat er tatsächlich alles Notwendige gemacht? Oder vielleicht doch etwas übersehen? Hat Rainer, sein eifriger Helfer und seit Kurzem sogar sein Stellvertreter, wirklich erledigt, was er ihm aufgetragen hat?
Rainer Iserlohe, gerade mal hundertfünfundfünfzig Zentimeter hoch, von Kollegen »der laufende Meter« genannt, sollte auf dem Weg zum Flughafen einen kleinen Abstecher zur Filiale der Sparkasse in der Dürener Straße machen. Dort hat Ebert – natürlich ohne Wissen der Amtsleitung – schon vor Jahren ein Schließfach angemietet. In diesem Schließfach, zu dem außer ihm nur Iserlohe Zugang hat, sollten die Blätter deponiert werden, die der Referatsleiter vor drei Tagen den »Rennsteig«-Akten entnommen hatte.
Natürlich war das illegal.
Akten dürfen weder ausgelagert noch gesäubert werden. Aber Ebert hatte Gründe, die er nicht einmal seinem Stellvertreter verraten hatte.
Den Papierpacken – etwa achtzig Blatt – hatte er in einen großen braunen Umschlag gesteckt, diesen zugeklebt und zusätzlich mit Tesafilm versiegelt. Bevor er sein Büro verließ, weil er in eine vom Präsidenten überraschend einberufene Besprechung gehen musste, hatte er auf den verschlossenen Umschlag in seiner etwas krakeligen Handschrift, aber trotzdem gut lesbar, mit einem schwarzen Filzstift das Wort »Ostbund« geschrieben.
Ostbund – das war irgendwo mal in den Berichten aufgetaucht, deshalb hatte er das Stichwort genommen. Er hätte genauso gut Friedrich auf den Umschlag schreiben können oder Erfurt oder NSU – aber das wollte er nicht.
Es war nachmittags kurz nach fünfzehn Uhr, als er seinem Stellvertreter den verschlossenen Umschlag gab.
Rainer saß bereits auf gepackten Koffern und sah andauernd auf die Uhr. Er wollte zu einem seit Langem geplanten Urlaub in der Karibik aufbrechen, hatte aber seinem Referatsleiter versprochen, er werde die Dokumente auf jeden Fall vorher zum Schließfach bringen.
Als Ebert am frühen Abend von der Konferenz beim Präsidenten in sein Büro zurückkam, schien alles so zu sein, wie sie es besprochen hatten: Die Aktenordner standen noch im Büro, und den Umschlag hatte Rainer offenbar weggebracht, denn er lag weder auf dem Schreibtisch noch in seiner Schublade. Auch der Schlüssel zum Schließfach war verschwunden, ein sichereres Zeichen, dass Iserlohe daran gedacht und ihn aus der Schublade in Eberts Schreibtisch geholt hatte – ohne Schlüssel hätte er das Schließfach nicht öffnen können. Ebert hatte sich zwar gewundert, dass sein Stellvertreter nicht mehr Vollzug gemeldet hatte. Sonst tat er das immer. Aber er hatte sich schnell beruhigt.
Auf Rainer ist Verlass, denkt er auch jetzt, nachdem er den Tank gefüllt und den Tankstutzen geschlossen hat.
Vielleicht hat er vor dem Abflug nur keine Zeit mehr gehabt, ihm eine Nachricht zu hinterlassen. Hauptsache, die brisanten Papiere sind nun in dem Bankschließfach.
Lächelnd geht er zur Kasse, um das Benzin zu bezahlen.
Unterwegs aber erstirbt sein Lächeln.
Dem Beamten des Verfassungsschutzes ist plötzlich eingefallen, dass er etwas übersehen hat: Die Seiten in den Aktenordnern waren fortlaufend durchnummeriert. Ein geübter Aktenleser würde also sofort merken, dass einzelne Seiten fehlen.
Der Gedanke löst bei ihm Panik aus.
Auch er hat nämlich für die kommende Woche Urlaub genommen und will mit seiner Frau nach dem Treffen der Alten Herren vom Sauerland aus an die Ostsee fahren, wo sie ein Ferienhaus angemietet haben.
Spätestens am Montag werden die Beamten des Generalbundesanwalts in Köln aufkreuzen und Akteneinsicht verlangen. Und dann werden sie schon beim flüchtigen Durchblättern merken, dass einzelne Seiten fehlen. Deshalb müssen die von ihm gesäuberten Ordner noch heute vollständig geschreddert werden, damit niemand die Manipulationen bemerkt.
Ebert steuert seinen Wagen von der Zapfsäule auf den Parkplatz. Er versucht vergeblich, Rainer Iserlohe anzurufen. »Der laufende Meter« ist entweder noch in der Luft oder schon in der Karibik und geht nicht dran.
Ebert ruft den Wachhabenden an der Pforte des BfV an.
Es dauert eine Weile, bis sich am anderen Ende der Leitung jemand meldet. Der Wachhabende bestätigt ihm jedoch lediglich, was er bereits weiß: Es ist niemand da. Das Amt ist verwaist. Er werde aber, verspricht der brave Beamte, der Wagner heißt, den Herrn Referatsleiter selbstverständlich sofort zurückrufen, sollte sich zufällig jemand aus seiner Abteilung oder seinem Referat an der Pforte blicken lassen.
Ebert diktiert ihm vorsichtshalber die Nummer seines Autotelefons. Er glaubt allerdings nicht daran, dass dies etwas nützt, und beschließt, nach Köln zurückzufahren.
Er geht zu seiner Frau ins Café der Raststätte und eröffnet ihr, er müsse dringend zurück ins Amt fahren. Er habe dort etwas Wichtiges vergessen. Immerhin lässt er ihr noch Zeit, ihren Kaffee zu trinken.
Als er ins Auto steigt und losfahren will, klingelt sein Telefon erneut. Zu Eberts Überraschung ist Wagner dran und meldet Erfreuliches: Maria Ferber, die junge Sachbearbeiterin aus Eberts Referat, stehe neben ihm. Sie sei zufällig vorbeigekommen und nun für ihn zu sprechen.
Ebert ist erleichtert. Jetzt wird alles gut.
Die Ferber wird die Sache für ihn erledigen.
Maria Ferber ist alles andere als begeistert. Sie ist als Maikäfer kostümiert. Sie kam aus Düsseldorf, wo sie ihre Mutter besucht hat, und hat in Chorweiler ihre Freundin Sibylle aufgegabelt, die als Biene geht. Die beiden Frauen wollen in der Kultkneipe Weißer Holunder den Beginn der fünften Jahreszeit feiern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Maria eigentlich nur deshalb angesteuert, weil sie ihr Auto auf dem Parkplatz abstellen will. Danach wollen sie mit der Straßenbahn weiterfahren.
Aber jetzt hat sie ihren Chef am Ohr und der weist sie an, die sieben Aktenordner mit der Aufschrift »Rennsteig«, die noch in seinem Büro stehen, vollständig zu schreddern.
»Habe ich mich klar ausgedrückt?«, fragt Ebert. »Vollständig schreddern heißt vollständig schreddern. Es soll und darf nichts davon übrig bleiben!«
Der Präsident habe ihn soeben telefonisch angewiesen, das zu tun. In den Ordnern befänden sich Unterlagen, die man aus Gründen des Datenschutzes längst hätte löschen müssen. Da er im Sauerland und auch Iserlohe unerreichbar sei, müsse sie das übernehmen.
Nein, sie dürfe ihre Freundin nicht mit ins Amt nehmen. Aber er werde ihr, wenn sie alles erledigt habe, zwei Tage Sonderurlaub geben.
Maria hat keine Wahl. Sie muss zustimmen.
Entgegen dem Verbot ihres Chefs nimmt sie aber ihre Freundin Sibylle mit.
Nach einer Dreiviertelstunde ist die Sache erledigt.
Sie informiert den Chef. Dann machen sich die beiden Frauen auf zum Weißen Holunder. Die Kneipe ist bereits so voll, dass sie Mühe haben, überhaupt hineinzukommen. Aber da Maria den Wirt kennt, klappt es schließlich doch.
Teil I: Das Netzwerk
1.
Kurt Zink genoss den sonnigen Herbsttag. Über den Marktplatz von Templin schlendernd hatte er etwas Gemüse gekauft und nebenan beim Metzger ein Rinderfilet. Wie gewohnt wollte er in dem kleinen Café an der Ecke schräg hinter dem Rathaus einen Latte Macchiato trinken, ein Stück Kuchen essen und die Süddeutsche lesen, die er im Supermarkt erstanden hatte.
Nur einer der vier runden Tische war unbesetzt. Zink setzte sich so, dass er den Betrieb auf dem Marktplatz im Auge behalten konnte.
Er war gerne in Templin. In der uckermärkischen Kleinstadt war er 1945 zur Welt gekommen, kurz nach dem Ende des Weltkriegs, vor nunmehr siebenundsiebzig Jahren. Aufgewachsen war er in Bonn, der kleinen Metropole am Rhein, die vierzig Jahre lang die Hauptstadt der Bundesrepublik gewesen war. Dorthin hatte es seine Eltern nach dem Krieg verschlagen, weil sein Vater Beamter in einem Bonner Ministerium geworden war.
Seit Anfang der 1950er-Jahre hatte Zink in Bonn gelebt, Volksschule und Gymnasium besucht, auch eine Zeit lang studiert, aber gleichzeitig damit begonnen, Artikel für die Lokalzeitung zu schreiben. Er war zuerst freier Mitarbeiter, dann Redakteur, und als man ihm anbot, als politischer Korrespondent in die Parlamentsredaktion einer großen Kölner Tageszeitung zu wechseln, hatte er das Studium an den Nagel gehängt und war endgültig Journalist geworden.
Den Kanzler Konrad Adenauer hatte er schon als Schüler häufig gesehen. Der Alte aus Rhöndorf überquerte den Rhein auf derselben Autofähre, die auch Zink benutzte, wenn er mit dem Fahrrad zum Gymnasium nach Bad Godesberg fuhr. Wenn Adenauers schwarzer Mercedes in Niederdollendorf auf die Fähre rollte, wurde kein großes Tamtam gemacht. Die Fähre wurde weder für den übrigen Verkehr gesperrt noch fuhr sie gleich los, wenn der Bundeskanzler an Bord gekommen war. Es gab auch nur einen einzigen Polizisten, der ihn auf dem Weg von Rhöndorf nach Bonn auf einem Motorrad eskortierte.
Adenauer saß immer hinten und meistens las er sein Leib- und Magenblatt, die Kölnische Rundschau. Manchmal, wenn er aufschaute und die Pennäler sah, die ehrfürchtig seinen Wagen umstanden, ließ er die Zeitung sinken, lächelte und grüßte mit der rechten Hand.
Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger kannte Zink nur aus der Ferne, aber seit 1969 jeden Bundeskanzler persönlich: Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und auch Gerhard Schröder, den einzigen Kanzler, den er duzte. Als er im Januar 1990 das erste Mal Angela Merkel in Ostberlin traf, war sie Pressesprecherin der Partei Demokratischer Aufbruch. Sie hatte Schnittlauchhaare und nudelte gerade eine auf Matrize getippte Presseerklärung durch ein altmodisches Gerät.
Er stellte sich vor und fragte sie, ob sie kein Kopiergerät hätten. Sie antwortete: »Nein. Aber Sie könnten ja mal Ihren Verlag fragen, ob die uns ein paar ausgediente Geräte schicken können.«
Er versprach, das zu tun. Dann fragte er sie, woher sie käme. Sie sagte, wenn sie ihm das jetzt sage, werde er es sowieso sofort vergessen, weil Templin ein Ort sei, den jeder sofort wieder vergesse.
Ja, von wegen.
»Wenn Sie wüssten, wie oft ich in meinem Leben den Ortsnamen ›Templin‹ in Formulare geschrieben habe …«
Seitdem zwinkerten sie sich zu, wenn sie sich irgendwo begegneten.
Merkel war die letzte Kanzlerin, mit der er es als Journalist zu tun hatte. Olaf Scholz, den amtierenden, kannte er zwar auch, aber nur aus der Zeit, als der noch Generalsekretär der SPD war und wegen seiner schon damals arg gedrechselten Redewendungen »Scholzomat« genannt wurde.
Die Kellnerin riss ihn aus seinen Gedanken.
»Was darf ich Ihnen denn bringen?«, fragte sie.
Zink sah auf und traute seinen Augen nicht. Vor ihm stand eine atemberaubend schöne Frau. Die glatte, glänzende Haut ihrer Arme hatte die Farbe des Latte Macchiato, den er zu bestellen gedachte. Sie trug ein türkisfarbenes Kleid, das alle Rundungen ihrer makellosen Figur voll zur Geltung brachte. Ihre Sonnenbrille stak in ihrem krausen, schwarzen Haar, dessen ausufernde Fülle von einem ebenfalls türkisfarbenen Band am Hinterkopf zusammengehalten und gebändigt wurde. Sie sah nicht wie eine Kellnerin aus, sondern wie eine Prinzessin aus Tausendundeiner Nacht. Aber sie klang so uckermärkisch wie eine Einheimische.
»Einen Latte Macchiato«, stammelte Zink. »Und ein Stück Kuchen!«
Sie lächelte und verschwand.
Zink blickte ihr nach und bewunderte die lässige Eleganz, mit der sie sich durch das Kreuzfeuer der Blicke zwischen den Tischen und Stühlen bewegte.
Er seufzte.
Dann vertiefte er sich in seine Zeitung.
Den Mann bemerkte er erst, als der ihn ansprach und fragte, ob er sich zu ihm setzen dürfe. Es war ein schlanker, großer Herr, der ihn offenbar schon seit ein paar Minuten beobachtet hatte.
»Sie sind doch Kurt Zink«, sagte er. »Wir kennen uns von früher, jedenfalls kenne ich Sie.«
Zink war verblüfft. Das Gesicht kam ihm zwar bekannt vor. Aber er wusste nicht, mit wem er es zu tun hatte.
Er musterte ihn genauer. Sein Gegenüber war schätzungsweise zwei Köpfe größer als er und sah aus wie ein ehemaliger Leistungssportler: breite Schultern, athletische Figur, Turnschuhe. Sein einstmals volles, jetzt schütteres, dunkles Haar war schon leicht ergraut. Zink schätzte ihn auf fünfundsechzig bis siebzig Jahre. Er war trotz der herbstlichen Temperaturen sommerlich gekleidet, trug eine dünne beigefarbene Leinenhose, darüber ein kurzärmeliges grünes Polohemd und über der Schulter einen dünnen braunen Sommerpulli, dessen Ärmel er um den Hals geknotet hatte. Man konnte seine muskulösen Oberarme sehen und, da er die Sonnenbrille abgenommen hatte, unter buschigen Brauen auch seine flinken, wachen, dunklen Augen, mit denen er unablässig seine Umgebung absuchte.
Bevor er sich setzte, winkte er der Kellnerin, die gerade in der Nähe war, und gab, indem er die rechte Hand mit gespreiztem Zeige- und Mittelfinger in die Höhe hob, wortlos eine Bestellung auf. Sie nickte, lächelte und verschwand. Er beugte sich herunter und murmelte einen Namen, den Zink jedoch nicht verstand, weil er schlecht hörte und vergessen hatte, sein Hörgerät einzusetzen.
Personenschützer bei der Sicherungsgruppe Bonn sei er gewesen, fuhr der Mann fort. Helmut Schmidt habe er bewacht, auch nach dessen Zeit als Bundeskanzler. Daher kenne er Zink, der den Kanzler manchmal auf Reisen begleitet und auch den Pensionär Schmidt später häufig getroffen habe.
»Ach ja!«, sagte Zink und tat so, als erinnere er sich.
Es war ihm peinlich, dass er nicht wusste, wer sein Gesprächspartner war, der ihn offenbar besser kannte als umgekehrt er ihn. Noch peinlicher war ihm, dass er immer noch nicht wusste, wie er ihn anreden sollte. Irgendetwas mit »i« und »o« glaubte er, gehört zu haben.
Zink erhob sich halb von seinem Sitz, deutete eine Verbeugung an, reichte dem Fremden die Hand und entschuldigte sich. »Es tut mir leid, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Mein Personengedächtnis war leider immer schon schlecht«, versuchte er, die Peinlichkeit zu überspielen.
»Nein, nein!«, sagte der Mann. »Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich musste mir die Leute, die zum Kanzler kamen, immer einprägen, das war mein Job. Dabei aber musste ich selbst im Hintergrund und möglichst unsichtbar bleiben. Deshalb betrachte ich es fast als ein Kompliment, wenn Sie mich nicht erkannt haben.«
Er lächelte.
Etwa zwanzig Meter vor ihnen auf dem Markt wurde es plötzlich laut. Ein kleiner schwarzhaariger Junge rannte davon. Er hatte an einem Obststand etwas gestohlen, der Verkäufer versuchte schreiend, ihn einzufangen. Der Junge entwischte ihm. Laut fluchend und gestikulierend kehrte der Händler an seinen Stand zurück.
»Tja«, sagte Zink. »Der Junge war einfach schneller.«
»Und er kannte sich besser aus«, ergänzte der Personenschützer.
»Stimmt!«, sagte Zink. »Wenn er da vorn reingelaufen wäre, dann hätte er ihn gekriegt. Denn das ist eine Sackgasse!«
»Sie sind wohl öfter in Templin?«
»Ja,«, sagte Zink. »In letzter Zeit schon. Ich bin sogar hier geboren.«
»Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen«, antwortete der Mann.
»Entschuldigung«, sagte Zink, dem die Sache plötzlich unheimlich wurde. Woher wusste sein Tischnachbar, dass er in Templin geboren wurde? »Sagen Sie mir noch mal Ihren Namen? Ich habe ihn leider eben nicht richtig verstanden.«
»Iserlohe! Siegfried Iserlohe!«
»Und woher wissen Sie, dass ich in Templin geboren wurde?«
»Berufskrankheit!«, antwortete Iserlohe. »Ich sagte doch: Ich musste immer genau wissen, wer sich dem Bundeskanzler und später dem Pensionär Schmidt näherte. Deshalb musste ich mich auch mit Ihnen und Ihrer Vita beschäftigen.«
Die Kellnerin brachte Latte Macchiato und Kuchen für Zink und einen doppelten Espresso für Iserlohe.
Zink kramte in seinem Gedächtnis. Ihm fiel ein, dass er im Spiegel einmal gelesen hatte, einer der Personenschützer des Kanzlers Helmut Schmidt hätte aus Versehen fast Rudolf Augstein erschossen.
Aus lauter Verlegenheit fragte Zink: »Waren Sie das, der 1974 um ein Haar Rudolf Augstein erschossen hätte?«
»Nein«, wehrte Iserlohe ab. »Das war nicht ich. Zum Glück hatte ich an diesem Tag dienstfrei. Das Missgeschick ist einem Kollegen widerfahren und hat intern großen Wirbel ausgelöst.«
Er nahm einen Schluck.
»Aber ich habe geahnt, dass Sie mich auf diese Geschichte ansprechen würden«, sagte er und kramte aus seinem kleinen Rucksack, den Zink erst jetzt bemerkte, eine braune Brieftasche hervor. »Deshalb habe ich die Story mitgebracht.«
Wieder wunderte sich Zink. Iserlohe hatte offenbar gewusst, dass er heute in diesem Café sitzen würde, und sich darauf vorbereitet, ihn anzusprechen.
Iserlohe zog aus der Brieftasche ein vielfach gefälteltes Stück Papier hervor, das Zink, nachdem es auf dem Tisch ausgebreitet und geglättet worden war, sofort als eine herausgetrennte Seite des Magazins Spiegel erkannte. Auf einem großen Foto, das die obere Hälfte einnahm, sah man, wie Augstein, der hinter Schmidt einen Hang hinuntergeht, über dessen Kopf eine Axt schwingt.
An die Entstehungsgeschichte dieses Fotos erinnerte Zink sich genau. Einer der damals beteiligten Redakteure hatte sie Mitte der Neunziger, also circa zwanzig Jahre später, in einem Text enthüllt. Als die Spiegel-Leute zum Interview an einem Wochenende in Schmidts Sommerhaus am Brahmsee eintrafen, habe der Kanzler erst einmal so getan, als fühle er sich belästigt. Er habe am Wochenende eigentlich Besseres zu tun, als Interviews zu geben, grantelte er. Zum Beispiel wolle er auf seinem Grundstück ein paar Büsche weghauen. Dies werde er nachher auch tun.
Als sie mit dem Interview fertig waren, hatte der Fotograf gefragt, ob man den Bundeskanzler bei der Arbeit im Gehölz ablichten dürfe. Schmidt war einverstanden.
Mit den entsprechenden Gartengerätschaften ausgerüstet, machte man sich daraufhin auf den Weg zum See. Es ging einen steilen und rutschigen Hang hinunter, der mit Sträuchern bewachsen war. Der Fotograf war vorausgegangen und sah nun von unten zu, wie Schmidt, Augstein und die anderen beiden Redakteure, seitwärts gehend, den Steilhang herunterkamen. Vorneweg Schmidt, der eine Säge in der Hand hielt, hinter ihm Rudolf Augstein mit einer Axt. Und diese Axt schwang er, als er sah, wie der Fotograf die Kamera zückte, hinter dem Rücken des Kanzlers über dessen Kopf so, als wolle er zuschlagen.
Dass dies aus Jux geschah, konnte man auf dem Foto den Gesichtern der beiden Redakteure ansehen, die hinter Augstein gingen. Beide lachten herzlich. Der ganz oben am Berg stehende Personenschützer konnte den Jux allerdings nicht als solchen erkennen. Aus seiner Perspektive sah Augsteins erhobene Axt wie eine Bedrohung aus.
Deshalb wäre es fast zur Katastrophe gekommen.
Der Beamte hatte seine Dienstwaffe bereits gezogen, um das vermeintliche Attentat zu verhindern. Aber da Augsteins Kollegen in der Schusslinie standen, blieb der Fotograf der Einzige, der schoss – das Foto nämlich.
Zink und der frühere Personenschützer beugten sich über den Zeitungsausschnitt. Iserlohe erzählte, welchen Wirbel der Vorfall damals ausgelöst hatte. Der diensthabende Beamte habe damit rechnen müssen, dass das Foto veröffentlicht werden würde, deshalb habe er den Vorfall notgedrungen seinem Vorgesetzten gemeldet.
Er wurde streng verwarnt, und es wurde eine neue Vorschrift erlassen. Sie besagte, dass zwischen dem Personenschützer und der zu schützenden Person niemals mehr als eine oder höchstens zwei Personen stehen dürften. Auch dürfe der Abstand nicht zu groß sein. Dies gelte auch, wenn man sich in dem persönlichen Bereich des zu Schützenden, beispielsweise in dessen Garten bewege. Die Sicherungsgruppe Bonn habe den Fotografen sogar gebeten, ihr das Foto zu Schulungszwecken zu überlassen, berichtete Iserlohe. Jahrelang sei allen Polizeianwärterinnen und Anwärtern anhand dieser Fotografie demonstriert worden, wie man es auf keinen Fall machen dürfe.
Warum erzählt er mir das alles, dachte Zink.
»Sie können sich vielleicht vorstellen, wie froh jeder von uns war, der an diesem Tag nicht Dienst gehabt hat«, beendete Iserlohe seine Erzählung. »Aber eigentlich wollte ich etwas ganz anderes mit Ihnen bereden. Haben Sie einen Moment?«
In diesem Augenblick klingelte sein Handy. Er entschuldigte sich, stand auf und ging ein paar Schritte zur Seite.
Zink sah, wie er zuerst eine ganze Zeit zuhörte und dann zu reden begann. Er konnte nicht verstehen, was er sagte. Er sah nur, wie er immer heftiger gestikulierte, wieder schwieg, wieder etwas sagte und dann das Gespräch, offenbar verärgert, beendete.
»Ist was passiert?«, fragte Zink, als Iserlohe zurück an den Tisch kam.
»Noch nicht«, erwiderte Iserlohe. »Aber ich muss weg!« Er blickte um sich, als fühle er sich verfolgt. Dann legte er, ohne jede weitere Erklärung, fünf Euro für seinen Espresso auf den Tisch, griff seinen Rucksack und verschwand.
Zink sah, wie er davoneilte, anfangs noch gehend, zum Schluss rennend, bis er in einer Seitenstraße verschwunden war.
In der Eile hatte er den Ausriss mit dem Artikel vergessen und, wie Zink danach feststellte, auch die darunterliegende Brieftasche.
Zink trank seinen Kaffee aus, bestellte einen neuen und dachte nach. Warum hatte ihn Schmidts ehemaliger Personenschützer gerade heute hier in Templin angesprochen? Warum hatte er ihm den Artikel aus dem Spiegel gezeigt? Und, warum war er nach dem Telefongespräch, das er außer Hörweite geführt hatte, überstürzt aufgebrochen? Irgendetwas war faul an der Geschichte. Zink hoffte, der Mann werde das Fehlen seiner Papiere bemerken und zurückkommen.
Aber er kam nicht zurück.
Als Zink nach einer Stunde vorsichtig die Brieftasche öffnete, fand er im Innern einen Dienstausweis der Sicherungsgruppe Bonn aus dem Jahr 1974, ausgestellt vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden auf Siegfried Iserlohe, geboren am 29. Juli 1950 in Köln.
Obwohl das Foto fast fünfzig Jahre alt war, erkannte Zink in dem dort abgebildeten jungen Uniformträger den Mann wieder, mit dem er gerade zusammengesessen hatte. Kein Zweifel: Es war der frühere Personenschützer Siegfried Iserlohe, der ihn von früher kannte und an den er sich jetzt, wo er weg war, auch vage zu erinnern glaubte. Zink hatte den Kanzler a. D. Helmut Schmidt noch ein paar Mal besucht. Und da war immer jemand in der Nähe gewesen, der den Pensionär bewacht hatte, selbst in dessen Garten im Hamburger Reihenhaus.
Er schaute nach, ob sich in der Brieftasche vielleicht Iserlohes Adresse oder Telefonnummer fänden. Es gab ein paar Fotos. Auf einem war Iserlohe zu sehen, wie er dem Kanzler Helmut Schmidt die Wagentür aufhält. Außerdem eines mit einer Frau und drei Halbwüchsigen, offenbar Familienfotos. Und ein paar Visitenkarten, mit denen er nichts anfangen konnte. Keine davon gehörte Iserlohe.
Zink überlegte, ob er die Brieftasche liegen lassen oder im Café abgeben sollte. Er ging hinein, bezahlte alles und erklärte der hübschen Kellnerin die Situation. Sie lächelte verständnisvoll. Er notierte seine Handynummer auf einem kleinen Notizblock und bat sie, den Zettel Iserlohe zu geben, falls dieser später zurückkommen und nach seinen Papieren fragen sollte. Da er vorher noch auf die Toilette gehen wollte, legte er die Brieftasche in seinen Einkaufskorb. Er sah sie fragend an und sie gab ihm lächelnd zu verstehen, dass sie auf seine Sachen aufpassen werde.
Als er zurückkam, stand sie immer noch neben der Kasse und lächelte ihn an. Zink nahm seinen Einkaufskorb und ging zu dem Parkplatz direkt vor der Stadtmauer, wo er sein Auto abgestellt hatte.
Dass ihm ein Mann folgte, bemerkte er nicht.
2.
Heinrich Ebert hatte schlechte Laune. Ein Reporter des Recherche-Netzwerks CORRECTIV namens Alexander Möller hatte sich gemeldet und ihn auszufragen versucht. Ebert, seinerzeit Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz und wegen der Vernichtung von NSU-Akten seit zehn Jahren im vorgezogenen Ruhestand, habe doch im Sommer 2012 vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages erklärt, er persönlich sei es gewesen, der am 11. November 2011 Akten über rechtsradikale Umtriebe in Thüringen geschreddert habe.
Er habe jetzt aber gehört, sagte der Reporter, nicht Ebert, sondern eine dazu überhaupt nicht befugte Sachbearbeiterin namens Maria Ferber habe dies auf Eberts Weisung erledigt. Ob er das bestätigen könne. Auch hatte er Andeutungen über ein Bankschließfach in Köln gemacht, in dem Ebert und sein Stellvertreter angeblich geheime Akten aus den Beständen des Amtes deponiert hätten, was ebenfalls streng verboten war.
Ebert hatte das Telefongespräch wütend weggedrückt. Er fühlte sich ertappt und hatte keine Lust, mit dem Schnüffler zu reden. Er wusste ja, dass die Kerle von CORRECTIV nicht lockerließen, wenn sie einmal an einer Geschichte dran waren.
Er wanderte ziellos durch seine Wohnung. Woher hatte der Reporter seine Handynummer? Sie stand in keinem öffentlichen Verzeichnis. Nur ein paar Vertraute hatten sie. Irgendeiner musste gequatscht und sie weitergegeben haben. Früher, als er noch in Köln wohnte, fühlte er sich vor solchen Nachstellungen sicher. Da bewegte er sich als Alter Herr der Bonnensia in einem intakten und verschwiegenen Freundeskreis, aus dem nie etwas nach außen drang.
Die meisten seiner Bonner Freunde waren längst tot, und seit er 2015, nach dem Tod seiner Frau, nach Erfurt gezogen war, hatte er kaum noch Kontakt zu den wenigen noch lebenden alten Kameraden. In Thüringen kannte ihn kaum jemand. Aber selbst hier war man vor linken Schnüfflern offenbar nicht mehr sicher. Mit ihnen hatte er sich immer schon gezofft und nie einen Hehl aus seiner rechten Gesinnung gemacht.
Ebert blieb stehen und sah durchs Fenster in seinen kleinen Garten hinaus.
Schon in den Siebzigerjahren, wenn er als Student mit seinem rechtsradikalen Freund Klaus Krohe, genannt KK, in der Schumannklause oder einer anderen Studentenkneipe der Bonner Südstadt auftauchte, hatte er seinen Nimbus gepflegt. »Ebert – wie Friedrich, nur nicht so rot«, so stellte er sich gern vor, und wenn jemand ihn »Nazi« nannte, wurde er handgreiflich.
Viele Jahre später erst erfuhr er, dass KK in Wahrheit ein von Markus Wolf eingeschleuster Agent der DDR war. Ein Journalist namens Kurt Zink, den er ebenfalls aus der Schumannklause kannte, hatte die Sache publik gemacht.
Zunächst hatte Ebert die angebliche Enttarnung seines Kumpels für eine linke Lüge gehalten. Dann bekam er, von Amts wegen, die Bestätigung. Es stimmte. KK war ein Stasi-Spitzel. Es war ein Schock. Ebert fühlte sich von seinem Freund verraten und missbraucht.
Gegen dessen Rat hatte er 1977 Angelika geheiratet, die Tochter eines betuchten Weinhändlers von der Mosel, mit dem er sich bei Familientreffen regelmäßig stritt. Denn sein Schwiegervater, der wie er Heinrich hieß, war Sozialdemokrat und Anhänger des SPD-Kanzlers Helmut Schmidt.
Als 1978 sein Sohn zur Welt kam, bestand er darauf, der Junge müsse Adolf Heinrich genannt werden. Seine Frau und deren Familie reagierten ablehnend. Heinrich, ja! Aber um Himmels willen bitte nicht Adolf. Er blieb dabei.
Bloß weil ein deutscher Politiker auch mal so hieß, der dummerweise so leichtsinnig war, sich von England und Frankreich in einen aussichtslosen Krieg treiben zu lassen … Klar, gab er zu, das war ein Fehler. Und dann auch noch gleichzeitig Russland zu überfallen, das konnte ja nicht gut gehen. Aber deshalb sei der Name doch nicht ein für alle Mal verbrannt. Adolf Heinrich sei außerdem eine Verbeugung vor den beiden Großvätern des Jungen.
Dagegen ließ sich schwer argumentieren.
Und so blieb es dabei.
Wegen seines ersten Namens hatte sein Sohn schon in der Grundschule viele Anfeindungen und Hänseleien aushalten müssen. Er hatte sie, wie es schien, verwunden. Als er älter wurde, hatte er den Namen sogar mit trotzigem Stolz getragen, fast wie einen Orden: Seht her, ich heiße so, weil mein Vater nach meiner Geburt im Jahre 1978 fand, es sei an der Zeit, dem Namen seines eigenen Vaters, meines Großvaters, wieder Geltung und Würde zu verschaffen.
Irgendwann aber hatte er, es muss im Jahr 2019 gewesen sein, eine winzige Änderung vorgenommen, von der sein Vater allerdings erst erfuhr, als jemand ihn darauf aufmerksam machte. Sein Sohn lasse seinen Namen nicht mehr mit einem »f«, sondern einem »ph« enden. Wahrscheinlich ein Versehen, dachte der alte Ebert zunächst. Bis er eines Tages in einem Brief, den sein Sohn ihm geschickt hatte, im Briefkopf sah, dass tatsächlich aus Adolf Adolph geworden war.