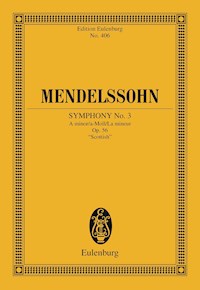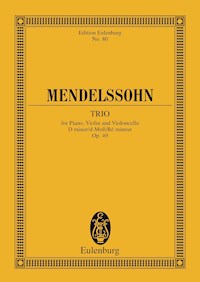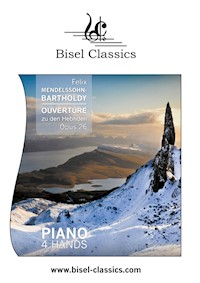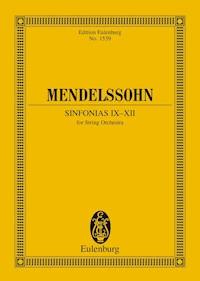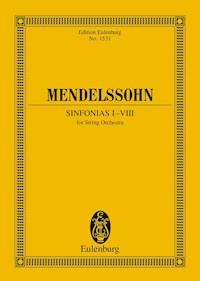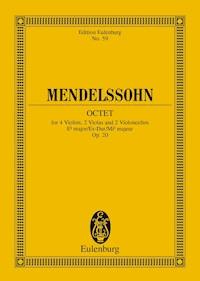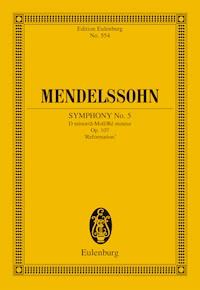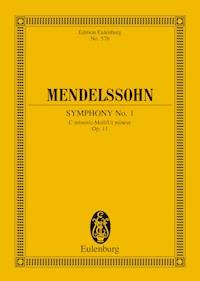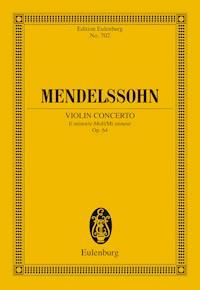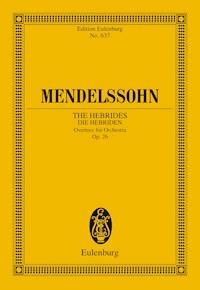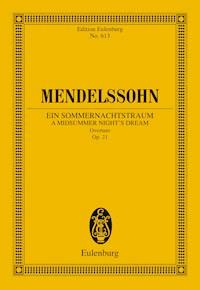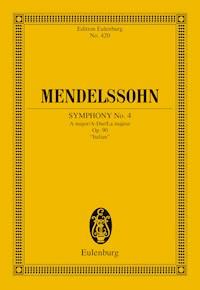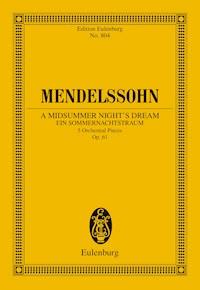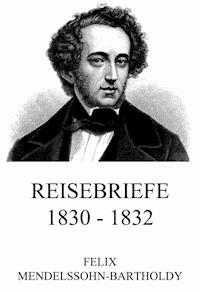
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der berühmte Komponist erzählt eindrucksvoll von seinen Konzertreisen durch Deutschland.
Das E-Book Reisebriefe 1830 - 1832 wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reisebriefe aus den Jahren 1830 bis 1832.
Felix Mendelssohn Bartholdy
Inhalt:
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Biografie und Bibliografie
Reisebriefe
Aus Briefen aus London vom Jahre 1832.
Weitere Briefe
FelixMendelssohn-Bartholdy– Biografie und Bibliografie
Komponist, geb. 3. Febr. 1809 in Hamburg, gest. 4. Nov. 1847 in Leipzig, Sohn des Bankiers Abraham Mendelssohn und Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn, wurde in Berlin, wohin die Familie einige Jahre nach seiner Geburt übersiedelte, neben gründlichem Unterricht in den allgemeinen Bildungsfächern von Louis Berger im Klavierspiel und von Zeller in der Komposition unterwiesen und machte so schnelle Fortschritte, daß er mit 15 Jahren bereits vier Singspiele geschrieben und im Vaterhause zur Ausführung gebracht hatte und mit 17 Jahren die noch heute allgemein bewunderte Sommernachtstraum-Ouvertüre schrieb. Ein Besuch Cherubinis in Paris 1825 beseitigte durch dessen günstiges Urteil die letzten Bedenken des Vaters gegen die Wahl der Musik als Lebensberuf. Neben ausgedehnten Arbeiten auf allen Gebieten der Komposition studierte aber Felix eifrig Sprachen, so daß er eine deutsche Bearbeitung der »Andria« des Terenz veröffentlichen konnte, welche die Anerkennung der Gelehrten fand. Von 1827 ab besuchte er fleißig die Vorlesungen der Berliner Universität. In demselben Jahr gelangte eine Oper seiner Komposition, »Die Hochzeit des Camacho«, im königlichen Schauspielhause zur Ausführung. Dieselbe sollte die einzige bleiben; trotz vielfachen Suchens hat sich M. nicht entschließen können, einen zweiten Bühnenversuch zu machen (ein Singspiel: »Die Heimkehr aus der Fremde«, schrieb er 1829, zur silbernen Hochzeit seiner Eltern). Doch beweist sein Fragment einer Oper »Loreley« (Text von Geibel), das seiner letzten Lebenszeit angehört, daß ihn Opernprojekte bis zuletzt beschäftigt haben. Um so größeres Interesse verwandte er aber auf die Instrumentalkomposition. Als er 1829 mit seiner englischen Reise seine Wanderjahre antrat, hatte er bereits eine stattliche Reihe Kammermusikwerke, Symphonien, Klaviersachen etc. geschrieben, darunter auch schon die Ouvertüre »Meeresstille und glückliche Fahrt«, und auch schon die berühmte erste Wiederaufführung von Bachs »Matthäuspassion« durch die Singakademie unter seiner Direktion durchgesetzt. Als er im Frühjahr 1829 in London auftrat, war der kaum Zwanzigjährige bereits ein fertiger Meister und feierte als Klavierspieler und Komponist in den Konzerten der Philharmonischen Gesellschaft Triumphe. Eine Frucht der englischen Reise, die ihn auch nach Schottland führte, ist die »Hebriden-Ouvertüre«, die er bei seiner Rückkehr aus Italien, wohin er sich nach kurzem Aufenthalt in Berlin wandte, 1832 in London zur ersten Ausführung brachte. Im Mai 1830 trat er die Reise nach Italien über Weimar und München an. So stark ihn die italienischen musikalischen Zustände enttäuschten, so sammelte er doch in dem schönen Land eine Fülle von Eindrücken und benutzte die Gelegenheit, die Schätze älterer Musik und italienischer Bibliotheken zu studieren, wobei ihm besonders Baini und Santini in Rom hilfreiche Hand leisteten. Nachdem M. noch Neapel besucht hatte, trat er die Rückreise an, die ihn über München führte (wo er den Auftrag erhielt, eine Oper zu schreiben, der aber mangels eines guten Textes nicht perfekt wurde). Zunächst besuchte er noch Paris und London, ehe er (im Mai 1832) nach Berlin zurückging. Dort war soeben Zelter gestorben; M. bewarb sich um die da durch erledigte Dirigentenstelle der Singakademie, doch wurde ihm Rungenhagen vorgezogen. Verstimmt unternahm M. im Frühjahr 1833 seine dritte Reise nach London und führte hier seine A dur-Symphonie auf (die italienische), kehrte auch wieder nach London zurück (das er noch öfters aufsuchte), nachdem er zu Pfingsten 1833 das Niederrheinische Musikfest in Düsseldorf dirigiert und die ihm angetragene Stellung eines städtischen Musikdirektors angenommen hatte, die er im Herbst antrat. Die ihm damit aufgebürdete Arbeitslast (er hatte nicht nur auch die Winterkonzerte und die Kirchenmusik zu dirigieren, sondern mußte zugleich die musikalische Leitung des unter Immermann 1834 eröffneten Stadttheaters übernehmen) wurde ihm bald zu groß, so daß er die Direktion der Oper seinem Freund J. Rietz übertrug. In Düsseldorf schrieb er den größten Teil seines Oratoriums »Paulus«, dessen Erstaufführung auf dem Musikfeste zu Düsseldorf 1836 stattfand. Inzwischen hatte aber M. die Düsseldorfer Stellung mit der des Dirigenten der Gewandhauskonzerte in Leipzig vertauscht (im Sommer 1835). Mit Mendelssohns Erscheinen nahm das Musikleben Leipzigs einen außerordentlichen Aufschwung, und die Gewandhauskonzerte hoben sich zum tonangebenden Konzertinstitut in Deutschland. Von hoher Bedeutung wurde auch die Begründung des Konservatoriums. Der Plan Friedrich Wilhelms IV., in Berlin ein Konservatorium in großem Stil unter M. zu begründen, veranlaßte mehrmals M., seinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen (1841, 1843, 1845). Doch kehrte er immer nach kurzer Zeit wieder nach Leipzig zurück, und auch der Dresdener Hof vermochte nicht, ihn Leipzig abspenstig zu machen. Schon 1836 wurde M. zum Ehrendoktor der Leipziger Universität ernannt; 1841 erhielt er vom König von Sachsen den Kapellmeistertitel, 1843 vom König von Preußen den eines Generalmusikdirektors. 1837 hatte sich M. mit Cäcilie Jeanrenaud, der Tochter eines Predigers in Frankfurt a. M., verheiratet, mit der er ein glückliches Familienleben führte. Der Tod seines Vaters (1835), seiner Mutter (1842) hatte bereits eine starke Erschütterung seines seelischen Gleichgewichts bewirkt. Noch schwerer traf ihn der Tod seiner Lieblingsschwester Fanny (s. Hensel 2), und nur wenige Monate später folgte er ihr ins Grab. Wie den Vater und die Schwester raffte auch ihn ein Nervenschlag dahin. Seine Leiche wurde nach Berlin übergeführt. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Tondichter II« (beim Art. »Musik«).
Mit seinen beiden Oratorien »Paulus« und »Elias« steht M. als der bedeutendste Meister dieser Formen in der Zeit des Aufschwunges der Chorkomposition in Nachahmung Haydns und Händels da, letzterm näherstehend als Haydn. Wenn auch die vorwiegend lyrische und melodienfreudige Natur Mendelssohns in diesen Werken bemerkbar wird, so erhebt sich dieselbe doch hoch über diejenige der Zeitgenossen. Mit der »ersten Walpurgisnacht« schuf er eine neue Form, die der Chorballade, die zunächst Schumann weiter ausbaute. Diesen Chorwerken reihen sich zunächst an: die auf Wunsch Friedrich Wilhelms IV. geschriebenen Chöre zu Sophokles' »Antigone« und »Ödipus« und Racines »Athalia«, mehrere Kantaten (»An die Künstler« und »Gutenberg-Kantate«, beide für Männerchor), die Symphonie mit Chor »Lobgesang« (als Symphonie Nr. II), dazu 5 Psalmen für Soli, Chor und Orchester, 3 Psalmen zu 8 Stimmen a cappella, mehrere Hefte Motetten und andre geistliche Gesänge (auch Fragmente eines dritten Oratoriums, »Christus«). Zu ganz besonderer Beliebtheit gelangten auch die Chorlieder, zweistimmigen Lieder (Duette) und viele der einstimmigen Lieder Mendelssohns, in denen er sehr zu einer volksmäßigen Faktur hinneigt, doch oft mit einem starken Zusatz von Sentimentalität. Aber dem Vokalkomponisten ist zum mindesten ebenbürtig der Instrumentalkomponist, der in weit höherm Grad als der Vokalkomponist als Fortbildner der Romantik Webers und Schuberts gelten muß. Zwar zügelt seine Phantasie überall der angeborne und durch Erziehung verstärkte Formensinn, der für sein gesamtes Schaffen charakteristisch ist und ihn gegenüber dem mit Ideen verschwenderischen Schumann manchmal formalistisch erscheinen läßt; doch liegt über vielen seiner Instrumentalwerke ein Hauch echter Naturpoesie und lebt in ihnen ein echter Märchengeist. Obenan stehen da seine Ouvertüren »Fingalshöhle« (»Hebriden«), »Meeresstille und glückliche Fahrt« und »Das Märchen von der schönen Melusine«, die ganze »Sommernachtstraum-Musik« (während in der Ruy-Blas- u. Trompeten-Ouvertüre mehr ein theatralischer Geist herrscht), auch die III. (schottische) und IV. (italienische) Symphonie sowie viele seiner zahlreichen Klavierkompositionen, besonders die Lieder ohne Worte, die eine beispiellose Popularität erlangten. Glänzend und doch mit innigen und graziösen Momenten durchsetzt sind seine beiden Klavierkonzerte in G moll und D moll, das H moll-Capriccio mit Orchester, auch sein Violinkonzert und seine Kammermusikwerke mit Klavier (3 Trios, 3 Quartette, 1 Sextett, 2 Sonaten und 1 Variationenwerk mit Cello, eine Violinsonate), während die nur für Streichinstrumente geschriebenen in der Wirkung hinter denen der Klassiker zurückbleiben. Eine Gesamtausgabe seiner Werke, von Rietz redigiert, erschien 1871–77 im Verlag von Breitkopf u. Härtel in Leipzig. Einen wertvollen Beitrag zur Kunde seines künstlerischen Strebens wie der Liebenswürdigkeit und Reinheit seines Charakters liefern die von seinem Bruder Paul M. herausgegebenen Briefe (Bd. 1: »Reisebriefe 1830–1832«, Leipz. 1861; Bd. 2: »Briefe 1833–1847«, das. 1863; Volksausg. in einem Band, 7. Aufl. 1899). Mendelssohns »Briefe an Ignaz und Charlotte Moscheles« wurden von Felix Moscheles (Leipz. 1888) herausgegeben, der »Briefwechsel zwischen Felix M. und Julius Schubring« erschien daselbst 1891. Vgl. Ed. Devrient, Meine Erinnerungen an Felix M. und seine Briefe an mich (3. Aufl., Leipz. 1891); Hiller, Felix M., Briefe und Erinnerungen (2. Aufl., Köln 1878); S. Hensel, Die Familie M. in Briefen und Tagebüchern (12. Aufl., Berl. 1904, 2 Bde.); Karl Mendelssohn-Bartholdy (s. unten 2), Goethe und Felix M. (Leipz. 1871); Lampadius, Felix M., ein Gesamtbild seines Lebens und Wirkens (das. 1886); Reißmann, Felix M., sein Leben und seine Werke (3. Aufl., Berl. 1892); E. Wolff, Felix M. (das. 1905). – Aus dem Erträgnis einer Ausführung von Mendelssohns »Elias« unter Leitung von J. Benedict wurde 1848 in London unter dem Namen Mendelssohn-Scholarship ein Fonds begründet, dessen Zinsen als Stipendium an talentvolle junge englische Komponisten vergeben werden. Der erste Mendelssohn Scholar war Arthur Sullivan (1856–60). Auch Berlin besitzt eine Mendelssohn-Stiftung, bestehend in einem Stipendium von 1500 Mk. für junge deutsche Komponisten und ausübende Tonkünstler, die mindestens ein halbes Jahr an einem vom Staat subventionierten Musikinstitut studiert haben.
Reisebriefe, F. Mendelssohn-Bartholdy
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849631529
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Reisebriefe
Dritte, unveränderte Auflage, Leipzig, Verlag von Hermann Mendelssohn. 1862.
»In musikalischen Kreisen hatte ich von den außerordentlichen Fähigkeiten des Knaben gehört, ihn in der Singakademie und in Zelters Freitagsmusiken gesehen, auch in einer Singeteegesellschaft getroffen, wo er unter den Erwachsenen in seinem Kinderanzuge, dem sogenannten Habit, stand: einer am Halse weit ausgeschnittenen engen Jacke, über welche das weite Beinkleid geknöpft war. In dessen seitwärts eingeschnittenen Taschen hatte der Kleine gern die Hände gesteckt und wiegte den Lockenkopf seitwärts hin und wider.« (Aus Devrients Erinnerungen an Mendelssohn)
Weimar, den 21. Mai 1830.
Eines so heitern frischen Reisetags wie des gestrigen, weiß ich mich gar nicht zu entsinnen seit meiner Reisepraxis. Früh Morgens war der Himmel grau und bedeckt, die Sonne kam erst später durch; dazu kühle Luft und Himmelfahrtstag; die Leute waren geputzt, und ich sah sie in einem Dorfe in die Kirche gehen, in einem anderen wieder herauskommen, wieder in einem andern Kegel schieben; bunte Tulpen gab's überall in den Gärten, und ich fuhr schnell, und sah mir alles an. In Weißenfels gaben sie mir einen kleinen Korbwagen, und in Naumburg gar eine offene Droschke; die Sachen wurden hintenauf gepackt, sammt dem Hut und Mantel; ich kaufte mir ein Paar Maiblumensträuße, und so ging's durch das Land, wie auf einer Spazierfahrt. Hinter Naumburg kamen Pförtner-Primaner, und beneideten mich; dann fuhren wir dem Präsidenten G. in einem kleinen Wägelchen, das schwer an ihm zu tragen hatte, vorbei, und seine Töchter, oder Frauen, kurz die zwei Damen, die mit ihm waren, beneideten mich wohl nicht minder; den Kösener Berg trabten wir hinan, denn die Pferde brauchten kaum zu ziehen, und wir holten eine Menge bepackter Hauderer ein; die beneideten mich gewiß auch, denn ich war wirklich beneidenswerth. Die Gegend sah so frühlingsmäßig und geputzt, bunt, heiter aus, und dann ging die Sonne so ernsthaft hinter den Hügeln unter, und dann fuhr der russische Gesandte in zwei großen vierspännigen Wagen so mürrisch und geschäftsmäßig, und ich fuhr in meiner Droschke als Hasenfuß so bald bei ihm vorbei, und Abends bekam ich noch statische Pferde, damit ein kleiner Verdruß auch nicht fehlte, (er gehört nach meiner Theorie zum Plaisir) und ich componirte den ganzen Tag so sehr gar nichts, sondern genoß faul. – Die Sache war herrlich, das ist wahr, und wird nicht vergessen werden. Ich schließe diese Beschreibung mit der Anmerkung, daß die Kinder in Eckartsberge ganz ebenso Ringe Rosenkranz spielten, wie bei uns, und daß sie sich durch den fremden Herrn nicht stören ließen, obwohl er vornehm zusah; ich hätte lieber mitgespielt! Den 24sten. Das schrieb ich, ehe ich zu Goethe ging, Morgens früh nach einem Spaziergange im Park; nun bin ich noch hier, und konnte wahrlich nicht zur Fortsetzung des Briefes kommen. Ich werde auch vielleicht noch zwei Tage hier bleiben, und es ist nicht schade darum; denn so heiter und liebenswürdig, wie dies mal, und so gesprächig und mittheilend habe ich den alten Herrn noch nie gefunden. Der Grund aber, warum ich wohl noch bleiben werde, ist gar nicht übel, und macht mich fast eitel, oder vielmehr stolz; auch will ich ihn Euch nicht verschweigen. Goethe schickte mir nämlich gestern an einen hiesigen Maler einen Brief, den ich selbst abgeben sollte, und Ottilie vertraute mir an, daß der Auftrag mein Portrait zu zeichnen, darin enthalten sei, weil Goethe es zu einer Sammlung Zeichnungen seiner Bekannten, die er seit einiger Zeit, angefangen hat, legen wolle. Die Sache machte mir fast Freude (fast im biblischen Sinne); da ich aber den Herrn Maler »will er wohl« bis jetzt nicht getroffen habe (er mich also auch nicht), so werde ich wohl übermorgen noch bleiben. Es thut mir auch nicht leid, wie gesagt, denn ich lebe ganz prächtig hier, und genieße die Nähe des alten Herrn so recht aus dem Grunde, habe bis jetzt alle Mittage bei ihm gegessen, und bin heut Morgen wieder zu ihm beschieden; heut Abend giebt er eine Gesellschaft, wo ich spielen soll, und da spricht er nun über alles, fragt nach allem, daß es eine Freude ist. – Ich muß aber ordentlich und folgerecht erzählen, damit Ihr Alles erfahrt. Des Morgens ging ich zu Ottilie die ich zwar noch kränklich und zuweilen klagend, aber doch heiterer als früher, und gegen mich so freundlich und liebenswürdig, wie immer fand. Wir sind seitdem fast immer zusammen gewesen, und ich habe mich sehr gefreut, sie näher kennen zu lernen. Ulrike ist jetzt so angenehm und lieblich, wie nie zuvor; der Ernst, den sie bekommen, hat sich mit ihrem ganzen Wesen vereinigt, und sie hat eine Sicherheit und Tiefe der Empfindung, die sie zu einer der liebenswürdigsten Erscheinungen machen, die ich kenne. Die beiden Knaben, Walter und Wolf, sind lebendig, fleißig und zuthulich, und wenn sie von Großpapa's Faust sprechen, so klingt das gar zu nett. Zur Erzählung wieder zu kommen, schickte ich den Brief von Zelter sogleich hinein zu Goethe; der ließ mich zu Tische bitten; da fand ich ihn denn im Äußeren unverändert, Anfangs aber etwas still, und wenig theilnehmend; ich glaube, er wollte mal zusehen, wie ich mich wohl nehmen möchte; mir war es verdrießlich, und ich dachte, er wäre jetzt immer so. Da kam zum Glück die Rede auf die Frauenvereine in Weimar, und auf das Chaos, eine tolle Zeitung, die die Damen unter sich herausgeben, und zu deren Mitarbeiter ich mich aufgeschwungen habe. Auf einmal fing der Alte an lustig zu werden, und die beiden Damen zu necken mit der Wohlthätigkeit, und dem Geistreichthum, und den Subscriptionen, und der Krankenpflege, die er ganz besonders zu hassen scheint; forderte mich auf, auch mit loszuziehen, und da ich mir das nicht zweimal sagen ließ, so wurde er erst wieder ganz wie sonst, und dann noch freundlicher und vertraulicher, als ich ihn bis jetzt kannte. Da ging's denn über alles her; von der Räuberbraut von Ries meinte er, die enthielte Alles, was ein Künstler jetzt brauche, um glücklich zu leben: einen Räuber und eine Braut; dann schimpfte er auf die allgemeine Sehnsucht der jungen Leute, die so melancholisch wären; dann erzählte er Geschichten von einer jungen Dame, der er einmal die Tour gemacht hätte, und die auch einiges Interesse an ihm genommen habe; – dann kamen die Ausstellungen, und der Verkauf von Handarbeiten für Verunglückte, wo die Weimaranerinnen die Verkäuferinnen machen, und wo er behauptete, daß man gar nichts bekommen könnte, weil die jungen Leute alles unter sich schon vorher bestimmten, und dann versteckten, bis die rechten Käufer kämen u.s.w. – Nach Tische fing er denn auf einmal an: »Gute Kinder – hübsche Kinder – muß immer lustig sein – tolles Volk« und dazu machte er Augen, wie der alte Löwe, wenn er einschlafen will. Dann mußte ich ihm vorspielen, und er meinte, wie das so sonderbar sei, daß er so lange keine Musik gehört habe; nun hätten wir die Sache immer weiter gefühlt, und er wisse nichts davon; ich müsse ihm darüber viel erzählen »denn wir wollen doch auch einmal vernünftig mit einander sprechen.« Dann sagte er zu Ottilie: »Du hast nun schon gewiß Deine weisen Einrichtungen getroffen; das hilft aber nichts gegen meine Befehle, und die sind, daß Du heut hier Deinen Thee machst, damit wir wieder zusammen sind.« Als die nun frug, ob es nicht zu spät werden würde, da Riemer zu ihm käme, und mit ihm arbeiten wolle, so meinte er: »Da Du deinen Kindern heut früh ihr Latein geschenkt hast, damit sie den Felix spielen hörten, so könntest Du mir doch auch einmal meine Arbeit erlassen.« Dann lud er mich auf den heutigen Tag wieder zu Tisch ein, und ich spielte ihm Abends viel vor; meine drei Walliser oder Walliserinnen machen hier viel Glück, und ich suche mein Englisch wieder vor. Da ich Goethe gebeten hatte, mich Du zu nennen, ließ er mir den folgenden Tag durch Ottilie sagen, dann müsse ich aber länger bleiben als zwei Tage, wie ich gewollt hätte, sonst könne er sich nicht wieder daran gewöhnen. Wie er mir das nun noch selbst sagte, und meinte, ich würde wohl nichts versäumen, wenn ich etwas länger bliebe, und mich einlud, jeden Tag zum Essen zu kommen, wenn ich nicht anders wo sein wollte; wie ich denn nun bis jetzt auch jeden Tag da war, und ihm gestern von Schottland, Hengstenberg, Spontini und Hegels Ästhetik erzählen mußte, wie er mich dann nach Tiefurth mit den Damen schickte, mir aber verbot nach Berka zu fahren, weil da ein schönes Mädchen wohne, und er mich nicht ins Unglück stürzen wolle, und wie ich dann so dachte, das sei nun der Goethe, von dem die Leute einst behaupten würden, er sei gar nicht eine Person, sondern er bestehe aus mehreren kleinen Goethiden – da wär' ich wohl recht toll gewesen, wenn mich die Zeit gereut hätte. Heut soll ich ihm Sachen von Bach, Haydn und Mozart vorspielen, und ihn dann so weiter führen bis jetzt, wie er sagte. Übrigens war ich auch ein ordentlicher Reisender, und habe die Bibliothek, und Iphigenie in Aulis gesehen. Hummel hat Octaven und dergleichen gestrichen!!
Felix.
Weimar, den 25. Mai 1830
Eben bekomme ich Euren lieben Brief vom Himmelfahrtstag, und kann mir nicht helfen, muß noch einmal von hier aus darauf antworten. Dir, liebe Fanny, schicke ich nächstens die Copie meiner Symphonie; ich lasse sie hier abschreiben, und schicke sie nach Leipzig, (wo sie vielleicht aufgeführt werden wird) mit der gemessenen Ordre, sie Dir baldmöglichst zuzustellen. Sammle doch Stimmen über den Titel, den ich wählen soll. Reformationssymphonie, Confessionssymphonie, Symphonie zu einem Kirchenfest, Kindersymphonie, oder wie Du willst; schreib mir darüber, und statt aller dummen Vorschläge, einen klugen; die dummen, die aber bei der Gelegenheit ausgeheckt werden, will ich auch wissen. Gestern Abend war ich in einer Gesellschaft bei Goethe, und spielte den ganzen Abend allein: Concertstück, Aufforderung, Polonaise in C von Weber, drei Wälsche Stücke, Schottische Sonate. Um zehn war es aus; ich blieb aber natürlich unter dummem Zeug, Tanzen, Singen u. s. w. bis zwölf, lebe überhaupt ein Heidenleben. – Der Alte geht immer um neun Uhr auf sein Zimmer, und so wie er fort ist, tanzen wir auf den Bänken, und sind noch nie vor Mitternacht aus einander gegangen.
Morgen wird mein Portrait fertig; es wird eine große, schwarze, sehr ähnliche Kreidezeichnung; aber ich sehe sehr brummig aus. Goethe ist so freundlich und liebevoll mit mir, daß ich's gar nicht zu danken, und zu verdienen weiß. Vormittags muß ich ihm ein Stündchen Clavier vorspielen, von allen verschiedenen großen Componisten, nach der Zeitfolge, und muß ihm erzählen, wie sie die Sache weiter gebracht hätten; und dazu sitzt er in einer dunklen Ecke, wie ein Jupiter tonans, und blitzt mit den alten Augen. An den Beethoven wollte er gar nicht heran. – Ich sagte ihm aber, ich könne ihm nicht helfen, und spielte ihm nun das erste Stück der C Moll-Symphonie vor. Das berührte ihn ganz seltsam. – Er sagte erst: »das bewegt aber gar nichts; das macht nur Staunen; das ist grandios,« und dann brummte er so weiter, und fing nach langer Zeit wieder an: »das ist sehr groß, ganz toll, man möchte sich fürchten, das Haus fiele ein; und wenn das nun alle die Menschen zusammenspielen!« Und bei Tische, mitten in einem anderen Gespräch, fing er wieder damit an. Daß ich nun alle Tage bei ihm esse, wißt Ihr schon; da fragt er mich denn sehr genau aus, und wird nach Tische immer so munter und mittheilend, daß wir meistens noch über eine Stunde allein im Zimmer sitzen bleiben, wo er ganz ununterbrochen spricht. Das ist eine einzige Freude, wie er einmal mir Kupferstiche holt und erklärt, oder über Hernani und Lamartines Elegien urtheilt, oder über Theater, oder über hübsche Mädchen. Abends hat er schon mehreremal Leute gebeten, was jetzt bei ihm die höchste Seltenheit ist, so daß die meisten Gäste ihn seit langem nicht gesehen hatten. Dann muß ich viel spielen, und er macht mir vor den Leuten Complimente, wobei »ganz stupend« sein Lieblingswort ist. Heute hat er mir eine Menge Schönheiten von Weimar zusammen gebeten, weil ich doch auch mit den jungen Leuten leben müsse. Komm ich dann in solcher Gesellschaft an ihn heran, so sagt er: »meine Seele, Du mußt zu den Frauen hingehen, und da recht schön thun.« – Ich habe übrigens viel Lebensart, und ließ gestern fragen, ob ich nicht doch vielleicht zu oft käme. Da brummte er aber Ottilie an, die es bestellte, und sagte: »er müsse erst ordentlich anfangen mit mir zu sprechen, denn ich sei über meine Sache so klar, und da müsse er ja vieles von mir lernen.« – Ich wurde noch einmal so lang, als Ottilie mir das wiedersagte, und da er mir's gestern gar selbst wiederholte, und meinte, es sei ihm noch Vieles auf dem Herzen, über das ich ihn aufklären müsse, so sagte ich »O ja« und dachte »es soll mir eine unvergeßliche Ehre sein.« Öfter geht es umgekehrt!
Felix.
München, den 6. Juni 1830.
Lange ist es nun schon her, daß ich Euch nicht geschrieben habe, und Ihr habt wohl gar Sorge deswegen gehabt. Nehmt es nur nicht übel; ich konnte wahrlich nichts dafür, habe mich genug geängstigt deswegen, – meine Reise beschleunigt, wie es gehen wollte, – mich nach Schnellposten überall erkundigt, bin überall falsch berichtet worden, bin nun eine Nacht durchgereist, um mit der heutigen Post schreiben zu können, von der ich in Nürnberg erfuhr, und da ich endlich hier ankomme, geht heut gar keine Post ab. Ich möchte toll werden, und Deutschland mit seinen kleinen Fürstenthümern, seinem verschiedenen Gelde, seinen Fahrposten, die 5/4 Stunden zur Meile brauchen, und seinem Thüringer Walde, wo es regnet und stürmt, ja sogar mit seinem Fidelio heut Abend hier, kann mir gewogen bleiben! Denn so todmüde ich bin, muß ich nun doch pflichtschuldigst hineingehen, und möchte viel lieber schlafen. Seid nur nicht böse auf mich, und scheltet mich auch nicht, wegen des langen Verzugs; ich kann Euch sagen, daß ich heut Nacht, während des Fahrens immer aus den Wolken den Zopf, oder die Nase kucken sah, die ich hier bekommen würde. Nun will ich Euch aber auch erzählen, warum ich Euch so spät schreibe. Einige Tage nach meinem letzten Briefe aus Weimar wollte ich, wie ich Euch geschrieben hatte, hierher abreisen, und sagte das auch an Goethe bei Tisch, der dazu ganz still war. – Nach Tische aber zog er aus der Gesellschaft Ottilie in ein Fenster, und sagte ihr: »Du machst, daß er hier bleibt.« Die versuchte denn nun mich zu bereden, ging mit mir in dem Garten auf und ab; ich aber wollte ein fester Mann sein, und blieb bei meinem Entschlusse. Da kam der alte Herr selbst, und sagte, das wäre ja nichts mit dem Eilen; er hätte mir noch viel zu erzählen, ich ihm noch viel vorzuspielen, und was ich ihm da vom Zweck meiner Reise sagte, das sei gar nichts. Weimar sei eigentlich jetzt das Ziel meiner Reise gewesen, und was ich hier entbehrte, das ich an meinen tables d'hôte finden würde, könne er nicht einsehen; ich solle noch viel Gasthäuser zu sehen bekommen. – So ging's weiter, und da mich das rührte, und Ottilie und Ulrike auch noch halfen, und mir begreiflich machten, wie der alte Herr niemals die Leute zum Bleiben, und nur desto öfter zum Gehen nöthigte, und wie keinem die Zahl der frohen Tage so bestimmt vorgeschrieben sei, daß er ein Paar sicher frohe wegwerfen dürfte, und wie sie mich dann bis Jena begleiten würden, so wollte ich wieder nicht ein fester Mann sein, und blieb. Selten in meinem Leben habe ich einen Entschluß so wenig bereut, wie diesen, denn der folgende Tag war der allerschönste, den ich je dort im Hause erlebt habe. Nach einer Spazierfahrt des Morgens fand ich den alten Goethe sehr heiter; er kam in's Erzählen hinein, gerieth von der Stummen von Portici auf Walter Scott, von dem auf die hübschen Mädchen in Weimar, von den Mädchen auf die Studenten, auf die Räuber, und so auf Schiller; und nun sprach er wohl über eine Stunde ununterbrochen heiter fort, über Schiller's Leben, über seine Schriften, und seine Stellung in Weimar; so gerieth er auf den seel. Großherzog zu sprechen, und auf das Jahr 1775, das er einen geistigen Frühling in Deutschland nannte, und von dem er meinte, es würde es kein Mensch so schön beschreiben können wie er; dazu sei auch der 2. Band seines Lebens bestimmt; aber man käme ja nicht dazu, vor Botanik und Wetterkunde, und all dem anderen dummen Zeug, das einem kein Mensch danken will; erzählte dann Geschichten aus der Zeit seiner Theaterdirektion, und als ich ihm danken wollte, meinte er, »ist ja nur zufällig; das kommt alles so beiläufig zum Vorschein, hervorgerufen durch Ihre liebe Gegenwart.« Die Worte klangen mir wundersüß; kurz es war eins von den Gesprächen, die man in seinem Leben nicht vergessen kann. Den andern Tag schenkte er mir einen Bogen seines Manuscripts von Faust, und hatte darunter geschrieben: dem lieben jungen Freunde F. M. B., kräftig zartem Beherrscher des Piano's, zur freundlichen Erinnerung froher Maitage 1830. J. W. von Goethe, und gab mir dann noch drei Empfehlungen hieher mit. – Finge nur der fatale Fidelio nicht bald an, so könnte ich noch manches erzählen; so aber nur noch den Abschied vom alten Herrn. Ganz im Anfang meines Aufenthalts in Weimar hatte ich von einer betenden Bauernfamilie von Adr. von Ostade gesprochen, die vor neun Jahren großen Eindruck auf mich gemacht habe. – Als ich nun Morgens hineinkomme, um mich ihm zu empfehlen, sitzt er vor einer großen Mappe und meint: »ja, ja, da geht man nun fort, wollen sehen, daß wir uns aufrecht erhalten bis zur Rückkunft; aber ohne Frömmigkeit wollen wir hier nicht auseinander gehen, und da müssen wir uns denn das Gebet noch einigemal zusammen ansehen.« – Dann sagte er mir, ich solle ihm zuweilen schreiben, (Muth! Muth! Ich thue es von hier aus) und dann küßte er mich, und da fuhren wir weg, nach Jena, wo mich Frommans ungemein freundlich aufnahmen, und wo ich Abends auch von Ulrike und Ottilie Abschied nahm, und so ging es dann hierher. Um 9 Uhr. Nun ist Fidelio vorüber, und in Erwartung des Abendessens noch ein Paar Worte. – Die Schechner hat wahrhaftig sehr verloren; der Ansatz der Stimme ist bedeckt; sie hat oft bedeutend heruntergezogen, und dennoch kommt in manchen Momenten die Innerlichkeit so rührend wieder hervor, daß ich in meiner Art zuweilen weinte; – alle übrigen waren schlecht, und so war auch vieles an der Aufführung zu tadeln; doch sind vortreffliche Mittel im Orchester, und die Ouvertüre ging in der Art, wie sie sie geben, sehr gut. Ist aber doch mein Deutschland ein närrisches Land; es kann die großen Leute hervorbringen und achtet sie nicht; es hat große Sänger genug, viel denkende Künstler, aber keinen untergeordneten, treu und anspruchslos wiedergebenden; Marzelline verziert ihre Rolle; Jaquino ist ein Tölpel; der Minister ein Schaaf; und wenn ein Deutscher, wie Beethoven, eine Oper geschrieben hat, so streicht ein Deutscher, wie Stuntz, oder Poißl, (oder wer es sonst gethan hat) die Ritornelle, und dergleichen Unnützes darin; ein anderer Deutscher setzt Posaunen zu seinen Symphonien; ein dritter sagt dann B sei überladen, und dann ist ein großer Mann vorbei! – Lebt denn wohl; seid sehr gesund, fröhlich und glücklich, und mögen alle meine Herzenswünsche für Euch in Erfüllung gehen.
Felix.
München, den 14. Juni 1830.
An Fanny Hensel!
Mein liebes Schwesterchen!
Da habe ich heut früh Euren Brief vom 5ten bekommen, und so bist Du noch immer nicht wohl; ich möchte gern bei Dir sein, und Dich sehn, und Dir was erzählen; es will aber nicht gehn. Da habe ich Dir denn ein Lied aufgeschrieben, wie ichs wünsche und meine; dabei habe ich Dein gedacht, und es ist mir sehr weich dabei. Neues ist wohl fast nicht darin; Du kennst mich ja, und weißt was ich bin; der bin ich denn immer noch, und so magst Du drüber lachen, und Dich freuen; ich kann Dir wohl was anderes sagen und wünschen, was Besseres aber nicht. Weiter soll auch nichts im Brief stehn; daß ich Dein bin, weißt Du, – so möge Dir Gott geben, was ich hoffe und bitte:
Linz, den 11. August 1830.
Liebe Mutter!
»Wie der reisende Musikus in Salzburg seinen großen Pechtag abhielt.«
Ein Bruchstück aus dem ungeschriebenen Tagebuch des Grafen F.M.B***. (Fortsetzung.)
Als ich den vorigen Brief an Euch geschlossen hatte, fing der unglücklichste Pechtag an, über mich hereinzubrechen. Ich nahm den Bleistift, und verdarb zwei meiner Lieblingszeichnungen aus dem Bairischen Gebirge, dergestalt daß ich sie ausreißen, und aus dem Fenster werfen mußte. Das ärgerte mich, und um mich zu zerstreuen, ging ich auf den Kapuzinerberg. Daß ich mich unterwegs verirrte, versteht sich von selbst; im Augenblicke als ich auf dem Gipfel ankam, fing es fürchterlich an zu regnen, und ich mußte unter dem Regenschirm schnell wieder hinunterlaufen. Jetzt wollte ich wenigstens das Kloster unten besehen, und schellte an; da fiel mir ein, daß ich nicht genug Geld für den zeigenden Mönch hatte; so etwas nehmen sie aber sehr übel, und ich machte darum, daß ich fortkam, ohne dem Pförtner weiter zu antworten. Jetzt schloß ich meine Paquete nach Leipzig und brachte sie auf die Post; erst müssen sie auf der Mauth visitirt sein, hieß es. Ich ging nach der Mauth; sie ließen mich eine Stunde warten, bis sie einen Schein von drei Zeilen zusammen brachten, und benahmen sich so flegelhaft, daß ich mich obenein noch mit ihnen herumzanken mußte. – Hang Salzburg dachte ich, und bestellte Pferde nach Ischl, wo ich mich zu erholen hoffte von allem Pech im Neste. Sie bekommen keine Pferde, ohne Erlaubniß von der Polizei. Nach der Polizei. Sie bekommen keine Erlaubniß, ehe Ihr Paß vom Thor her da ist. Was spreche ich lange? Nach unzähligem Hin- und Herschicken und Laufen kam die ersehnte Postchaise; ich habe gegessen, lasse einpacken, und denke, nun ist's überstanden; Rechnungen und Trinkgelder sind bezahlt. Wie ich vor die Thür trete, fahren im Schritt zwei elegante offene Reisewagen vor, und die Leute aus dem Wirthshaus eilen den Herrschaften, die zu Fuß nachkommen entgegen. Ich kümmere mich aber um nichts, und setze mich in meine Chaise. Indem sehe ich, daß einer von den angekommenen Wagen hart neben dem meinigen hält, und eine Dame sitzt darin. Aber welch eine Dame! Damit Ihr nun nicht gleich glaubt, ich hätte mich verliebt, und das sei die Krone des Pech's, fange ich damit an, daß sie ältlich war: aber sie sah sehr liebenswürdig und freundlich aus, und trug ein schwarzes Kleid, mit schwerer goldner Kette, und gab dem Postillon sein Trinkgeld in die Hand, und lächelte dazu sehr lieb. Weiß Gott, warum ich lange an meinem Koffer ruckte, und nicht abfahren ließ; ich sah immerfort hinüber, und so unbekannt sie mir war, so war mir stark zu Muthe, als müßte ich sie geradezu anreden. Es mag vielleicht Einbildung gewesen sein, aber ich lasse es mir nicht ausreden, daß auch sie hinüberschaute, und den ruppigen Reisenden, mit der Studentenmütze, besah. Als sie nun aber gar auf meiner Seite ausstieg, und sich dabei ganz vertraulich an meiner Wagenthür anhielt, dann ein Weilchen stehen blieb, und die Hand immer ruhig auf meiner Wagenthür liegen ließ, so hatte ich alle meine wohlerworbene Reiseroutine nöthig, um nicht auch hinauszusteigen, und zu sagen: »Liebe Dame, wie heißen Sie denn?« – Die Routine siegte aber, und ich rief vornehm: Immer zu, Schwager. Da zog die Dame ihre Hand schnell zurück, und es ging fort. Ich war über alles verdrießlich, dachte nach, und schlief ein. Ein Wagen mit zwei Herren, der an uns vorüberrollte, weckte mich auf. Es entspann sich nun folgendes Gespräch zwischen dem Schwager und mir: Ich: die kommen auch von Ischl, da werde ich keine Pferde bekommen. Er: O die zwei Wagen die still hielten waren auch von da, und Sie kriegen doch Pferde. Ich: Waren die auch von Ischl? Er: Ei freilich; die kommen alle Jahre dahin, und waren voriges Jahr auch hier; ich habe sie gefahren und es ist eine Baronin aus Wien, (Herr Gott! dachte ich) und sie ist schrecklich reich, und hat solche schöne Töchter; als sie beide nach Bertholsgaden ins Bergwerk hinunter fuhren, da hab' ich sie geführt; da haben sie mal nett ausgeschaut, mit ihren Bergmannskleidern. Sie haben auch ein Gut, und sind doch ganz gemein mit unser einem. – Halt still – schrie ich. Wie heißen sie? – Kann nit sagn. – Pereira? – Glaub nit. – Fahr zurück, sagte ich entschlossen. – Dann kommen Sie heut Nacht nicht mehr nach Ischl, und wir haben eben den schlimmsten Berg gemacht; auf der Station werden Sie es erfahren. – Mir wurde es wieder ungewiß; ich fuhr weiter; auf der Station kannten sie den Namen nicht, ebensowenig auf der folgenden; endlich nach sieben unglaublich ungeduldigen Stunden komme ich an, frage noch im Wagen: wer ist heut Morgen in zwei Chaisen nach Salzburg gefahren? und erhalte die ruhige Antwort: die Baronin Pereira; geht morgen früh weiter nach Gastein, kommt aber in 4 – 5 Tagen wieder. – Nun hatte ich's gewiß, sprach auch noch ihren Kutscher; Niemand von der Familie war dageblieben; die beiden Herren in der nachfahrenden Chaise waren die beiden Söhne gewesen (gerade die, die ich nicht kannte). Zum Überfluß fiel mir auch noch ein elendes Portrait ein, das einmal bei Tante H.. gezeigt wurde, und die Dame im schwarzen Kleide war die Baronin Pereira. Gott weiß, wann ich sie nun einmal wieder zu sehen bekomme! Ich glaube nicht, daß sie mir je hätte einen angenehmeren Eindruck machen können, und werde gewiß die reizende Gestalt, und die freundliche Miene nicht so bald vergessen. Aber fatal ist es doch mit den Vorgefühlen; man hat sie wohl leicht, aber man erfährt nur erst immer hinterher, daß es welche gewesen sind. – Ich wäre auf der Stelle umgekehrt, und die Nacht durch gefahren, aber da ich mir überlegte, daß ich sie höchstens im Moment der Abreise, vielleicht gar nicht mehr in Salzburg träfe, daß ich mir den ganzen Reiseplan und Wien verdürbe, wenn ich gar mit nach Gastein ginge, (denn auch daran dachte ich) endlich auch, daß Salzburg als Pechnest an mir gehandelt habe, da sagte ich noch einmal Adieu, und ging sehr katzenjämmerlich zu Bette. Am andern Morgen ließ ich mir denn ihr leeres Haus zeigen, und zeichnete es für Dich, liebe Mutter. Das Pech donnerte noch fern ab, so daß ich keinen guten Standpunkt fand, – daß sie mir im Gasthofe für eine Nacht mehr als einen Dukaten abforderten, und dergl. Ich fluchte englisch und deutsch, fuhr weiter, legte Ischl, Salzburg, die Pereira, den Traunsee zur Vergangenheit, und bin so hier, wo ich heute einen Ruhetag gemacht habe. Morgen denke ich weiter zu gehen, und so Gott will übermorgen Nacht in Wien zu schlafen. Von dort aus das Weitere. So endigte sich der Pechtag aus meinem Leben; aber lauter Wahrheit, keine Dichtung; nicht mal das Handanlehnen ist zugesetzt, sondern alles buchstäbliches Portrait. Das Unbegreifliche dabei ist mir, daß ich Flora, die mit dabei war, ganz übersehen habe; denn die alte Frau im schottischen Mantel, die in's Wirthshaus ging, war Frau von W.., und der alte Herr mit der grünen Brille, der ihr nachkam, kann auch Flora nicht gewesen sein. Kurz wenn es einmal verkehrt geht, so ist kein Halten. Ich schreibe heut nichts weiter als das, – es ärgert mich noch zu frisch; das Nächstemal will ich vom Salzkammergut erzählen, und wie hübsch meine gestrige Reise war, und wie Recht Devrient hatte, der mir diesen Weg empfohlen. Ebenso der Traunstein und die Fälle der Traun sind ganz wunderschön, und so ist überhaupt die Welt sehr süß. Gut ist es, daß Ihr darin seid, und daß ich übermorgen Briefe finde, und so noch manches. Liebe Fanny, ich will jetzt mein non nobis, und die A Moll-Symphonie componiren. Liebe Rebecka, wenn Du mich singen hörtest »im warmen Thal«, mit überschnappender Stimme, so fändest du es fast zu jämmerlich. Du machst das besser. O Paul! Verstehst Du mit dem Gulden Schein, Gulden W. W., schweren Gulden, leichten Gulden, Conventionsgulden, Teufel und seine Großmuttergulden umzugehen? ich nicht. – Ich wollte deshalb Du wärst bei mir, indeß auch noch aus anderen Gründen vielleicht. –
Lebt mir wohl! Felix.
Pressburg, den 27. September 1830.
Herr Bruder!
Glockengeläut, Trommeln und Musik, Wagen an Wagen, hin und herlaufende Menschen, überall buntes Gewühl, so sieht es etwa um mich herum aus, denn morgen ist die Krönung des Königs, auf die seit gestern die ganze Stadt wartet, und den Himmel um Heiterkeit und Aufklärung seinerseits bittet, da die große Ceremonie, die gestern sein sollte, des anhaltenden, furchtbaren Regens wegen hat verschoben werden müssen. Nun ist es seit Nachmittag blau und schön; der Mond scheint ruhig auf die tobende Stadt, und morgen mit dem frühesten leistet der Kronprinz seinen Eid (als König von Ungarn) auf dem großen Marktplatz; dann geht er mit dem ganzen Zug von Bischöfen und Großen des Reichs in die Kirche, und reitet dann endlich auf den Königsberg, der hier vor meinem Fenster liegt, um da am Ufer der Donau in die vier Weltgegenden hin zu hauen, und so Besitz von dem neuen Königthum zu nehmen. Ich habe durch diese kleine Reise ein ganzes Land mehr kennen gelernt, denn Ungarn mit seinen Magnaten, seinem Obergespan, dem orientalischen Luxus, und der Barbarei darneben, ist hier zu sehen, und die Straßen bieten einen Anblick, der mir ganz unerwartet und neu ist. Man findet sich wirklich dem Orient hier näher; die fürchterlich stupiden Bauern oder Sklaven; die Zigeunerhaufen; die mit Gold und Edelsteinen überladenen Bedienten und Wagen der Großen (denn sie selbst sieht man nur höchstens durch die heraufgezogenen Wagenfenster), dann der sonderbar kecke Nationalzug, die gelbe Farbe, die langen Schnurrbärte, die fremde, weiche Sprache – alles das macht den buntesten Eindruck von der Welt. Gestern früh durchzog ich allein die Straßen; da ritt erst eine lange Reihe lustiger Militairs auf ihren lebhaften, kleinen Pferden; hinterdrein kam ein Zigeunertrupp und musicirte; dazwischen Wiener Elegants mit Brillen und Handschuhen, im Gespräch mit einem Kapuziner Mönch; dann ein Paar von jenen kleinen barbarischen Bauern, in langen weißen Röcken, den Hut tief im Gesicht, – die schwarzen, glatten Haare rund herum gleich abgeschnitten, mit rothbrauner Haut, sehr trägem Gang und einem unbeschreiblichen Ausdruck von Gleichgültigkeit und wilder Stupidität; dann ein Paar scharfe, feine Alumnen der Theologie in ihren langen blauen Röcken, Arm in Arm gehend; Ungarische Besitzer in der schwarzblauen Nationaltracht; Hofbediente; ankommende, über und über schmutzige Reisewagen. Ich folgte der Menge, wie sie sich langsam bergan bewegte, und kam so endlich auf das verfallene Schloß, von wo aus man die ganze Stadt, und die Donau weithin übersieht; überall von den alten weißen Mauern, und oben von den Thürmen und Balcons sahen Menschen herunter; in jeder Ecke standen Jungen, und schmierten ihre Namen den Wänden für die Nachwelt an; in einem kleinen Gemache (vielleicht war es sonst eine Kapelle, oder irgend ein Schlafzimmer) wurde jetzt ein ganzer Ochs gebraten, und drehte sich am Spieß, und das Volk jauchzte dazu; eine große Reihe Kanonen steht vor dem Schloß, um bei der Krönung gehörig los zu donnern; unten in der Donau, die hier ganz toll wüthet, und pfeilschnell durch die Schiffbrücke stürzt, lag das neue Dampfboot, das mit Fremden beladen eben angekommen war; dazu die Aussicht weit in's ebene buschige Land hinein, auf die Wiesen, die von der Donau überschwemmt sind, auf die von Menschen wimmelnden Dämme und Straßen, auf die Berge, die mit ungarischem Wein von oben bis unten bepflanzt sind – das Alles ist fern und fremd genug. – Und dazu der hübsche Gegensatz, mit den freundlichsten, liebsten Leuten zusammen zu wohnen, und mit ihnen das Neue doppelt überraschend zu finden – es waren wirklich wieder von den Glückstagen, lieber Herr Bruder, die der gütige Himmel mir gar so oft und so reichlich schenkt.
Den 28sten um 1.
Der König wäre unter die Haube gebracht. Es ist himmlisch schön gewesen. Was soll ich Dir viel beschreiben? – In einer Stunde fahren wir alle nach Wien zurück, und von da ab gehe ich so weiter. Unter meinem Fenster ist Mordlärm, und die Bürgergarde läuft zusammen, aber nur um vivat zu schreien. Ich habe mich allein unter dem Volk drängen lassen, während unsre Damen von den Fenstern aus Alles sahen, und der Eindruck dieser unglaublich glänzenden Pracht ist mir unvergeßlich. Auf dem großen Platz der barmherzigen Brüder drängte sich das Volk wie toll, denn dort mußte er den Eid leisten, auf einer mit Tuch behangenen Tribüne; das Tuch durfte der Pöbel nachher abreißen, um sich darin zu kleiden; auch war in der Nähe ein Springbrunnen mit rothem und weißem Ungarwein; die Grenadiere konnten die andringenden Leute nicht abhalten; ein unglücklicher Fiaker, der einen Augenblick still hielt, war im Moment mit Menschen bedeckt, die auf die Speichen der Räder, auf's Verdeck, auf den Bock sprangen, und ihn wie die Ameisen überdeckten, so daß der Kutscher, ohne ein Mörder zu werden, nicht weiter fahren durfte, und ruhig alles abwartete. Als der Zug kam, den man mit entblößtem Haupte erwartete, konnte ich meinen Hut nur mit äußerster Mühe abnehmen, und in die Höhe halten; da wußte aber ein alter Ungar hinter mir, dem das die Aussicht versperrte, gleich Rath, packte ohne Umstände zu, und quetschte in einem Griff den armen Hut so matsch, daß er kaum so groß wurde, wie eine Mütze; dann schrien sie, als ob sie am Spieß stäken, und rissen sich um das Tuch; kurz sie waren Pöbel; aber meine Ungarn! Die Kerle sehen aus, als ob sie zur Noblesse und zum Nichtsthun geboren, und darüber sehr melancholisch wären, und reiten wie die Teufel. Als der Zug vom Hügel herunterging, kamen erst die gestickten Hofbedienten, die Trompeter und Pauker, die Herolde und dergl. Gesinde, und dann sprengte auf einmal, in furchtbaren Sätzen, plein carrière, ein toller Graf die Straße herunter; das Pferd ist mit Gold gezäumt; er selbst mit Diamanten, ächten Reiherfedern, Sammt-Stickerei überdeckt (er hat nämlich seinen Prachtanzug noch nicht an, weil er recht wild reiten muß; Graf Sandor heißt der Wütherich), der hat einen elfenbeinernen Scepter in der Hand, und sticht sein Pferd damit: dann bäumt sich's jedesmal, und macht einen gewaltigen Satz; hat der nun ausgetobt, dann kommt ein Zug von etwa sechzig anderen Magnaten, alle mit derselben phantastischen Pracht, alle mit den schönen farbigen Turbans, den lustigen Schnurrbärten, und den dunklen Augen; der eine reitet einen Schimmel den er mit einem goldenen Netze behängt hat; der andere einen Grauen, mit Diamanten auf allen Zügeln; ein anderer einen Rappen mit purpurnem Zeuge; einer trägt Himmelblau vom Kopf bis zu den Füßen, überall mit Gold dick gestickt, einen weißen Turban, und weißen langen Dolman; ein anderer ganz in Goldstoff mit purpurnem Dolman; so ist einer immer bunter, reicher, als der andere, und alle reiten so keck, ungenirt und fanfaronmäßig daher, daß es eine Lust ist; und nun erst die ungarische Garde, den Esterhazy an der Spitze, der blendend von Brillanten und Perlenstickerei ist; wie ist es zu erzählen? Man muß den Glanz gesehen haben, wie der Zug sich auf dem breiten Platze ausdehnte und still stand, und wie alle die Edelsteine und bunten Farben, und die hohen goldenen Bischofsmützen und die Crucifixe im hellsten Sonnenschein blitzten, wie tausend Sterne! –
Nun denn, morgen soll es, so Gott will, weiter gehen. Da hast Du einen Brief, Herr Bruder; schreib auch einmal bald an mich, und laß mich wissen, wie Dir das Leben geht; Ihr habt ja in Berlin auch einen Aufstand und zwar von Schneidergesellen gehabt; was ist es denn damit? –
Euch aber liebe Eltern und Euch Geschwister, sage ich nun noch einmal Lebewohl aus Deutschland; jetzt soll es von Ungarn nach Italien gehen, von da schreibe ich mehr und ruhiger. Sei froh, lieber Paul, und gehe frisch vorwärts; freue Dich an allem Frohen, und denke an Deinen Bruder, der sich in der Welt herumtreibt. Lebe wohl.
Dein Felix.
Venedig, den 10. October 1830.
Das ist Italien! Und was ich mir als höchste Lebensfreude, seit ich denken kann, gedacht habe, das ist nun angefangen, und ich genieße es. Der heutige Tag war zu reich, als daß ich mich nicht jetzt des Abends ein wenig sammeln müßte, und da schreibe ich denn an Euch, und will Euch danken, liebe Eltern, die Ihr mir dies ganze Glück schenkt, und will an Euch sehr denken, Ihr lieben Schwestern, und will Dich mir herwünschen, Paul, um mich an Deiner Freude über das tolle Treiben zu Wasser und zu Lande wieder zu freuen, und möchte Dir beweisen Hensel, daß die Himmelfahrt der heiligen Maria ja das Allergöttlichste ist, was Menschen malen können! Ihr seid aber eben einmal nicht da, und ich muß also mein Entzücken in elendem Italienisch am Lohnbedienten auslassen, weil er stillhält. – Ich werde aber confus, wenn es so fortgeht, wie diesen ersten Tag, denn des Unvergeßlichen hat sich mir in jeder Stunde so viel gezeigt, daß ich nicht weiß, wo ich Sinne hernehmen soll, um es recht zu begreifen. Die Himmelfahrt habe ich gesehen; dann eine ganze Gallerie im Palast Manfrini; dann ein Kirchenfest in der Kirche, wo nebenbei der heilige Petrus von Tizian hängt; dann die Markuskirche; Nachmittags war ich auch auf dem adriatischen Meere spazieren, und in den öffentlichen Gärten, wo das Volk im Grase liegt und frißt; dann wieder auf dem Markusplatze, wo in der Dämmerung ein unglaubliches Treiben und Drängen ist; und alles das mußte gerade heut sein, weil wieder viel Neues und Anderes nur morgen zu sehen ist. Aber ich muß nun ordentlich erzählen, wie ich zu Wasser hergekommen bin, (denn zu Lande, sagt Telemach, geht es hier nicht gut) und werde zu dem Ende von Gratz ausholen. Das ist ein langweiliges Nest, zum Gähnen eingerichtet. Warum wollte ich aber auch, eines ( he) Verwandten wegen, einen Tag länger bleiben? Wie kann ein Reisender mit Erfahrungen, von einer Mutter und Schwester, die liebenswürdig sind, auf einen Bruder schließen, der Fähnrich ist? Mit einem Wort: der Mann wußte nichts mit mir anzufangen, und ich vergebe es ihm, und schwärze ihn nicht bei seiner Mutter an, wenn ich mein Versprechen halte, und ihr schreibe. Aber daß er mich Abends ins Theater führte, und mich den Rehbock sehen ließ, den Rehbock, der das Infamste, Verwerflichste, Elendeste ist, was der seelige Kotzebue geschaffen hat; und daß er ihn doch ganz nett, und etwas piquant fand, das muß ihm nicht vergeben werden, denn der Rehbock hat soviel haut goût oder fumet, daß er kaum für die Katze taugt. – Hier ist aber Venedig, also bin ich von Gratz weggekommen. Mein alter Fuhrmann lud mich in der Finsterniß um Vier auf, und das Pferd schlich mit uns beiden davon. Hundertmal hab ich auf der zweitägigen Reise an Dich gedacht, liebster Vater; Du wärst vor Ungeduld aus der Haut, und vielleicht auf die des Kutschers gefahren; denn wenn er bei jedem kleinen Abhang langsam absteigend langsam einhemmte, und den geringsten Hügel im Schneckenschritt herauffuhr; wenn er zuweilen nebenher ging, um sich ein wenig die Füße zu vertreten; wenn alle möglichen Fuhrwerke, mit Hunden oder Eseln bespannt, uns einholten, und vorbeifuhren; wenn der Kerl endlich an einem großen Berge sich einen Vorspann von zwei Ochsen nahm, die mit seinem Pferde in guter Eintracht zusammen zogen, so mußte ich mich zurückhalten um ihm nicht auf den Pelz zu kommen; auch that ich es zuweilen; aber dann versicherte er ernsthaft, es gehe sehr schnell, und ich konnte nicht das Gegentheil beweisen. Dazu blieb er in den schändlichsten Kneipen liegen, brach Morgens um Vier auf, kurz ich kam wie zerschlagen nach Klagenfurt; als ich aber auf meine Frage, wann der Venetianische Eilwagen durchpassire, zur Antwort erhielt, in einer Stunde, so machte mich das wieder frisch; ein Platz wurde mir versprochen; ein gutes Abendbrot bekam ich auch; die Eilpost kam zwar zwei Stunden später, weil sie auf dem Sömmering starken Schnee gehabt hatten, indessen sie kam; drei Italiener saßen darin, und wollten mir den Schlaf wegschwatzen; aber ich schnarchte ihnen das Schwatzen weg; so wurde es Morgen, und als wir in Resciutta einfuhren, sagte der Condukteur, jenseit dieser Brücke, da verstehe kein Mensch mehr Deutsch. Davon nahm ich denn also für lange Zeit Abschied, und über die Brücke ging's. Gleich drüben veränderten sich die Häuser; die platteren Dächer mit den rundlich gebogenen Ziegeln, die tiefen Fenster, die langen weißen Wände, die hohen viereckigen Thürme zeigten auf ein anderes Land, und die blaßbraunen Gesichter der Menschen, unzählige Bettler, die den Wagen belagern, viele kleine Kapellen, die bunter und sorgsamer von allen Seiten mit Blumen, Nonnen, Mönchen u. s. w. bemalt sind, deuten wohl auf Italien hin; aber die einförmige Gegend des Weges, der sich zwischen kahlen weißen Felsen dahinzieht, an einem Strome, der sich ein breites Bette von Steinen gebrochen hat, im Sommer aber nur als kleiner Bach zwischen dem Geröll sich verliert, – die traurige Monotonie der ganzen Landschaft, wollen nicht zu Italien passen. »Ich habe diese Stelle mit Fleiß etwas dünn gehalten, damit das Thema hernach recht vortritt,« sagt der Abt Vogler, und ich glaube, der liebe Herrgott hat ihm das abgelernt, und hat es hier eben so gemacht; denn hinter Ospedaletto tritt das Thema hervor, und thut freilich wohl. Ich hatte mir den ganzen ersten Eindruck von Italien, wie einen Knalleffekt, schlagend, hinreißend gedacht; – so ist es mir bis jetzt nicht erschienen, aber von einer Wärme, Milde und Heiterkeit, von einem über Alles sich ausbreitenden Behagen und Frohsinn, daß es unbeschreiblich ist. Hinter Ospedaletto geht es in die Ebene; die blauen Berge bleiben im Rücken; die Sonne scheint klar und warm durch das Weinlaub; die Straße führt zwischen Fruchtgärten fort; ein Baum ist an den anderen durch Ranken gekettet; es ist als ob man da zu Hause wäre, Alles schon lange kennte, und nun wieder einmal Besitz davon nähme. Dazu fliegt der Wagen über die glatte Straße, und als es Abend wurde, kamen wir nach Udine, wo wir die Nacht blieben, wo ich zum erstenmale Abendbrot italienisch forderte, und wie auf dem Glatteis mit der Zunge, bald ins Englische ausglitt, bald sonst stolperte. Darauf am andern Morgen wurde ich geprellt; aber ich machte mir gar nichts daraus, und es ging weiter fort. Es war gerade an einem Sonntag; von allen Seiten kamen die Leute in ihren bunten, südlichen Trachten, mit Blumen; die Frauen Rosen im Haar; leichte Einspänner rollten vorüber, die Männer ritten auf Eseln zur Kirche; an den Posthäusern überall Haufen von Müssiggängern in den schönsten, faulsten Gruppen; (unter andern faßte einer einmal seine Frau, die neben ihm stand, so ganz ruhig in den Arm, und drehte sich mit ihr um, und sie gingen weiter; das hieß so gar nichts und war so hübsch!) nun zeigten sich hin und wieder venetianische Landhäuser an der Straße, und wurden nach und nach dichter und dichter; man fährt endlich zwischen Häusern, und Gärten, und Bäumen wie in einem Park; das Land sieht so feierlich aus, als sei man ein Fürst, und hielte seinen Einzug; denn die Weinreben zwischen den Bäumen sind mit ihren dunklen Trauben die schönsten Festkränze; alle Menschen haben sich geschmückt und geputzt; ein Paar Cypressen stören Nichts. In Treviso war gar eine Erleuchtung; papierne Laternchen hingen über den ganzen Platz, und in der Mitte gab es einen großen bunten Transparent. Prächtig schöne Mädchen gehen auch da umher in ihren weißen langen Schleiern, mit den rothen Kleidern. So gelangten wir gestern in finstrer Nacht nach Mestre, stiegen in eine Barke, und fuhren bei stillem Wetter nach Venedig ruhig hinüber. Da ist unterwegs, wo man nur Wasser, und weit vor sich Lichter sieht, mitten im Meere ein kleiner Fels; darauf brannte eine Lampe; die Schiffer nahmen alle den Hut ab, und einer sagte dann, das sei die Madonna für den großen Sturm, der hier zuweilen sehr gefährlich und bös sei. Nun ging es ohne Posthorn oder Wagenrasseln, oder Thorschreiber in die große Stadt, unter unzähligen Brücken durch; die Stege wurden belebter, viel Schiffe liegen umher, beim Theater vorbei, wo die Gondeln, wie bei uns die Wagen, in langen Reihen auf ihre Herrschaften warten, in den großen Canal bei dem Markusthurm, dem Löwen, dem Dogenpalast, der Seufzerbrücke vorüber. Die Undeutlichkeit der Nacht erhöhte nur meine Freude, als ich die wohlbekannten Namen hörte, und die dunkeln Umrisse sah, und da bin ich denn in Venedig. Nun denkt, daß ich heut die größten Bilder in der Welt kennen gelernt, daß ich die Bekanntschaft eines sehr liebenswürdigen Mannes, von dem ich bis jetzt nur gehört hatte, endlich persönlich gemacht habe: ich meine den Herrn Giorgione, der ein prachtvoller Mensch ist, und ebenso den Pordenone, der die edelsten Bilder hinstellt, und dann einmal sich selbst, mit vielen dummen Schülern, so fromm, und treu, und andächtig malt, daß einem wird, als spräche man eben mit ihm und gewönne ihn lieb, – da sei ein anderer nicht verwirrt. Soll ich aber ein Wort von den Tizians sagen, so muß ich ernsthaft werden. Bisher habe ich nicht gedacht, daß er ein so glücklicher Künstler gewesen sei, wie ich heut gesehen habe. Daß er das Leben mit seiner Schönheit, und seinem Reichthum genossen habe, zeigt das Bild in Paris, und das habe ich gewußt; aber er kennt auch den allertiefsten Schmerz, und weiß wie es im Himmel ist; das zeigt seine göttliche Grablegung, und die Himmelfahrt. Wie die Maria da auf der Wolke schwebt, und ein Wehen durch das ganze Bild geht; wie man ihren Athem, und ihre Beklemmung und Andacht, und kurz die tausend Empfindungen alle in einem Blick sieht, – die Worte klingen nur alle so philiströs und trocken gegen das, was es heißen soll! – Und dann sind drei Engelsköpfe auf der rechten Seite, die von Schönheit das Höchste sind, das ich kenne; die reine, klare Schönheit, so unbewußt, heiter und fromm. Aber nichts weiter! ich muß sonst poetisch werden, oder bin es gar schon, und das kleidet mich wenig; aber sehen werd' ich's alle Tage. Und doch muß ich noch ein Paar Worte von der Grablegung sagen, denn Ihr habt den Kupferstich davon. Schaut ihn an, und denkt an mich; das Bild ist das Ende von einem großen Trauerspiel, so still, und groß, und schneidend schmerzlich. Da ist die Magdalene, die hält die Maria, weil sie fürchtet, daß sie vor Schmerz sterben möchte und will sie zurückführen, sieht sich aber dennoch selbst noch einmal um, und man erkennt, daß sie sich diesen Anblick für ewig einprägen will, und daß sie ihn jetzt zum letztenmale hat; das ist über Alles! – Und dann der verstörte Johannes, der mehr an die Maria denkt und leidet; und der Joseph, der nur mit dem Grab und seiner Andacht beschäftigt, das Ganze offenbar ordnet und leitet; und der Christus, der so ruhig daliegt, und nun alles überstanden hat, – dazu die herrliche Farbenpracht, und der dunkele streifige Himmel – es ist ein Bild, das mit fortreißt und spricht, und das mich nie verlassen wird. Ich glaube nicht, das mich noch vieles in Italien so ergreifen wird; aber Vorurtheile habe ich nicht, das wißt Ihr, und könnt es auch jetzt wieder daran sehen, daß mir das Märtyrerthum des heil. Petrus, von dem ich am meisten erwartete, am wenigsten von den dreien gefallen hat. Mir kam es nicht so