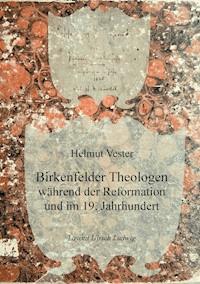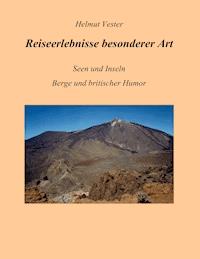
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Erzählungen führen nach England und Schottland, nach den USA, nach Griechenland, auf Inseln im Mittelmeer und im Atlantik. Es geht um überraschende Erlebnisse im fremden Land. Alle Geschichten zielen auf solche Ereignisse, die im Gedächtnis bleiben. Die Geschichten sind nur Beispiele, auch um zu zeigen, dass uns das Leben nach der Tätigkeit im Dienst noch viel Neues zu bieten hat. Sie greifen aus dem ganz unterschiedlichen Erleben einzelne Ereignisse heraus, lustige, auch schwierige, aber alle in Erinnerung bleibend. Sie wollen nicht belehren, sondern nur merkwürdige, überraschende Erlebnisse darstellen, die gewiss auch manches über den Charakter der dort Lebenden wiedergeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Erzählungen führen nach England und
Schottland, nach USA, nach Griechenland, zu
Inseln im Mittelmeer und im Atlantik. Alle
zeigen seltene, überraschende Ereignisse, die
im Gedächtnis bleiben.
Inhaltsverzeichnis
Wo wir England begegneten
Wieder einmal eine gute Idee
The Law of diminishing Returns
An einer Straße in Soho
Spätestens in einer Stunde
I have seen enough Ruins today
Lotte
Englischer Humor – oder was sonst?
My Heart is in the Highlands
Klärung der Fronten
Auch im Regen lässt es sich wandern
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
104 Proof
Von der Dialektik des Lebens
Auf den Kopf gefallen
Mein Fuß ist zu lang
In Hitze und Winterkälte – und das alles Ende Juni
Ein Tag für den Grand Canyon
Über die Paintbrush Divide
In Kalifornien
Am Pacheco Pass
Not of worldly value
In der Casa de Fruta
Unter der Sonne des Südens
Gedicht
Mallorca kann auch anders sein
Toscana 1993
Ich schrei doch nicht
Ganz normale Menschen
Wer langsam fährt
Wir auch reserviert haben
Zweimal Rhodos
Kolymbische Nächte
Das andere Rhodos
Sizilien
Sizilien – Stufen der Annäherung
Eliane Suter zum Abschied
Ein toller Tag auf La Gomera (1992)
Ein zweiter Blick auf La Gomera (2005)
Was nicht in den Prospekten steht
Höhlenjagd in Nordspanien
Madeira-Impressionen
Apriltage
Drei Sonnentage
Abend
Hunde
An der Levada
I. Wo wir England begegneten
Wieder einmal eine gute Idee
Richard Pinney ist schon immer ein kluges Köpfchen gewesen. Nein, wirklich; er hatte unentwegt Ideen, beste Ideen – vor allem Dingen Ideen, wie man, ohne sich anstrengen zu müssen, auf ehrliche Weise zu Geld kommen konnte. Zweimal stellte er diese Ideen als oberster Geldsammler seinem Land zur Verfügung – im Krieg als Bettler für das britische Rote Kreuz, 1953 nach dem Tode des Königs als Geldeintreiber für den King George VI Memorial Fund. Beinahe wäre er für seine Verdienste geadelt worden; doch irgendwie hat es nicht gereicht. Schade, dann wären wir ja mit einem englischen Adligen befreundet gewesen! Er zog sich nach dieser Enttäuschung zurück aufs Land und lebte dort seinem Pläsier. Dort begegneten wir England und begannen, es zu lieben.
Richard Pinney
Reich war er nicht, aber, wie gesagt, er hatte immer Ideen. Er wohnte in Suffolk an der Schlauchmündung des Butley River, und so lag es nahe, vom Fluss auch zu leben. Er schnitt Schilf, ließ daraus Matten für den Fußboden und Mättchen für den Esstisch weben; mit ihnen begann er einen einträglichen Handel. Er fing Fische, Muscheln, Hummer und züchtete Austern. Diese Sächelchen aß er mit Wonne und fütterte auch seine Gäste damit. Hummer schon zum Frühstück und Hummer als Fleischersatz zum Dinner. Herrlich! Hummer am nächsten Morgen und beim nächsten Hummer. Schon nicht mehr ganz so attraktiv. Hummer, Hummer und wieder Hummer! Es soll Leute gegeben haben, die seit einem dreitägigen Besuch bei Richard dieses Tier zeitlebens nicht mehr anrührten.
Später räucherte Richard aus Irland eingeführten Lachs und eröffnete ein Fischlokal. Im Nachbarort wirkte der berühmte Komponist Benjamin Britten, und nach den Konzerten kamen die Besucher scharenweise in Richards Lokal. Das Geschäft blühte, fand Aufnahme in Gourmetführer und wurde im Fernsehen portraitiert. Richard hatte wieder einmal ein glückliches Händchen gehabt.
Eines Tages kam ihm eine neue Prachtsidee. Am Butley River gingen zahllose Schnecken spazieren. Sie hatten die Größe der Weinbergschnecken und trugen das gleiche Haus auf dem Rücken wie sie. Der einzige – äußere – Unterschied gegenüber den Weinbergschnecken bestand darin, dass die Fluss-Schnecken schwarz waren. „Igittigitt“, möchte man sagen, „schwarze Schnecken, wie unappetitlich!“ Doch Richard dachte anders, dachte ökonomisch. Schnecken, sagte er sich, sind ein anerkannter Leckerbissen, und zudem sehr teuer. Zu Hunderten räkeln die sich am Flussufer; da käme es doch einfach auf einen Versuch an, ob man mit ihnen nicht ein delikates Essen bereiten könnte.
Die beiden Besucher wurden losgeschickt, die Viecher zu sammeln. Schnell hatten sie einen Korb voll beisammen. Mathilde bereitete sie in einer Kasserolle zu – liebevoll, wie es sich für eine Ehefrau gehört, mit vielen Kräutern und fein mit Butter abgeschmälzt. Die Kasserolle wurde in den Backofen geschoben, und die Erwartung auf ein wohlschmeckendes Schneckengericht war groß, besonders bei Richard, der schon wieder eine neue Verdienstmöglichkeit witterte. Die Familie war skeptisch. Sollten sie eines Besseren belehrt werden?
Dann der große Augenblick: Die Kasserolle kommt aus dem Backofen, dampfend, duftend – auch lieblich duftend? Richard lässt die erste Hitze entweichen, spießt mit einem spitzen Gäbelchen und spitzen Fingern eine Schnecke auf. Er schiebt sie in den Mund und probiert voller Erwartung. Wir andern platzen fast vor Spannung. Richard verzieht keine Miene.
„Da, Mathilde“, sagt er und schiebt die Kasserolle seiner Frau hin. „Wirf sie weg!“
„Was ist?“, fragt Mathilde, „Schmecken sie nicht?“
Richard: „Wirf sie weg!“
Nie mehr wurde über die Möglichkeit gesprochen, den Speisezettel mit Schnecken anzureichern. Wie interessant wäre es, zu wissen, ob diese schwarze Schneckenart genießbar ist oder nicht. Nur eines ist klar: Richard hätte die Schnecken zuerst zwei oder drei Tage hungern lassen müssen. Mit ihrem gesamten Darminhalt konnten sie tatsächlich keine Delikatesse sein.
So vergessen auch ideenreiche Köpfe manchmal eine winzige Kleinigkeit – und gerade sie kann entscheidend sein. Nur gerne darüber reden – das tun sie nicht.
The Law of diminishing Returns
„Kennt ihr Cointreau?“
„Cointreau? Nein, noch nie gehört. Was ist das? Eine Person? Ein Ort oder was?“
Doctor Jones, Chefarzt der Chirurgie in einem Krankenhaus in Ipswich, der aber nach englischer medizinischer Nomenklatur als Chirurg Mr. Jones zu nennen wäre, also besagter Mediziner hatte uns zwei Studenten bei unserem ersten abendlichen Gespräch die Frage gestellt, und wir hatten uns als Ignoranten erwiesen.
„Cointreau“, sagte er, „ist ein Likör, und zwar, wie schon der Name sagt, ein französischer. Er ist sehr teuer, besonders in England, wo die Alkoholika hoch besteuert werden. Das stammt eben noch aus unserer puritanischen Tradition. Würdet ihr gern ein Gläschen Cointreau probieren?“
Oh, ein großzügiger Mann, der Mr. Jones. Er kannte uns doch erst ein paar Stunden und bot jetzt schon von seinem teuren Likör aus Frankreich an!
„Gern, of course!“, kam es wie aus einem Munde.
Mr. Jones schenkte drei Likörgläser ein, und „Cheers!“ die Degustation konnte beginnen. Der Likör, dieser kostbare Likör, natürlich nur in homöopathischen Schlucken genossen, rann wie Feuer die Kehle hinab, aber wie himmlisches, den ganzen Menschen aufs angenehmste erwärmendes Feuer. Günter und mir, uns beiden, die damals von Wein noch wenig verstanden, nicht einmal wussten, dass Wein trocken sein könne, uns kam es vor, wir hätten noch nie etwas Köstlicheres getrunken.
Und wie erfreut waren wir, als wir die Gläser geleert hatten und Mr. Jones fragte, ob wir gerne noch ein Gläschen trinken würden.
„Aber ja, keine Frage!“
„Freut mich!“, sagte Mr. Jones, „dass ihr meinen Cointreau schätzt. Aber trotzdem denke ich, ist es besser, wenn wir es bei dem einen Glas belassen. Nein, nein, nicht weil dieser Likör so teuer ist, sondern wegen des law of diminishing returns. Kennt ihr dieses Gesetz?“
Wieder mussten wir unsere Unwissenheit bekennen.
„Dieses Gesetz besagt, dass man bei der Wiederholung eines schon gehabten Genusses nur noch etwa die Hälfte der ursprünglichen schönen Empfindung hat. Diese Erfahrung ist sehr enttäuschend, ja geradezu bitter, und da ich euch eine solche Enttäuschung ersparen möchte, wollen wir es bei einem Gläschen belassen.“
Es muss betont werden, dass die Enttäuschung von uns beiden auch so groß war, sehr groß sogar – freilich über die gar nicht gehabte Wiederholung unseres Anfangsgenusses. So konnten wir uns auch nicht vorstellen, dass die Enttäuschung über den wenn auch reduzierten, aber gehabten Genuss so groß gewesen wäre wie die über den gar nicht stattgefundenen. Wie dem auch sei, Mr. Jones war offensichtlich ein sehr kluger Mann, schließlich war er ja Chefarzt.
Aber war er auch, wie wir gedacht hatten, ein großzügiger Mann? Hatte er die kleinen Würstchen, uns beiden Erntehelfer auf seinem Gutshof, den seine Frau betrieb, während er in der Woche in Ipswich Gallenblasen herausoperierte, hatte er uns bloß auf den Arm nehmen wollen? Der Fortgang der Ereignisse zeigte, dass dem wohl nicht so war – das wäre freilich eine neue Geschichte, die allzu deutlich den Geiz des Reichen zur Schau stellen würde.
An einer Straße in Soho
„Would you like to come home?“, sagte eine rauchige Frauenstimme zu mir.
Die nicht mehr ganz so junge Dame stand, in einem kurzen, engen Röckchen und mit knallroten Lippen, an einer Straße in Soho. Ich war nicht völlig unvorbereitet; Roger hatte mir gesagt, er wolle mir Soho, die berühmte Rotlichtszene von London, vorführen.
Roger ist Richard Pinneys Neffe. Ich habe ihn aus den Augen verloren und weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Damals war er Seekadett in der Royal Navy. Er hatte mich für einen kurzen Aufenthalt nach London eingeladen, wo wir in der Zweitwohnung seiner Eltern, einem kleinen, gut eingerichteten Flat im Westend, übernachteten. Wir wollten auf der Themse segeln und sonst noch einiges erleben.
An den Segeltörn habe ich zwiespältige Erinnerungen. Ich kannte ja nur die allerelementarsten Grundbegriffe, die Richard Pinney mir zwei Jahre zuvor beigebracht hatte. Mein erster – und zugleich letzter – selbständiger Segelausflug mit seinem Dinghy auf dem Butley River hatte ein schnelles, unrühmliches Ende gefunden: Beim ersten Kreuzen gelang es mir nicht, das Boot rechtzeitig zu wenden, und schon saß ich am Ufer fest und musste, um den Kahn wieder flott zu bekommen, Zuflucht zu den Rudern nehmen. Und jetzt mit einem richtigen Seekadetten der Royal Navy auf der Themse segeln? Ich würde mich unweigerlich blamieren. Doch Roger beruhigte. Er würde in dem kleinen Dinghy, alles selber machen; lediglich beim Kreuzen müsste ich auf sein Kommando das Gewicht verlagern, das sei wirklich alles.
Und genau so kam es auch. Allerdings war es für mich überraschend, wo wir segelten. Themse, lernte ich, ist nicht gleich Themse. Wir segelten nicht auf dem Oberlauf, etwa bei Maidenhead oder Goring-on-Thames, wo der Fluss noch schmal und die liebliche Landschaft wie auf den Bildern von Constable typisch englisch ist; nein, Rogers Segelboot, das der Royal Nayy gehörte und den Kadetten zum Üben diente, lag bei Gravesend im Port of London, dem Hafen. Dort, wo die dicken Pötte aus Übersee ankerten und löschten, die Frachter aus aller Herren Welt, und wo damals auch noch der eine oder andere Überseedampfer einlief und Zwischenstation machte, dort sollten wir kreuzen?
Also zwiespältige Gefühle: Auf der einen Seite fühlte ich mich stolz, in einer kleinen Nuss-Schale in einem der größten Häfen der Welt herumzuschippern, und das Segeln bei angenehmem Aprilwetter, milder Sonne, mäßigem Wind machte ja auch riesigen Spaß. Roger, versteht sich, segelte, und er verstand sein Handwerk. Ich hatte nur die Pflichten eines Mitfahrers. Wir mussten wenden. „Now, right!” sagte Roger. Der Gast verlagerte sein Gewicht nacht rechts, und das Dinghy legte sich in eine scharfe Rechtskurve. Auf dem gegenüber liegenden Ufer Tilbury, die Docks, Kräne, die in den Himmel ragten. Sie mitten im Gewühle. Und das ist auch schon die andere Seite: Das Gefühl, doch nur ein nutzloser passenger zu sein, nicht sehr angenehm; dazu mit dem kleinen Untersatz in dem graugrünen, mit Ölflecken verschmutzten Wasser um die riesigen Pötte herumzukurven – nicht zu jeder Sekunde ein erfreulicher Gedanke. Man könnte schließlich auch kentern. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob wir irgendwelche Rettungsringe an Bord hatten, vermute es jedoch. Auf jeden Fall passierte nichts; wie rammten kein anderes Schiff, wir kenterten nicht, niemand fiel ins schmutzige Themsewasser, niemand wurde nass. Der angehende Seeoffizier Roger war ein exzellenter Segler und ich – offensichtlich – ein exzellenter passenger.
Dieser Nachmittag, eine vor allem in der Erinnerung doch überwiegend erfreuliche Erfahrung, die beschwingte, lag nun hinter mir, eine andere hoffentlich nicht weniger erfreuliche Erfahrung stand bevor. Roger hatte mich zum Abendessen in ein Chinarestaurant eingeladen. Ich meine, dass es damals in Deutschland noch keine exotischen Gaststätten gab – und wenn doch, so hatte ich auf jeden Fall noch nie chinesisch gespeist. Zum Glück müsse man nicht mit Stäbchen essen, erklärte Roger, er werde mich bei der Wahl der Speisen beraten. An Details habe ich keine Erinnerung. Aber das ist bei einem Chinarestaurant gar nicht so wichtig. Auch wenn die Karte mit 150 Nummern protzt, so schmecken, wie es scheint, die verschiedenen Gerichte zwar nicht schlecht, aber im Grunde doch immer gleich oder zum mindesten sehr ähnlich.
Dieser Genuss lag noch vor mir, sollte da noch ein weitere unvorhergesehene Erfahrung auf mich warten? Roger hatte mir ja gesagt, wir würden durch Soho schlendern und diese bestimmte Sorte von Damen sehen, aber nur sehen, und er hatte dazu gesagt, sie dürften nach englischem Recht in der Öffentlichkeit zwar auftreten, aber nicht werben, auf keinen Fall offensiv. Das zwar freundlich klingende „Would you like to come home?“ kam mir aber durchaus als Werbung, als überraschende und sehr offensive Werbung vor. Roger wollte mir doch nur London von verschiedenen Seiten zeigen, mich – zugegeben – vielleicht auch mit dem Großstadtlebeben ein bisschen schockieren; denn ich hatte zwar schon vom Karlsruher Entengässchen gehört, aber noch nie eine leibhafte Prostituierte gesehen, und jetzt lernte ich sie kennen, jedenfalls den Londoner Typ: aufgedonnert, Aufsehen provozierend, aber mit keinesfalls attraktivem, eher abstoßendem Äußeren – nicht nur in wenigen Exemplaren, sondern an allen Straßenecken in Soho und auch mit direkter, mehrmals geäußerter Anfrage. Wollte mich Roger gegen sein Versprechen etwa verführen?
Ich muss gestehen, mir wurde bei dem Gedanken schon etwas schwummrig. Vor meinen Augen tauchte eine kleine Wohnung auf, im zweiten oder dritten Stock eines Viktorianischen Londoner Mietshauses, typisch englisch eingerichtet: mit Kamin im Wohnzimmer, geblümten Teppichböden, viel Plüsch und überall die unvermeidlichen Nippes, daneben das Schlafzimmer mit einem Frisiertisch und dem überdimensionalen Spiegel, davor Lippenstifte und Puderdose und mit dem, wie sehr viele spätere Erfahrungen belegten, unbequemen Doppelbett. Davor eine nicht mehr ganz junge Dame mit rauchiger Stimme, die sich zu entkleiden anschickte und ungeduldig auf den unfreiwilligen Freier wartete. Ein wenig attraktiver, eher unerfreulicher Gedanke. Und sagte da Rogers nicht neben mir: „How much?” Wie, gleich zwei auf einmal? Die Gedanken überschlugen sich, bis mir bewusstwurde, was Rogers mit kühler Stimme wirklich gesagt hatte: „No, thank you very much.“ Ich atmete tief durch; er wollte mich doch nur schockieren.
Zügig schritten wir aus. Nach einigen Minuten lag das berüchtigte Viertel hinter uns. Jetzt konnte ich mich rückhaltlos auf das chinesische Dinner freuen.
Spätestens in einer Stunde
Noch klang die Bach-Kantate in uns nach. Plötzlich zerbrach ein unangenehmes Geräusch unsere besinnliche Stimmung: Die Zündung schnarrte und schnarrte, ging aber nicht in das bekannte Jaulen über, welches das Ableben der Batterie ankündigt. Also die Batterie konnte es nicht sein, aber sei es, wie es wolle: Der Motor sprang nicht an. Was war bloß mit dem nagelneuen Vectra los?
Gestern Abend waren wir mit unserem in Stanstead gemieteten Vauxhall in Cambridge angekommen, hatten an diesem sonnigen Aprilsamstag einen ausgedehnten Gang durch die historischen College-Anlagen gemacht und vor allem die wunderbaren Glasfenster der King’s College Chapel bewundert; jetzt wollten wir den Tag mit dem Konzertbesuch im Jesus College ausklingen lassen. Doch dieser Tag wollte so schnell nicht zu Ende gehen. Die Zündung schnarrte; die Klänge der Bachschen Musik verloren sich von Minute zu Minute. Draußen fing es zu regnen an; es wurde kalt. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Startversuch wagte, glaubten wir, ein anderes, hoffnungsvolleres Geräusch unter der Motorhaube zu hören, doch es blieb eine akustische Täuschung. Die Zeit verging, und guter Rat war teuer.
Just, als unsere Stimmung sich dem Nullpunkt näherte, erschienen zwei junge Engländer, 18 oder 20 Jahre alt. Sollte ich sie um Hilfe bitten? Oder würde ich mich auf etwas Unwägbares einlassen? Ich riskierte es. Ob sie etwas von Automatikautos verstünden? Sie, sehr freundlich: „Ja, ein bisschen“, und schon machten sie sich an die Arbeit: Motorhaube auf, Startversuche an irgendwelchen mir unbekannten Hebeln und Leitungen – alle Bemühungen vergeblich. Nichts bewegte sich.