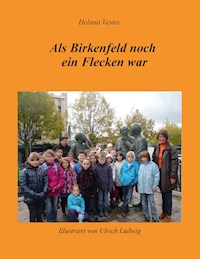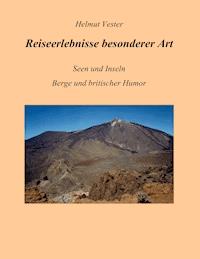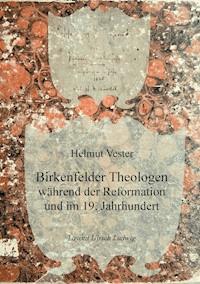
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Pfarrer Heinrich Christlieb berichtete monatlich und forderte die zukünftigen Pfarrer zur Nachfolge auf. Vier Pfarrer im 19. Jahrhundert berichten über das tägliche Leben und gehen an wichtigen Stellen interessant "über den Tellerrand" hinaus. Ein Pfarrer, der lange krank war und hauptsächlich die Hilfe von Vikaren benötigte, und einige wenige, die nur kurze Zeit blieben, waren Christliebs Erwartungen vom monatlichen Bericht nicht gewachsen. Pfarrer Straub füllte diese Lücke. Der zweite Interessens-Punkt besteht darin, dass das handgeschriebene Original nur einmal vorhanden ist. Um es für viele lesbar zu machen, schien die Wiedergabe in Druckschrift eine vernünftige Lösung; sie öffnet den Zugang zum ganzen Inhalt. Nun bot es sich an, zusätzlich zu diesem größeren Text eine Untersuchung den Birkenfelder Theologen Martin Kügelin in einem kleineren Teil an "Christliebs Chronik" anzuschließen; Christlieb verweist ja schon auf den historischen Kollegen hin. Grundsätzliches über Martin Kügelin findet sich in Engelhardts Ortschronik, doch mir schien es wichtig, mehr als dort über sein Leben und Werk herauszufinden, auch manches auf den meist lateinischen Urkunden nachzulesen und schließlich Martin Kügelins Verbindung mit seiner großen Birkenfelder Familie zu erarbeiten. Lateinische Zitate sind in der Regel original wiedergegeben und eigene Übersetzungen in Klammern angefügt. Martin Kügelin ist es wert, dass wenigstens die Birkenfelder ihn kennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Viele Birkenfelder haben von der Christlieb-Chronik schon gehört oder gelesen. Pfarrer Heinrich Christlieb amtierte hier von Mai 1823 bis September 1838. Er war 26 Jahre alt, frisch verheiratet, als er hier seine erste selbständige Stelle antrat. Vor seiner Birkenfelder Zeit war er in Murrhardt als Pfarrverweser tätig gewesen. 1838 wurde er Dekan in Heidenheim und von 1845 bis 1871 übte er das gleiche Amt im Kirchenbezirk Ludwigsburg aus. Zwei Jahre nach seiner Pensionierung starb er dort im Alter von 76 Jahren. Er ist auch Autor einiger theologischer Schriften. So findet sich zum Beispiel im Internet die Kopie des Buches „Christliche Trostbibel“.
Als erster uns bekannter Birkenfelder Autor beschrieb nun Christlieb in dieser Chronik in einem gründlichen Anfangskapitel die Topographie Birkenfelds, die Pfarrei und die Geschichte des Ortes im Überblick. Im Hauptteil, den Annalen, finden sich Jahr für Jahr die Ereignisse im Dorf. Christlieb hatte so begonnen, und hinterließ seinen Nachfolgern die Aufgabe, diese Jahreschronik fortzuschreiben. Neben amtlichen Papieren entstand so ein buntes Bild des Ortes: die Kirche und die Kirchgänger, Kirchen- und Gemeinderäte, die Schultheißen, Schulen und Lehrer, Kinder und Jugendliche, Beruf, Einkommen und Armut, Wetter und Brandstiftungen, Ereignisse in der Umwelt.
Ernst Gottlieb Mayer, Christliebs Nachfolger (1839-1852), folgte dessen Beispiel: besonders interessant liest sich, wie weit die 1848er Revolution im Dorf ankam. Pfarrer Mondon (1852-1862) war leider häufig krank und konnte seinen Teil nicht liefern; so wurde die Folge unterbrochen. Erst Pfarrer Eduard Straub 1875-1878 griff die Chronik wieder auf und beschrieb mit Hilfe von Erzählungen der Bürger und mit vorhandenen amtlichen Schriften die fehlenden Seiten (1854-1874). Danach folgte sein Bericht über seine eigene kurze Erfahrung (1875-1878) in Birkenfeld und als Schluss (von da bis 1897) Carl Hugo Seeger, der nach Zuffenhausen abwanderte.
Soweit eine Vorstellung des Inhalts. Alle diese Texte waren handgeschrieben – von verschiedenen Menschen mit einer Reihe von unterschiedlichen, aber immer schwer lesbaren Handschriften. Die damalige Handschrift ist nicht zu vergleichen mit der heutigen. Wer noch Sütterlin gelernt hat, könnte sie lesbar finden. Allerdings kommt dazu, dass es keine einheitliche Grammatik gab und auch keine einheitliche Rechtschreibung.
Rektor Engelhardt hatte schon einige interessante Stellen in der Birkenfelder „Ortsgeschichte“ aufgegriffen, doch die gesamte Chronik schien mir so bedeutend, dass es wichtig wäre, sie in die moderne Druckschrift, soweit möglich, umzuschreiben und als kleines Buch zu veröffentlichen. Der Text ist, soweit er lesbar war, wörtlich wiedergegeben; erhalten blieb die originale Rechtschreibung – mit wenigen Ausnahmen, etwa die heutige Verwendung von „-ß“ und „-ss“. Inhaltlich schwer verständliche Begriffe ließen sich in der Regel als Fußnote oder bei einem unbekannten Wort mit einer eckigen Klammer [ ] im Text erläutern. Fragezeichen weisen auf solche Stellen hin.
Der zweite, kleinere Teil des Buchs ist dem Birkenfelder „Martin Kügelin“, einem Theologen (gest. 1559) gewidmet. Nach seinem Studium in Tübingen war er ab 1532 Theologieprofessor an der Universität in Freiburg. In den grundsätzlichen Fragen seines Lebens ist er durch Engelhardt bekannt gemacht. Mir lag es jedoch am Herzen, mehr über sein Leben und Wirken zu erfahren. Die Veröffentlichung der Christlieb-Chronik legte es nahe, den Text dieses nicht unbedeutenden Birkenfelders anzuhängen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Chronik der Gemeinde Birkenfeld
(angefangen im Jahr 1825 durch Pf. M. Christlieb)
Beschreibung der Pfarrei Birkenfeld
Topographie
Pfarrbeschreibung
Chronik von Birkenfeld
Die Annalen
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850/68
1870/75
1875
1876
1877
1878
1897/98 (letzter Eintrag)
Nachruf für Pfarrer Seeger
Kügelin – Sohn einer großen Birkenfelder Familie
Einführung
Der Flecken Birkenfeld um 1500 und die Familie Kügelin
Martin und die Familie
Bedeutung der Familie in Birkenfeld
Der Lebenslauf Martin Kügelins
Studium und Lehrtätigkeit in Tübingen
Die Bewerbung in Freiburg
Professor in Freiburg als Secundarius
Als einziger Ordinarius
Bewerbungen für die zweite Professur
Die Beurteilung Kügelins durch Zeitgenossen und Historiker
Die Religionsgespräche in Worms und Regensburg 1540/41 – 1545/46
Allerlei aus dem Alltag
Tod und Beerdigung
Literatur
Chronik der Gemeinde Birkenfeld (angefangen im Jahr 1825 durch Pf. M. Christlieb)
I. Beschreibung der Pfarrei Birkenfeld
1. Topographie
Das Pfarrdorf Birkenfeld liegt nach v. Gammers Karte von Württemberg unter dem 48° 42' N.Br. und 26° 19' O.L., nach Kauslers Karte vom Oberamt Neuenbürg dagegen unter 48° 53' N.B. und 26° 22' O.L. Es bildet einen Teil der nordwestlichen Grenze von Württemberg und ist auf drei Seiten von badischer Markung eingeschlossen.
Das Dorf ist am nördlichen Rand des Schwarzwalds auf dem östlichen Abhang eines freien Hügels erbaut und überschaut aus seinen Obstbäumen hervor das freundliche Enztal bis nach Pforzheim, von welchem es 5/4 Stunden, so wie von Neuenbürg eine Stunde, entfernt ist.
Zu dem nicht unbeträchtlichen Flecken gehört die eine Viertelstunde entlegene Ziegelhütte an der Straße von Neuenbürg nach Pforzheim, ferner die Mahlmühle an der Enz, ebenfalls eine Viertelstunde vom Ort entfernt und gerade auf dem Punkt erbaut, wo die Enz das enge, wilde, wald- und bergumkränzte Schwarzwaldtal verlässt und in eine weitere, lichtere und freundlichere Ebene eintritt. Endlich gehört noch zu Birkenfeld die Schwarzlochsägmühle an der Enz, nicht weit über der Einmündung des Grösselbachs in die Enz, fast Dreiviertelstunden von Birkenfeld und nur eine Viertelstunde von Neuenbürg. Während die Mahlmühle und die Ziegelhütte das Eigentum ihrer Bewohner sind, gehört die Schwarzlochsägmühle nicht dem Säger, der sie bewohnt und betreibt, sondern für jetzt dem Schulmeister Roth in Neuenbürg, dem Adlerwirt Meeh von da, dem Schultheißen Reichstetter von Waldrennach, den Bauern Friedrich Glauner und Jakob Seufer von Obernhausen und dem Rössleswirt Schuhmacher von Gräfenhausen.
Die Markung des Orts ist sehr beträchtlich. Sie erstreckt sich, die württembergischen Markungen der Orte Engelsbrand − in alten Urkunden Englischbrand −, Neuenbürg, Gräfenhausen und Obernhausen und die der badischen Ortschaften Dietlingen, Brötzingen und Büchenbronn berührend, in ihrer größten Länge von dem Grösseltale bis in den Schönbühel-Wald, fast zwei Stunden lang. Auch auf den benachbarten Markungen haben die Birkenfelder ansehnliche Güter, z.B. Wiesen jenseits der Enz auf Büchenbronner und den Oerlach-Wald [Erlach] auf Dietlinger Markung. Ja ihre meisten und trefflichsten Weinberge liegen auf der Markung des badischen Orts Dietlingen und keltern ihren Wein in einer nur für die Birkenfelder bestimmten badischen Freikelter, aus welcher der Wein ohne Zoll ins Badische und ins Württembergische ausgeführt werden darf.
Das Klima von Birkenfeld ist ziemlich mild, besonders in Vergleichung der nahe gelegenen Wald- und Bergorte; doch ist − der Weinstock ausgenommen − alles später als in Brötzingen oder Dietlingen, selbst als in Obernhausen, was wohl in der höheren, den scharfen Winden weit mehr ausgesetzten Lage Birkenfelds seinen Grund hat.
Die Temperatur von Birkenfeld scheint nach meinen Beobachtungen über den Barometer- und Thermometerstand fast mit den von Stuttgart, nach den im Schwäbischen Merkur angegebenen Barometer- und Thermometerständen, übereinzustimmen, nur dass sich der höheren Lage wegen die Dünste in der Luft hier bälder in Schnee verwandeln als in Stuttgart, der auch wegen der heftigen, kalten Winde hier länger liegen bleibt.
Ihren Boden teilen die Birkenfelder in weißen und roten. Zu diesem rechnen sie alles Feld, das rechts oder südöstlich von dem Fußweg nach Obernhausen, im Gründle genannt, vom Flecken selbst und dem Stäudichbuschweg nach Brötzingen liegt. Dieses rote Bodenfeld halten sie mehr als 3-mal so hoch wie das weiße, das schwereren, mageren Boden hat und sehr viel mehr Dünger bedarf. Der erstere gehört unter die sehr fruchtbaren, der zweite unter die mittelmäßig fruchtbaren Böden.
Die Produkte dieses gedoppelten Bodens sind sehr mannigfaltig. Das Hauptprodukt ist der Wein, der in der Tiefenbach ziemlich gering, in den Blochweinbergen und der Neureut mittelmäßig, in der Kempf dagegen und ihren Umgebungen sehr vorzüglich wächst und in besseren Jahren an Geschmack und Geist nicht leicht einem Weine Württembergs nachsteht. Der Ackerbau wird nach der Dreifelderwirtschaft betrieben, nämlich im ersten Jahr säen sie Dinkel, hie und da auch Roggen, hier Korn genannt, in den Acker, im zweiten Haber, im dritten bleibt er brach liegen oder wird gewöhnlich über den Sommer gebaut, d.h. mit Erdbirnen, Hanf, Erbsen usw. bepflanzt. Gerste wird wenig gebaut, ebenso Flachs und Kraut. Nach der Dinkel Aernte werden Rüben in die Stoppeln gesät, die jedoch nicht immer geraten, übrigens von gutem Geschmack sind. Die Obstbaumzucht, die sehr beträchtlich ist, wird mit jedem Jahr wichtiger und ausgedehnter. Schade, dass fast kein Birkenfelder mit dem Pfropfen, besonders der Kirschbäume, umzugehen weiß und die Fleckenbaumschule so klein ist. Von vorzüglicher Güte sind die sogenannten deutschen Kartoffeln, die im roten Boden wachsen und von den Neuenbürgern und Dietlingern sehr geschätzt werden. Ein großer Teil des Bodens ist in gute Wiesen verwandelt, die größtenteils gewässert werden, ein anderer Teil trägt Eichen, Buchen und Forchen. Endlich liefert der Boden noch Leimen [Lehm], Kalk und den in der ganzen Nachbarschaft verbreiteten roten Sandstein zum Bauen.
Der Flecken selbst zählt 289 meistens schlechtgebaute Häuser und Scheunen und mit den Wittwen 240 Bürger. Die Straßen und Wege außerhalb des Orts sind – Dank sei es dem Eifer des gegenwärtigen Schultheißen Christian Dittus! – nunmehr ziemlich gut hergestellt. Dagegen sind die Gassen noch immer voller Morast, den die Einwohner durch Laub, Stroh und dergl., das sie auf die Straße zetteln, absichtlich zur Besserung ihrer Felder zu vermehren suchen. Trotz des Überflusses an Morast fehlt es dem Orte in heißen Sommern an Wasser. Die Brunnen vertrocknen bis auf den einen am Rathaus, der so spärlich läuft, dass das Wasser bei Tag und Nacht bewacht wird, wie es z.B. 1823 und 1825 geschah. Es wurden zwar im Jahr 1823 und 1824 zwei Versuche gemacht, neue Quellen zu entdecken, und auf den Gütern rechts und links von dem sogenannten Burgwege lange und tief gegraben, wiewohl ohne allen Erfolg. Ersprießlich wären die steinernen Trottoirs an den Häusern, wenn sie besser erhalten würden. In ihrem gegenwärtigen Zustand sind sie – besonders des Nachts – mehr schädlich als nützlich.
Unter den öffentlichen Gebäuden ist die Kirche das schlechteste, das Pfarrhaus allein in gutem Zustand. Am nordöstlichen Ende des Dorfes fast tiefer als alle übrigen Häuser, einige Schritte vom Pfarrhaus, steht, einer alten Kelter gleich, die kleine steinerne Kirche mit ihrem jämmerlichen Turmhäuschen. Ich kann es nicht Turm nennen, indem es unten zwar ein massiver steinerner Turm, oben aber nichts anderes als ein gewöhnliches Häuschen mit Dachläden und einem langen Hausdach ist.1 Die Sakristei ist finster, kalt und feucht und hat immer eine ungesunde Zugluft. Das Inwendige der Kirche entspricht dem Ganzen. Die Dielen des Bodens sind ganz verfault. Der Gang auf die Kanzel wäre für manchen wohlbeleibten Pastor zu eng. Die Orgel, noch das beste Stück der Kirche, erst 1825 repariert und gestimmt, steht auf ebenem Boden im Chor. Überdies fehlt es der Kirche und dem Turm an der Hauptsache: beide sind zu klein. Die Kirche hat nicht Raum für alle Einwohner und der Turm ist zu niedrig, als dass im oberen Dorf Läuten und Schlagen gehört werden könnte.
Von Antiquitäten ist wenig zu sehen. In der Kirche sind noch 3 Grabsteine, auf welchen die Schrift noch mehr oder weniger kenntlich ist. Der erste bildet die Schwelle von der Sakristei in die Kirche herunter. Auf dem Rand liest man den Spruch Hiob 19, 25 SCIO QUOD REDEMTOR – ET IN CARNE MEA VIDEBO DEUM. Auf dem Stein in der Mitte stehen 2 Wappenschilder, davon das zur Linken eine Lilie zwischen 4 Kreuzen, das zur Rechten aber ein A und das Zeichen Psi enthält. Nach der Jahreszahl 1600 liest man mit großen lateinischen Lettern: Auf den VI Oktober, als man zählt nach unseres einigen Erlösers Jesu Christi selig machenden Geburt MDCVIII, ist in Christo Jesu seliglich entschlafen weiland der Ehr − das Übrige, leider die Hauptsache, bedeckt die Kanzeltreppe.2 Auf dem Grabstein links vom Altare ist noch zu lesen: Anno Domini
anno domini IST Alhier der Ehrwirdig her Wendel bolt (?)– Mestern PFARRER in Birkefeld –
Noch weniger vermochte ich die alte gotische Inschrift des Grabsteins hinter dem Altar zu entziffern. Nur die Worte brachte ich heraus – HERR ANNES (vielleicht ANDRES) – PFARHER zu Birkenfeld. In der Sakristei befinden sich in der östlichen und südlichen Ecke 2 kleine Schildchen, auf deren ersterem das Wort ages – vielleicht agnes – noch mit Mühe zu lesen ist. Oben am Gewölbe, wo die Spitzbögen zusammenlaufen, befindet sich ein Wappenschild mit folgenden Zeichen:
Den gleichen Fehler, wie die Kirche, hat der Kirchhof; er ist, obgleich erst anno 1797 erweitert, zu klein. Schon nach 12 Jahren muss ein Leichnam seinen letzten Fleck Erde einem neuen abtreten, und ich selbst sah einen noch ganz unbeschädigten Sarg mit den Gebeinen herausgegraben. Auch ist der Kirchhof zu nahe an den Wohnungen, besonders am Pfarrhause.
Ein würdiges Seitenstück zur Kirche ist das Schulhaus. Gottlob! dass doch zwei Schulzimmer vorhanden und Schulmeister und Provisor abgesondert lehren können! Auch sind die Schulzimmer, außer dass sie auch zu klein sind, freundlich, luftig und hell. Dagegen ist für den Schulmeister schlecht gesorgt. Eine einzige, gar nicht große Stube mit einer Schlafkammer daneben ist sein ganzer Wohnraum. Für den Provisor ist noch eine Kammer da und eine für die Magd. Die Küche ist finster, der Keller fehlt ganz, desgleichen auch die Scheuer, statt deren eine alle Regeln der Symmetrie verspottende Holzhütte dem Schulhaus gegenüber angebracht ist.
Ziemlich leidlich ist das Innere des Rathauses, das Äußere dagegen, besonders die Steintreppe, trägt traurige Spuren von dem Zahn der Zeit.
Statt eines Zuchthäusleins werden 2 greuliche Löcher, eines unter der Rathaustreppe und das andere unter der Treppe des Tobias Ilg auf dem alten Lindenplatz gebraucht.
Die beiden Keltern gehören der württembergischen und der badischen Regierung, weswegen die Birkenfelder von ihren Weinen den Achten, statt den Zehnten, geben.
Der Flecken besitzt auch ein Waschhaus im oberen Dorfe an einer Pfüze, der Teuchel-See genannt.
Das Pfarrhaus war noch im Jahre 1820 eine baufällige Spelunke, in der sich mancher Bauer zu wohnen geschämt hätte – ohne Wahl das schlechteste im Königreich. In diesem Jahr wurde es bis auf die der Kirche zugekehrte Seite niedergerissen und geräumiger und bequemer aufgebaut, so dass es zwar immer noch klein, doch artig und freundlich genug ist. Auch muss ich der Gemeinde, welcher das Haus gehört, das Zeugnis geben, dass sie ohne Weigerung noch manches Nötige auf meine Erinnerung nachholte, z.B. das Gipsen des Cabinets am Wohnzimmer, die Aufführung eines neuen Abtritts, das Graben einer sogenannten Dohle im Keller, die das Wasser unter dem Pfarrgarten fort ausführt, eine Klingel, ein Türchen im Kamin zum Räuchern und dergl. Nur der Keller ist klein und nicht tief genug.
Die zum Pfarrhaus gehörigen Gebäude, ein Waschhaus und eine Holzhütte, in welche mein „Vorfahre“ oft seine Kartoffeln eingrub, sind in gutem Stande, die kleine Scheune dagegen sehr alt, elend und baufällig.
Die Birkenfelder teilen ihren Flecken in das Ober- und in das Unterdorf. Jenes begreift den ganzen südlichen Teil des Orts gegen Neuenbürg, die ganze Straße vom Rathausbrunnen an bis zum Burgweg mit allen Nebengassen, namentlich der Heerd- und Schmiedgasse. Dagegen gehört zum Unterdorf der nördliche Teil des Dorfs vom Rathausbrunnen an Pforzheim zu, desgleichen die Straße rechts vom Rathaus hinauf gegen die Ziegelhütte und die linke Reihe der Häuser am Waschhause.
In der Mitte des Dorfs, beim Rössle und des Tobias Ilgen Haus ist ein erhöhter Platz, zur Linde genannt, weil dort vor Jahren eine große Linde – recht passend – gestanden hatte, in deren Stamm, als sie wegen erlittener Beschädigung im Jahr 1786 umgehauen wurde, ein in das Holz eingelassenes Halseisen oder vielmehr ein Stück davon gefunden wurde, wie im Fleckenbuche bemerkt ist.
Die Seelenzahl des Dorfes, die Ziegelhütte und die Mühlen mit eingerechnet, betrug im Jahr 1825 − 928, darunter 444 männlichen und 484 weiblichen Geschlechts. Nach einer freilich bloß 3-jährigen Bilanz kommt auf 34 Menschen ein Gestorbener, während in London von 20, in Manchester, der gesündesten Stadt Englands von 30, in Philadelphia dagegen von 42 Menschen einer stirbt.3 Birkenfeld gehört also zu den gesünderen Orten, wiewohl Entzündungen und hitzige Fieber aller Art hier in der Gegend sehr häufig sind und von den Neugeborenen fast die Hälfte im 1.sten Jahr stirbt. Auf 24 Menschen darf man einen Geborenen rechnen, während in Maryland auf 25, in Paris auf 28 ¼, in St. Paul in Brasilien auf 21 Menschen ein Geborener gezählt wird, deren Verhältnis zu der Einwohnerzahl von und Markus überhaupt auf 1:28 angegeben wird.4 Auf 29 Kinder kommt ein Totgeborenes. Die Zahl der Schulkinder ist gegen die Seelenzahl unverhältnismäßig klein, sie beträgt nämlich nur 135 Kinder, 59 Knaben und 76 Mädchen, was einesteils dem im Frühjahr 1823 hier grassierenden Scharlachfieber, andernteils der Sorglosigkeit der Aeltern in Behandlung kranker Kinder und hauptsächlich der verkehrten Gewohnheit zuzuschreiben ist, allen Kranken ohne Unterschied Wein nach Genüge zu reichen.
Die Commun Birkenfeld gehört unter die Wohlhabenderen des Königreichs. Sie hat nicht nur keine Steuerreste, keine Passivschulden, sondern 5000 f. Aktivkapitalien und daneben beträchtliche Waldungen von Eichen, Forchen und Buchen. Von den letzten bekommt jeder Bürger jährlich nicht ganz 1 Klafter Bürgergabe.
Dagegen ist der Heilige sehr unbeträchtlich. Er besitzt nicht über 750 f. Kapital 5, und da viele Lasten auf ihm ruhen, so entsteht gewöhnlich ein jährliches Defizit von 45 – 50 f. 6, welches die Communkasse bisher immer gedeckt hat und seit 1824 in dem abgehaltenen Ruggerichte auch für künftig mit jährlich 50 f. zu decken übernommen hat. Der Schulfonds besitzt gegenwärtig 153 f. an Kapitalien.
Auch in Hinsicht des Vermögens der Einzelnen kann Birkenfeld, was in unseren Tagen selten ist, ein wohlhabender Ort genannt werden. Es gibt zwar keine außerordentlich Reichen hier, aber vielleicht eben zum Glück daher gibt es auch keine Bettelarmen. Denn wenn auch jährlich etliche Mal an 20 Personen nach einer Stiftung Brot ausgeteilt wird, so erhalten dieselben doch sonst keine weitere Unterstützung, einen Blinden ausgenommen, der ein jährliches Gratial von 5 f. bekommt, und sie bringen sich alle selbst fort, bis auf einige abgelebte Alte, die ihr Vermögen ihren Kindern ausgeteilt haben und dafür von ihnen erhalten werden. So haben alle Einwohner dahier ihr Auskommen, nur die einen ein reichliches, die andern ein hinlängliches, die dritten ein sparsames.
Dazu trägt die Nähe von Pforzheim nicht wenig bei. Hier kauft und verkauft der Birkenfelder sein Vieh, dorthin bringt er seine Schweine, tragen Weiber und Mädchen Milch und Eier und Butter; dort verkauft er sein Obst, dorthin geht der Arme und erwirbt sich durch Taglöhnen Kost und Geld. Kurz, in Pforzheim wird alles verwertet, in Neuenbürg gar nichts, höchstens Kartoffeln.
Auf der anderen Seite trägt aber eben die Nähe von Pforzheim und Neuenbürg auch dazu bei, dass nur die allernötigsten Handwerker hier gedeihen können und die beiden Krämer, die hier sind, kaum den Namen verdienen. Der Zahl nach wären die meisten Handwerker zahlreich befragt, aber viele treiben das Handwerk gar nicht oder bloß für ihren Hausgebrauch. Es gibt nämlich hier
23 Weber
11 Schneider
9 Maurer
8 Schuhmacher
6 Zimmerleute
4 Ziegler
6 Bäcker
5 Küfer
3 Kübler
4 Schreiner
1 Siebmacher
5 Wagner
4 Schmiede
1 Metzger
1 Mahl- und 1 Sägmüller.
Dagegen fehlt es an einem Hafner und einem Nagelschmied. Im Orte selbst sind 2 Schildwirtshäuser, der Adler und das Rössle, und 1 Gassenwirt. Außer den Genannten sind die übrigen Bürger fast alle Bauern. Neben ihm ist noch ein Chirurgus, ein Feldmesser und ein Zollvisitator hier wohnhaft.
Hebammen hat der hiesige Flecken zwei, welche neben der Fronfreiheit ihrer Männer nur jede jährlich 8 f. bekommen. Die ganze Industrie der Birkenfelder besteht darin, dass die Ärmeren Beeren, Wachholderholz, Kresse usw. sammeln und nach Pforzheim tragen, die Vermöglicheren Brennholz nach Vaihingen und Bretter nach Schröck 7 am Rhein führen. Überdies wird auch Kirschengeist, Hopfen, Zwetschen und Fruchtbranntwein gebrannt und dürfen ausgeschenkt werden.8
Die Viehzucht ist mittelmäßig. Das Vieh ist gewöhnlich klein und ungestalt. Die Birkenfelder besitzen gegenwärtig 9
Bedeutender ist die Schweinezucht, die einen starken Handelszweig der Birkenfelder ausmacht.
Pferde werden hier gar nicht gezogen. Es sind deren höchstens 20 im Orte.
Außer Tauben und Hühnern wird kein Geflügel gehalten; Enten und Gänse im Pfarrhofe waren den Kindern eine höchst wunderbare und neue Erscheinung.
In der Kost sind die Birkenfelder nicht so einfach wie die Bauern des Unterlandes. So oft Brot gebacken wird, wird allerlei Kuchen mitgebacken. Fast jeder Birkenfelder schlachtet, und wäre er auch ganz allein und arm, jährlich sein Schwein. Auch legen sich die meisten neben ihrem Obstmost noch ein oder etliche Imi ihres Weines in den Keller, womit sie jedoch immer bald fertig sind.
Ihre Kleidung hat nichts Ausgezeichnetes, wohl aber die Unreinlichkeit derselben.
Die direkten Abgaben des Ortes belaufen sich jährlich auf 2700 f., nämlich die Staatssteuer auf 1300 f., der Amtsschaden auf 600, der Communschaden auf 800 f.
Für die Bürgerannahme zahlt ein Mann 35 - 50 f., ein Weib 17 - 25 f., ein Kind 12 - 30 kr.
Der Magistrat besteht, der Verfassung gemäß, aus 9 Mitgliedern. Schultheiß ist gegenwärtig Christian Dittus, Bauer, in seinem Eifer für Gemeinwohl und Ordnung und seinem Betragen gegen den Geistlichen höchst achtungswert. Er ist zugleich Zoller, Acciser und Ratschreiber und Waisenrichter und Untergänger.
Der erste Richter ist Eberhard Fix, zugleich Bürger- und Waldmeister, Waisenrichter, Untergänger und Kirchenkonventsbeisitzer.
Johannes Müller, zugleich Konventsrichter, Waisenrichter und Untergänger.
Abraham Oelschläger, Mühlschauer, Scharwächter und Brotwäger.
Samuel Wessinger, Ziegelschauer.
Friedrich Vollmer, Brotwäger.
Johannes Schroth, Scharwächter und Zehntknecht.
Michael Ilg, Feuerschauer und Unterkäufer.
Gottfried Oelschläger.
Der Obmann der Deputierten ist Johannes Wessinger. Die Deputierten sind Christoph Fix, Abraham Wessinger, Jakob Roth, Georg Bizer, Christoph Müller, Michel Vollmer, Johannes Vollmer, Kaspar Oelschläger.
Was die Sitten und den Charakter der Birkenfelder betrifft, so hat der Unterzeichnete, unter Beziehung auf seine Schilderung im Conzeptbuche pag. 84 - 87, nur noch Folgendes zu bemerken. Die Unmäßigkeit im Trinken, die Brutalität und die Fresslust, die man sonst den Birkenfeldern vorzuwerfen pflegte, haben, Gott sei Dank!, sehr nachgelassen. Dagegen ist der wirklich unermüdliche Fleiß der Birkenfelder zum Sprichwort geworden, dass man in der Gegend überall sagt von einem geschäftigen Menschen, „er knie nur ins Bett wie die Birkenfelder“. Leider ist mit diesem Fleiße eine große Missungunst verbunden, die alles allein haben will und, wenn sie noch durch Beleidigungen gereizt wird, bei manchen in eine Tücke ausartet, die sich gern ein Auge ausschlägt, nur damit der andere beide Augen verliere. Der Birkenfelder ist munter und aufgeweckt; selbst die trockensten Alten leben an der Kirchweih und den Hochzeiten in jovialer Laune aufs neue auf. Ein gesunder Verstand, ein richtiges Urteil zeichnet sie aus. Auch die Sprache ist für Schwaben ziemlich rein und lange nicht so breit, als sie gewöhnlich in Altwürttemberg gesprochen wird.10 Die Birkenfelder haben mit ihren Nachbarn das Eigene, dass sie das D nach L, M und N gar nicht hören lassen, z.B. Wall statt Wald, Hemm statt Hemd, Hann statt Hand, unner statt unter usw. Auch in der Mitte nach jenen Buchstaben wird das D nicht gehört. So sprechen sie auch das CH vor S nicht aus, sondern sagen waasen statt wachsen, Flaas statt Flachs, Fuus statt Fuchs usw. Sehr auffallend war für mich, von allen Einwohnern, selbst den gebildetsten, der Ausdruck „Ei ja wohl“ statt „o nein, nichts weniger“ gebrauchen zu hören. Sonderbare Idiotismen dieser Sprache sind: Zähnbart (= Kinn), Pfedderich (= Pate), Ballisaden (=Milchbrot), Lapp (= Maul).
Die Kirche wird sehr zahlreich an Sonntagen besucht, und zwar nachmittags wie vormittags, desto seltener in den Wochengottesdiensten, an Bußtagen und Feiertagen. Der Sonntag wird gegenwärtig wieder in Ehren gehalten, nur dass nach einem in der Gegend allgemein üblichen Gebrauch abends nach dem Melken jeder Futter für sein Vieh11 holt Während der beiden Gottesdienste wird an Sonn- und Feiertagen von einem Gemeinderat und einem Deputierten Umgang in den Wirtshäusern und Branntweinschenken gehalten und jeder Birkenfelder, der sich dort betreten 12 lässt, um 1 f. in den Heiligen gestraft. Die Feiertage dagegen werden von den Meisten, die Stunde des Gottesdienste ausgenommen, fast ganz wie Werktage behandelt.
Das Verhältnis zwischen Ehemann und Eheweib ist hier so ziemlich wie überall. Nur das ist besonders, dass die Weiber die Weinberge fast ganz allein besorgen. Auch glauben die Männer allgemein, dass es ihnen erlaubt sei, ihre Weiber abzustrafen, nur in der Ordnung, d.h. mit dem Seilstumpen ohne Knoten. Das Verhältnis der ehelichen Kinder zu den unehelichen ist nach einer 10-jährigen Bilanz wie 13 zu. Die Erziehung der Kinder ist sehr weit zurück. Die Schüler bleiben von März bis in den November ihren kleinsten Geschwistern oder 13-14-jährigen Kindsmädchen überlassen. Einem Kinde Privatunterricht geben zu lassen, ist ganz unerhört. Nur wenige Mädchen konnten bisher stricken; Nähen verstanden weder Alte noch Junge. Den heranwachsenden Kindern wird hier so viel Freiheit gelassen, dass ihre Stimme in häuslichen Angelegenheiten bald mehr gilt als die der Eltern. Sind die Kinder vollends erwachsen, so sind wenig Eltern mehr imstande, sie in der Zucht zu erhalten; nach der Konfirmation glaubt jedes Kind, seinen Eltern nicht mehr folgen zu dürfen. Vorwürfe der letzteren wegen Ausschweifungen, Nachtschwärmereien usw. werden von diesen mit Grobheiten und Scheltworten usw. erwidert, dass die Alten gern aufhören zu singen, um nur das Zwitschern ihrer Jungen loszuwerden. Haben die betagten Eltern endlich ihr Vermögen an ihre Kinder abgegeben, so sind sie in ihrem eigenen Hause fremd, ihres Eigentums und ihrer selbst nicht mehr mächtig und die Knechte, die Kindsmägde ihrer eigenen Kinder geworden
Im äußeren Betragen zeigt der Birkenfelder ziemlich viel Anstand und Höflichkeit. Dem Herrn Pfarrer einen „Guten Abend“ zu sagen vergisst weder Alt noch Jung, und wenn einer, während der Pfarrer zum Fenster hinaussieht, auf der Strasse vorübergeht, so zieht er seine Mütze und behält sie so lange in der Hand, bis er ganz am Hause vorbei ist. Lächerlich sieht es aus, wenn sie ohne ihre Mütze grüßen; sie greifen nach dem Kopfe, wie wenn sie eine Mütze abnehmen wollten und verbeugen sich dann mit dem Kopfe in der leeren Hand.
Ein Unglück für die Moralität der Birkenfelder, die gewiss nicht geringer ist als der anderen Dörfer, ist die Lage des Ortes an der Grenze. Durch ihren Verkehr mit dem Auslande kommen sie in unzählige Versuchungen zu Zollfraudationen [Zollbetrügerei], denen sie leider, trotz der wachsamen Spürnase der Zollgardisten, meistens unterliegen. Sie nehmen das sehr leicht und halten es entweder für etwas, das sich von selbst so versteht, oder mehr für einen Beweis von Klugheit als von Unredlichkeit.
Ebenso leicht wissen sie ihr Gewissen zu schweigen, wenn sie in Büchenbronn über der Enz Holz stehlen, was zu meinem großen Schmerz fast allgemein ist. Wenn ich nur kein Scheiterholz nehme, hört man sie sagen, so ist es nicht Böses. Den Büchenbronnern nützt es wenig oder nichts und uns sehr viel. Wo sollten wir Holz hernehmen? Kaufen können wir es nicht. So nehmen wir das Holz, aber das ist nicht gestohlen.
In der ganzen Umgegend gibt es häufig Pietisten und eine sehr schöne Art von Separatisten, die nach glaubwürdigen Aussagen eine Weibergemeinschaft unter sich haben, wenigstens eine Art Licisteat 14, so dass bei ihren Wallfahrten in eine auswärtige Kirche nie ein Ehemann mit seinem Weibe geht. (So sagte mir einst einer der badischen Separatisten, als ich, um sein Eigenlob zu mäßigen, auf diese ihre Sitte anspielte, es heiße ja in der Bibel: „Ein Bischof sei eines Weibes Mann.“ Also dürfe man, wenn man es nicht sei, mehrere haben.) In Birkenfeld existieren gottlob! weder Pietisten noch Separatisten, doch sind Kenntnis und Liebe der Religion hier in keinem geringeren Grade, als ich anderswo getroffen.
Die meisten Krankheiten kurieren die Birkenfelder durch Wein und durch Schwitzen. Hilft das nicht, so wendet man sich an einheimische Medicaster, die Tausendgüldenkraut, Dosten, Gerstenwasser, leider auch Pillen verordnen. Die dritte Instanz machen der Doktor von Tiefenbrunn, der Schäfer von Busenbach, nunmehr in Forchheim. Erst wenn auch diese nicht mehr helfen können, geht man gewöhnlich zum rechten Arzt. Im Ganzen sind die Meisten sehr ängstlich, wenn ihnen nur das Mindeste fehlt. Die Kranken werden – besonders an Sonntagen – fleißig besucht und mit Speisen versorgt.
Auffallende Gebräuche habe ich wenige bemerkt. Bei Hochzeiten macht gewöhnlich der Schulmeister den Brautführer. Vor der Kirche wird viel Rosmarin verteilt. Wen man auszeichnen will, dem gibt man ein Band dazu. Sehr geschmacklos ist der Kopfputz der Braut und ihrer Gespielen, die das Haar so weit als möglich aus dem Gesicht ziehen und Stirn