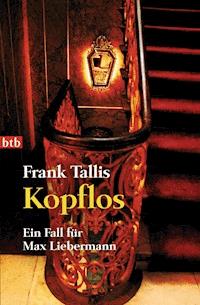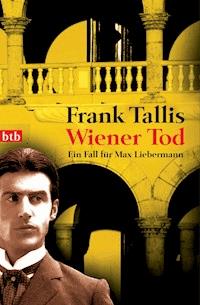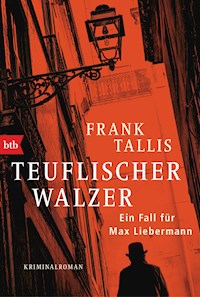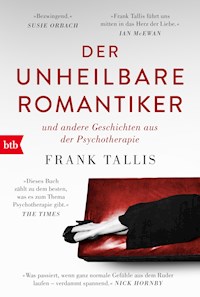9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Max-Liebermann-Krimis
- Sprache: Deutsch
Das morbide Wien in seinem tödlichsten Glanz
Ein perfider Serienmörder sucht Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts heim. Den ermordeten jungen Frauen ist keine Verletzung anzusehen. Bei genauer Untersuchung des Hinterkopfes entdeckt der Pathologe, dass eine Hutnadel durch eine kleine Öffnung der Schädeldecke ins Gehirn getrieben wurde. Die Ermittlungen führen Inspektor Oskar Rheinhardt auf die dunkle Seite Wiens, wo er bald die Hilfes seines Freundes Max Liebermann, des jungen Psychoanalytikers, nötig hat ...
Der fünfte Teil der Erfolgsserie um den Psychoanalytiker und Detektiv Max Liebermann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Oskar Rheinhardt bekommt es im Wien der Jahrhundertwende mit einem teuflischen Serienmörder zu tun. Den ermordeten jungen Frauen ist eine kaum sichtbare, tödliche Verletzung zugefügt worden. Rheinhardt ermittelt im Halbwelt-Milieu, denn bei den Getöteten handelt es sich vornehmlich um Dirnen oder gefallene Bürgersmädchen. Ist das die unausrottbare Kehrseite des deutlich merkbaren gesellschaftlichen Fortschritts? Rheinhardts Freund, der junge Psychoanalytiker, hat Deutungen parat, gegen die sich Oskar mit Händen und Füßen wehrt. Oder sollte tatsächlich etwas daran sein, dass sich die unaussprechlichsten sexuellen Phantasien in der Psyche auch der edelsten Kreise eingenistet haben? Frank Tallis entwirft einen überaus spannenden und atmosphärisch dichten Kriminalfall im Wien von Sigmund Freud und Gustav Mahler und konfrontiert den künstlerischen und gesellschaftlichen Aufbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einer scheinbar zeitlosen Todesverfallenheit.
FRANK TALLIS ist Schriftsteller und praktizierender klinischer Psychologe. Für seine Romane erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Writers’ Award from the Arts Council of Great Britain und den New London Writers’ Award. Frank Tallis lebt in London.
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
Der Theseustempel
1
Liebermann saß auf einem Stuhl am Kopfende des Ruhebettes. Er hatte die Stellung eingenommen, die seiner Meinung nach dem Zuhören besonders dienlich war: übereinander geschlagene Beine, die rechte Faust an der Wange, die Spitze des Zeigefingers an der Schläfe. Sein auf dem Rücken liegender Patient, Herr Norbert Erstweiler, konnte den jungen Arzt nicht sehen. Herr Erstweiler sah vor allem die weiße Zimmerdecke und, wenn er den Blick senkte, eine schlichte Tür mit Milchglasscheibe. Herrn Erstweilers Augen kamen nicht zur Ruhe. Ihre hektischen Bewegungen ließen auf Unbehagen und Furcht schließen. Es wirkte, fand Liebermann, als hätte Herr Erstweiler Angst davor, dass jemand plötzlich ins Zimmer kommt.
»Ich erwarte niemanden«, sagte Liebermann.
»Entschuldigen Sie?«
»Wir werden nicht gestört. Niemand wird hereinkommen.«
»Gut … das wäre mir nicht angenehm.«
»Sie erzählten gerade von Ihrem gestörten Schlaf.«
»Das stimmt. Ich kann nicht mehr einschlafen. Ich gehe ins Bett, lösche die Lampe, und dann erfüllt mich sofort der Schrecken. Es ist die Dunkelheit … es hat etwas mit der Dunkelheit zu tun.«
»Ist es etwas in der Dunkelheit?«
»Nein, so würde ich es nicht ausdrücken. Ich würde sagen, es ist die Art der Dunkelheit … ihre Leere, auch mein Appetit ist gänzlich geschwunden, und mein Stuhlgang ist flüssiger.«
Liebermann fiel auf, dass die Hände von Herrn Erstweiler leicht zitterten.
»Haben Sie Mühe beim Atmen, Herr Erstweiler?«
»Ja, ich habe Beklemmungen in der Brust … und mein Herz, ich spüre es die ganze Zeit schlagen. Irgendwas ist damit nicht in Ordnung. Ich weiß das.«
Liebermann schaute auf die Notizen auf seinem Schoß.
»Nein, Herr Erstweiler. Ihr Herz ist vollkommen in Ordnung.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob der Kardiologe, bei dem ich war, eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat.«
»Professor Schulde ist eine Autorität.«
Erstweiler schaute auf die Tür.
»Nun, das mag ja sein … aber auch Autoritäten können irren.«
Liebermann musterte seinen Patienten: Anfang dreißig, dunkles, schon leicht ergrautes Haar, ein schmales, verhärmtes Gesicht, müde, blutunterlaufene Augen, Fingerabdrücke auf der Brille. Drei Falten hatten sich in Erstweilers Stirn eingegraben, eine kurze, eine lange und eine weitere kurze. Sie waren so tief, dass sie wohl nie mehr verschwinden würden. Er hatte seine Toilette vernachlässigt, und sein Kinn war schorfig.
Erstweiler legte sich eine beruhigende Hand auf sein rasendes Herz.
Dem jungen Arzt fiel auf, dass die Unterhaltung über seine Symptome die Unruhe des Patienten noch erhöhte. Er beschloss, ihn abzulenken, indem er sich einem anderen Thema zuwandte.
»Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie erst kürzlich nach Wien gekommen«, sagte Liebermann.
»Ja. Ich bin kurz vor Weihnachten hergezogen.«
»Woher stammen Sie?«
»Tulln – kennen Sie das, Herr Doktor?«
Erstweilers Stimme klang hoffnungsvoll.
»Ich habe davon gehört«, antwortete Liebermann. »Sind Sie dort geboren?«
»Nein, in Eggenburg, aber meine Familie ist nach Tulln gezogen, als ich noch sehr klein war. Eine stille Provinzstadt«, sagte Erstweiler, »aber ich bin ein einfacher Mensch und mit wenig zufrieden. Wandern, Angeln … ein wenig Rudern im Sommer.« Erstweiler blinzelte, und ein schwaches Lächeln milderte seine Züge. »Ich war in Tulln sehr glücklich.«
»Warum haben Sie die Stadt verlassen?«
»Als mein Arbeitgeber starb, wurde ich entlassen. Ich war Privatsekretär eines Ratsherrn – des Ratsherrn Metternich – und arbeitete im Rathaus. Es war keine sehr anspruchsvolle Tätigkeit – Korrespondenz, den Terminkalender führen, diese Dinge. Metternich starb im Herbst des vergangenen Jahres. Seine Krankheit zog sich recht lange hin. Er wusste …« Erstweiler zögerte und stotterte dann: »d-d-dass er st-st-sterben würde …« Liebermann sah, dass der Ärmste versuchte, gegen eine schreckliche Erinnerung anzuarbeiten. Erstweiler holte tief Luft und fuhr fort: »Er schrieb einem Freund und empfahl mich für einen Posten im Büro. Er war ein sehr freundlicher alter Mann, Metternich, und wusste, dass ich Mühe haben würde, eine andere Arbeit in Tulln zu finden. Metternichs Freund war Herr Winkler, ein Geschäftsmann, der Möbel und objets d’art aus Japan importiert. Ich arbeite jetzt in seinem Lager in Simmering. Die Arbeit ist nicht sonderlich gut bezahlt, aber man hat mir gesagt, dass man mich bald befördern wird.«
Liebermann machte sich ein paar Notizen und fragte dann: »Leben Sie allein?«
»Ja … nein. Was ich meine, ist Folgendes … ich habe mir ein Zimmer genommen, zur Untermiete, im Haus eines Tschechen und seiner Frau.«
»In Simmering?«
»Nicht weit von Winklers Lagerhaus entfernt.«
»Haben Sie Familie oder Freunde in Wien?«
»Nein.«
»Und zu Hause in Tulln? Haben Sie dort jemanden zurückgelassen?«
»Meine Eltern sind beide verstorben. Ich habe einen älteren Bruder … aber wir haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Er ist nach Salzburg gezogen. Er ist Beamter bei der Eisenbahn, recht weit oben. Er trägt eine Uniform wie ein General! Wir waren nie sonderlich eng. Er hält mich für …« Erstweiler verzog das Gesicht, »… zu wenig ehrgeizig.«
Liebermann klopfte sich mit seinem Zeigefinger an die Schläfe, dann schrieb er die Worte »Angstneurose« und »Angsthysterie« nieder. Er war mit seiner mutmaßlichen Diagnose nicht ganz zufrieden. Wieder beobachtete er, wie sein Patient zur Tür blickte, und fügte in Klammern hinzu: »Dementia paranoides?« Liebermann beschloss, sich wieder den Symptomen zuzuwenden.
»Wann sind Sie das erste Mal erkrankt, Herr Erstweiler?«
»Etwa vor einer Woche. Es kam sehr plötzlich.«
»Haben Sie früher an ähnlichen Zuständen gelitten? Atemnot? Herzrasen?«
»Nein, noch nie. Ich war immer sehr gesund.«
»Ist etwas vorgefallen, das Sie aufgeregt hat?«
Erstweiler antwortete nicht.
Liebermann beharrte: »Haben Sie eine schlechte Nachricht erhalten? Haben Sie einen Unfall gesehen? Ist eine Beziehung zu Ende gegangen?«
»Nein … nichts dergleichen.«
»Aber etwas muss vorgefallen sein …«
Erstweiler schloss die Augen. Der bloße Gedanke an eine Enthüllung weckte in ihm das Verlangen, die Welt auszusperren.
»Was denken Sie?«, fragte Liebermann leise. »Was glauben Sie, bedeuten diese Symptome?«
Der Patient öffnete wieder die Augen. Sie waren glasig, schienen ins Nichts zu starren, und seine Stimme klang entsprechend schleppend: »Sie bedeuten, dass ich sterben werde.«
»Aber Sie sind kerngesund, Herr Erstweiler. Alle Untersuchungen und Tests haben gezeigt, dass Sie sich ausgezeichneter Gesundheit erfreuen. Also.« Liebermann klopfte mit seinem Stift auf die Armlehne seines Stuhls, um die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu ziehen. »Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Sie augenblicklich an Angstzuständen leiden, Hyperventilation, Tachykardie, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit – aber diese Symptome sind relativ harmlos.«
Erstweiler ignorierte Liebermanns Appell.
»Mein Schicksal ist besiegelt«, flüsterte er. »Ich werde sterben. Und Sie und Ihre Kollegen können nichts tun, um mich zu retten. Wenn der Tod an die Tür klopft, kann man ihm nicht den Einlass verwehren.«
Liebermann machte sich eine weitere Notiz.
»Herr Erstweiler?«
Der Patient schien aus seinem gedankenverlorenen Zustand zu erwachen. Seine Augen richteten sich wieder auf die wirkliche Welt – die Zimmerdecke und die Tür.
»Ja?«
»Irgendetwas ist Ihnen zugestoßen«, Liebermann dämpfte seine Stimme, um der Direktheit seiner Aufforderung entgegenzuwirken. »Es ist wichtig, dass Sie mir alles erzählen. Nur dann kann ich Ihnen helfen.«
»Ich hätte nie in den Krankenhausaufenthalt einwilligen sollen. Das war die Idee meines Hausarztes Dr. Vitzhum. Er hat mich überredet … er hat mir eingeredet, ich hätte ein Nervenleiden, und dass die Welt ganz anders aussähe, wenn ich mich ein paar Wochen lang ausruhen würde. Ich wollte ihm sehr gerne glauben – natürlich –, was hatte ich auch für eine Wahl? Damals glaubte ich, dass er recht habe, ich glaubte, ich werde verrückt, aber das ist nicht der Fall. Wenn ich doch nur verrückt würde! Lieber Gott! Wenn Sie mich heute für verrückt erklären würden und es beweisen könnten, dann wäre ich sehr erleichtert.«
»Wovor haben Sie Angst, Herr Erstweiler?«
»Vor dem Sterben. Ich will nicht sterben.«
Liebermann unterstrich das Wort »Thanatophobie« zwei Mal.
»Noch einmal, Herr Erstweiler, blicken Sie doch bitte auf die Fakten.«
»Glauben Sie mir – das habe ich.« Erstweiler sprach ganz offensichtlich nicht von den medizinischen Untersuchungen.
»Ich kann mir kein vollständiges Bild von Ihrem Geisteszustand machen«, meinte Liebermann, »solange Sie mir nicht sämtliche Umstände eröffnen. Sie sagen, dass es Ihr Leiden mildern würde, wenn Sie für verrückt erklärt würden. Ich bin jedoch nicht in der Lage, Ihnen diese etwas ungewöhnliche Erleichterung zu gewähren, solange Sie sich weigern, mich ins Vertrauen zu ziehen.«
Erstweiler strich sich über die Bartstoppeln seines Kinns. Eine lange Stille trat ein. Schließlich antwortete er.
»Als es zum ersten Mal passierte, war ich mir nicht sicher …« Er schluckte, und sein Adamsapfel bewegte sich heftig. »Ich ging den Graben entlang, als ein Fiaker an mir vorbeifuhr. Ich konnte nur einen kurzen Blick auf den Fahrgast erhaschen und glaubte, es sei mein Bruder. Wir haben in etwa denselben Körperbau und sind uns sehr ähnlich, besonders was die Züge auf der väterlichen Seite unserer Familie angeht. Der Mann trug einen Filzhut. Es hätte mir schon da klar sein müssen.«
»Was?«
»Wir sind uns äußerlich sehr ähnlich, haben uns aber immer sehr unterschiedlich gekleidet. Im Unterschied zu mir hat er, soweit ich weiß, nie einen Filzhut getragen. Außerdem kommt er nur selten nach Wien. Er konnte es also nicht gewesen sein.«
»Ich bin mir nicht ganz sicher, ob …«
»Bitte, Herr Doktor«, unterbrach ihn Erstweiler. »Lassen Sie mich fortfahren. Jetzt, wo ich schon einmal angefangen habe, würde ich auch gerne fertigerzählen … An diesem Abend war ich recht unruhig. Ich konnte mich nicht hinsetzen. Ich versuchte, mein Buch zu lesen, aber es war mir unmöglich, mich zu konzentrieren. Mein Tisch steht recht nah am Fenster, und ich schob – ohne besonderen Grund – den Vorhang beiseite und schaute nach draußen. Mein Zimmer liegt im ersten Stock, und als ich nach unten schaute, sah ich einen Herrn unter einer Gaslaterne stehen. Er trug einen Filzhut.«
Liebermann schaute wieder auf seine Notizen, lächelte innerlich und unterstrich Dementia paranoides.
»Sie wurden also verfolgt?«
Erstweiler schüttelte den Kopf. Sein Gesichtsausdruck war gequält.
»Es war etwas Seltsames an dem Mann. Das wusste ich sofort, aber erst als ich ihn eine Minute oder mehr beobachtet hatte, wie er dort stand, wurde mir klar, was es war:
Er warf keinen Schatten. Und in diesem Augenblick, genau in dem Moment, in dem ich sah, dass er keinen Schatten hatte, hob er seinen Kopf und schaute zu meinem Fenster hoch. Mein Herz pochte wie wild, und mir drehte sich der Magen um. Sein Gesicht …« Herr Erstweiler schüttelte noch nachdrücklicher den Kopf. »Er war ich, er war mein Doppelgänger, mein Double.«
»Ist es möglich, dass Sie sich geirrt haben? Sie waren aufgeregt, es war dunkel …«
»Er stand direkt unter der Gaslaterne!« Zum ersten Mal war eine leichte Verärgerung in Erstweilers Stimme auszumachen.
»Was haben Sie dann getan?«
»Was konnte ich schon tun? Ich goss mir ein Glas Slibowitz ein und verkroch mich bis zum Morgen im Bett. Die Nacht verbrachte ich vollkommen verängstigt. Sie wissen doch sicher, was das bedeutet, Herr Doktor, wenn jemand seinen Doppelgänger sieht? Ich werde sterben, und nichts kann mich retten.«
2
Kriminalinspektor Oskar Rheinhardt stieg vor dem Hoftheatereingang des Volksgartens aus seiner Kutsche. Zwei Gendarmen in langen blauen Mänteln und Pickelhauben flankierten das Tor. Sie erkannten den Inspektor und schlugen die Hacken zusammen, als er an ihnen vorbeiging. Rheinhardt eilte den Weg entlang und suchte in seinen Jackentaschen nach einer Schachtel Zigarren. Er seufzte, als er feststellte, dass die Taschen leer waren. Er hatte seine Trabukkos auf seinem Schreibtisch vergessen. Über der Hofburg hingen langgestreckte Wolken in der milden Luft, die Farben des frühen Morgens waren weich und matt.
Rheinhardt war noch nicht sehr weit gekommen, als er hinter sich jemanden herbeieilen hörte. Er drehte sich um und sah seinen Assistenten.
»Herr Inspektor!«
Die langen Beine des jungen Mannes trugen ihn zügig und zuversichtlich voran.
Wenn man doch wieder jung sein könnte, dachte der Inspektor (obwohl seine athletischen Leistungen auch in seiner Jugend nie sonderlich beachtenswert gewesen waren).
»Guten Morgen, Haussmann.«
Der junge Mann drosselte sein Tempo und blieb schließlich stehen. Er beugte sich vor und stützte sich mit den Händen auf den Knien ab. Als er wieder zu Atem gekommen war, folgten sie zusammen dem Weg, der auf ein graues Gebäude mit dreieckigem Giebel und dorischen Säulen zuführte, das von weiteren Gendarmen umstanden wurde.
»Haben Sie sich je gefragt«, meinte Rheinhardt beiläufig, »warum mitten in unserem Volksgarten ein griechischer Tempel steht?«
»Nein, Herr Inspektor, das habe ich nicht.« Haussmanns Stimme klang etwas resigniert, da er aus Erfahrung wusste, dass auf eine solche Frage normalerweise eine didaktische Antwort folgte. Seinem Vorgesetzten schien das Schulmeisterliche zu gefallen.
»Nun, mein Junge«, erwiderte Rheinhardt, »er wurde für eine berühmte Plastik gebaut, ›Theseus und der Zentaur‹ des berühmten italienischen Bildhauers Antonio Canova. Deswegen heißt der Tempel auch Theseustempel. Bei dem Gebäude handelt es sich um den Nachbau eines Tempels, der in Athen steht, des Hephaistostempels.«
»Hephaistos?«
»Der Gott des Feuers und Handwerks, insbesondere des Handwerks, das sich des Feuers bedient, die Schmiedekunst beispielsweise.«
»Steht die Plastik denn noch in dem Tempel, Herr Inspektor?«, fragte Haussmann mit gespieltem Interesse.
»Nein. Man hat sie vor etwa zehn Jahren ins Kunsthistorische Hofmuseum gebracht. Sie steht im Stiegenhaus auf dem ersten Treppenabsatz. Haben Sie sie noch nie gesehen?«
»Ich bin kein sonderlicher Kunstliebhaber, Herr Inspektor.«
»Waren Sie denn noch nie im Kunsthistorischen Hofmuseum?«
»Nein, Herr Inspektor, ich finde alte Gemälde …«
»Ja?«
»Deprimierend.«
Rheinhardt schüttelte den Kopf und tat Haussmanns Bemerkung mit einer wegwerfenden Handbewegung ab.
»Es ist eine schöne Plastik«, fuhr Rheinhardt fort, der sich von dem Banausentum seines Assistenten nicht beirren ließ. »Der große Held Theseus hat seinen Knüppel zum Schlag erhoben.« Plötzlich sah Rheinhardt besorgt aus. »Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wer Theseus ist?«
»Ja, Herr Inspektor. Ich besitze ein Buch mit griechischen Sagen. Ich habe es bei einem Gedichtwettbewerb in der Schule gewonnen.«
Rheinhardt zog die Augenbrauen hoch.
»Ich wusste nicht, dass Sie Gedichte schreiben?«
»Das tue ich auch nicht, Herr Inspektor, jedenfalls nicht mehr. Aber in der Schule habe ich noch Gedichte geschrieben.«
Ihre Unterhaltung kam zu einem verfrühten Ende, als sich ein Gendarm, groß und mit glühenden Wangen, von seinen Kollegen trennte und auf sie zutrat, um sie zu begrüßen. Er stellte sich als Gendarm Badem vor.
»Richtig, Badem«, sagte Rheinhardt. »Sie haben die Leiche entdeckt.«
»Ja, Herr Inspektor.« Der Gendarm stand sehr aufrecht und drückte die Brust raus, als würde ihm gleich ein Orden verliehen werden. Rheinhardt, den der Stolz des jungen Mannes rührte und amüsierte, klopfte ihm auf die Schulter.
»Ganz vortrefflich! Das Sicherheitsamt steht in Ihrer Schuld.«
»Danke, Herr Inspektor«, sagte Badem, und seine Augen funkelten gerührt. Dann nahm der junge Mann wieder eine normale Haltung ein und meinte: »Sie liegt dort drüben, Herr Inspektor.« Er hob die Hand und deutete auf einige Büsche, bei denen sich seine Kollegen versammelt hatten.
Rheinhardt verließ den Fußweg, um nachzusehen.
Die Frau lag flach auf dem Rasen. Ihre Haarnadeln waren herausgerutscht, und dunkle, üppige Locken umrahmten ihr Gesicht. Die Anordnung ihrer Glieder – die gespreizten Beine und die ausgebreiteten Arme – ließ an Hingabe denken. Ihr Kleid war über die Knie hochgerutscht, und ein Paar gestreifter Strümpfe war zum Vorschein gekommen. Rheinhardt fiel auf, dass die Sohlen ihrer Halbstiefel fast durchscheinend waren. Bei näherer Betrachtung konnte man ein kleines Loch sehen. Auch ihr Mantel war abgenutzt, die Manschetten waren ausgefranst, einige Fetzen des Mantelfutters, das schon lange entfernt worden war, waren noch zu erkennen. Sie war jung, vielleicht nicht älter als achtzehn, und das Weiß ihrer bleichen Haut kontrastierte mit der Künstlichkeit des karmesinroten Puders auf ihren Wangen.
Sie hatte ein interessantes Gesicht, sinnlich und anziehend, aber nicht in einem herkömmlichen Sinne schön. Ihr Ausdruck tödlicher Ruhe ließ auf verächtliche Gleichgültigkeit schließen – vielleicht sogar Grausamkeit. Ihre Lippen waren etwas ungleichmäßig, gekrümmt, und ihre Nase war zu großzügig proportioniert. Und doch fügten sich diese Fehler zu etwas Faszinierendem.
Rheinhardt kniete sich neben sie hin und durchsuchte ihre Taschen nach einem Ausweis, fand aber nur einige kleine Münzen, ein Taschentuch und zwei Schlüssel. Der Hut der Frau lag in einiger Entfernung auf der Erde neben etwas, was dem Inspektor ein Stück Unterwäsche zu sein schien.
»Sie ist nicht erstochen oder erschossen worden«, sagte Rheinhardt und öffnete ihren Mantel. Er konnte keine Blutflecken auf ihrem einfachen weißen Kleid sehen.
»Erdrosselt, Herr Inspektor?«, fragte Haussmann.
Rheinhardt veränderte seine Stellung und betrachtete ihren Hals.
»Nein, ich glaube nicht. Erstickt vielleicht …«
Der Inspektor erhob sich, klopfte sich seine Hose ab und ging zu dem weggeworfenen Kleidungsstück. Als er es entfaltete, bestätigte sich sein Verdacht. Er hielt einen roten Baumwollschlüpfer in der Hand.
Haussmann runzelte die Stirn. »Wurde sie … missbraucht?«
»Ich vermute.«
Der Schlüpfer flatterte in der leichten Brise. Rheinhardt kam sich plötzlich respektlos vor, faltete das Kleidungsstück vorsichtig zusammen und legte es wieder auf die Wiese.
»Inspektor Rheinhardt?«
Ein Mann mit einem Homburg und Brille schaute über die Büsche. Der Fotograf. Der Begleiter des Mannes, sein Lehrling, tauchte hinter ihm mit einem Stativ auf.
»Ah, Herr Seipel«, sagte Rheinhardt. »Guten Morgen.«
»Können wir anfangen, Herr Inspektor?«
»Ja, allerdings. Sie dürfen anfangen.«
Rheinhardt trat von dem Leichnam zurück. Er zog sein Notizbuch hervor und notierte sich ein paar Beobachtungen, dann wandte er sich wieder an seinen Assistenten: »Kommen Sie, Haussmann.«
Die beiden Männer gingen zum Theseustempel und erklommen die breite Freitreppe.
Der Inspektor rieb sich die Hände und betrachtete die Umgebung. Direkt vor sich hatte er die weiße, reichverzierte Fassade des Burgtheaters, und dahinter erkannte er die Türme der Votivkirche. Als er den Kopf nach links drehte, sah er die neugotischen Türme des Rathauses und die klassizistische Pracht des Parlamentsgebäudes, auf dem sich zwei geflügelte Wagenlenker, die versuchten, ihre sich aufbäumenden Pferde im Zaum zu halten, über das mit Marmorfiguren bevölkerte Tympanon ansahen.
»Haben Sie schon gefrühstückt?«, fragte Rheinhardt.
Seinen Assistenten überraschte die Frage, und er erwiderte vorsichtig: »Nein, Herr Inspektor, das habe ich noch nicht.«
»Ich auch nicht. Da wir uns nun schon einmal ganz in der Nähe des Café Landtmann befinden, könnten wir dort genausogut eine Kleinigkeit essen, bevor wir uns ins Pathologische Institut begeben.«
»Ja, Herr Inspektor – wie Sie wünschen.«
»Nur ein paar Kaisersemmeln.« Der Inspektor hielt inne, zwirbelte seinen Schnurrbart und meinte dann, da er die Aussicht auf diesen Imbiss unbefriedigend fand: »Und vielleicht ein Stück Gebäck. Ich habe erst letzte Woche im Café Landtmann einen sehr guten Zwetschkenstrudel gegessen.«
Sie gingen die Arkaden entlang, die das schmucklose Äußere des Tempels umgaben. Keiner der beiden Herren hob den Blick, um die Sehenswürdigkeiten zu bewundern, die ihnen dieser Rundgang eigentlich darbot: die schwarzen und grünen Kuppeln, die barocken Laternen, die blühenden Blumen und die niedrigen Hecken, die barocke Muster bildeten. Sie hielten den Blick auf den steinernen Bodenbelag gerichtet, der von unzähligen Vorgängern zu silbrigem Glanz abgetreten war.
Plötzlich beschleunigte Haussmann seinen Schritt und kniete sich hin.
»Was ist das?«, fragte Rheinhardt.
»Ein Knopf.«
Er reichte ihn seinem Vorgesetzten.
Er war groß, rund und aus Holz.
»Irgendwelche Fußabdrücke?«
Haussmann stützte sich mit den Händen ab, beugte sich vor und betrachtete die Pflastersteine eingehender. Die Stellung, die er eingenommen hatte – die irgendwie eckig und scharfkantig wirkte – ließ ihn wie ein wildes Tier erscheinen. Er erinnerte an einen langbeinigen Hund, der Witterung aufnimmt. Seine Antwort war enttäuschend.
»Nein.«
Rheinhardt hielt den Knopf in die Höhe und sagte: »Er stammt von ihrem Mantel.«
3
Wo also beginnen? Mit einer Geburt oder mit einem Tod? Und da haben wir es schon, verstehen Sie, die zwei gehören immer zusammen. Wann beginnt ein Leben? Bei der Empfängnis? Das ist ein Anfang, aber nicht notwendigerweise der einzige. Es gibt auch keinen Grund, warum wir die Empfängnis besonders hervorheben sollten. Die Farbe meiner Augen beispielsweise, die ich von meiner Mutter geerbt habe, geht meiner Geburt voraus. Gewisserweise sind die Züge, die sich schließlich zu einem Individuum vereinigen, bereits in der Welt, ehe es dort eintrifft. Die Empfängnis ist bloß der Punkt, an dem sie sich vereinigen. Deswegen sind wir, wenn wir gezeugt werden, den Toten ebenso verpflichtet wie den Lebenden. Ich existierte, allerdings in recht zerstreuter Form, lange bevor ein Dorfgeistlicher meine Stirn mit Weihwasser benetzte und mir einen Namen gab. Es gibt kein fons et origo. Ich habe keinen Anfang.
Sie wünschen eine Geschichte. Sie wünschen eine Chronologie. Aber nichts ist je so einfach. Sehen Sie, einfach nur meine Geschichte zu beginnen, ist mit philosophischen Problemen behaftet. Eines jedoch hebt sich heraus. Eines kann ich mit Sicherheit behaupten. Ich tötete meine Mutter. Andere sehen das natürlich anders, aber ich kann das nur so sehen. Sie starb wenige Minuten, nachdem ich »geboren« wurde. Stellen Sie sich die Szene vor, wenn Sie so freundlich sein wollen. Der Doktor, der die Stiege herunterkommt, mein Vater, der von seinem Stuhl aufspringt, aber plötzlich vom Gesichtsausdruck des Mediziners verwirrt wird. Ist das Kind gesund? Der Arzt nickt. Ja, ein Junge. Ein kräftiger, gesunder Junge. Mein Vater neigt den Kopf. Er weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ihre arme Frau, murmelt der Arzt, ich fürchte, es stand nicht in meiner Macht, sie zu retten. Rasch gewinnt der Arzt seine Autorität wieder zurück. Einige technische Floskeln folgen. Eine Erklärung, die nichts klärt. So sind die Ärzte – Sie sollten das wissen. Er schüttelt meinem Vater die Hand und geht. Mein Vater, schockiert, betäubt, leer, geht die Treppe hinauf und betritt das Schlafzimmer, in dem die Frauen immer noch die blutigen Laken abziehen. Seine Frau ist tot. Eine der Frauen bedeckt das Gesicht der Toten und bekreuzigt sich. Sie sieht meinen Vater an und lächelt, ein barmherziges, trauriges, liebliches Lächeln, das Lächeln, das die Darstellungen der Mutter Gottes ziert, sie deutet auf die Wiege. Ihr Sohn, sagt sie. Mein Vater tritt vor und schaut auf das winzige, bereits in Windeln gewickelte Geschöpf.
Sie werden mir eine Beobachtung gestatten: Ich habe später verstanden, dass die Reaktion meines Vaters auf sein Unglück alles andere als typisch war. Wenn Frauen im Kindbett sterben, ist es häufig so, dass liebende Ehemänner Trost in ihrem Nachkommen finden, weil etwas von der Geliebten in diesem weiterlebt. Mein Vater scheint jedoch in dieser Hinsicht versagt zu haben. Er sah meine Mutter nicht in mir. Mein In-der-Welt-Sein gab ihm nicht das Gefühl, ihr näher zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass ich ihn bloß an ihre Abwesenheit erinnerte, und das machte den Verlust nur noch schmerzlicher.
Ein freudloses Haus also. Voller Enttäuschung. Kalt. Düster. Es wurde geschwiegen, die Uhr tickte. Das ist die Atmosphäre, in der ich aufgewachsen bin.
Eine Fotografie meiner Mutter stand auf dem Kaminsims. Ich kann sie immer noch sehen, wenn ich die Augen schließe, deutlich, in der Dunkelheit leuchtend. Das schnörkelige Rankenmuster des Silberrahmens. Das Edelweiß, die Kerze, die manchmal angezündet wurde (aber meist nicht brannte). Mein Vater hatte die Gewohnheit, von meiner Mutter als einem Engel zu sprechen, und so kam es, dass ich sie mir mit Flügeln vorstellte.
Wenn ich allein im Haus war, schlich ich mich in den Salon, nahm die Fotografie vom Kaminsims und betrachtete ihr Antlitz. Meine Mutter war eine sehr schöne Frau: Goldenes Haar, große Augen und anmutige Züge. Irgendetwas im Hintergrund der Fotografie hielt ich irrtümlich für weiße Federn, die ordentlich hinter ihrem Rücken gefaltet waren. In das Bild meiner Mutter einzutauchen war eine Beschäftigung, der ich heimlich nachging. So musste es sein, denn mein Vater hätte sie nicht gebilligt. Einmal fand er mich und riss mir den Rahmen aus der Hand. Er war wütend und hieß mich, mit solch einem wertvollen Gegenstand vorsichtig umzugehen. Wenn ich ihn fallen ließe, dann würde das Glas kaputtgehen. Er sei unersetzlich, und ich sollte mehr Respekt haben. Ich erinnere mich an den seltsamen Ausdruck seiner Augen. Ich hatte Angst und erwartete eine Strafe. Wenn ich jetzt an diesen Vorfall zurückdenke, würde ich sagen, dass der seltsame Ausdruck meines Vaters eifersüchtig, besitzergreifend war.
Die Frauen des Dorfes bemitleideten mich. Sie brachten mir Suppe und gaben mir an Feiertagen vom Festessen ab. Ich wurde immer dazu aufgefordert, mit ihren Kindern zu spielen. Und wenn ich mit Hans, Gudrun, Dirk oder Gerda spielte, sahen die Frauen zu und lachten. Aber manchmal ertappte ich sie dabei, wie sie Blicke tauschten, und ich sah Tränen des Mitleids. Wenn ich ging, dann stopften sie mir die Taschen mit Plätzchen voll und küssten und umarmten mich. Alle diese Frauen hatten den gleichen, unverwechselbaren Geruch, salzig und süß, eine Mischung aus Schweiß und Konfekt. Ich liebte es, von ihren fülligen, roten Armen umschlossen zu werden, aber es war nie genug. Sie konnten mir meine Mutter nie ersetzen – sie hatten keine Flügel.
Ich ging gern in die Schule. Die anderen Kinder hassten sie, aber für mich war sie eine willkommene Abwechslung von meinem Zuhause und den düsteren Stimmungen meines Vaters. Ich mochte unser kleines Klassenzimmer, die geweißelten Wände, die Tafel, den Kanonenofen. Mein Lieblingsfach war Geschichte, was hauptsächlich auf den lebhaften Unterricht unseres Lehrers, Herr Griesser, zurückzuführen war. Onkelhaft und glatzköpfig, bis auf zwei komische Büschel über den Ohren, Brille, und Dinge gerne wild gestikulierend unterstreichend. Mit der Fingerspitze konnte er einen exotischen Horizont beschreiben, Pyramiden und Stufenpyramiden und uns nach Gizeh und Elam versetzen. Griechische Sagen erwachten mit anschaulichen Beschreibungen der Heldentaten zum Leben. Theseus war für mich ebenso wirklich wie unser Bäcker.
Aber Herr Griesser war nicht nur ein hervorragender Lehrer, er war auch ein begeisterter Amateurarchäologe. Einmal fand er in der Wachau eine prähistorische Axt und schenkte sie dem Naturhistorischen Museum. Sie stellten sie in einer Vitrine aus, und sie ist heute noch im Saal mit den Gegenständen aus der Bronzezeit zu sehen.
Herr Griesser war der Erste, der mir von Mumien erzählte. Ich war vollkommen fasziniert. Als er mir erzählte, dass es Mumien in Wien gebe, echte Mumien, wollte ich sie unbedingt sehen. Ich bat meinen Vater, bettelte darum, dass er mich dorthin mitnehme, aber wie zu erwarten, weigerte er sich.
Mein Interesse an Mumien war für einen Jungen seltsam praktisch. Ich konzentrierte mich auf die Einzelheiten der Konservierung. Die ägyptische Methode der Einbalsamierung wird in der Tat bereits von Herodot beschrieben. Es handelt sich um einen primitiven, aber effektiven Prozess. Nachdem die Eingeweide und das Gehirn entfernt worden sind, wird der Leichnam mit Palmwein abgerieben und mit Gewürzen bestreut. Dann wird er siebzig Tage in eine Salzlösung eingeweicht, gebadet und in Leinenstreifen gewickelt. Schließlich wird der Tote in einen Holzkasten gelegt.
Die Ägypter legten ebenfalls großen Wert auf das Aussehen der Leichen, besonders das der weiblichen Leichen. Die Büste wurde durch Ausstopfen bewahrt, und die Brustwarzen wurden mit Kupferknöpfen nachgebildet. Perücken wurden getragen. Die Leichen wurden mit gelbem Ocker angemalt und die Nägel mit Henna eingefärbt.
Genial.
Aber ich schweife ab.
Diese Tatsachen dürften für Sie kaum von Interesse sein. Sie wollen mehr über mich wissen.
4
Professor Mathias stand am Fußende des Seziertisches und blickte auf die Leiche hinab. Er war ein älterer Herr mit einem müden, freundlichen Gesicht. Sein graues Haar war ungekämmt und seine gesamte Erscheinung etwas unordentlich. Er band die Schürzenbänder hinter seinem Rücken zu einer Schleife und summte dabei Töne, aus denen nie eine Melodie entstand. Seine Totenklage wurde gänzlich unmusikalisch, als er die tiefsten Töne seines Stimmumfangs erreichte. Hier konnte der Professor nur noch ein anhaltendes, rhythmisches Grollen erzeugen. Schließlich gab er die Musik zugunsten des Sprechens auf. »Sie meinen also, dass sie geschändet wurde?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!