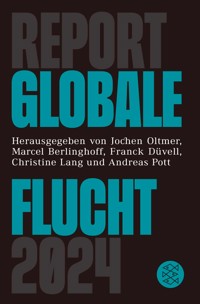
Report Globale Flucht 2024 E-Book
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zum Weltflüchtlingstag 2024: Der jährliche Bericht zu einem der drängendsten Themen unserer Zeit Flucht ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Der »Report Globale Flucht« versammelt forschungsbasiertes Wissen aus unterschiedlichen Perspektiven und verschafft so einen Überblick über zentrale Debatten, aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zum Thema Flucht. Schwerpunkt des Reports 2024 ist die Asylpolitik der Europäischen Union. Herausgegeben von Jochen Oltmer, Marcel Berlinghoff, Franck Düvell, Christine Lang und Andreas Pott im Auftrag des Projekts »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT). Mit Beiträgen von Ludger Pries, Petra Bendel, Carolien Jacobs, Nader Talebi u.v.a.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgegeben von Jochen Oltmer, Marcel Berlinghoff, Franck Düvell, Christine Lang und Andreas Pott
Report Globale Flucht 2024
Im Auftrag des Projekts »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT)
Über dieses Buch
Im »Report Globale Flucht« beleuchten über 30 Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen wichtige Aspekte rund um eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Schwerpunkt des Reports 2024 ist die Asylpolitik der Europäischen Union.
MdEP Tineke Strik ordnet im Gespräch mit Franck Düvell die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ein. Martin Lemberg-Pedersen untersucht die Externalisierungspläne der britischen Tory- und dänischen SD-Regierung. Ilija Trojanow unterhält sich mit Laura Lotte Lemmer über den Exil-Begriff und die aktuelle Migrationsdebatte. Hannes Schammann, Sybille Münch und Thorsten Schlee analysieren die Diskussion um die angebliche Überforderung von Kommunen bei der Aufnahme von Schutzsuchenden. Außerdem berichten Autor:innen über das regionale Fluchtgeschehen in der Ukraine, in der Türkei, im Iran und in der Demokratischen Republik Kongo, u.v.m.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Herausgegeben von Jochen Oltmer, Marcel Berlinghoff, Franck Düvell, Christine Lang und Andreas Pott im Auftrag des Projekts »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT)
Impressum
Das Projekt »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT) wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Die folgenden Institute führen das Projekt durch:
Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC)
Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN, Universität Erlangen-Nürnberg)
German Institute of Development and Sustainability (IDOS, Bonn)
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS, Universität Osnabrück)
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
ISBN 978-3-10-491989-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Literatur
Fokusthema: EU-Flüchtlingspolitik
Petra Bendel – Durchbruch und Desaster: Die jüngste Einigung auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
Prozessualer Durchbruch
Inhaltliche Schieflage
Umsetzung und normative Ausrichtung der künftigen EU-Asylpolitik
Tineke Strik im Gespräch mit Franck Düvell – »Ich befürchte, dass der Pakt das Gegenteil dessen bewirken wird, was er erreichen soll«
Grenzen
Khaled Barakeh – Self Portrait as a Power Structure
Ludger Pries – Erzwungene Migration und die Grenze zwischen Mexiko und den USA
Ursachen für den Anstieg nicht registrierter Grenzüberschreitungen
Erleichterter Grenzübertritt – oder doch nicht?
(Gescheiterte) Versuche einer harten Grenzkontrolle
Lehren für Flüchtlingsschutz und -forschung
Hussein Mohammadi – Unter einem Baum
Die Blätter und der Stacheldraht
Das Meer und die Augen
Der Vogel
Unter einem Baum
Der Weg
Die Abendsonne
Der Mond
Das Boot
Der Wald
Stand des Flüchtlingsschutzes
Martin Lemberg-Pedersen – Externalisierungsbestrebungen europäischer Staaten
Externalisierung, Eindämmung und sichere Wege, um Schutz in der EU zu finden
Fehlende Lehren aus der Externalisierungspolitik außereuropäischer Staaten: Australien und Israel
Argumentative Strategien, die zur Legitimierung einer Externalisierungspolitik entwickelt werden
Externalisierung als recycelter Imperialismus
Olaf Bernau – Niger: Vom Transitland zum EU-Hotspot südlich der Sahara
Antimigrationsgesetz 2015–36
Asylverfahren in Niger
Abschiebungen und freiwillige Rückkehr
Zirkuläre Mobilität statt Abschottung
Benjamin Etzold und Anas Ansar – Geflohene Rohingya in Bangladesch – Wie kann diese langanhaltende Vertreibungskrise gelöst werden?
Die Vertreibung der Rohingya aus Myanmar
Lokale Aufnahme und humanitäre Hilfe unter den Bedingungen langanhaltender Vertreibung
Freiwillige Rückkehr und Rückführung nach Myanmar – unrealistische Erwartungen
Umsiedlungen und eigenständige Weiterreise in andere Länder
Fazit: Denkanstöße zur Lösung der Vertreibungskrise der Rohingya
Yonous Mohammadi im Gespräch mit Franck Düvell – »Mit den schlechten Aufnahmebedingungen drängen die griechischen Behörden die Schutzsuchenden de facto dazu, das Land zu verlassen«
Bernd Kasparek – Pushbacks an Europas Grenzen
Pushbacks als staatliche Grenzgewalt
Die Evros-Grenze
Regionale Pushback-Praktiken
Pushbacks und EU-Grenzverwaltung
Zivilgesellschaftliche Handlungsoptionen
Nachgefragt und nachgelesen
Karin Scherschel im Gespräch mit Andreas Pott und Marcel Berlinghoff – »Wen oder was meinen wir eigentlich, wenn wir von Flucht und Geflüchteten sprechen?«
Literatur
Marcel Berlinghoff – »Boat people klingt harmloser…« Der Artikel »Völkerwanderung des zwanzigsten Jahrhunderts« von Marion Gräfin Dönhoff aus dem Juli 1979 neu gelesen
Fluchtkrise in Südostasien
Eine empathische Darstellung
Biographische Fluchtbezüge Dönhoffs
Absage an vereinfachte Deutungsmuster des Kalten Krieges
Willkommenskultur avant la lettre
Jochen Oltmer – Ein Schutzstatus für »Bürgerkriegsflüchtlinge«? Die (Nicht-)Aufnahme von Geflüchteten aus den postjugoslawischen Kriegen der 1990er Jahre in Deutschland
Postjugoslawische Fluchtverhältnisse
Prekäre Aufnahme in Deutschland
Remigrationspolitik
Ausblick: Postjugoslawische Fluchtverhältnisse und »Massenzustrom-Richtlinie« der EU
Ilija Trojanow im Gespräch mit Laura Lotte Lemmer – »Die meisten Debatten heutzutage haben mit der Realität der Migration nichts zu tun«
Flucht regional
Franck Düvell – Einführung in die Rubrik
Franck Düvell – Ukraine
Die Fluchtverhältnisse Ende 2023
Befristeter Schutz – und wie weiter?
Bleiben oder zurückkehren?
Rückkehr und Wiederaufbau
Schlussfolgerungen
Oxana Matiychuk im Gespräch mit Bettina Bannasch – Pendelbewegungen: Flucht, Engagement und Resilienz angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine
Eray Canlar und Başak Kale – Türkei
Flüchtlinge, Asylsuchende und Personen mit temporärem Schutzstatus in der Türkei
Die Auswirkungen des Erdbebens auf Infrastruktur und Grundbedürfnisse
Erdbebenbedingte Binnenflucht im Osten der Türkei
Vom Erdbeben betroffene Flüchtlinge
Freiwillige und erzwungene Rückkehr von Schutzsuchenden aus der Türkei
Zwangsweise Migration in andere Staaten
Schlussfolgerungen
Nader Talebi und Aryasp Delvarani – Iran
Aufnahme und Diskriminierung von Afghan:innen im Iran
Iran als Transitland und Vorposten Europas
Hoffnung, Revolution und Migration aus dem Iran
Carolien Jacobs – Demokratische Republik Kongo
Hintergründe der Binnenvertreibung in der Demokratischen Republik Kongo
Nationale und internationale Schutzrahmen für Binnenvertriebene
Die mensch(enrecht)liche Seite der Binnenvertreibung in der Demokratischen Republik Kongo
Fazit: Eine Stärkung der lokalen Integration von Binnenvertriebenen
Fluchtziel Bundesrepublik Deutschland
Hannes Schammann, Sybille Münch und Thorsten Schlee – Die Produktion der Überforderung. Die kommunale Aufnahme Schutzsuchender im Jahr 2023
Überforderung bei der Unterbringung Geflüchteter?
Überforderte Ausländerbehörden?
Wer erhält Entlastung?
Tatjana Baraulina und Christian Kothe – Eine nachhaltige Rückkehr: Anspruch und Wirklichkeit
Nachhaltigkeit in der Rückkehrpolitik
Rückkehr und ökonomische Teilhabe
Rückkehr und soziale Zugehörigkeit
Verbleib im Rückkehrland
Fazit: Was bewirkt die Förderung nachhaltiger Rückkehr?
Jörg Dollmann, Jannes Jacobsen und Sabrina J. Mayer – Die Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in Deutschland im Zeitverlauf. Eine längsschnittliche Analyse des DeZIM.panels
Unterstützungsbereitschaft für Geflüchtete im Zeitverlauf
Befürwortung von Sanktionen
Fazit
Das DeZIM.panel als Umfrageinfrastruktur am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung
Nataliya Pryhornytska im Gespräch mit Christine Lang – Die ukrainischstämmige Zivilgesellschaft in Deutschland: Wandel und Herausforderungen
Dominic Sauerbrey – Fluchtchronik 2023/24
Februar 2023
März 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Dezember 2023
Januar 2024
Februar 2024
Die Autor:innen
Vorwort
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts nimmt die Zahl der registrierten Schutzsuchenden weltweit zu. Im Jahr 2001 lag sie noch bei rund 40 Millionen. 2023/24 hat sie die Schwelle von 100 Millionen überschritten. Das bedeutet allerdings nicht, dass Fluchtbewegungen vor einem Vierteljahrhundert weniger Relevanz hatten: In der Vergangenheit sind insbesondere »Binnenvertriebene«, also Schutzsuchende, die innerhalb ihres Herkunftslandes vor Gewalt auswichen, deutlich seltener registriert worden als heute.[1] Außerdem wurden die den Berechnungen zugrunde liegenden Definitionen mehrfach geändert und neue Kategorien entwickelt. Absolute Zahlen über Schutzsuchende lassen sich mithin im globalen Kontext über einen längeren Zeitraum kaum sinnvoll miteinander vergleichen, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Umfang der Weltbevölkerung seit dem Jahr 2000 um rund zwei Milliarden Menschen zugenommen hat.
Obwohl also ein kritischer Blick auf die Bedingungen und Effekte der Produktion fluchtbezogener Daten vonnöten ist, bleibt festzuhalten, dass seit Beginn des Jahrtausends die quantitative Bedeutung von Fluchtbewegungen weltweit angewachsen ist. Der bei weitem größte Anteil der Schutzsuchenden in der Welt gelangt dabei nicht in die Europäische Union (EU) oder nach Deutschland. Jedoch stieg auch hier die Zahl der Asylanträge. Hinzu kommen Millionen schutzsuchende Ukrainer:innen, die kein Asyl beantragen mussten. Vor diesem Hintergrund sorgt das Thema Flucht in Europa weiterhin für außerordentlich große Aufmerksamkeit und prägt politische und öffentliche Debatten.
Im Dezember 2023 haben sich Vertreter:innen des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments auf einen von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf für eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) verständigt. Diesem widmet sich das Fokusthema dieses Bandes.[2] Der Entwurf muss (Stand Januar 2024) allerdings noch vom Rat und vom Parlament verabschiedet werden, anschließend folgen Verhandlungen über die komplexen Durchführungsbestimmungen. Die Reform ist das Ergebnis eines langen Prozesses: Erste Vorschläge lagen bereits 2016 vor, das aktuelle Gesetzespaket folgte 2020 als »Pakt für Migration und Asyl«. Abzuwarten bleibt, ob die geplanten EU-Verordnungen Verfahren vor nationalen Gerichten standhalten und die europäischen Fluchtverhältnisse ändern werden. Ein Kernproblem wird aller Voraussicht nach bleiben, dass die Mitgliedstaaten mehrheitlich weiterhin die verpflichtende Umverteilung von Geflüchteten verweigern.
In diesem Zusammenhang haben verschiedene politische Akteure in Europa Vorschläge eingebracht, um Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU auszulagern und anerkannte Flüchtlinge anschließend entweder in den Drittländern zu belassen oder in der EU aufzunehmen.[3] Eine Aufnahme anerkannter Flüchtlinge funktionierte allerdings bisher nur sehr bedingt, wie etwa das Abkommen zwischen der EU und der Türkei vom März 2016 oder die regelmäßigen Appelle des Flüchtlingshochkommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), anerkannte Flüchtlinge umzusiedeln (»Resettlement«), zeigen.
In der Bundesrepublik führte Anfang 2024 das von Vertreter:innen der Alternative für Deutschland (AfD) und deren rechtsradikalen Verbündeten propagierte, nicht ganz neue politische Konzept einer sogenannten »Remigration« von Migrant:innen und Flüchtlingen zu einer breiten zivilgesellschaftlichen Mobilisierung gegen die extreme Rechte. Die völkisch-nationalistischen Pläne reichen von der Ausweisung von Ausländer:innen bis hin zum Entzug der Staatsbürgerschaft von Deutschen, denen ein Migrationsbezug zugeschrieben wird – eine Praxis, die das Grundgesetz nach Artikel 16, außer unter bestimmten engen Voraussetzungen, gar nicht zulässt. Wesentlich für solche Vorstellungen ist der Gedanke, die Lage von Menschen mit sogenanntem »Migrationshintergrund« neben »hohem Anpassungsdruck« auch mit »maßgeschneiderten Gesetzen«[4] massiv zu verschlechtern, um den Abwanderungsdruck zu erhöhen. Dies weckt Erinnerungen an die antijüdischen Maßnahmen im nationalsozialistischen Deutschland, die darauf abzielten, Jüdinnen und Juden zu marginalisieren und zu vertreiben. Auch den Entzug der Staatsbürgerschaft praktizierte schon der NS-Staat mit dem Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit von 1933 und der Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz von 1941. Im Parteiprogramm der NSDAP von 1920 hieß es bereits, dass »alle Nicht-Deutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden« sollten. Letzteres zielte insbesondere auf die Flüchtlinge des Ersten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die in einer solchen Tradition stehenden rechtspopulistischen und rechtsextremen Konzepte führten dazu, dass der ursprünglich wissenschaftliche Begriff »Remigration« in kürzester Zeit zu einem politischen Kampfbegriff mutierte. So unverdächtig das »Unwort des Jahres« 2023 klingen mag, aus völkisch-nationalistischer Perspektive meint es Vertreibung und Deportation.
Gegenwärtig prägen elf große Kriege und Konflikte die globalen Fluchtverhältnisse: in der Ukraine, in Syrien, in Venezuela, im Südsudan, in Myanmar/Bangladesch, im Sudan, im Gaza-Streifen, in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, in der Zentralafrikanischen Republik und in Eritrea (in der Reihenfolge der Anzahl von Geflüchteten). Die Nichtregierungsorganisation International Crisis Group listet insgesamt nicht weniger als siebzig Krisen und Konflikte sowie dreißig weitere Risikosituationen weltweit auf. Fluchtursachen liegen in aller Regel in Konflikten innerhalb von Staaten begründet, wenn auch oft unter Einmischung anderer Staaten. Zwischenstaatliche Kriege, wie sie aktuell etwa zwischen Russland und der Ukraine oder Aserbaidschan und Armenien zu beobachten sind, bleiben eine Ausnahme.
Die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine[5] und im Gaza-Streifen prägen die Debatten in Europa gegenwärtig besonders. Andere bewaffnete Konflikte mit zum Teil wesentlich mehr Opfern, wie etwa in Syrien[6], im Sudan, in der DR Kongo[7] oder in Venezuela[8], haben demgegenüber weitaus weniger gesellschaftliche Debatten ausgelöst. Auch die Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Fluchtverhältnisse in Afghanistan[9], Äthiopien[10] und Myanmar/Bangladesch[11] trat 2023 in den Hintergrund.
In Hinsicht auf die Wahrnehmung des russischen Angriffs auf die Ukraine verhindert weiterhin das Nachwirken des »Kalten Krieges« und das Denken in Einflusssphären des 19. und 20. Jahrhunderts eine kritische Auseinandersetzung mit Russland als autoritärem Aggressor und als bedeutendem Verursacher globaler Fluchtbewegungen. Erinnert sei etwa an die Besetzung Tschetscheniens und die Zerstörung der Hauptstadt Grosny ab 1999. Selbst die russische Intervention in Syrien seit Herbst 2015, insbesondere die Bombardierung Aleppos durch russische Kampfflugzeuge, die maßgeblich zur verstärkten Flucht nach Europa 2015/16 beitrug, löste in weiten Teilen der Welt ungleich weniger Empörung und Solidarität aus, als die militärische Intervention Israels im Gaza-Streifen in Reaktion auf den Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.
Der aktuelle Konflikt im Gaza-Streifen geht historisch zurück auf den Ersten Weltkrieg – auf die Auflösung des russischen, österreichisch-ungarischen und osmanischen Imperiums. Die nachfolgende Bildung neuer Nationalstaaten hinterließ mit den Worten von Hannah Arendt eine »Nation der Minderheiten und das Volk der Staatenlosen«, wobei sie Staatenlose mit Flüchtlingen gleichsetzte.[12] Zwischen 1880 und 1945 flüchteten aufgrund von Verfolgung, Pogromen und dem Holocaust etwa 600000 Jüdinnen und Juden aus Europa nach Palästina. Dort wurde 1947 der Staat Israel gegründet. Von 1945 bis heute wanderten 1,3 Millionen Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion beziehungsweise Russland nach Israel ein, vor allem aufgrund der Unterdrückung jeglicher jüdischer Kultur.[13] Im selben Zeitraum flohen weitere etwa 850000 Jüdinnen und Juden vor Verfolgung aus verschiedenen arabischen beziehungsweise islamisch geprägten Staaten nach Israel. Dies kam, da kaum mehr Jüdinnen und Juden in muslimisch geprägten Ländern leben, einer weitreichenden Vertreibung gleich. Aufgrund dieser Vorgeschichte gilt Israel manchen Beobachtern als »Staat der Flüchtlinge«.[14] Zugleich ging der Staatsgründungsprozess Israels samt dem arabisch-israelischen Krieg 1948 mit umfangreichen Vertreibungsaktionen einher, in dessen Folge rund 750000 palästinensische Araber:innen vertrieben wurden.
Für die Araber:innen in dieser Region konnten sich in den späten 1940er Jahren die beteiligten Parteien (die arabischen Staaten, die palästinensischen Organisationen und die vormaligen westlichen Kolonialmächte) nicht auf einen eigenen Staat einigen. Palästinenser:innen, wie sie im Sinne der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) seit den 1970er Jahren üblicherweise bezeichnet werden, blieben eine der letzten Gruppen aus der »Schar von Flüchtlingen und Staatenlosen«[15] in der Folge der Auflösung der europäischen Kolonialreiche und des osmanischen Imperiums.[16] Die in diesem historischen Kontext neu entstandenen arabischen Staaten tragen eine Mitverantwortung für die fortdauernde Staatenlosigkeit der geflohenen Palästinenser:innen, denn sie bieten ihnen und ihren Nachfahren bis heute selten dauerhafte Perspektiven, etwa durch Staatsbürgerschaft.
Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und deren Verbrechen an der Zivilbevölkerung flohen zunächst rund eine halbe Million Israelis aus den Grenzgebieten zum Gaza-Streifen und zum Libanon innerhalb des Landes oder wurden evakuiert. Im Zuge des massiven Gegenangriffs zerstörten die israelischen Streitkräfte im Gaza-Streifen großflächig auch zivile Ziele. Bis Anfang 2024 mussten aufgrund der Kampfhandlungen schätzungsweise 1,9 Millionen Palästinenser:innen innerhalb des Gaza-Streifens fliehen. Bis Ende Januar 2024, als dieser Beitrag verfasst wurde, war weder die Versorgung der Flüchtenden noch ein Ausweichen vor den sich ausweitenden Kriegshandlungen möglich. Nichts deutet gegenwärtig darauf hin, dass sich daran absehbar etwas ändern wird. Die Flucht- und Flüchtlingsforschung ist dazu aufgerufen, in den kommenden Monaten und Jahren auch zu dieser Konflikt- und Fluchtkonstellation und ihren Folgen wissenschaftliches Wissen bereitzustellen. Dass sie dabei nicht nur auf großes Leid stößt, sondern zugleich in einem durch konkurrierende Deutungsangebote wie Antisemitismus, Siedlerkolonialismus oder Rassismus maximal aufgeladenen politischen Diskursfeld zu navigieren hat, macht die Herausforderung nicht geringer – eine Herausforderung, die auch die Vorbereitung des nächstjährigen Reports Globale Flucht kennzeichnen dürfte.
Mit diesem bis Januar 2024 entstandenen zweiten Report Globale Flucht versammeln wir zahlreiche namhafte Vertreter:innen von Wissenschaft und Zivilgesellschaft und präsentieren Beiträge zu aktuellen Fragen der globalen Fluchtverhältnisse und Themen der Fluchtforschung. Unsere Autor:innen schauen nicht nur auf das diesjährige Fokusthema der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, sondern auch auf einige der umfangreichsten Fluchtbewegungen weltweit: aus der Ukraine in die EU, aus Zentralamerika in die USA oder aus Myanmar nach Bangladesch. Mehrere Beiträge gelten aktuellen, intensiv diskutierten flüchtlingspolitischen Themen in Deutschland wie der Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kommunen bei der Aufnahme von Schutzsuchenden sowie Maßnahmen zur Rückkehrförderung. Andere Texte blicken bewusst zurück und beschäftigen sich mit der (Nicht-)Aufnahme südostasiatischer »boat people« in der Bundesrepublik Deutschland Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre sowie postjugoslawischer Bürgerkriegsflüchtlinge in den 1990er Jahren. Wie bereits der Report Globale Flucht 2023 verfolgt auch die vorliegende Ausgabe den Anspruch, nur selten beachteten Fluchtsituationen Aufmerksamkeit zu schenken – wie zum Beispiel den Fluchtbewegungen in der Demokratischen Republik Kongo, aber auch der Flucht in den wie aus dem Iran.
Wir danken den Autor:innen sowie dem S. Fischer Verlag, und hier insbesondere unserer Lektorin Luca Homburg, für die reibungslose Kooperation. Laura Lotte Lemmer hat sich dankenswerterweise der Beiträge angenommen, die aus dem Feld der Kultur stammen. Unser Dank gilt außerdem dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das diese Publikation im Rahmen der Förderung des Projekts FFVT ermöglichte.
Literatur
Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 1986.
Correctiv: Geheimplan gegen Deutschland, 2024, https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/
Fransen, Sonja/de Haas, Hein: Trends and Patterns of Global Refugee Migration, in: Population and Development Review, 48. 2022, H. 1, S. 97–128 https://doi.org/10.1111/padr.12456
Fröhlich, Christiane: Syrien, in: Oltmer u.a. (Hg.), Report Globale Flucht 2023, S. 183–190.
Grüner, Frank: Sowjetbürger, Religionsgemeinschaft, nationale Minderheit. Juden und jüdisches Leben in der Sowjetunion, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 71. 2021, H. 16, S. 40–47.
Guevara Gonzáles, Yaatsil: Venezuela, in: Oltmer u.a. (Hg.), Report Globale Flucht 2023, S. 191–197.
Mann, Itamar: Refugees, in: Mafe’akh: Lexical Review of Political Thought, 2011, H. 2, S. 81–112.
Mielke, Katja/Schetter, Conrad: Afghanistan, in: Oltmer u.a. (Hg.), Report Globale Flucht 2023, S. 174–182.
Muhumad, Abdirahman A./Flaig, Merlin/Grävingholt, Jörn: Äthiopien, in: Oltmer u.a. (Hg.), Report Globale Flucht 2023, S. 163–173.
Oltmer, Jochen/Berlinghoff, Marcel/Düvell, Franck/Krause, Ulrike/Pott, Andreas (Hg.): Report Globale Flucht 2023, Frankfurt a.M. 2023.
Fokusthema: EU-Flüchtlingspolitik
Petra Bendel
Durchbruch und Desaster: Die jüngste Einigung auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
Kurz vor Jahresschluss, am 20. Dezember 2023, einigten sich in einem »Jumbo-Trilog« die Unterhändler von Europäischer Kommission, Europäischem Parlament und Rat der Europäischen Union informell auf eine lange ausstehende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems – den von der Kommission bereits im September 2020 initiierten »Neuen Pakt für Migration und Asyl«.[17] Es handelt sich um ein ausgesprochen umfangreiches und komplexes Paket von Gesetzen, die noch formal das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und sodann in den Mitgliedstaaten implementiert werden müssen. Die politischen Reaktionen auf die Einigung lassen sich auf einem rhetorischen Kontinuum abtragen, das von einem »historischen Durchbruch« bis hin zu einem »Desaster« reicht.
Der vorliegende, bewusst normativ gefärbte Beitrag erläutert, warum diese Einigung zwar aus prozessualer Sicht als Durchbruch gelten kann, aber aus flüchtlings- und menschenrechtlicher Sicht auch gefährliche, schlimmstenfalls desaströse Aspekte beinhaltet. Er fragt außerdem, wie sich die künftige Entwicklung der europäischen Asylpolitik mit Blick auf die Umsetzung des Paktes und schließlich auf die normativen Grundlagen europäischer Flüchtlingspolitik einschätzen lässt.
Prozessualer Durchbruch
Bereits ein erstes von der Kommission vorgelegtes, umfassendes Reformvorhaben nach der letzten starken Fluchtmigration, die »Agenda für Migration«[18], war an der Uneinigkeit der Mitgliedstaaten spätestens 2018 gescheitert. Sie hatten sich mit dem Parlament nicht auf einen Ersatz für das seit jeher dysfunktionale, in den Jahren 2015 und 2016 aber kollabierte Dublin-System einigen können. Allzu unterschiedlich blieb die Interessenlage zwischen den diversen Staatengruppen im Innern der Europäischen Union. Hunderttausende Geflüchtete wanderten aus den Grenzstaaten, die dem Dublin-Prinzip zufolge eigentlich für das Asylverfahren zuständig gewesen wären, weiter. Ziele bildeten vor allem Deutschland und Schweden, während sich die Staaten an den Außengrenzen bei der Aufnahme und Durchführung der Verfahren im Stich gelassen fühlten.
Die Positionen der EU-Mitgliedstaaten drifteten in der Folge der Ereignisse von 2015/16 weit über die Fragen auseinander, wie viel europäische Harmonisierung überhaupt nottäte und welche Aufnahmebereitschaft sie jeweils zeigten: Insbesondere eine Gruppe mittel- und osteuropäischer Staaten sah nicht die Notwendigkeit gemeinsamer europäischer Regelungen. Sie wollte das souveränitätslastige Feld von Flucht und Zuwanderung vielmehr national organisieren. Eine wachsende Staatengruppe war nicht bereit, zusätzliche Schutzsuchende aufzunehmen. Die europäischen Standards zur Aufnahme von Schutzsuchenden gerieten damit in einen »Negativwettbewerb«, in dem sich EU-Staaten gegenseitig in möglichst harschen Flüchtlingspolitiken überboten. An den EU-Außengrenzen herrschten menschenrechtswidrige Bedingungen in Aufnahmezentren, für die »Moria«, das völlig überfüllte griechische Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos, geradezu sinnbildlich wurde. Moria brannte schließlich im September 2020 ab, 12000 Menschen waren nun obdachlos.[19] Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot gerieten, wurden in Länder wie Libyen zurückgetrieben, in denen offenkundig menschenrechtswidrige Bedingungen herrschten. Völkerrechtswidrige Pushbacks, die meist von Mitgliedstaaten ausgingen, blieben ungeahndet. Das EU-Asylsystem setzte wenig Anreize, die internationalen und selbstgesetzten Regeln zu befolgen, da die Mitgliedstaaten kaum auf europäische Solidarität bei der Verteilung von Schutzsuchenden zählen konnten. In diesem Schäbigkeitswettbewerb[20] konnten sich die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament lediglich darauf einigen, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Frontex, erneut erheblich auszubauen und die gemeinsame Asylagentur (European Union Agency for Asylum, EUAA) zu verstärken. Auch verlegten sie sich darauf, mit Ländern außerhalb der Europäischen Union zu kooperieren und mit ihnen das Rückkehrsystem für abgelehnte Asylsuchende zu verstärken.
Einzig einmal war es nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Anfang 2022 in einem Akt anfänglicher Solidarität gelungen, EU-weit gemeinsam die Richtlinie zur vorübergehenden Schutzgewährung zu aktivieren, die es schon seit 2001 gibt. Sie erlaubte es, den Geflüchteten aus der Ukraine einen zeitlich befristeten Aufenthaltsstatus und damit auch Zugang zu sozialen Mindeststandards zu gewähren, ohne dass sie ein langwieriges Asylverfahren durchlaufen müssen. Die Richtlinie und ihre Umsetzung in nationales Recht ließ es im Prinzip zu, dieser Personengruppe unbürokratisch Schutz zu gewähren und die Menschen in den Arbeitsmarkt der aufnehmenden Mitgliedstaaten zu integrieren. Nicht einigen konnten sich die Mitgliedstaaten hingegen, Aufnahmekontingente für die ungleich verteilten Ukrainer:innen zu benennen, wie es die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz durchaus erlaubt hätte.[21]
Angesichts dieser Lage hatte die Kommission Ende September 2020 mit dem »Neuen Pakt für Migration und Asyl« einen »frischen Start« in der EU-Asylpolitik vorgelegt, der in den vergangenen drei Jahren immer wieder verhandelt worden war.[22] Die Herkulesaufgabe bestand darin, die über die Migration zerstrittenen Mitgliedstaaten stärker zu einen und zu mehr Solidarität bei der Aufnahme zu bewegen, die Abwärtsspirale des Flüchtlingsschutzes zu stoppen, die Migration in geordnetere Bahnen zu lenken und durch striktere Auflagen zu reduzieren. Ein weiteres Scheitern einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik, so die Annahme, würde den EU-Bürger:innen den Eindruck verschaffen, dass die Regierungen die Kontrolle über die Migrationsbewegungen verloren hätten und zu einer Einigung nicht in der Lage wären. Damit, so die Befürchtung, würden sie zu einem Erstarken der populistischen bis extremen Rechten bei den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 beitragen, was eine Einigung auf ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem vollends obsolet machen würde. Staaten wie Polen und Ungarn sollten mit Hilfe technischer Anreize übergangen beziehungsweise überstimmt werden, denn die Koalition der flüchtlingspolitisch liberaleren Staaten fürchtete, dass die EU-Ratspräsidentschaft Ungarns ab Mitte 2024 erst recht eine Asylreform verunmöglichen würde.
Durch Überstimmen Polens und Ungarns als langjährigen Blockierern im Rat konnten per Mehrheitsentscheid im Juni überraschend die »Asylverfahrensverordnung« und die »Asylmanagement-Verordnung« beziehungsweise im Oktober 2023 die »Krisenverordnung« als Etappenziele erreicht werden. Schließlich einigten sich Rat, Parlament und Kommission im Dezember über das Gesamtpaket der Asylreform, das nur als Ganzes verabschiedet werden sollte. Nach drei Jahren Stop-and-Go war es dem »Jumbo-Trilog« bei dieser letzten Verhandlungsetappe letztlich darum gegangen, überhaupt noch eine Einigung zu erzielen.
Aus der Perspektive der Kommission[23], der Parlamentspräsidentin und der Berichterstatter:innen[24] sowie der spanischen Ratspräsidentschaft[25] war die Einigung am 20. Dezember 2023 daher ein »Erfolg für Europa«, eine »historische Einigung«, ja, ein »historischer Durchbruch«: Er erlaube es, nach den langen, kontroversen Verhandlungen an einer gemeinsamen europäischen Politik festzuhalten, ohne dass die EU in Migrationsfragen auseinanderbräche. Andernfalls hätte aus der Sicht einiger Mitgliedstaaten – so auch der deutschen Bundesregierung, die nach anfänglichem Zögern den Ratskompromissen zustimmte – die Sorge bestanden, jedes Land werde künftig seine eigene Asylpolitik verfolgen. Dies wiederum hätte zu einer Wiedererrichtung von Binnengrenzen und damit zu einem Scheitern des Schengener Abkommens von 1985 führen können.
Bei genauerer Analyse der Äußerungen auf den Pressekonferenzen im Dezember 2023, insbesondere der Rede von Kommissarin Ylva Johansson, zeigt sich: Die Einschätzung, dass es sich hier um einen »Durchbruch« handele, machte sich weniger an den Inhalten (»policies«) fest als vielmehr an der konfliktgeladenen, prozesshaften Dimension der Politik (»politics«). In der Tat: Mitgliedstaaten, deren Tradition im Umgang mit Zuwanderung, deren ideologische Orientierung in den aktuellen Regierungen und deren Verständnis von souveräner oder supranationaler Gestaltung von Migration weit auseinanderlagen, einigten sich auf einen wohl durchaus historisch zu nennenden Kompromiss. Parlament und Rat, deren Positionen in Teilen große Diskrepanzen aufwiesen, näherten sich an und vereinbarten ein gemeinsames Paket von Maßnahmen, das noch der Annahme durch die EU-Gesetzgeber und der Umsetzung in den Mitgliedstaaten harrt.
Inhaltliche Schieflage
Das vereinbarte Paket von Rechtsakten besteht aus folgenden fünf Pfeilern: einer Revision der Verordnung zur Regelung der Asylverfahren[26], des Abgleichs biometrischer Daten (EURODAC)[27], eines Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen[28], eines gemeinsamen Asyl- und Migrationsmanagements[29] sowie einer Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl[30]:
Die Asylverfahrensverordnung führt unter anderem ein gemeinsames, strafferes Verfahren und Standards zum internationalen Schutz ein. Auf der Grundlage der Asylverfahrensverordnung soll zügig festgestellt werden, ob Asylanträge unbegründet oder unzulässig sind. Asylverfahren an der Grenze sollen künftig verpflichtend sein für solche Personen, die als Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung eingestuft werden, die Behörden durch falsche Angaben oder durch Verschweigen von Informationen getäuscht haben oder aus einem Drittstaat mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 % stammen. Ihr Asylverfahren wird dann qua »Fiktion der Nichteinreise«[31] nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, sondern in einer Transitzone beziehungsweise an einem eigenen Standort innerhalb des Mitgliedstaates durchgeführt.
Die Mitgliedstaaten selbst (nicht etwa: unabhängige Stellen) müssen einen Monitoring-Mechanismus zur Einhaltung der Grundrechte im Grenzverfahren einrichten. Darüber hinaus müssen sie adäquate Aufnahme- und Personalkapazitäten aufbauen, eine jährlich festgelegte Zahl an Anträgen im Grenzverfahren durchführen und die Rückkehr jener Personen vollstrecken, die keine Aufnahme erfahren. Auf EU-Ebene wird eine Höchstgrenze von zunächst 30000 Asylanträgen festgelegt, die bearbeitet werden müssen. Diese Kappungsgrenze, die mit Aufbau entsprechender Kapazitäten erhöht werden kann, wird auf die Mitgliedstaaten entsprechend umgerechnet. Reist eine Person aus einem »sicheren Drittstaat« ein, einem Staat, in dem das Leben und die Freiheit des Antragstellers garantiert sind, dann können die Asylprüfbehörden deren Antrag als unzulässig ablehnen.
Auf der Basis der Screening-Verordnung werden verstärkte Personenkontrollen inklusive Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfungen sowie die Registrierung in der Datenbank EURODAC (für die ebenfalls eine revidierte EURODAC-Verordnung beschlossen wurde) unter Einsatz des Fingerabdrucksystems an Außengrenzen während einer Frist von maximal sieben Tagen durchgeführt. Dem Ergebnis entsprechend werden die Personen an der Grenze einem der vorgesehenen Verfahren zugeleitet: Rückkehr ins Herkunftsland oder Einleitung eines Asylverfahrens. Die Verordnung betrifft solche Personen, die beim unbefugten Überschreiten einer Außengrenze auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen, bei Such- und Rettungseinsätzen auf See ausgeschifft wurden, die ohne entsprechende Papiere an Außengrenzübergangsstellen oder in Transitzonen einen Antrag auf internationalen Schutz stellen beziehungsweise im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufgegriffen werden. Die betroffenen Personen dürfen währenddessen nicht einreisen und können unter bestimmten Bedingungen in Haft genommen werden. Auch für die Zeit des Screenings müssen die Mitgliedstaaten einen unabhängigen Mechanismus zur Überwachung der Achtung der Grundrechte einrichten.
Das Dublin-System wird durch die Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement abgelöst. Dennoch müssen weiterhin Schutzsuchende ihren Antrag in der Regel im Mitgliedstaat der ersten Einreise oder des rechtmäßigen Aufenthaltes stellen. Gründe für die Übertragung der Zuständigkeit für einzelne Asylsuchende zwischen Mitgliedstaaten wurden eingeschränkt mit dem Ziel, Sekundärwanderungen zu vermeiden. Zentral ist hier die Errichtung eines »neuen Solidaritätsmechanismus«. Demnach muss nicht jeder Mitgliedstaat selbst Asylsuchende aufnehmen oder aus anderen Staaten übernehmen. Stattdessen ist es möglich, Solidarität durch Finanzbeiträge, auch in Drittländern, zu leisten oder »alternative Solidaritätsmaßnahmen« zu übernehmen, beispielsweise Personal zu entsenden. Dabei entscheiden die Mitgliedstaaten selbst, welche Leistungen sie erbringen. Der Solidaritätsmechanismus soll EU-weit durch einen Koordinator gesteuert werden.
Bei der Krisenverordnung handelt es sich um einen neuen Rechtsakt. Er ermöglicht es den Mitgliedstaaten in sogenannten »Krisenreaktionen«, in sogenannten »Situationen höherer Gewalt« oder in Konstellationen, in denen Migrant:innen »instrumentalisiert« werden, die Registrierung von Asylanträgen oder das Asylverfahren an der Grenze anzupassen: Für die Registrierung von Schutzanträgen läuft dann eine verlängerte Frist von vier Wochen (anstelle von regulär sieben Tagen). Außerdem können die Kriterien für eine Prüfung eines Asylantrags im Grenzverfahren, beispielsweise die entsprechende Anerkennungsquote, angehoben werden (etwa auf einen Schwellenwert von 50 %). Sofern der Rat zustimmt, können betroffene Mitgliedstaaten zugleich auch Solidaritätsbeiträge und Unterstützungsmaßnahmen bei der EU und ihren Mitgliedstaaten anfordern.
Inhaltlich-normativ weist das Paket, wie etliche Parlamentsfraktionen und Abgeordnete, Menschenrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände, Seenotrettungsorganisationen, Flüchtlingsorganisationen und -helfer:innen sowie Anwält:innen und NGOs wiederholt kritisiert haben, eine deutliche Schieflage auf.[32] Diese ordnungspolitische Schlagseite gehe, so die Kritik auch von etlichen (rechts-)wissenschaftlichen, wenngleich unterschiedlich nuancierten Beiträgen[33], auf Kosten der Rechte von Schutzsuchenden in der EU und an ihren Außengrenzen, ja, sie gefährde nach manchen Einschätzungen sogar das individuelle Recht auf Asyl und menschenrechtliche Grundprinzipien der Flüchtlingspolitik.
Die Verfasserin dieses Beitrags schließt sich der Auffassung an, dass die inhaltlichen Ziele (»policies«) der Schutzgewährung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und den EU-eigenen Standards immer stärker gegenüber dem – an sich berechtigten – Anspruch der Mitgliedstaaten auf Kontrolle ihrer (gemeinsamen Außen-)Grenzen und den Souveränitätsansprüchen einiger Mitgliedstaaten ins Hintertreffen geraten sind. Dabei ist durchaus zu konstatieren, dass die Mitgliedstaaten und gerade auch die deutsche Bundesregierung vor einem Dilemma standen: Einerseits wollten sie auf der prozessualen Ebene einem gemeinsamen Verfahren zustimmen und sorgten sich zurecht um das Schengen-Prinzip offener Binnengrenzen. Andererseits ist inhaltlich darauf zu verweisen, dass die Zustimmung zu einer solchen inhaltlichen Verschärfung eine Gefährdung menschenrechtlicher Grundlagen der europäischen Asylpolitik beinhaltet. Diese inhaltliche Einschätzung ergibt sich im Wesentlichen aus drei roten Linien, die aufgrund der bisherigen Einigung überschritten werden könnten:
eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls durch eine Inhaftnahme von Familien mit Kindern ohne Altersgrenze,
mangelnde Verfahrensgarantien im Grenzverfahren, ganz besonders in den Krisenmechanismen, und, damit zusammenhängend, die Ausweitung der Zahl »sicherer Drittstaaten«,
eine mögliche Unterhöhlung des grundlegenden flüchtlingsrechtlichen Prinzips des Non-Refoulements.
Dabei steckt freilich mancher Teufel im Detail der letztlich noch zu fixierenden Regelungen durch die beiden EU-Gesetzgeber und durch die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Im Einzelnen:
Das neue Verfahren an den Außengrenzen führt letztlich dazu, dass Asylverfahren zumindest zeitweise unter haftähnlichen Bedingungen, etwa in Transitzentren, stattfinden müssen. Die meisten Mitgliedstaaten wollten diese Verfahren selbst für Familien mit Kindern durchführen. Das Europäische Parlament hingegen hatte zunächst die Durchführung von Grenzverfahren nur als Ausnahme vorgesehen und verlangt, dass Familien mit Kindern unter 12 Jahren nicht in Haft genommen werden sollten. Das Parlament aber unterlag in den Verhandlungen mit dem Rat, der nach Kompromissvorschlägen der Ratspräsidentschaft letztlich keinerlei Altersbeschränkung für eine Inhaftnahme von Kindern für eine Dauer von sechs bis neun Monaten vorsah. Auch die deutsche Bundesregierung konnte sich im Rat mit ihrem Begehr nicht durchsetzen, Familien mit Kindern unter 18 Jahren aus diesen Verfahren auszunehmen.[34]
Es zeigt sich jedoch, dass bei der letztlichen Einigung im Dezember 2023 die Möglichkeiten zu einer Inhaftnahme selbst von Kindern extrem weit ausgelegt und die Schutzmechanismen für Kinder übergangen wurden. Dieser Einschätzung liegt ein ausführlicher gemeinsamer Bericht des Europarates und der europäischen Agentur für Grundrechte über die Kinderrechte an den Grenzen zugrunde.[35] Gefährdet wird das in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 verankerte Grundprinzip des »Kindeswohls«. Kindern kommen als vulnerablen Personen auch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der EU-Grundrechtecharta zufolge besondere Schutzrechte zu. Diese gelten auch für Flüchtlings-, Asylsuchenden- und Migrantenkinder, wie das EU-Sekundärrecht zur Regelung von Asyl, Rückführung und Inhaftierung von Einwanderern bestimmt.
Wenngleich unter sehr engen Grenzen eine Inhaftnahme von Ausländer:innen nach der EMRK möglich ist, müssen die Staaten jedoch speziell bei Kindern Alternativen zur Inhaftierung gebührend berücksichtigen und entlang der Regeln des Europarates nachweisen, dass es sich um eine Maßnahme des letzten Mittels handelt. Dies schreiben auch Art. 11 Abs. 2 der bisher gültigen Richtlinie über Aufnahmebedingungen und Art. 17 Abs. 1 der Rückführungsrichtlinie fest. Selbst wenn die Inhaftierung rechtmäßig und nicht willkürlich ist, kann sie je nach Kindesalter, Dauer und Unterbringungsform immer noch eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen.
Außerdem fragt sich, wie genau man sich diese haftähnlichen Bedingungen an der Grenze künftig in der Praxis wird vorstellen können – allzu präsent sind noch die Bilder der stets überfüllten »Hotspots« – siehe das Symbol »Moria« – an den Grenzen. Daran wird auch die Festlegung einer Höchstzahl an Plätzen wohl nichts ändern. Ob sich die herrschenden Missstände in zahlreichen Aufnahmeeinrichtungen an den Außengrenzen in der künftigen Praxis hin zu effizienteren Verfahren und menschenrechtskonformen Aufnahmebedingungen werden ändern lassen, bleibt fraglich. »Das Konzept der ›Kappungsgrenze‹ macht dieses Vorhaben noch fragwürdiger, da die Qualität von Grenzverfahren hinter rein quantitativen Zielgrößen zurückstehen könnte«.[36]
Auf breite Kritik stieß auch die Ausweitung solcher beschleunigter Grenzverfahren, die durch eine »Fiktion der Nichteinreise« eine bisher nur unter bestimmten Bedingungen mögliche verkürzte Prüfung des Schutzanspruchs direkt an der Grenze vorsehen.[37] »Künftig – so die Kritik an den Entwürfen – wird die bisherige Ausnahme zur Regel. Einem beachtlichen Anteil der Schutzsuchenden droht das Szenario, unmittelbar an den europäischen Außengrenzen einem Grenzverfahren zugeleitet zu werden, dessen Ergebnis in vielen Fällen die formale Abweisung des Asylantrags als unzulässig sein wird; demgemäß wird die Rückführung in den entsprechenden Drittstaat veranlasst, ohne dass der Asylantrag überhaupt jemals inhaltlich geprüft wurde.«[38] Bei dieser Art von Verfahren stellen sich anschließend auch praktische Fragen eines möglichen Rechtsbehelfs. Dies gilt insbesondere im Falle des Krisenmechanismus dann, wenn außergewöhnlich viele Schutzsuchende an die EU-Außengrenzen kommen oder aber ein Drittstaat Schutzsuchende »instrumentalisiert«. NGOs und einige Fraktionen im Europäischen Parlament befürchten nicht ohne Grund, dass diese Regelung zu mehr rechtswidrigen Pushbacks und einer Unterhöhlung des völkerrechtlichen Refoulement-Verbots führen könnte.
Schließlich, und damit zusammenhängend, soll die Liste sicherer Drittstaaten, in die zurückgewiesen werden darf, ausgeweitet werden. Hier fragt sich, wie die Sicherheit der dorthin Zurückzuweisenden, sprich: die Achtung der Menschenrechte im Drittstaat, garantiert und überwacht werden soll. Damit steht ein Grundprinzip der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention akut auf dem Spiel: Denn das Refoulement-Verbot aus Art. 33 Abs. 1 GFK und Art. 3 EMRK hält dann eine Rückweisung für menschenrechtswidrig, wenn der betreffenden schutzsuchenden Person in dem entsprechenden Staat Verfolgung beziehungsweise unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht. Dies gilt auch dann bereits für die erste Zurückweisung, wenn die Gefahr einer »Kettenabschiebung« in weitere Staaten oder gar in den Verfolgerstaat oder einen anderen unsicheren Staat droht. Zuletzt hatte das Parlament immerhin noch verlangt, dass es bei der Bestimmung eines Staates als »sicher« eine »Verbindung« zwischen der aus der EU abzuschiebenden Person und dem Drittstaat geben müsse.
Umsetzung und normative Ausrichtung der künftigen EU-Asylpolitik
Wie immer wird man auf die finale Fassung der von Parlament und Rat abgestimmten Verordnungen und schließlich auf die Umsetzung warten müssen, die in den kommenden zwei Jahren in den Mitgliedstaaten zu erfolgen hat. Zwar haben wir es überwiegend mit Verordnungen und nicht mehr mit Richtlinien zu tun, die erst noch in nationales Recht hätten überführt werden müssen. Allerdings variieren die Mitgliedstaaten in ihrer Fähigkeit und in ihrem Willen, diese Verordnungen auch zu implementieren. Zuletzt waren wir Zeug:innen eines regelrechten Unterbietungswettbewerbs unter den Mitgliedstaaten, was die Standards in Asylverfahren, bei der Aufnahme und beim Zugang zu Integrationsleistungen angeht. Ob und wie er durch die neuen Einigungen durchbrochen werden kann, ist gegenwärtig in keiner Hinsicht zu erkennen.
Um die Verordnungen umsetzen zu können, müssen außerdem erst noch weitere Migrationspartnerschaften mit möglichen Drittstaaten ausgehandelt werden, welche die rückgewiesenen Personen zurücknehmen sollen. Diese Partnerschaften setzen in der Regel Anreize für Staaten, die ihre eigenen Staatsangehörigen zurücknehmen sollen, wenn sie innerhalb der EU kein Recht auf Schutz erhalten. Allein: Wie will die EU die Einhaltung von Prinzipien »sicherer Drittstaaten« gewährleisten angesichts der Tatsache, dass die in Frage kommenden Staaten es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen. Obschon beispielsweise Libyen längst und hinlänglich schwerste Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen wurden, wird weiterhin mit der libyschen Küstenwache kooperiert. Eine Absichtserklärung der EU mit Tunesien hat Präsident Kais Saied, der mit seinen Äußerungen gegen Migrant:innen sichtlich zu rassistischen Übergriffen in seinem Land beitrug, einseitig eingefroren. Jüngst bemühte sich Kommissionspräsidentin von der Leyen, auch angesichts des Konfliktes zwischen Israel und Palästina, um eine »strategische und umfassende Partnerschaft« mit Ägypten, ebenfalls einem Staat, der kaum als »sicherer Drittstaat« bezeichnet werden kann.
Der erneute Trend zur Verschärfung der Asylpolitik war absehbar und Konsequenz einer langen Reihe von Maßnahmen, die im Zielkonflikt der Migrationspolitik zugunsten von Versicherheitlichung und Externalisierung auf Kosten der Schutzgewährung gingen. Die ab 1999 vereinheitlichte, anfangs eher liberale, an der Prävention von Flucht, einem gemeinsamen Asylrahmen, Rechten von Drittstaatsangehörigen, Antidiskriminierung, Familienzusammenführung, der Zulassung von Arbeitsmigration und Integration ausgerichtete EU-Migrations- und Integrationspolitik hatte bereits seit dem 11. September 2001 mit einer Konzentration auf eher sicherheitspolitische Aspekte auf die Terroranschläge reagiert. Instrumente der Visabeschränkung, Grenzkontrolle und -überwachung waren Maßnahmen, auf die sich die Mitgliedstaaten am ehesten einigen konnten. Spätestens seit der starken Fluchtzuwanderung 2015/16 aber war eine Konzentration auf die normativen Grundlagen der Flüchtlingsfrage perdu.[39] Diese normativen Grundlagen umfassen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention sowie die Grundrechtecharta der EU. Sie verweisen auf die Prinzipien des Verbots unmenschlicher Behandlung und Folter, der Achtung des Privat- und Familienlebens, des völkergewohnheitsrechtlich verfestigten Prinzips der Nichtzurückweisung, des Verbotes, einen Flüchtling aufgrund illegaler Einreise zu bestrafen und das Verbot von Kollektivausweisungen.[40]
Im Dezember 2023 wurde das 75-jährige Bestehen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefeiert. Es war zugleich das Jahr und der Monat einer möglichen Erosion der Menschenrechte an den EU-Außengrenzen.
Literatur
Angenendt, Steffen/Biehler, Nadine/Bossong, Raphael/Kipp, David/Koch, Anne: Endspurt bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für die deutsche und europäische Asylpolitik (SWP-Aktuell 2023/A 55), Berlin 2023.
Bast, Jürgen/von Harbou, Frederick/Wessels, Jana: Human Rights Challenges to European Migration Policy (REMAP, 27.10.2020), Gießen 2020.
Bendel, Petra/Ripoll Servent, Ariadna: Asylum and Refugee Protection: EU Policies in Crisis, in: Ariadna Ripoll Servent/Florian Trauner (Hg.), The Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research, London 2018, S. 59–69.
Bendel, Petra: Contemporary Politics of International Protection in Europe: From Protection to Prevention, in: Agnieszka Weinar/Saskia Bonjour/Lyubov Zhyznomirska (Hg.), The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe, London 2019, S. 293–302.
Bendel, Petra: EU-Flüchtlingspolitik in der Krise. Blockaden, Entscheidungen, Lösungen, Bonn 2017.
Bendel, Petra: Fresh Start or False Start? The New Pact on Migration and Asylum, in: Sergio Carrera/Andrew Geddes (Hg.), The EU Pact on Migration and Asylum in Light of the United Nations Global Compact on Refugees International Experiences on Containment and Mobility and their Impacts on Trust and Rights, Florenz 2021, S. 240–250.
Bendel, Petra: Refugees: »How could we possibly get here?« The European Union is Crossing Human-rights Red Lines with its Common European Asylum System, in: Social Europe, 25.7.2023, https://www.socialeurope.eu/refugees-how-could-we-possibly-get-here
Bendel, Petra: Willkommenskultur 2.0, in: Thomas Mirow (Hg.): Wende in Europa: Ausblick auf eine neue Zeit. Berichte zur Lage der Nation, Hamburg 2022, S. 117–240.
Council of Europe/FRA: Children in Migration: Fundamental Rights at European Borders, 18.12.2023, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2023-children-in-migration-fundamental-rights-at-eu-borders_1.pdf
Council of the EU, Press Release: The Council and the European Parliament reach breakthrough in reform of EU asylum and migration system, 20.12.2024, https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/12/20/the-council-and-the-european-parliament-reach-breakthrough-in-reform-of-eu-asylum-and-migration-system/
Europäische Kommission COM (2020) 209 final: Mitteilung der Kommission, Ein neues Migrations- und Asylpaket, 23.9.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609
Europäische Kommission COM(2020) 611 final: Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0611
Europäische Kommission COM(2020) 610 final: Vorschlag für eine Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement, https://commission.europa.eu/document/e7c88ecd-1104–4094-bffd-25b3ee7c7200_de
Europäische Kommission COM(2020) 612 final: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung des Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62–11ea-b31a-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
Europäische Kommission COM(2020) 613 final: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0613
Europäische Kommission COM(2020) 614 final: Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) XXX/XXX [Verordnung über Asyl-und Migrationsmanagement] und der Verordnung (EU)





























