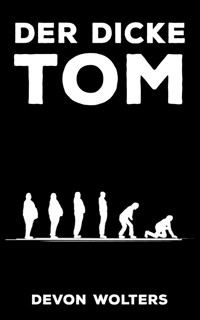3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fünf Geschichten von zwei Stimmen aus der jungen Horrorliteratur. Düstere, surreale Stimmungen mit Themen, die über die klassischen Motive hinausgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Restmensch
Restmensch - InhalttraumhaftEndstationDer AsteroidGoldene ZeitenSieDanksagungCovergestaltungAutorenImpressumRestmensch - Inhalt
traumhaft - Daniel Spieker
Endstation - Devon Wolters
Der Asteroid - Daniel Spieker
Goldene Zeiten - Daniel Spieker
Sie - Devon Wolters
Danksagung
Covergestaltung
Autoren
traumhaft
1
Ich bin da, ichwill nicht da sein, ich mache den ersten Schritt in meine Zukunft.
Der Bahnsteig, die Stadt. Grau in grau. Hinter mir schließt sich die Tür des Zuges, er fährt abund lässt mich allein zurück. In meiner Hand ein winziger Koffer, in meiner Hosentasche ein Schlüssel. Ich vergewissere mich noch einmal, dass er da ist, dann gehe ich zum Informationsschalter.
»Können Sie mir …«
»Ist nicht zu verfehlen – gehen Sie einfach durch die Bahnhofshalle und dann finden Sie Ihren Block; die Nummern sind gut sichtbar.«
Man sieht mir anscheinend an, dass ich Teil des Programms bin. Ich nicke, bedanke mich kurz und gehe zu den automatischen Türen des Bahnhofsgebäudes, die sich lautlos zur Seite schieben, und trete ein. Hier wird nichts verkauft, es gibt nur ein Café, in dem zwar Licht brennt, aber wohl nichts los ist.
Als ich die Bahnhofshalle verlasse, sehe ich schon die Blöcke. Sie sind gigantisch. In jedem Einzelnen sind riesige Nummern eingraviert. Ich schlafe in Block 6 Raum 512 und arbeite in Block 17. So viel weiß ich. Es ist noch unklar, in welchem Raum ich genau arbeiten muss; man wird ihn mir noch zuteilen, hat man mir gesagt.
Ich überquere den leeren Parkplatz und die ebenso leere Straße und steuere direkt auf die riesige 6 zu, die ich in der Ferne schon sehen kann. Der Eingang wird noch einmal mit Pfeilen an den Wänden ausgeschildert und ich erreiche ihn schnell. Er besteht aus zwei breiten Schiebetüren, die sich automatisch öffnen, als ich in ihre Nähe komme – so wie beim Bahnhof. Ein süßlicher Geruch strömt mir entgegen und ich trete ein.
Im Eingangsbereich gibt es einen Aufzug, eine Rezeption, an der eine ältere Frau sitzt und Pfeife raucht, und den Zugang zu einem unscheinbaren Supermarkt.
»Sie sind der Neue, oder?«, fragt die Frau und schaut mich mit einem Ausdruck an, den ich nicht einordnen kann.
»Ja, der bin ich.«
»Fühlen Sie sich willkommen.«
»Danke«, sage ich und erzwinge ein Lächeln. Sie wendet sich wieder einer Zeitschrift zu.
Es gibt keine Treppe, wirklich nur den Aufzug. Scheiße. Ich fahre bis in den fünften Stock, mein Herz hämmert, ich hasse Aufzüge. Allgemein enge Räume.
Im fünften Stock hält der Aufzug mit einem Ping aus einer uralten Lautsprecheranlage. Ich steige aus. Ein endloser Gang aus gleichen Türen mit unterschiedlichen Nummern. Ich suche die Nummer 512 und schiebe den Schlüssel in das Schloss. Eine Sekunde warte ich, das ist jetzt meine Zukunft, dann drehe ich den Schlüssel. Ein Klicken, die Tür schwingt auf, ich gehe hinein, ziehe sie zu und habe für einen Moment Ruhe. Ich schließe die Augen und lehne mich an die Tür, die anscheinend aus Metall besteht – sie ist eiskalt. Langsam öffne ich die Augen wieder. Ein Bett, ein Beistelltisch, ein Tisch mit Fernseher, alles in ein schummriges Abendlicht getaucht, das durch ein schmutziges Fenster dringt. Ich schalte die Lichter an.
Kachelboden, Kachelwände, Kacheldecke. Kaltes Licht. Ich ziehe nach einem Blick nach draußen den Vorhang am Fenster zu, setze mich auf das Bett und rauche. Hier kommt man also hin, wenn man seine Arbeit verliert und keine neue findet. Meine Chance, wie mir die Beraterin erklärt hatte.
Ich drücke die Zigarette im Aschenbecher aus, neben dem eine Broschüre liegt. In ihr ist aufgelistet, was und wie viel ich verdiene, was ich beachten muss und so weiter. Hier wird vor allem mit Wertmarken bezahlt.
Ich überfliege die Broschüre und werfe sie dann in den Mülleimer neben dem Bett. Im Moment will ich das alles gar nicht wissen.
Es ist ja nicht für immer. Ich werde in ein paar Monaten genug Geld haben, um wieder wegzuziehen und, während ich einen neuen Job suche, eine Wohnung anzumieten.
Der ganze Komplex ist im Aufbau und wird vom Staat subventioniert. Sicher gibt es Hunderte, vielleicht sogar Tausende, die hier für ein paar Monate bleiben. Auch wenn ich noch niemanden gesehen habe. Es ist ja nicht für immer. Und es ist eine richtige Chance. Ich kann mir alles genau ausrechnen, wenn ich will. Aber ich will nicht.
Neben dem Raum mit dem Bett (es fühlt sich falsch an dieses Kachelmassaker Schlafzimmer zu nennen), gibt es noch ein winziges Badezimmer mit einem Klo, einem Waschbecken und einer Dusche, dicht an dicht gepresst. Ich schließe die Badezimmertür, setze mich zurück aufs Bett und schalte den Fernseher ein. Ein Horrorfilm läuft, schwarzweiß, irgendwas Uraltes. Ich stelle den Wecker und schlafe irgendwann ein.
Ich weiß, dass ich träume. Ich sehe mich selbst, wie ich am Bettrand sitze und auf den Fernseher starre. Irgendwann stehe ich auf und schlage und trete gegen die Wände. Ich schreie, es gibt keine Tür, nur noch diese Wände. Ich schreie und schlage und ich weiß nicht warum. Ich will mir helfen, aber ich kann nicht.
2
Als ich aufwache, fühle ich mich ausgelaugt. Nachdem ich mich aus dem Bett gequält und mir die Zähne geputzt habe, klingelt der Wecker. Ich schalte ihn aus und stelle mich dann ans Fenster. Die Stadt sieht am Morgen genauso trist aus wie bei meiner Ankunft, aber zumindest dringen ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke.
Der erste Tag.
Ich weiß nicht viel über die Arbeit, nur dass sie wohl in einem Büro erledigt wird. Sie wird sicher nicht besser oder schlechter als jede andere Arbeit sein. Ich ziehe mich an und rauche eine Zigarette am Fenster. Heute Abend werde ich ein paar Bier kaufen, irgendwas um das Ganze zumindest etwas erträglicher zu machen.
Ich fahre mit dem Aufzug nach unten und komme in der Eingangshalle an, in der immer noch die Frau mit der Pfeife sitzt.
»Es wurde sich über Sie beschwert.«
»Warum?«
»Versuchen Sie nicht so laut zu sein. Nicht so wild.«
Ich ziehe meine Augenbrauen zusammen, aber sage nichts, sondern nicke nur knapp, dann gehe ich weiter, am Supermarkteingang vorbei, nach draußen. Nach wenigen Minuten sehe ich Block 17 auch schon in der Ferne. Er sieht aus wie alle anderen. Unten eine blanke Ebene, oben viele winzige Fenster. Als ich den baugleichen Eingang erreiche, gewährt er mir ebenfallsautomatisiert Einlass. Blöcke aus Fertigteilen.
Hier gibt es keinen Supermarkt, aber eine Art Kantine, die jedoch nicht in Betrieb zu sein scheint, der Abschnitt ist aber gleich – außerdem gibt es eine Rezeption. Ich bin kurz darüber verwirrt, dass hier nicht auch die Frau von Block 6 sitzt, sondern ein junger Mann. Vielleicht ist hier ein Bürogebäude nichts anderes als ein Hotel, nur dass man hier eben tagsüber ist. Ich trete an die Rezeption und sage, dass ich neu hier bin.
»Wohnhaft in Block 6?«, gibt der Mann routiniert von sich.
»Ja, das bin ich.«
»Gehen Sie in Raum 198. Ich schicke einen Abteilungsleiter dahin.«
Er sagt das auf eine Art, als leite er alle Abteilungsleiter an und wäre selbst irgendwie der Abteilungsleiter der Abteilungsleiter. Hier gibt es auch nur einen Aufzug, aber ich muss glücklicherweise nur eine Etage nach oben. Um 198 zu erreichen, muss ich zweimal abbiegen. Hinter den Türen scheint kein Betrieb zu sein. Vielleicht später. Die Tür mit der Plakette 198 ist angelehnt und ich trete ein. Ein Mann steht am Fenster, raucht. Er hat schüttere graue Haare und passt nur gerade so in seinen Anzug. Sonst gibt es in dem Raum nur eine Schreibmaschine, einen Aluminiumtisch, einen Aluminiumstuhl. Ein Aschenbecher steht auf dem Tisch. Immerhin.
»Wie finden Sie die Stadt?«
Ich sage nichts.
»Dazu fällt einem nichts mehr ein, stimmt’s?«
Er dreht sich um und reicht mir die Hand. Schwacher Händedruck.
»Also, Ihre Aufgabe ist es, Geschichten zu schreiben, der Ablauf ist hier.« Er zeigt auf ein Blatt.
»Ich bin kein Autor«, sage ich.
»Wir sind alle irgendwie Autoren, oder?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Ein wenig mehr Enthusiasmus! Also, Sie schreiben die Geschichten nach dem Ablauf hier. Eine am Tag. Keine Sorge, Sie müssen nicht perfekt schreiben, nicht einmal eine perfekte Rechtschreibung haben, das wird alles noch redigiert und es sind sowieso nur Automatenromane«, sagt mein neuer Chef.
Ich kenne diese Romane, in jeder Stadt gibt es Automaten, an denen man für wenig Geld ein paar von ihnen ziehen kann. Früher habe ich manchmal einen gelesen, mittlerweile kaum noch.
»Haben Sie noch Fragen?«
»Wie lange arbeite ich?«
»Wenn der Text fertig ist, können Sie gehen. Drücken Sie einfach auf den blauen Knopf am Rand des Tisches. Die Arbeit ist ebenfalls vorbei, wenn das Signal ertönt; falls der Text dann noch nicht fertig ist, wird er auch redigiert, aber fehlende Wörter werden vom Lohn abgezogen.«
»Was mache ich dann mit dem Text?«
»Lassen Sie ihn einfach liegen.« Er schaut auf sein Handgelenk, an dem lose eine einfache Uhr hängt. »Noch etwas? Ich muss weiter. Der Nächste wartet.«
»Nein, nichts.« Er klopft mir auf die Schulter.
»Es freut mich, dass Sie Teil dieses Projektes sind. Wir schreiben die Zukunft.« Dann geht er und ich hoffe, dass wir nicht wirklich die Zukunft schreiben. Mir knurrt der Magen.
Ich setze mich an den Tisch und versuche es mir halbwegs bequem zu machen; dann lese ich mir das Skript durch. Ein Liebesroman auf dem Land. In meinem ganzen Leben habe ich Dörfer nur im Fernsehen gesehen und ich glaube, es hat auch keinen Wert ein Dorf zu besuchen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich noch Dörfer gibt oder nur noch Einöden in denen Tiere und Felder automatisiert zu Produkten verarbeitet werden.
Ich zünde mir noch eine Zigarette an, schreibe den ersten Absatz über Liese, wie sie zum ersten Mal Dietmar trifft und denke an meine letzte Beziehung. Mein Exfreund ist irgendwann abgehauen und hat mein ganzes Bargeld und meinen Schnaps eingesteckt. Die Welt ist schlecht, aber zumindest Liese lässt sich in Kapitel 2 von einem pulsierenden Schwanz durchficken.
Am Ende kriegt sie ein Kind und sie ziehen in die Stadt und lieben sich bis in alle Ewigkeit. Ich schreibe Seite für Seite und merke, dass es tatsächlich nicht so schwierig ist, wie ich dachte. Als ich kurz vorm Ende bin, ertönt der Gong und eine unscheinbare Schublade an der Seite des Schreibtischs schiebt sich auf. Marken. Geld bekomme ich erst nach einem Monat, aber zumindest ein paar Marken für den Tag. Sieben Lebensmittelmarken und drei Freizeitmarken, auch wenn ich nicht weiß, wofür ich diese benutzen kann.
Ich stecke die Marken ein, richte noch einmal den Stapel Blätter und gehe. Die Gänge sind leer – sonst ist niemand mehr hier. Ich habe das Gefühl, als würde ich in einer toten Stadt sinnlose Arbeit verrichten und mir dadurch Reste von Glück zusammenkratzen.
Mit dem Fahrstuhl fahre ich nach unten, verabschiede mich knapp bei dem Mann an der Rezeption und mache mich zurück auf den Weg zu meinem Block. Es ist bewölkt, die Straßenlaternen scheinen alle in einem weißlichen, kalten Licht. Ich fühle mich gleichzeitig einsam und beobachtet und ich kann das Gefühl nicht einordnen. Die große 6 leuchtet matt im Dunkel und weist mir den Weg.
Mittlerweile habe ich wirklich großen Hunger. Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Ich betrete den Eingangsbereich des Blocks und schaue nur kurz zur Rezeption; der Pfeifenqualm beachtet mich gar nicht. Die Frau schläft wohl nie. Ich wende mich zum Supermarkt und finde mich in engen Gängen wieder. Die Verpackungen sind alle minimalistisch gehalten, wahrscheinlich staatliche Eigenproduktion oder Ausschussware anderer Städte. Die Plaketten an den Regalreihen tragen keine Preise. Ich gehe durch die Reihen zu der Kasse und dahinter sitzt ein gelangweilter, junger Mann, der unglaublich glatte Haut hat. Er beobachtet mich mit einem zurückhaltenden Lächeln und ich kann nicht deuten, ob es sexuell oder wachsam gemeint ist.
»Wo sind die Preise?«, frage ich knapp.
»Alles eine Marke«, sagt er mit belegter Stimme.
Ich wende mich ab und beiße mir auf die Lippe. Mein Blick wandert durch die Gänge. Mir fällt schnell auf, dass es keine Nahrungsmittel gibt, die man kochen müsste; meistens sind es abgepackte Fertiggerichte. Ich greife mir irgendeine gebratene Schuhsohle mit Nudeln und noch sechs Bier. Zigaretten habe ich noch. Ich bringe alles zu der Kasse und schiebe dem Mann die Essensmarken zu. Einen Moment lang starre ich auf seine Hände, betrachte die Äderchen, die glatte Haut und kann nicht anders als mir vorzustellen, wie er mir einen runterholt. Dann packt er alles in eine Papiertüte und reicht sie mir. Er erwidert meinen Blick jetzt etwas irritiert. Ich verlasse den Laden und fahre mit dem Aufzug nach oben, zurück zum Zimmer. Im Stehen würge ich das Essen herunter und fühle mich noch viel elender. Zwei Bier später und ich sitze am Bettrand und masturbiere. Danach vernichte ich noch die restlichen Bier und lege mich aufs Bett, starre durch den Zigarettenqualm aus dem Fenster in die graue Wüste. Ich denke über Blumen nach, stelle mir vor, wie vor jedem Fenster ein Bouquet hängt; vielleicht mit Tulpen, rot, grün, blau. Aber dahinter so oder so nur nichtssagende Gestalten mit nichtssagenden Leben. Falls dort wirklich jemand lebt. Ich habe das Gefühl, als wäre diese Stadt nur für mich gemacht worden.
Wo sind die Leute? Kommen sie noch? Sind sie schon weg? Sehe ich die anderen Arbeiter einfach nicht? Ich drehe mich schwerfällig um, drücke die Zigarette im Aschenbecher aus und starre an die Decke. Bekomme ich jeden Tag sieben Essensmarken? Vielleicht sollte ich mir ein paar aufheben, um mich richtig zu betrinken. Oder ich finde in diesem Supermarkt irgendwo Schnaps. Noch eine Zigarette. Fernseher an. Das siebente Siegel läuft.
Ich schalte aus und ziehe die Decke über meinen Kopf, weil ich Angst habe, dass diese Welt da draußen in mich eindringen könnte.
Ich weiß, dass ich träume. Ich sehe mich selbst wie ich vor dem Mann an der Kasse stehe. Ich starre ihn an und er kann sich nicht bewegen. Er scheint wegzuwollen, aber er kann nicht. Langsam gehe ich zu ihm hin und knöpfe seine Kassiereruniform auf, Knopf für Knopf für Knopf für Knopf. Da sind nur seine Augen, die erst erschrocken schauen und je länger ich ihn anstarre den Glanz verlieren. Unter dem Hemd ist ein glatter, trainierter Körper. Ich strecke meine Zunge heraus und lecke ihm langsam über die Brust. Ich sehe, wie seine Augen erst zu mir schauen und dann einfach starr geradeaus.
3
Ich wache von meinem Husten auf. Es ist noch früh, mein Wecker klingelt erst in ein paar Stunden. Ich brauche ein paar Momente, um mich zu orientieren – dann fällt mir alles ein. Ich stehe auf, stelle mich ans Fenster und rauche. Früher habe ich nie geträumt, ab und zu Fetzen, aber mehr nicht. Ich habe nur noch zwei Zigaretten. Ich atme tief ein und aus und schaue in die leeren Straßen in denen die Laternen gerade ausgehen. Meine Mutter hat mich, bevor ich gegangen bin, noch einmal umarmt. Ich hatte ihr am Telefon erzählt, dass ich hierhin gehen würde und sie hatte mich gebeten, dass ich noch einmal zu ihr fahre. Wir haben nicht viel geredet, nur darüber wie wichtig diese Chance wäre, und dann bin ich nach einem Kaffee und einer Umarmung wieder zur Bushaltestelle getrottet. Das war alles gewesen. Ich lasse mich aufs Bett fallen. Ich bin jetzt in meinen besten Jahren und es hätte durchaus schlechter laufen können. Ein, zwei falsche Abbiegungen mehr und ich säße jetzt auf der Straße.
Ich ziehe mich aus und gehe in die Dusche. Fast meine ganze Kleidung, die ich mithatte, ist jetzt schmutzig; ich brauche dringend einen Waschsalon oder ähnliches. Ich dusche eine knappe Stunde. Als ich das Wasser abdrehe, starre ich auf die Fliesen und sehe zu wie die Tropfen langsam nach unten fließen. Ich brauche irgendeine Beschäftigung, ein Hobby oder sowas. Der Tag kommt mir sehr lang vor.
Es ist ja nicht für immer.
Ich ziehe mich an, auch wenn es viel zu früh ist, packe den Rest meiner Kleidung in den Koffer und fahre mit dem Aufzug nach unten. Als ich auf die Rezeption zusteuere, sitzt dort wieder die Frau und schaut mich mit einem Blick an, den ich nicht einordnen kann.
»Guten Mor…«
»Sie machen sich unbeliebt.« Sie sagt das langsam und betont jedes einzelne Wort.
»Was …«
Sie wendet sich wieder ihren Zeitschriften zu. Ich verlasse die Rezeption und betrete die Straße. Niemand ist zu sehen. Es ist noch viel zu früh, um zur Arbeit zu gehen, aber ich werde die Zeit bis dahin nutzen, um einen Waschsalon zu suchen. Hoffentlich eignen sich die Freizeitmarken dafür. Ich orientiere mich erst einmal an Block 17 und gehe dann daran vorbei, Block 23, 24, 29, 31. Und irgendwann ein fast leerer Platz, abgegrenzt durch einzelne dünne Linien am Boden, weiße einfache Linien. Auf dem Platz steht eine einzelne Bank. Ich stelle den Koffer daneben, setze mich und sehe mich um. Um mich herum sind die Blöcke 41, 47, 48 und 50. Ich rauche meine vorletzte Zigarette und starre in den gräulichen Himmel. Es sollte regnen, aber es regnet nicht.
Was hat die Frau an der Rezeption gemeint? Ich schnipse die Zigarette achtlos auf den Platz. Ich will hier weg. Es ist, als würden die riesigen Nummern in mich hineinscheinen, sich in mich einbrennen wollen.
»Hallo.« Neben mir ist eine ältere Frau aufgetaucht.
»Hallo«, wiederhole ich.
»Hast du noch eine Zigarette?« Eine habe ich noch. Ich gebe sie ihr.
»Danke.« Sie zündet sich die Zigarette an. Ich wende meinen Blick ab und fixiere die 47 vor mir.
»Warum bist du hier?«
Ich zucke mit den Schultern.
»Warum du?« Ich drehe mich zu ihr.
»Mord.« Sie sagt das ohne Übertreibung in der Stimme.
»Ich habe niemanden umgebracht«, entgegne ich.
Sie nickt und lächelt.
»Das ist gut … Wie lange bist du schon hier?«
»Ein paar Tage.«
»Ich bin schon so lange hier … und ich habe diesen Platz hier erst vor einigen Wochen gefunden. Seitdem komme ich jeden Tag. Und du findest ihn direkt.«
»Er war nicht wirklich schwer zu finden.«
»Für dich vielleicht nicht.« Sie schaut lange ins Leere. »Manchmal glaube ich, dass es … dass das hier der letzte Ort ist. Das ist der Endpunkt. Da draußen gibt es nichts mehr.«
Sie nimmt meine Hand, ich lasse es zu.
Als ich aufstehe, ist sie eingeschlafen. Ich muss zur Arbeit, es wird Zeit. Ich hebe den Koffer vom Boden auf. Einen Augenblick schaue ich sie noch an, aber dann gehe ich los. Die nächsten Tage muss ich wieder herkommen und mit ihr reden. Zumindest bin ich hier nicht mehr allein, das reicht schon für ein Gefühl von Sicherheit. Ich bin nicht der Einzige.
Als die große 17 in Sichtweite rückt, werde ich langsamer. Ich habe noch einen Moment Zeit und ich will ihn nicht aufgeben. Dann gehe ich weiter und bereue es keine Zigaretten mehr zu haben. Die automatischen Türen schieben sich zur Seite. Der Mann an der Rezeption sieht mich abschätzig an, als ich in den Aufzug steige. Vielleicht soll man keine Taschen mitnehmen. Vielleicht wird hier geklaut. Aber warum sollte man die Texte mitnehmen? Für wen soll man schreiben, wenn es niemand liest?
Als ich oben in meinem Raum ankomme, ist niemand da; nur eine Geschichte, die geschrieben werden muss. Es ist diesmal keine Liebesgeschichte, sondern eine Geschichte über einen jungen Mann, der mit einer Firma in Kontakt tritt, die sein Leben verbessern will. Es fällt diesmal schwerer zu schreiben, es ist, als würden die Tasten einen langsameren Anschlag haben. Seite um Seite füllt sich der Stapel und ich merke, dass mir die Zeit langsam ausgeht. Vielleicht beende ich die Geschichte etwas gehetzt, aber keine Minute nachdem ich die letzte Seite weggelegt habe, ertönt der Gong. Hätte ich direkt auf den Knopf drücken sollen? Hätte mir das irgendwas gebracht? Die Seite des Tisches wird aufgeschoben und ich greife mir die Marken. Irgendwie hatte ich gehofft, den Mann vom letzten Tag wiederzutreffen, allein um ihn zu fragen, wo man seine Sachen waschen kann. Ich stecke die Marken in die Hosentasche, richte die Papiere und schließe hinter mir leise die Tür. Ich horche ein paar Sekunden lang. Aus den anderen Räumen kommen seltsame Töne, aber ich kann sie nicht kategorisieren. Ich gehe zu der nächsten Tür und presse mein Ohr an das Metall. Mein Herz klopft schneller – ich habe Angst, dass jeden Augenblick jemand die Tür öffnen könnte. Irgendetwas oder irgendjemand flüstert darin. Ich verstehe nur ein einziges Wort: Schuld.
Ich löse mich von dem Material, fahre mit dem Aufzug nach unten und mache mich auf den Heimweg. Das eiskalte Straßenlaternenlicht scheint jetzt noch viel stärker zu sein. Ich fühle mich wie auf einem Operationstisch. Am Himmel suche ich den Mond, aber es ist wohl zu bewölkt, um ihn zu sehen. Ich erreiche die 6 und gehe direkt in den Supermarkt, ohne die Frau an der Rezeption anzusehen. Waschmittel fällt wohl auch unter Essensmarken, Zigaretten ebenfalls, dann noch drei Bier und abgepackte Nudeln, die silbrig im Kunstlicht glänzen. Dann gehe ich zur Kasse, um zu fragen, ob es hier stärkeren Alkohol gibt. Der Kassierer schaut mich nur entsetzt an.
Ich frage nochmal: »Gibt es irgendwas Starkes hier? Schnaps?« Er sagt nichts, sondern schaut weg und scannt einfach die Artikel ab.
»Kannst du mir mal antworten?«, sage ich jetzt etwas lauter. Er schaut mich an und eine Träne läuft ihm über die Wange. Es tut mir plötzlich leid, lauter geworden zu sein, aber ich weiß nicht, was ich tun soll.
»Sorry«, sage ich knapp und lege sechs Essensmarken auf den Tisch. Ich schaue ihn nicht an, weiß nicht, ob er überhaupt darauf reagiert. Er packt alles in eine Papiertüte und ich verlasse den Laden. Die Frau an der Rezeption schaut mich nicht an, sondern blättert in irgendwelchen Lifestylemagazinen. Ich nehme den Aufzug und fahre nach oben. In der Spiegelung des Metalls des Aufzugs sehe ich verzerrt aus, wie ein Monster. Was habe ich getan?
Zurück im Zimmer wische ich die Gedanken zur Seite und fange an, meine Wäsche zu sammeln und behelfsmäßig in der Dusche zu waschen. Meine Mutter hat das früher auch immer mit der Hand gemacht und ihre Hände waren nach kurzer Zeit aufgerissen und entzündet gewesen. Vielleicht sollte ich mir morgen Handschuhe besorgen. Ich hänge die Sachen überall im Zimmer auf, wo es möglich ist. Vielleicht gibt es gar keinen Waschsalon, vielleicht ist das eben so. Irgendwie fehlt mir die Lust noch einmal jemanden zu fragen. Höchstens die Frau bei den Bänken. Ich stelle die Biere neben das Bett und lasse mir die Szene noch einmal durch den Kopf gehen. Warum hat sie meine Hand genommen? Es war nichts Sexuelles, nicht einmal besonders liebevoll, einfach nur einen Moment nicht allein sein. Ich will mir nicht vorstellen, wie lange sie schon allein ist. Hoffentlich ist es bald vorbei.
Es tut gut am Fenster Zigaretten zu rauchen. Während ich im Supermarkt war, hat es angefangen zu regnen. Immer wieder treffen einzelne Tropfen meine Hände. So schlimm ist es eigentlich nicht. Ich schnipse die Zigarette aus dem Fenster und hoffe, dass die Straße Feuer fängt. Nichts passiert. Die Nudeln schmecken nach Pappe. Auch wenn das Essen sicher keinen Preis gewinnt, ist es sehr nahrhaft. Ich trinke noch ein Bier, lege mich dann ins Bett und schlafe ein.
Ich weiß, dass ich träume.Ich sehe mich, wie ich in dem Arbeitsraum stehe. Draußen brennt es, alle Blöcke brennen, nur hier hat sich das Feuer noch nicht hin verirrt. Ich schließe das Fenster, um das Feuer auszuschließen. Da ist der Tisch und die Schreibmaschine. Der Gong ertönt und ich nehme die Schreibmaschine und werfe sie gegen die Wand, immer und immer wieder. Die Tasten lösen sich als das Gehäuse splittert, aber ich höre nicht auf. Jedes einzelne Teil wird auseinandergerissen, verbogen, zerstört. Irgendwann fange ich an, die Buchstaben zu ordnen und es sind immer wieder dieselben, ein H, ein U, ein S, ein L, ein C, ein D. Immer wieder, obwohl ich weiß, dass es nicht möglich ist. Ist das der Grund, warum ich wütend bin? Irgendwann bin ich fertig und es brennt nicht mehr. Ich sehe mich, wie ich weine und die Tränen auf den Boden fallen und ihn zersetzen und dann falle ich, dort wo ich mir selbst den Boden unter den Füßen weggeweint habe.
Der Gong wird lauter und lauter und lauter.
4
Ich schlage auf dem Boden auf, bleibe noch einige Zeit neben meinem Bett liegen und versuche mich zu sammeln. Dann mache ich den Wecker aus und greife mir die trockensten Klamotten, die ich habe. Alle sind noch leicht feucht, aber was anderes habe ich nicht. Jetzt wünsche ich mir, dass ich früher aufgestanden wäre, um noch zu den Bänken zu gehen, aber ich weiß ja nicht einmal, ob ich dort wirklich jemanden angetroffen hätte. Ich dusche nicht, gehe zum Aufzug und als sich die Metalltüren aufschieben, beeile ich mich die Eingangshalle zu verlassen, ohne die Frau an der Rezeption sehen zu müssen. Auf der Straße ist es trocken – vom gestrigen Regen keine Spur mehr. Als ich in die Straße einbiege, in der auch Block 17 steht, sehe ich die Frau in der Ferne. Ich winke ihr, sie scheint es auch zu sehen, aber sie dreht sich um und geht. Ich stehe wie angewurzelt da. Hätte ich sie wecken sollen, als ich gegangen bin?
Mit einem mulmigen Gefühl betrete ich Block 17 und der Junge an der Rezeption zieht die Augenbrauen hoch, als er mich sieht. Ich versuche es nicht weiter zu beachten und gehe den gewohnten Weg bis zu meinem Arbeitszimmer. Diesmal wartet der Mann vom ersten Tag wieder dort und sitzt auf meinem Stuhl. Ich schließe die Tür hinter mir und er sieht mich lange an. Irgendwann sagt er: »So geht das nicht. Schlagen Sie sich solche Gedanken aus dem Kopf.«
»Was wollen …«
»Gehen Sie an die Arbeit und trödeln Sie nicht. Sie kriegen erst einmal weniger Marken, vielleicht denken Sie dann über sich und Ihr Verhalten nach.« Er steht auf und verlässt den Raum. Perplex öffne ich das Fenster und rauche erst einmal. Nach ein paar Minuten höre ich ein Auto. Ich sehe meinen Abteilungsleiter dort klein am Boden, wie er am Straßenrand anscheinend auf den Wagen wartet. Er scheint ein paar Worte mit jemandem im Wagen zu wechseln und dann fährt das Auto langsam weiter. Schwarz, glanzlos. Als es um die Ecke gebogen ist, ist es wieder ganz still und ich setze mich an meinen Tisch. Haben sie über mich gesprochen? Ich versuche nicht mehr darüber nachzudenken und wende mich der Arbeit zu.
Das Blatt beschreibt diesmal eine Geschichte, die eigentlich nur ein Monolog ist. Anscheinend jemand, der hoch depressiv ist. Ich verstehe den Sinn und Zweck nicht, aber es kann mir egal sein. Hauptsache ich komme bald hier raus. Diesmal geht es schnell, auch wenn mich das Gespräch immer noch aufwühlt. Ich habe eine seltsame Ahnung, nur eine Ahnung, noch keinen konkreten Gedanken. Es dauert nicht lange, bis der Monolog fertig ist. Er ist nicht lang, aber ich weiß nicht, was ich noch schreiben soll. Ich lege ihn auf den Stapel und drücke den Knopf. Weniger Marken. Vier Essensmarken und eine Freizeitmarke. Zum Glück habe ich gestern nicht so viel getrunken. Ich ordne den Stapel diesmal nicht. Es scheint mir nicht wichtig zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas wirklich publiziert wird.
Ich weiß, dass ich wegmuss. So dürfte das nicht laufen. Willkürsysteme. Ich weiß nicht, wie ich mich wehren soll. Ich verlasse das Zimmer, fahre nach unten, gehe zum Supermarkt und halte meinen Aufenthalt so kurz wie möglich. Zwei Packungen Nudeln und zwei Packungen Zigaretten, einfach nur, um zumindest morgen nicht dort auftauchen zu müssen.
Ich wechsele kein Wort mit dem Verkäufer und gehe so schnell wie möglich durch den Eingangsbereich zum Fahrstuhl. Ich muss hier weg.
Im Zimmer denke ich daran, dass es doch nicht so schlimm ist, aber mir wird klar, dass ich keine Chance hier habe. Morgen werde ich mit dem Zug zurückfahren. Das wird alles zu viel. Alles ist falsch – nicht immer offensichtlich, aber …
Mittlerweile ist mir egal, ob ich auf der Straße lande, zumindest ist es besser als dieser Kontrollverlust. Eine Zeit lang kann ich sicher bei meiner Mutter leben – vielleicht finde ich doch noch Arbeit. Mittlerweile wäre ich für alles bereit, Hauptsache raus aus diesem Käfig. Ich starre hinaus auf die Straße und sehe wieder dieses schwarze Auto, das ganz langsam durch die Gegend fährt. Das Ticket hierhin hat damals einen Hunderter gekostet, zurück wird es nicht mehr kosten, da bin ich mir sicher. Ich gehe zu meiner Tasche und suche das Geld, das ich mitgenommen habe. 30. 70 brauche ich also. Meine Mutter wird mir das Geld zumindest leihen, wenn ich sie darum bitte.
Aus meinem Koffer hole ich einen Block und einen Stift, womit ich ab und zu zeichne, und fange an, einen Brief an meine Mutter zu schreiben. Wohl fühle ich mich dabei nicht, aber ich versuche die Gefühle zu ignorieren. Sie wird das verstehen. Ich versuche ihr die Gegend und meine Lage zu erklären, aber merke immer mehr, wie falsch es klingt. So redet kein normaler Mensch. Ich kürze es auf ein Minimum ab und bitte sie einfach um das Geld. Sie wird mir helfen – ein allerletztes Mal. Ich falte das Blatt und gehe wieder nach unten. Ich möchte nicht an die Rezeption, aber ich muss, weil ich keine Ahnung habe, wie ich sonst einen Brief wegschicken könnte. An der Rezeption sitzt wieder die Frau und ich gehe langsam zu ihr hin.
»Hallo … ähm …«
»Ja?«, fragt sie und blickt genervt von dem Magazin auf.
»Brief, wie … wie verschicke ich einen Brief?«
»Geben Sie ihn mir und sagen Sie mir den Namen und Adresse.« Einen Augenblick lang überlege ich, ob ich ihr den Brief wirklich geben sollte, aber ich weiß, dass ich keine andere Option habe. Zögerlich reiche ich ihr den Brief; sie reißt ihn mir aus der Hand und faltet ihn auf.
»Das ist privat, Sie …« Sie blickt von dem Text auf und schaut mich mit kalten Augen an.
»Soll ich ihn verschicken oder soll er im Müll landen?«
Ich sage nichts.
»An Ihre Mutter. Oh, schlimm ist es hier also. Ah ja …« Sie zieht scharf Luft ein. »Und Sie sind sich sicher, dass ich das so abschicken soll? Kariertes Papier …«
»Ja – nur – wie schickt meine Mutter mir einen Brief zurück?«
»Das ist das geringste Ihrer Probleme.«
»Ich brauche das …«
»Es interessiert mich nicht. Ich kümmer mich um den Brief.« Sie faltet das Papier wieder zusammen und legt es auf ihren Tisch. Dann schlägt sie ihr Lifestylemagazin wieder auf.
»Wann …« Sie blickt wieder von der Zeitschrift auf.
»Wissen Sie, ich kann Ihnen dafür auch sehr viele Marken berechnen – wahrscheinlich mehr als Sie haben. Ich kümmer mich drum.«
»Ich will einfach nur, dass der Brief bald ankommt, damit …«
»Sie verschwinden können? Ich kümmere mich drum. Und wenn Sie noch ein Wort sagen, verschwindet dieser Brief irgendwo in meinen Unterlagen. Einfach so.«
Ich habe Angst, dass der Brief nie sein Ziel finden wird, aber ich muss ihr vertrauen.
»Danke – gute Nacht.«
»Machen Sie keinen Ärger mehr. Die Leute sehen Sie.«
Eine Gänsehaut überkommt mich, als ich den Tresen verlasse und zum Aufzug zurückkehre. Bevor ich auf den Knopf drücken kann, merke ich wie mein Herz seine Schlagrate mehr als verdoppelt. Ich schwitze, ich habe das Gefühl, dass jeden Moment jemand zu mir kommen und mich holen wird. Schnell drücke ich auf den Knopf und zum ersten Mal seit Jahren bin ich dankbar allein in einem kleinen Raum zu sein. Als der Aufzug ankommt, traue ich mich kaum hinauszugehen. Ich bleibe in der Tür stehen, höre hin. Auch hier sind seltsame Geräusche, die ich nicht einordnen kann. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Morgen werde ich noch einmal nachfragen, ob ich noch auf einem anderen Weg einen Brief versenden kann. Vielleicht wird der Abteilungsleiter da sein und zumindest kurz normal mit mir reden. Eilig gehe ich in mein Zimmer.
Lustlos stochere ich in den Nudeln herum und trinke ein paar Bier. Es beginnt zu regnen, diesmal stürmt es heftig. Der Regen trommelt gegen das Fenster, als ob er dringend Einlass haben will.
Nicht mehr lang. Nur noch ein paar Tage. Ich rauche ein paar Zigaretten, während ich vom Bettrand ins Nichts starre. Viel wollte ich gar nicht. Eine richtige Chance. Eine Chance, dass ich mich hocharbeiten kann. Dass ich irgendwann eine richtige Wohnung haben kann. Ab und an irgendeinen Typen treffen, ab und an etwas trinken gehen. Genug Geld um anständig leben zu können. Und das wird möglich sein – nur nicht hier. Ein Häuschen in einem Dorf. So wie in der Geschichte. Wo die Welt noch in Ordnung ist. Wo mich alle in Ruhe lassen. Ich denke wieder an den Typen aus dem Supermarkt und weiß nicht, warum er so eine Angst vor mir hat. Hat er gemerkt, wie ich ihn angesehen habe? Ist er so konservativ, dass er …? Ich weiß es nicht. Es wäre schön jetzt jemanden hier zu haben. Einfach nur um seine oder ihre Hand zu halten. Ich wünsche mir die Frau von den Bänken zurück. Irgendwen einfach. Ich lege mich aufs Bett und fange an zu weinen. Was habe ich getan?