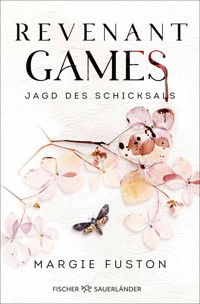12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Revenant-Games-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein gnadenloser Wettkampf. Sie will ihre Schwester zurück. Er will den Tod. In Blys Welt bestimmen Hexen und Vampire über Leben und Tod. Bly schlägt sich nur mithilfe ihres Bluts durch, von dem beide Gruppen abhängen. Doch nach einem Schicksalsschlag verliert Bly nicht nur ihre Schwester, sondern auch ihren besten Freund (und heimliche große Liebe) Emerson, der nur noch ein Jahr zu leben hat. Es sei denn, Bly tritt bei den Revenant Games an: ein tödlicher Wettkampf zwischen Vampiren und Hexen, bei dem der Gewinner eine Tote wieder zum Leben erwecken oder einen Menschen in einen Vampir verwandeln darf. Bly will um jeden Preis siegen. Doch sie hat nicht mit dem Vampir Kerrigan gerechnet, mit seinen unberechenbaren Absichten oder seiner unheimlichen Anziehungskraft … Band 1 der unwiderstehlichen Slow-Burn-Fantasy für alle Leser*innen von Hunger Games«, »Wicca Creed« und »Crush«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Margie Fuston
Revenant Games
Spiel auf Leben und Tod
Über dieses Buch
Ein gnadenloser Wettkampf. Sie will ihre Schwester zurück. Er will den Tod.
In Blys Welt bestimmen Hexen und Vampire über Leben und Tod. Bly schlägt sich nur mithilfe ihres Bluts durch, von dem beide Gruppen abhängen. Doch nach einem Schicksalsschlag verliert Bly nicht nur ihre Schwester, sondern auch ihren besten Freund (und heimliche große Liebe) Emerson, der nur noch ein Jahr zu leben hat. Es sei denn, Bly tritt bei den Revenant Games an: ein tödlicher Wettkampf zwischen Vampiren und Hexen, bei dem der Gewinner eine Tote wieder zum Leben erwecken oder einen Menschen in einen Vampir verwandeln darf. Bly will um jeden Preis siegen. Doch sie hat nicht mit dem Vampir Kerrigan gerechnet, mit seinen unberechenbaren Absichten oder seiner unheimlichen Anziehungskraft …
Band 1 der unwiderstehlichen Slow-Burn-Fantasy für alle Leser*innen von »Hunger Games«, »Wicca Creed« und »Crush«.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Margie Fuston ist in Kalifornien aufgewachsen. Sie studierte BWL und Englische Literatur und Kreatives Schreiben. Heute lebt sie wieder in den Wäldern Kaliforniens, streitet sich täglich mit ihren Katzen und hilft ihren Neffen dabei, Geistern und Meerjungfrauen hinterherzujagen.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Revenant Games« bei Margaret K. McElderry Books, einem Imprint der Simon & Schuster Children's Publishing Division, New York. Published by Arrangement with Margaret K. McElderry Books.
Text © 2024 by Margie Fuston
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2024 Fischer Sauerländer GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Lektorat: Svenja Kopfmann
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Grafikdesign & Illustration, unter Verwendung mehrerer Motiven von Shutterstock
Covergestaltung: Birgit Gitschier Grafikdesign & Illustration
Coverabbildung: Birgit Gitschier unter Verwendung mehrerer Motiven von Shutterstock
ISBN 978-3-7336-0640-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
DANKSAGUNG
Für meine Schwestern Jenny und Stacie – ich würde es mit einem Vampir aufnehmen, um euch zu retten.
EINS
Der Hunger trieb die meisten Menschen früher oder später an den Waldrand. Auch Bly spürte ihn, doch bei ihr war es nicht das Knurren eines leeren Magens, das sie ruhelos machte. Es waren ihre Träume, die ihr Fernweh anheizten. Sie glühten in ihrem Bauch, und manchmal glaubte sie, dass sie sie von innen heraus in Asche verwandeln würden, wenn sie nicht wenigstens versuchte, sie wahr werden zu lassen.
Sie stand oft dort und starrte auf die Stelle, an der die Bäume dicht und undurchdringlich wurden. Was sich dahinter verbarg, hatte sie sich häufig genug ausgemalt. Es war Zeit, herauszufinden, was sich wirklich jenseits des Walds versteckte.
Bly erstarrte, als sie hinter sich das Schmatzen von Schuhen im Schlamm hörte. Nur eine Person wusste von ihrem Plan. Sie drehte sich um und lächelte Elise an. Ihre Schwester schob sich eine sonnengebleichte Strähne hinters Ohr, die sich aus ihrem praktischen blonden Zopf gelöst hatte und auf ihre runden Wangen herabhing. Sie runzelte die Stirn, und um ihre rehbraunen Augen bildeten sich sorgenvolle Fältchen.
»Ich wusste, dass du kommen würdest«, sagte Bly.
Elise biss sich auf die Lippe und blickte über die Schulter zum Dorf zurück. Rauch stieg von den Schornsteinen in den fahlen Himmel auf.
Sehnsucht und ein Hauch von Reue zeichneten sich auf dem Gesicht ihrer Schwester ab. Bestimmt stellte sie sich gerade vor, sie würde vor dem Kamin sitzen und eine Scheibe von dem ofenwarmen Brot essen, das sie in aller Frühe gebacken hatte, würde an ihrem Pfefferminztee nippen und sich auf ihren Arbeitstag mit Vater oder Mutter vorbereiten.
Bly starrte auf die Holzhäuser, die sich im Dorf aneinanderreihten, und wünschte, sie würde das Gleiche empfinden wie ihre Schwester. Das hätte vieles einfacher gemacht. Aber alles, was sie sah, wenn sie ihre Heimat betrachtete, war eine Kälte, die in der Lunge brannte, und schlammige Wege, die niemals trockneten.
Bly verspürte nur dann Sehnsucht, wenn sie sich zu dem dichten Labyrinth aus Eichen und Kiefern umwandte, das sich vor ihr erstreckte. Sicher, dieser Wald war gefährlich. Ihre Familie und sie lebten in einer Menschenansiedlung im Ödland, eingezwängt zwischen der von Vampiren beherrschten Stadt Vagaris und dem von Hexen regierten Havenwhile. Vampire und Hexen waren sich in den meisten Dingen uneins, aber eine Regel berücksichtigten beide Völker: Solange die Menschen im Ödland blieben, hatten sie nichts von ihnen zu befürchten.
Im Wald galt diese Regel nicht.
Bly war nicht so dumm, aus Langeweile nach Gefahr zu lechzen. Sie sehnte sich nach dem, was auf sie wartete, wenn sie ihr trotzte, und war mutig genug, es zu versuchen.
Elise verstand das nicht.
Wie konnten ihre Schwester und sie sich so nahestehen und doch so unterschiedlich sein?
Elise würde Bly niemals durch den Wald an jenen fernen, sagenumwobenen Ort folgen, der angeblich dahinter lag, und Bly würde es niemals ertragen, hier im Ödland zu bleiben. Sie würden beide das Herz der jeweils anderen brechen müssen, um sich vollständig zu fühlen, doch vorerst war Elise noch an ihrer Seite, und Bly war dankbar dafür.
»Verrätst du mir wenigstens, warum wir auf Plündertour gehen?« Elise warf einen Blick auf Blys dicke Wollhose, die an den Knien bereits mehrmals geflickt war. »Brauchst du Geld für neue Kleidung? Ist dir kalt? Wir könnten diese Woche ein paar Mahlzeiten auslassen und so etwas zusammensparen. Ich frage Mutter, wenn du willst.«
Mutter sagte nie Nein zu Elise. Dennoch bat Blys Schwester sie nur selten um etwas. Sie selbst trug einen Rock, dessen ursprünglicher Stoff auf halber Wadenhöhe endete. Statt einen neuen zu verlangen, nähte sie unten einfach immer wieder neue Stoffstreifen in Grün- oder Brauntönen an und schaffte es irgendwie, dass das Ganze gewollt und hübsch aussah, wie anmutige Volants. Elises Fähigkeit, aus dem, was ihr zur Verfügung stand, etwas Reizvolles zu kreieren, war erstaunlich, aber Bly beneidete sie dennoch nicht darum.
Sie wollte keine Mahlzeiten auslassen, um sich neue, praktische Kleidung leisten zu können. Bly wollte mehr: Sie wollte einen vollen Magen, Röcke in vielen verschiedenen Farben und Schleifen für ihre Haare.
Sie wollte alles.
Elise nicht. Sie war zufrieden mit dem, was sie besaß. Bevor Bly das Haus verlassen hatte, hatte sie sich einen Vortrag von ihr darüber anhören müssen, dass sie doch alles hätten, was sie bräuchten – der Ausflug in den Wald stelle ein völlig unnötiges Risiko dar. Genau aus diesem Grund hatte Bly ihrer Schwester nicht verraten, warum sie nach Essbarem stöbern wollte, das sich auf dem Markt verkaufen ließ.
Sie wusste, dass ihre Schwester sie auch so begleiten würde. Bly wollte gerade den ersten Schritt in den Wald tun, als Elise sie beim Arm packte.
»Du könntest stattdessen Blut verkaufen. Das ist sicherer.«
Blut war das Wertvollste, was die Menschen im Ödland besaßen. Die Vampire brauchten es zum Überleben und die Hexen für ihre Magie.
Aber Bly stellten sich allein beim Gedanken daran, von einer Nadel gepikt zu werden und dabei zusehen zu müssen, wie die rote Flüssigkeit aus ihrem Körper strömte, die Nackenhaare auf. »Ich hasse Blut! Das weißt du doch.«
»Dann verkaufe ich eben meins.«
»Nein«, sagte Bly.
Sie hatte vorhergesehen, dass Elise ihr dieses Angebot unterbreiten würde, doch es wäre der falsche erste Schritt in ihr neues Leben gewesen. Wenn sie nicht mutig genug war, einen Tag im Wald zu verbringen, wie wollte sie dann eines Tages diesen Wald durchqueren, um nie wieder zurückzukehren?
Von ihrer Flucht aus dem Ödland träumte sie schon seit vielen Jahren. Elise und sie trafen sich seit frühester Kindheit mit ihrem gemeinsamen Freund Emerson am Waldrand, wagten sich manchmal sogar ein Stück hinein, jedoch nur bis zu einer Stelle, von der aus sie das Dorf noch sehen konnten. Vampire und Hexen ließen Menschen, die am äußersten Rand des Waldes blieben, normalerweise in Ruhe.
Während Elise und Bly immer auf die Kiefern geklettert waren, war Emerson unten geblieben und hatte Wache gehalten. Elise hatte Kiefernnadeln gesammelt, auf denen sie herumkauen konnten, wenn der Hunger übermächtig wurde, und Bly hatte auf dem höchstmöglichen Ast gekauert und über die Bäume gespäht. Es kursierten Geschichten über Menschen, die weit weg lebten, jenseits des großen, dichten Walds, der sich zwischen Havenwhile und Vagaris erstreckte. Diese Menschen bewirtschafteten angeblich ihren eigenen Grund und Boden und führten ein selbstbestimmtes Leben, anders als die Bewohner des Ödlands. Man raunte sich zu, diese Menschen hätten Baumhäuser errichtet und würden sich erfolgreich vor jenen verstecken, die sie jagten. Bly gefiel der Gedanke, so dicht am Himmel zu wohnen und nur von Ästen und Blättern umgeben zu sein.
Vor einigen Jahren war sie zu schwer geworden für ihren Lieblingsast. Er war zerbrochen, während sie ihren Tagträumen nachhing, als könnte er die Last ihrer vielen Wünsche nicht mehr tragen. Bly war in die Tiefe gestürzt und hatte sich auf dem Weg nach unten einige Schrammen zugezogen, aber der Aufprall auf den Boden war ausgeblieben.
Emerson hatte unter dem Baum gestanden und sie aufgefangen, und von diesem Moment an hatte sie begonnen, ihn mit anderen Augen zu betrachten.
Jede Träumerin brauchte jemanden, der mit beiden Beinen fest auf der Erde stand und sie auffing, wenn sie sich zu hoch hinauswagte. Bly allein würde es vermutlich nicht weit bringen, doch zusammen mit dem praktisch veranlagten Emerson konnte sie es schaffen, den Ödland hinter sich zu lassen, davon war sie überzeugt. Und nicht nur das – sie würden sich erfolgreich ein neues Leben aufbauen.
Blys Träume verließen die Welt der halb garen Gedanken und kapriziösen Fantasievorstellungen und richteten sich auf etwas, das tatsächlich im Bereich des Möglichen lag. Es würde ein einfaches Leben werden, das sie jenseits des Walds führen würden, und genau das wollte sie. Sie hatte immer schon die Hexen beneidet mit ihren Obstgärten und Äckern, und ihr gefiel die Idee, jeden Tag Erde zwischen ihren Fingern und die Sonne auf ihrem Nacken zu spüren. Bly würde auf die Apfelbäume klettern und die Früchte ernten, die sie essen und mit anderen teilen würden, und Emerson würde unterdessen als Schreiner arbeiten, was ihm mehr zusagte als die Schmiedearbeiten, die hier im Ödland sein Tagwerk waren. Er würde hübsche Tische zimmern, die sie bei anderen Menschen, die in ihrer Nähe lebten, gegen Kleider eintauschen konnten, Kleider, die so farbenfroh sein würden wie das Obst, das Bly anbaute. Wenn die Sonne abends tief am Himmel stand und sie von der Ernte nach Hause kam, würde Emerson schon auf sie warten. Er würde den Dreck von ihren Wangen wischen und sich knurrend darüber beschweren, nur um sie dennoch zu küssen. Sie würden gemeinsam das Abendessen zubereiten, und es würde sich nicht wie Arbeit anfühlen, weil Bly die Nahrungsmittel mit ihren eigenen Händen erzeugt hatte, wovon der Sonnenbrand auf ihrer Haut zeugte.
So etwas war eine Heimat, nicht dieses elende, schmutzige Dorf.
Das Problem war nur, dass Emerson sie nie so ansah wie sie ihn. Vielleicht war Bly schon zu lange mit ihm befreundet. Sie war sich sicher, dass ihm ein einziger Moment genügen würde – so wie bei ihr, als er sie aufgefangen hatte –, um sie mit anderen Augen zu betrachten und sich mit ihr eine Zukunft herbeizusehnen. Es war daher der erste, wichtigste Teil ihres Plans, dafür zu sorgen, dass Emerson sie auf ihrer Flucht begleitete.
Zitternd vor freudiger Erregung und auch ein wenig vor Angst verließ Bly nun den vertrauten Waldrand und spürte das weiche Knistern frisch gefallener Blätter unter ihren Füßen. Sie drehte sich nicht um, um sich zu vergewissern, dass Elise ihr folgte, aber in einigem Abstand vernahm sie deren zaghafte Schritte.
Eine Weile gingen sie schweigend dahin, schlängelten sich durch die Bäume, die das Sonnenlicht abschirmten und die Kälte noch intensiver machten. Selbst eine halbe Stunde vom Ödland entfernt war der Wald noch kahl und geplündert: Eicheln und Kiefernzapfen waren vom Boden aufgelesen, Kiefernnadeln von den niedrigeren Ästen entfernt, die Baumrinde abgeschält, um Tee oder Arzneien daraus zu kochen. So würde es noch einige Meilen weitergehen. Sie mussten tiefer hinein in den Wald.
Und sie mussten sich entscheiden, ob sie Richtung Havenwhile oder Vagaris gehen wollten. Je näher man Havenwhile kam, desto üppiger wuchsen die Pilze, und vor den Toren von Vagaris wucherten Beeren im Überfluss. Natürlich gab es – wie bei allem – einen Haken: In der Nähe der Vampirstadt machten die Blutsauger Jagd auf Menschen, schnappten sich ihre Opfer und tranken sie leer, bis sie das Bewusstsein verloren. Manche wachten wieder auf, andere nicht. Und die Hexenpilze waren mitunter verzaubert, versetzten die Menschen, die sie pflückten, in tiefen Schlaf, damit die Hexen ihnen Blut abzapfen konnten.
Bly wägte die Risiken ab und nahm Kurs auf Havenwhile. Sie wollte keinen Vampirbiss riskieren – lieber sollten die Hexen ihr Blut stehlen, während sie bewusstlos war und nichts davon mitbekam.
Elise packte zum zweiten Mal ihren Arm, und diesmal gruben sich ihre Finger ein wenig zu tief in ihr Fleisch. »Es ist noch nicht zu spät, um umzukehren!«
Als Antwort riss Bly sich los.
»Sag mir wenigstens, wozu du das Geld brauchst«, bat Elise.
Hier im Wald, wo lediglich die Bäume Zeugen waren, sprudelten die Worte nur so aus Bly heraus: »Ich brauche ein schönes Kleid, das ich auf dem Markt gesehen habe.«
Elise sah sie ungläubig an. »Was?« Sie beugte sich zu Bly vor, als hätte sie nicht richtig gehört.
Wenn Elise nicht den ganzen Plan kannte, klang das mit dem Kleid natürlich albern. Schließlich war es nur die erste Stufe, die alle anderen in Gang setzen sollte.
»Ich will fort von hier«, fügte Bly hinzu. »Für immer.«
Elise wirkte nicht überrascht, eher resigniert, als hätte sie diesen Moment bereits in Gedanken durchgespielt und wüsste, dass sie ihre Schwester nicht aufhalten konnte. Bly sprach schon von einer anderen Welt, seit sie alt genug war, sich Dinge vorzustellen, die nicht direkt vor ihrer Nase waren.
Elise blieb lange stumm. Als sie schließlich das Wort ergriff, verriet ihr Gesicht eiserne Entschlossenheit. »Dann müssen wir anfangen, bei jeder Mahlzeit etwas zur Seite zu legen, Äpfel zu trocknen und für Dörrfleisch zu sparen. Wärmere Kleider brauchst du auch. Wir werden Blut verkaufen müssen, sonst bekommst du nie genug Vorräte zusammen.«
Erleichterung durchströmte Bly, und auch ein leiser Schmerz mischte sich darunter. Elise kannte sie zu gut, um sie zum Bleiben überreden zu wollen. Das machte es gleichzeitig leichter und schwerer.
»Warte mal.« Elise unterbrach ihre Aufzählung der nötigen Gegenstände. »Wozu willst du ein Kleid? Eine neue Wollhose, die du unter einem Rock anziehen könntest, wäre besser.«
Blys Wangen brannten in der kalten Brise, die in diesem Moment aufkam und ihr durch die Locken strich. »Ich will Emerson bitten, mit mir zu kommen.«
Elise öffnete überrascht den Mund. »Unseren Emerson?«
Alles in Bly sträubte sich gegen dieses unser. Natürlich waren sie alle drei befreundet, aber Bly und Emerson waren sich zuerst begegnet, am Rand ebendieses Walds, wo Bly herumgestreift war und Emerson Stöcke gesammelt hatte, aus denen er schmale Messer schnitzen konnte. Anfangs hatte sie ihn nur aus der Ferne beobachtet und sich ausgemalt, er würde mächtige Schwerter fertigen. Sie hatte von Schlachten und Helden geträumt und ihn in ihre erfundenen Geschichten eingebaut. Beide waren sie bevorzugt zu dem Waldabschnitt gegangen, in dem die Äste der Eichen am weitesten über die kahlen Felder hinauswuchsen. Emerson hatte Bly zunächst nicht bemerkt, bis sie irgendwann den Mut aufgebracht hatte, ihn zu fragen, wozu er all die Messer brauchte.
»Zum Üben«, hatte er geantwortet. Sein Vater sei Klingenschmied, er selbst jedoch noch nicht alt genug, um in der Schmiede mitzuarbeiten, also trainiere er, indem er Miniaturschwerter schnitze.
Die Geschichten, die Bly sich über ihn ausgedacht hatte, waren spannender, und als sie ihm davon erzählte, lachte er herzhaft über all die törichten Abenteuer, die ihrer Fantasie entsprungen waren. Damals hatte er noch häufiger gelacht als heute. Trotzdem war sie jedes Mal überrascht gewesen von seiner rückhaltlosen, lauten Heiterkeit, weil er sonst häufig so ernst aussah.
Insgeheim hatte Bly immer an ihrer ursprünglichen Fantasiegeschichte festgehalten, in der Emerson der Held einer von ihr geschaffenen Welt war.
Sie waren bereits eine ganze Weile miteinander befreundet gewesen, als Elise hinzustieß, die ein Jahr jünger war als ihre Schwester und nur selten das Dorf verließ. Bly hingegen schlich sich jeden Tag in aller Frühe aus dem Haus, bevor ihre Eltern ihr Aufgaben übertragen konnten, während Elise daheimblieb, um zu backen und zu kochen. Sie beschwerte sich nie, brachte Bly sogar manchmal eine aufgewärmte Scheibe Brot mit Dörrfleisch an den Dorfrand, damit ihre Schwester nicht zum Mittagessen nach Hause kommen musste. Bly war ihr sehr dankbar, denn so konnte ihre Mutter, eine Heilerin, sie nicht zu irgendwelchen verletzten Patienten mitnehmen, deren Wunden sie nähen musste. Ihr wurde übel, wenn sie Blut sah, im Gegensatz zu Elise, die die Arbeit ihrer Mutter liebte und diese nur allzu gern begleitete. Sie hatte Bly sogar gestanden, dass es ihr wie Magie vorkam, Menschen zu heilen. Als Emerson Bly einmal zum Dorfrand begleitete, damit sie ihren Proviant abholen konnte, brachte Elise am nächsten Tag auch ihm eine Kleinigkeit mit, und wiederum einen Tag später nahm sie ihr eigenes Mittagessen mit hinaus und aß es mit Bly und Emerson am Waldrand. Bly fand es schön, ihre Freiheit mit ihrer Schwester teilen zu können, zu erleben, dass auch Elise Gefallen daran fand, wie sie ihre Tage verbrachte.
Gleichzeitig fiel es ihr schwer, auch noch Emerson mit Elise teilen zu müssen, denn ihre Schwester nahm schon ihre Eltern auf eine Weise ein, die Bly verwehrt blieb. Sie assistierte ihrem Vater, einem Gerber, der in der Vampirstadt arbeitete, genauso erfolgreich wie ihrer Mutter, wohingegen sich Bly bei beiden Tätigkeiten der Magen umdrehte. Beim Abendessen stritten ihre Eltern jedes Mal darum, wer Elise am nächsten Tag mitnehmen dürfe. Wer leer ausging, musste mit Bly vorliebnehmen oder allein arbeiten. Manchmal sahen die Eltern sie an, als wünschten sie, sie wäre eine zweite Elise und nicht das fantasievolle Mädchen, das ständig nach Unerreichbarem strebte. Einmal hatte Bly mit angehört, wie sie darüber diskutierten, was sie mit ihr anstellen sollten. Ihre Hoffnung war, dass sie eines Tages einen Mann mit einer guten Arbeit heiratete, denn dann wäre sie dessen Problem und nicht mehr ihrs. Dabei wäre Bly so gern die Lösung für jemanden gewesen, nicht das Problem. Aber das ging nicht in dieser engen, eingeschränkten Welt.
»Ich will, dass er mein Emerson wird«, sagte Bly nun zu Elise. »Ich dachte, das wüsstest du.« Obwohl sie diese Worte noch nie ausgesprochen hatte, war sie überzeugt davon, dass ihre Schwester Bescheid wusste. Nur Emerson schien nie etwas von ihren Gefühlen zu bemerken.
Elise taumelte nach hinten. Sie schluckte und sah sich im Wald um, als hätte er sich plötzlich verändert, als wüsste sie nicht mehr, wo sie war.
»Ich dachte … Also … Irgendwie kam mir Emerson nie wie jemand vor, der von hier fortgehen würde. Ich hatte keine Ahnung, dass er das vorhat«, stammelte sie. Dann verstummte sie, und ihr Blick huschte überallhin, nur nicht zu Bly. Als sie weitersprach, war ihre Stimme fest und entschlossen. »Ich freue mich, wenn er mit dir geht. Dann bist du nicht allein auf deiner gefährlichen Reise, und ich fühle mich zumindest ein bisschen besser.«
»Na ja, ich habe ihn noch nicht gefragt«, gestand Bly. Die Zweifel, die daraufhin auf Elises Gesicht erschienen, ärgerten sie. Ihre Schwester glaubte offenbar nicht, dass Emerson Ja sagen würde. »Genau deshalb brauche ich das Kleid«, fuhr sie fort. »Er soll mehr in mir sehen als nur seine Kindheitsfreundin.«
Als sie gestern das saphirblaue Kleid auf dem Markt entdeckt hatte, war sie fasziniert näher getreten und hatte über das seidene Mieder und den samtenen Rock gestrichen. Ein solches Kleid würde auf den schlammigen Wegen ihres Dorfs innerhalb weniger Minuten ruiniert sein, aber darüber hatte sie nicht nachgedacht. Sie hatte sich vorgestellt, sie würde es auf dem hölzernen Plateau eines Baumhauses tragen, während ihre Füße herunterbaumelten und sie Seite an Seite mit Emerson einen feurig roten Sonnenuntergang bewunderte. Der leuchtend blaue Stoff würde den perfekten Kontrast zum Abendrot bilden, und wenn Emerson sie darin sah – mit einer passenden Schleife, die ihre wilden dunkelbraunen Locken bändigte –, würde er nicht mehr das kleine Mädchen mit Blättern in den Haaren vor sich sehen. Er würde die junge Frau sehen, die sie inzwischen war, würde in der Lage sein, sich eine Zukunft mit ihr vorzustellen.
Doch Elise wirkte traurig, schien das Kleid nicht als den verheißungsvollen Beginn eines neuen Lebens wahrzunehmen. Bly selbst erschien es hochromantisch, wenn eine junge Frau sich hübsch machte, bevor sie einen Mann fragte, ob er mit ihr durchbrennen wollte. Sie hätte wissen müssen, dass Elise sie nicht verstehen würde. Nicht einmal im morgendlichen Wald, der vor Magie zu funkeln schien.
Bly seufzte. »Können wir bitte einfach weitergehen?«
Elise sah lange in die Richtung, aus der sie gekommen waren, bevor sie tief Luft holte und nickte. Sie setzten sich wieder in Bewegung, nahmen Kurs auf Havenwhile.
»Warte«, bat Elise schon nach wenigen Schritten. »Warum gehen wir nicht Richtung Vagaris?«
Bly fuhr verärgert zu ihr herum. »Weil ich lieber ein paar Stunden schlafe, als gebissen zu werden.«
»Nicht alle Vampire sind böse«, sagte Elise und starrte auf ihre Finger hinab. »Ich war schon öfter mit Vater in Vagaris. Die schlimmsten Vampire schicken sie zu uns auf die Märkte, damit wir denken, es wären alle so. Dabei gibt es auch viele … nette Vampire in Vagaris.«
Bly schüttelte den Kopf. »Lass das bloß nicht Emerson hören.«
Emersons Schwester hatte vor einigen Jahren in diesem Wald nach Essbarem gesucht und war nicht mehr lebend zurückgekehrt. Man hatte sie tot in den Beerensträuchern gefunden, die Kleider rot vom Saft der zerdrückten Früchte, der Hals rot vor Blut. Emerson war damals zwölf gewesen und hatte seither sein ansteckendes Lachen eingebüßt. Im Grunde war Bly noch immer auf der Suche nach dem Jungen, der er früher gewesen war. Sie bezweifelte, dass sie ihn wiederfinden würde, solange sie im Ödland lebten.
»Ich meine ja nur, dass wir uns vielleicht herausreden könnten, wenn uns Vampire beim Beerenpflücken erwischen. Schließlich kenne ich ein paar von ihnen«, argumentierte Elise. »Sie würden uns sicher laufen lassen.«
»Du klingst, als würdest du diese Blutsauger für deine Freunde halten.«
Elise schüttelte den Kopf und wich dem Blick ihrer Schwester aus. Bly konnte nicht einschätzen, ob sie abstritt, mit den Vampiren befreundet zu sein, oder sich über ihren Vampirhass ärgerte. Schließlich seufzte sie und ging an Bly vorbei auf Havenwhile zu, nicht ohne einen letzten Blick über die Schulter Richtung Vagaris zu werfen.
Die Vampire waren für sie die vertrautere Gefahr, und der Mensch entschied sich immer für die Angst, die er bereits kannte.
Bestimmt steckt nicht mehr dahinter, dachte Bly.
Sie wanderten schweigend dahin, während die Bäume um sie herum immer dichter wurden. Dann öffnete sich vor ihnen plötzlich eine Lichtung, und grelles Weiß funkelte ihnen entgegen.
»Schnee?« Elise blieb stehen und kniff die Augen zusammen.
»Nein.« Bly grinste und beschleunigte ihre Schritte, wobei sie die Sorge auf dem Gesicht ihrer Schwester geflissentlich ignorierte.
Am Rand der kleinen Lichtung, auf der das Gras wild um moosbedeckte Steine und schneeweiße, üppig aus dem Boden sprießende Pilze wucherte, schloss Elise zu ihr auf.
»Wunderschön«, hauchte Bly, während Elise zur gleichen Zeit murmelte: »Voller Gift.«
Bly lachte. »Wie es sich für schöne Dinge gehört.«
Elise machte ein angewidertes Gesicht, und Bly bückte sich und hob zwei lange Stöcke vom Waldboden auf. »Wenn wir vorsichtig sind, haben wir nichts zu befürchten.«
Wie jeder im Ödland wusste, wies die Unterseite der Hexenpilze schwache blaue Linien auf, wenn sie mit einem Fluch belegt waren. Sie mussten sie daher nur mithilfe der Stöcke umdrehen und sich vergewissern, dass sie weiß und ungefährlich waren. Fanden sie keine blauen Adern, konnten sie die Pilze unbesorgt anfassen.
Bly stupste das erste Exemplar um und freute sich über die saubere Unterseite. Elise holte scharf Luft, als ihre Schwester die Finger um den Stiel schloss. Bly grinste zu ihr nach oben und genoss das Gefühl der Pilzoberfläche auf ihrer Haut. Sie fühlte sich samtig weich an, zart wie eine Wolke. Fast schon magisch. Bly warf ihre Beute in das Säckchen, das sie an der Taille trug.
Elise sah ihr nervös bei der Arbeit zu. »Noch kein Fluch bisher«, sagte Bly. »Es würde schneller gehen, wenn du mir helfen würdest.«
Ihre Schwester biss sich zögernd auf die Lippe, ging dann jedoch in die Knie, um mit ihrem Stock zaghaft einen Pilz umzustoßen. Sie starrte ihn eine Ewigkeit an, bevor sie ihren Rock anhob und den Pilz mit spitzen Fingern hineinwarf.
Wenn sie beide so viele Pilze sammelten, wie sie konnten, würde Bly damit vielleicht genug Geld auf dem Markt verdienen, um sich das Kleid und einige Vorräte kaufen zu können.
Es dauerte nicht lange, bis sich Blys Beutel um seinen Inhalt spannte. Sie wollte sich gerade umdrehen und Elise mitteilen, dass es Zeit sei, nach Hause zu gehen, als sie den dumpfen Schlag hörte.
Auch ihr Herz führte einen dumpfen letzten Schlag aus und schien dann stehen zu bleiben. Bly atmete weiter, also musste auch ihr Herz weiterklopfen, aber sie spürte es nicht mehr.
»Elise?«, flüsterte sie.
Stille. Ihr Herz meldete sich zurück, raste viel zu schnell und hämmerte in ihren Ohren. Es wusste bereits, was Bly nicht wahrhaben wollte.
Langsam drehte sie sich um.
Elise lag auf der Seite, das goldblonde Haar auf dem Boden verteilt, die braunen Augen offen und leer. Sie sah nicht aus, als würde sie schlafen. Wie konnte das Leben nur so schnell aus diesen Augen gewichen sein?
Bly ließ sich neben ihrer Schwester auf die Erde nieder und streckte die Hand nach dem Pilz aus, den Elise immer noch umklammerte. Im letzten Moment hielt sie sich zurück. Ihre Finger zitterten so heftig, dass sie mehrere Versuche benötigte, um ihn mit ihrem Stock umzudrehen.
Ein hellblauer, kaum sichtbarer Streifen verlief entlang des Stiels. Leicht zu übersehen.
Bly schüttelte Elise. Sie war noch warm. Es würde alles wieder gut werden. Sie würde ihre Schwester von der Lichtung wegziehen und sich mit ihr irgendwo verstecken, bevor die Hexen sie fanden. Dann würde sie warten, bis der Schlafzauber seine Wirkung verlor, und schon konnten sie zusammen nach Hause gehen.
Es ist nur ein Schlafzauber. Nur ein Schlafzauber. Sie schläft, das ist alles.
Jedes Mal, wenn sie sich das einredete, fühlte es sich mehr wie eine Lüge an.
Ein Mensch, der schlief, sah anders aus.
Wieder stupste Bly den Pilz mit dem Stock an, und jetzt sah sie ihn, den winzigen braunen Punkt, der die glatte weiße Oberfläche störte. Sie zerdrückte den Pilz, und sein Fleisch fiel widerstandslos auseinander und gab den Blick auf einen kleinen Nachtschattendorn frei. Als Bly ihn sah, schnürte sich ihr die Kehle zu. Sie wusste, um was es sich dabei handelte: Dem Dorn wohnte ein Todesfluch inne, den die Hexen wiederum in einem Schlafzauberpilz versteckt hatten. Eine Falle innerhalb einer Falle. Niemals hätte Bly für möglich gehalten, dass die Hexen so boshaft sein konnten. Ihr Bauch krampfte sich zusammen.
Und dann begannen auch schon schwarze Adern von Elises Fingerspitzen aus über ihre Haut zu wandern, ein Netz zu spinnen bis zu ihren Wangen. Es war das Zeichen des Todes. Wie lange hatte ihre Schwester noch zu leben? Ein Jahr? Eine Woche? Nur wenige Sekunden? Jeder Todesfluch war anders, und Bly klammerte sich an die letzten, immer dünner werdenden Fasern der Hoffnung, bis sich Elises Lippen bläulich verfärbten und näher kommendes Stimmengewirr sie zwang, aufzublicken.
Die Hexen waren im Anmarsch, auch wenn sie sie noch nicht sehen konnte. Sie beugte sich dicht über Elises Lippen und hielt die Luft an, als könnte sie ihre Schwester wieder zum Leben erwecken, indem sie sich selbst das Atmen versagte.
Nichts.
Gelächter schallte durch den Wald. Es klang so leicht und fröhlich. Ihm lauschen zu müssen, während sie in die leeren Augen ihrer Schwester starrte, löste in Bly den Wunsch aus, sich die Ohren zuzuhalten, laut zu schreien und nie wieder aufzuhören.
Aber sie musste weg, ihr blieb keine Zeit.
Die Hexen würden gleich hier sein. Es hieß, sie spürten es, wenn ein Mensch einen verzauberten Pilz berührt hatte.
Bly drehte Elise auf den Rücken und versuchte, sie unter den Armen zu packen. Der Kopf ihrer Schwester sackte leblos zur Seite und zerquetschte weitere Pilze. Bly unterdrückte ein Schluchzen. Sie verschränkte die Arme unter Elises Achseln und zerrte sie einige Meter über den Boden, doch obwohl sie größer und älter war, war ihre Schwester schon immer die Kräftigere gewesen, mit starken Muskeln, die sich unter ihren üppigen Kurven verbargen.
Es gab kein Entrinnen. Die Stimmen wurden immer lauter.
Nichts lebte mehr in Elises noch immer offenen Augen.
Tot – das Wort breitete sich in Blys Verstand aus.
Elise war tot.
Und auch Bly würde sterben, wenn sie den Körper ihrer Schwester nicht aufgab.
Ihre Schwester hätte gewollt, dass sie davonlief. Eine Leiche ist nur noch eine Leiche, hätte sie gesagt. Kein Mensch mehr, den man retten kann.
Also legte Bly sie sanft auf dem Boden ab und drückte ihre Augenlider zu, die weich und glatt waren wie die Pilze, die sie getötet hatten. Die Hexen sollten die Augenfarbe ihrer Schwester nicht sehen. Sie hatten es nicht verdient, so viel Schönheit zu erblicken.
Elise hätte sie angeschrien, weil sie noch immer nicht geflohen war, hätte sie gefragt, warum sie so etwas Überflüssiges tat.
Bly rannte von der Lichtung weg, suchte Zuflucht zwischen den Bäumen. Sie hätte weiterlaufen müssen, zog sich jedoch in die Äste einer dunklen Eiche hinauf. In genau so einem Baum hatte sie in ihren Tagträumen gewohnt. Erschöpft versteckte sie sich im dichten Eichenlaub.
Die Hexen waren allesamt in gedeckte Braun- und Grüntöne gekleidet, die sich perfekt in den Wald einfügten. Bly nahm sie erst wahr, als sie lautlos die Lichtung betraten. Sie trugen Kronen aus grünen Blättern im Haar und bewegten sich mit einer Langsamkeit, die sie wie uralte Bäume erschienen ließen, die nur für einen kurzen Moment menschliche Gestalt angenommen hatten.
Es waren drei. Mit blitzenden Augen sahen sie sich um. Bly hatte das leuchtende Blau von Hexenaugen immer als schön empfunden, doch nun kam es ihr grell und aufdringlich vor.
Die drei Gestalten zertraten eigenartigerweise keinen einzigen Pilz. Zwei von ihnen legten eine Trage aus Sackleinen neben Elise ab, und die dritte beugte sich über ihren leblosen Körper und hielt ihr zwei Finger an den Hals. Zusammen rollten die Hexen Elise auf die Trage. Eine von ihnen zeigte auf die Schleifspuren auf dem Boden, woraufhin sich alle drei umsahen.
Nehmt mich mit, dachte Bly, sagte es jedoch nicht laut.
Wie gern wäre sie ebenfalls gestorben, aber damit hätte sie es sich zu leicht gemacht.
Die Hexen hielten sich nicht damit auf, nach ihr zu suchen, doch als sie die Trage hochnahmen und wieder mit dem Wald verschmolzen, hatte Bly das Gefühl, dass sie den wichtigsten Teil von ihr forttrugen. Den Teil, der zu Hoffnung fähig war.
Sie klammerte sich stundenlang an der Eiche fest und starrte zu der Stelle, an der Elise gelegen hatte, als müsste sie irgendwann wieder auftauchen.
Am Nachmittag wurde die Luft ein wenig wärmer und kühlte sich dann erneut ab, und noch immer saß Bly auf dem Baum, die Beine taub von dem Ast, auf dem sie kauerte. Zum ersten Mal in ihrem Leben war ihr Kopf vollkommen leer, ohne Träume, ohne Pläne. Als ihre Gedanken nach und nach zurückkehrten, kreisten sie um den Moment, an dem ihre Schwester zu Boden gesunken war. Dann wanderten sie weiter zurück zu jeder Sekunde, die diesem Moment vorausgegangen war, zu jeder Chance, die Elise ihr gegeben hatte, ihr Vorhaben aufzugeben und nach Hause zurückzukehren. Zu jeder Gelegenheit, zu verhindern, was passiert war.
Blys Hals brannte.
Der Himmel nahm ein schreckliches, beinahe schwarzes Dunkelblau an. Sie hatte die Farbe der Stunde zwischen Tag und Nacht immer geliebt, doch nun erinnerte sie sie daran, wie schnell sich das Gift unter Elises Haut ausgebreitet hatte.
Das gleichmäßige Knistern von Laub ließ sie aufschrecken. Vielleicht waren die Hexen zurückgekommen, um auch ihre Leiche zu holen? Sie fühlte sich, als wäre jedes Leben aus ihr gewichen.
»Bly?«
Es irritierte sie, ihren Namen zu hören. Wie konnten die Hexen wissen, wie sie hieß?
»Bly?«
Diesmal erkannte sie die Stimme, die durch den dichten Nebel ihrer Verzweiflung an ihr Ohr drang. Sie sorgte dafür, dass sich alles tausend Mal besser und gleichzeitig tausend Mal schlimmer anfühlte.
Emerson.
Bly versuchte, mit ihren tauben Gliedern vom Baum zu klettern. Sie rutschte ab und prallte gegen etwas Hartes, das nicht der Boden war. Emerson hatte sie aufgefangen, genau wie damals, als sie noch Kinder gewesen waren. Aber sie verdiente es nicht mehr, gerettet zu werden. Also versuchte sie, sich aus seinen Armen zu befreien, bis er sie losließ und sie eine Etage tiefer landete. Der Aufprall tat weh, und der Schmerz sorgte dafür, dass sie sich ein wenig besser fühlte.
Sie blickte in das Gesicht auf, das für sie wie ein Zuhause war: dunkle Haut mit noch dunkleren Augen, dichte Augenbrauen, die sich oft sorgenvoll zusammenzogen, volle Lippen, die er aufeinanderpresste, wenn er nachdachte. Und das tat er so gut wie immer.
Auch jetzt.
Emerson zog sie auf die Füße.
»Bly? Bly?« Er wiederholte fragend ihren Namen, während er mit den Händen über ihr Gesicht fuhr. Dann verharrte er. »Wo ist Elise?« Sein Blick verließ Bly und schweifte durch den immer finsterer werdenden Wald. »Sie hat mir einen Zettel hinterlassen. Ich bin sofort gekommen, nachdem ich ihn gefunden habe. Wie konntet ihr zwei nur so dumm sein?« Seine Augen richteten sich auf ihr Gesicht und schossen dann wieder davon. »Wo ist Elise? Bly?«
Sie erkannte deutlich den Moment, als er begriff – jenes langsame Auseinanderbrechen einer Realität, während sich dahinter eine andere, schrecklichere ausbreitete. Sein entsetztes Gesicht glich sicherlich ihrem, als sie sich umgedreht und ihre Schwester reglos auf dem Boden erblickt hatte. Nur dass es sich noch schlimmer anfühlte, dieses Entsetzen nun bei ihm zu erleben.
Emersons Lippen bewegten sich, aber Bly hörte nicht, was er sagte. Seine Hände packten ihre Arme, doch auch diese Berührung nahm sie nicht wahr. Ihr Kopf wackelte hin und her, offenbar schüttelte er sie.
Irgendwann ließ er von ihr ab und ging zu der Stelle, von der Bly ihren Blick nicht abwenden konnte. Sie beobachtete, wie er auf und ab marschierte, sich immer wieder mit den Fingern durch die dunkelbraunen, kurz geschorenen Locken strich.
Sie musste wegsehen. Bisher hatte sie die Art, wie er sich beim Nachdenken durch die Haare fuhr, immer geliebt. Sie hatte in Bly die Sehnsucht geweckt, nach seinen Händen zu greifen und sie in ihr eigenes Haar zu legen, während sie ihn küsste. Getan hatte sie es nie. Als sie Emerson nun anschaute, war die Sehnsucht verschwunden, zerstört von dem Moment, als Elise mit einem dumpfen Schlag auf dem Waldboden aufgekommen war.
Ein unerträglicher Schmerz nistete sich in Blys Brust ein, als ihr klar wurde, was sie alles verloren hatte: nicht nur ihre Schwester, sondern auch sich selbst. Sie fühlte sich bereits wie ein Mensch, der nicht wusste, was Träume waren, der sich nachts hinlegte und lediglich die Dunkelheit sah, der nur daran dachte, wie er den nächsten Tag überstehen konnte.
Dieses Gefühl der Leere machte ihr panische Angst.
Bis ihre Schuldgefühle die Überhand gewannen: Sie sorgte sich nur um ihre eigenen Träume, dabei waren es die Träume ihrer Schwester, die sie für immer zerstört hatte. Was hatte sich Elise für ihr Leben gewünscht? Bly hatte sie nie danach gefragt, war einfach davon ausgegangen, dass sie mit allem zufrieden war, weil sie stets ein sanftes Lächeln auf den Lippen getragen hatte.
Bly war eine schreckliche Schwester, nicht nur, weil sie Elise überredet hatte, mit ihr in den Wald zu kommen, sondern auch, weil ihr nie in den Sinn gekommen war, sie zu fragen, wovon sie träumte.
Bly setzte sich hin und zog die Beine an die Brust, machte sich so klein, wie sie sich fühlte.
Sie konnte unmöglich nach Hause gehen. Der Gedanke an das Entsetzen in den Gesichtern ihrer Eltern, wenn sie ihnen berichtete, was geschehen war, erschien ihr unerträglich. Dahinter würde das Bedauern darüber durchschimmern, dass es Elise war, die der Tod ereilt hatte, und nicht Bly. Sie selbst empfand ganz genauso, aber sie wollte nicht in die Augen ihrer Eltern blicken wie in einen Spiegel.
Irgendwann kam Emerson zurück und starrte so lange auf sie hinab, dass sie den Kopf auf die Arme sinken ließ, damit sie ihn und den Schmerz in seinem Gesicht nicht sehen musste – einen Schmerz, der ebenso gewaltig wie unauslöschlich war.
Tief in ihrem Inneren spürte sie, dass er sie verlassen würde, aber er tat es nicht. Noch nicht. Stattdessen hob er sie vom Boden hoch und trug sie nach Hause. Die Dunkelheit lag schwer über dem Ödland, als sie vor Blys Haus ankamen, wo ihre Eltern sich bestimmt schon wunderten, wo Elise den ganzen Tag gesteckt hatte, ihre Tochter, die nie herumstromerte und nie zu spät kam.
Emerson sagte kein Wort, als er sie vor der Haustür zurückließ, und das einzig Gute an der Dunkelheit war, dass sie sein Gesicht nicht erkennen konnte.
Am nächsten Morgen ging Bly auf, dass sie noch immer das Säckchen Pilze am Gürtel trug, für das Elise mit ihrem Leben bezahlt hatte. Sie brachte die Pilze zum Markt. Das Kleid kaufte sie nicht, aber sie erstand ein farblich passendes blaues Band und wickelte es sich so eng ums Handgelenk, dass ihr die Tränen in die Augen traten.
Dann fing sie an zu planen, allerdings nicht für die Träume, die sie bis zum gestrigen Tag gehegt hatte.
Die waren mit ihrer Schwester gestorben.
ZWEI
Ein Jahr, vier Monate und elf Tage, nachdem sie ihre Schwester getötet hatte, stand Bly erneut am Waldrand. Dieser Wald war schon immer der Ort ihrer Ängste gewesen, auch wenn sie dahinter die Erfüllung ihrer Träume vermutet hatte. Jetzt lauerte in den Schatten zwischen den Bäumen zusätzlich ihre Schuld. Die Angst ließ sich verscheuchen, wenn es notwendig war, doch die Schuld war ein hungriger Wolf, der unablässig auf Beute lauerte. Sie konnte ihm nur für eine gewisse Zeit entkommen. Er nagte auch jetzt an ihr, während sie zögernd dastand, unfähig, den letzten Schritt vom schlammigen Pfad in die raschelnden Blätter und knisternden Kiefernnadeln zu wagen. Vielleicht musste sie doch keine Beeren sammeln. Besser war es, wenn sie zuerst versuchte, noch mehr Blut zu verkaufen. Sie hörte förmlich Elises Stimme im Ohr. Bestimmt hätte sie ihr das Gleiche vorgeschlagen.
Ausnahmsweise ließ sich Bly von ihren Bedenken leiten. Während sie kehrtmachte, stellte sie sich vor, die Äste der Eichen würden nach ihr greifen, würden versuchen, sie in ihre Mitte zu ziehen, damit sie Buße leistete. Aber das war lächerlich. Ihre Schuld lebte nicht in diesem Wald.
Sie lebte in ihren Knochen.
Bly zupfte an dem ausgefransten blauen Band an ihrem Handgelenk, während sie durch die struppige, tot wirkende Wiese zurück zum Dorf ging. Sie versuchte, nicht an ihre Schwester zu denken. Es fiel ihr schwer, denn wenn sie sie verdrängte, verstärkte sich ihre Schuld noch. Für einen Moment blieb Bly stehen und atmete tief durch, damit ihre schmerzhaften Erinnerungen sie nicht lähmten. Dann hätte sie niemandem mehr etwas genutzt.
Zum zweiten Mal in ihrem Leben hatte sie einen echten Plan, nicht nur unbestimmte Träume. Doch diesmal war alles anders. Sie war kein Kind mehr, das zu viele Bedürfnisse hatte und nur an sich dachte.
Ihr Herzschlag verlangsamte sich. Sie fühlte sich schwach, und ihr Blick schien von einem flimmernden dunklen Rand umgeben zu sein, aber das lag am Blutverlust und nicht daran, dass sie sich ihrem Kummer hingab. Bly hatte sich längst an den Schwindel gewöhnt, der damit einherging, dass sie von allem zu wenig hatte – zu wenig Blut in ihren Adern und zu wenig Nahrung im Bauch. Als sie sich wieder in Bewegung setzte, waren ihre Schritte dennoch fest und gleichmäßig. Sie beobachtete, wie ihre Stiefel immer tiefer im Schlamm des Pfads versanken, bis sie die ersten Holzhäuser erreicht hatte und der Weg breiter wurde. Weniger tückisch war er hier dennoch nicht, denn die Pfützen sahen zwar klein aus, waren jedoch umso tiefer und verschlangen einem das halbe Bein. Wer einmal in eine getreten war, vergaß es nie wieder und schlängelte sich fortan erfolgreich um sie herum. Nur die Kinder waren noch jung genug, um sich nicht an der Feuchtigkeit und Kälte zu stören.
Bly erinnerte sich noch gut an ihre eigene Kindheit, auch wenn es ihr lieber gewesen wäre, sie hätte sie vergessen. Elise, Emerson und sie hatten immer kleine Stöcke am Waldrand gesammelt und sie mit frischen, biegsamen Kiefernnadeln zusammengebunden. Dann hatten sie ihre selbst gebauten Wasserfahrzeuge in die tiefsten Pfützen gesetzt und sie mit Steinen beschwert, um zu sehen, welches am widerstandsfähigsten war. Emerson und Elise waren handwerklich geschickter und pragmatischer, und so hatte die auf Ästhetik bedachte Bly jedes Mal verloren. Sie wollte, dass ihre Boote in Schönheit untergingen.
Voller Wehmut dachte sie daran zurück. Sie war immer schon zu eitel gewesen. Die Haut unter ihrem Armband spannte plötzlich und brannte, und Bly fragte sich, ob sie es fester zugeschnürt hatte als sonst.
Sie riss sich von ihren gefährlichen Erinnerungen los und konzentrierte sich auf die erschöpften Bewohner des Ödlands, die mit ausdruckslosem Blick an ihr vorbeigingen. Diese Menschen hatten schon vor langer Zeit vergessen, wie es gewesen war, als die Pfützen ihnen noch Freude bereitet hatten. Ihre Welt war brutal und kalt. Sie war kein Ort für Träumer, aber Bly hatte noch einen letzten Traum, an den sie sich klammerte, bevor sie sich dem Schicksal dieser Leute ergab.
Und um ihn wahr werden zu lassen, brauchte sie noch mehr Geld.
Das Ödland war ein langer, schmaler Streifen Land, in dem die Menschen in kleinen Dörfern lebten. Zwischen diesen Dörfern fanden Märkte statt, die teilweise von Vampiren und Hexen betrieben wurden. Die Häuser wurden schöner, je näher man einem solchen Markt kam, denn sie gehörten jenen Bewohnern, die mit den Vampiren oder Hexen zusammenarbeiteten. Es waren Spione, die ihre Auftraggeber informierten, wenn jemand zu lange verschwand. Dann trommelten diese eine Jagdgesellschaft zusammen und durchkämmten den angrenzenden Wald. Die Vampire und Hexen machten es den Menschen so schwer wie möglich, aus dem Ödland zu fliehen, was Bly in ihrem Glauben bestärkte, dass es jenseits dieser trostlosen, zwischen Vagaris und Havenwhile eingezwängten Welt noch eine andere geben musste. Im Grunde war es großes Glück gewesen, dass sie damals, vor einem guten Jahr, doch keinen Fluchtversuch unternommen hatte, denn ihre Pläne hatten sich allein auf die Zeit danach beschränkt. Manchmal war sie selbst erschrocken darüber, wie leichtsinnig sie gewesen war.
Bly erreichte den Markt, der ihrem Dorf am nächsten war, und trat vom matschigen Weg auf eine gepflasterte Straße. Während den Vampiren und Hexen das Elend, in dem die meisten Menschen leben mussten, vollkommen gleichgültig zu sein schien, hatten sie für sich selbst höhere Ansprüche. Anfangs hatten sie versucht, die Straßen der Märkte mit glänzend weißen Steinen zu pflastern, doch da die Menschen zu viel Schmutz mit sich herumtrugen, war ihre Wahl schließlich auf glatte, runde Kiesel in verschiedenen Farben gefallen. Früher hatte sich Bly noch darüber geärgert, dass sie lediglich die Farbe der Steine verändert hatten, statt die löchrigen, ständig unter Wasser stehenden Wege durch die Dörfer auszubessern. Jetzt kümmerten sie derartige Kleinigkeiten nicht mehr. Sie war nur dankbar, dass ihre Füße auf dem Markt nicht nass wurden und froren.
Während sie an den äußeren Marktständen vorbeiging, die von Menschen betrieben wurden, hielt sie den Kopf gesenkt und zog sich ihre graue Kappe tiefer in die Stirn. Diese Stände waren einfache Holztische, auf denen im Wald gesammelte Pilze oder Beeren ausgebreitet waren oder Ramsch gegen anderen Ramsch getauscht wurde. Dann folgten jene Stände, an denen Bewohner des Ödlands ihre Ware im Auftrag von Vampiren oder Hexen verkauften. Aus Havenwhile stammten beispielsweise sämtliche Lebensmittel, die nicht im Wald oder auf den Wiesen gesammelt werden konnten, denn auf den sumpfigen Feldern, die die Menschenansiedlungen säumten, wuchs kaum etwas. Die Hexen belieferten die Märkte mit Brot, Kartoffeln, Äpfeln und selteneren Früchten wie Orangen. Ihr Zitrusduft hatte Bly früher immer dazu gebracht, stehen zu bleiben und zu schnuppern. So hatten ihre Träume gerochen, und manchmal verharrte sie noch immer vor den Ständen und dachte daran zurück, wie viel Hoffnung vor Elises Tod ihr Herz erfüllt hatte. Heute hingegen verlangsamte sie nicht einmal ihre Schritte und ging genauso eilig an den von Vampiren belieferten Ständen vorbei, an denen Fleisch, Stoffe, Metalltöpfe und Messer feilgeboten wurden. Produziert wurden alle diese Dinge von Menschen, und auch das Verkaufspersonal bestand aus Bewohnern des Ödlands. Während die Vampire und Hexen den Großteil des Profits einheimsten, bekamen die Menschen kaum genug zum Leben. Schließlich mussten sie hungrig bleiben, damit sie weiter gezwungen waren, ihr Blut zu verkaufen.
Bly konnte nicht verhindern, dass die altvertraute Wut in ihr hochkochte. Weder Vampire noch Hexen kamen ohne die Menschen aus, warum verurteilten sie sie also zu derartiger Armut? Nach dem tragischen Tod von Emersons Schwester hatten ihr Kindheitsfreund und sie viele Tage am Waldrand verbracht, auf Kiefernnadeln herumgekaut und ihrem Zorn über die Ungerechtigkeit der Welt freien Lauf gelassen. Sie waren sich einig gewesen, dass die Menschen sich gegen ihre gnadenlosen Herrscher erheben und die Kontrolle über ihr Leben zurückerobern müssten. Letzten Endes hatte Emerson jedoch resigniert die Schultern gezuckt: Sie seien zu schwach, um siegreich aus einem Aufstand hervorzugehen. Die Bewohner des Ödlands hätten es in der Vergangenheit immer wieder versucht, und es habe nie gut geendet. Wozu etwas wiederholen, das nur zu noch mehr Tod und Gewalt führen würde? Sie müssten aufhören, so zu tun, als hätten sie eine Chance. Bly hatte damals die Furcht in seinem Gesicht erkannt, eine Furcht, unter der er seine Wut erfolgreich begrub. Er hätte es niemals ertragen, noch mehr Menschen zu verlieren, die er liebte, also würde er ein ruhiges, unauffälliges Leben führen.
Bly wäre ihm blindlings in eine Revolution gefolgt, wenn er es von ihr verlangt hätte, deshalb hatte er sie mit seiner sachlichen Vernunft vermutlich beide gerettet. Es hieß, vor einigen Jahren hätte wieder eine Rebellengruppe versucht, Menschen durch den Wald in die Freiheit zu schmuggeln. Den Gerüchten zufolge sogar mit einigem Erfolg, bis die Anführer erwischt und umgebracht worden waren. Die Leute erzählten sich, es seien auch Vampire Teil der Gruppe gewesen, aber das war schwer zu glauben. Welches Motiv hätten sie haben sollen, ihren unfreiwilligen Blutspendern zur Freiheit zu verhelfen?
Die Vampire und Hexen organisierten das Leben der Menschen im Ödland so, dass diese im Grunde einfach nur existierten. Sie starben weder aus, noch war ihr Dasein lebenswert. Das Leben hier war nicht fair, genauso wenig wie der Tod. So funktionierte es nun mal in dieser Welt, solange sich die Leute zurückerinnern konnten.
Es gab eine Legende, die erklärte, wie die heutige Ordnung der Dinge entstanden war. Sie bestand sowohl aus wahren als auch aus erfundenen Elementen – welche das waren, hing vom Erzähler ab –, aber das meiste stimmte in allen Versionen überein: Vor langer Zeit hatte es weder Vampire noch Hexen gegeben, nur Menschen, die in einer magischen Welt zusammengelebt hatten. Die Natur hatte ihnen alles gegeben, was sie brauchten, und noch mehr. Wer glänzende Haare wollte, braute das Blütenblatt einer Lilie zu Tee, wer Husten hatte, trank Wasser aus einem bestimmten Fluss, und eine goldene Beere von einem weit entfernten Strauch bewirkte, dass man ein Jahr länger zu leben hatte. Jeder konnte sich dieser Magie bedienen, konnte die Schätze der Natur so verwenden, wie ihm beliebte, und vielleicht hätten alle glücklich und zufrieden sein können, wenn die Wünsche der Menschen nicht überhandgenommen hätten. Schon bald waren alle goldenen Beeren geerntet und alle Lilien verblüht.
Die Magie verschwand, dabei konnten die Menschen nicht mehr ohne sie leben. Irgendwo musste sie weiterexistieren, und man raunte sich zu, es gebe einen Heiligen Teich, dessen Wasser verzaubert sei. Die Menschen suchten lange danach, bis sie auf ein tiefes Gewässer in einem einsamen Wald stießen, dessen Oberfläche in vielen magischen Farben schimmerte. Von nah und fern kamen die Bewohner, um das Wasser zu trinken, in der Hoffnung, dass es ihnen die Macht zurückgab, die ihnen entronnen war. Aber die Wirkung war nicht bei allen dieselbe: Einige wurden zu Hexen, mit Augen wie schimmernde Seen und der Fähigkeit, durch ihre Zauberkräfte die Dinge wieder mit Magie aufzuladen. Andere kehrten als Vampire zurück, mit Augen so dunkel wie Eichenrinde nach dem Regen und neuen, rohen Kräften. Sie waren schnell und stark, erholten sich umgehend von sämtlichen Verletzungen, waren unsterblich. Wieder andere Bewohner schienen vom Wasser des Teichs unverändert zu bleiben.
Nachdem der letzte Tropfen getrunken war, fingen die Leute an, mit ihren Gaben zu experimentieren. Die Vampire stellten fest, dass ihre Kräfte dahinschwanden, bis sie schließlich ihren Gelüsten nach menschlichem Blut nachgaben. Die Hexen probierten aus, welche Zutaten sie brauchten, um Früchte oder Blüten mit Zauberkräften aufzuladen, und versuchten es instinktiv mit ihrem eigenen Blut. Als das nicht klappte, schlug eine von ihnen menschliches Blut vor, worüber die anderen anfangs lachten – waren die Menschen doch diejenigen, um die die Magie scheinbar einen Bogen gemacht hatte. Aber irgendwann testete eine Hexe die Wirkung, und siehe da, es funktionierte.
Ebenjene, die gedacht hatten, der Teich hätte ihnen nichts gegeben, stellten fest, dass sie den Schlüssel zur Magie der anderen in den Händen hielten. In einer gerechteren Welt wären sie durch diese Macht zu Göttern geworden. Früher hatte Bly sich manchmal ausgemalt, wie es in einer solchen Welt gewesen wäre.
Stattdessen wurden die Menschen zum Ersatz für die Blätter, das Gras, die Blumen – all die Dinge, die vor dem Verschwinden der Magie mit Füßen getreten worden waren.
Die Hexen und Vampire begannen, sie zu jagen, weil sie ihr Blut brauchten, während sie sich gleichzeitig gegenseitig bekämpften, in dem Glauben, sie seien mehr von Magie gesegnet als die Gegenseite und hätten es daher verdient, die Herrscher des neuen Reichs zu sein.
Mit der Zeit merkten sie, dass sie einander ebenbürtig waren und dass die eine Sache, die sie beide brauchten, dabei war, auszusterben: die Menschen. Ein Waffenstillstand wurde ausgerufen, in dessen Zuge die Macht zwischen Hexen und Vampiren aufgeteilt und Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der menschlichen Art ergriffen wurden.
Bly fröstelte. Sie und die anderen Bewohner des Ödlands waren seither zwar davor geschützt, abgeschlachtet zu werden, aber vor der immerwährenden Kälte bewahrte sie niemand. Auch nicht vor einem Leben im Elend.
Die Märkte waren neutrale Orte, an denen alle drei Volksgruppen unbehelligt miteinander Handel treiben konnten – zumindest weitgehend. Um dies zu gewährleisten, lungerten auf der einen Seite Wachleute aus Vagaris zwischen den Ständen herum, bekleidet mit blutroten Uniformen und hohen schwarzen Stiefeln, die glänzten wie hungrige Vampiraugen. Auf der anderen Seite mischten sich Wachleute aus Havenwhile unters Volk, die dunkelbraune Umhänge trugen und deren Gürtel Dutzende Taschen für Zaubergegenstände aufwiesen. Die Wachen sollten eingreifen, falls irgendjemand sich auf gesetzeswidrige Weise an den Menschen vergriff.
Bly hatte so etwas erst einmal erlebt: Eine Frau war versehentlich gegen einen Vampir gestoßen, der sich umgedreht und in ihren Hals gebissen hatte, bevor sie auch nur hatte schreien können. Die Hexenwachen waren nur eine Sekunde später zur Stelle gewesen, hatten den Vampir mit einem Zauber überwältigt und ihn in Richtung Havenwhile davongeschleppt. Denn dies war die Strafe für ein solches Verhalten: Die Gegenseite durfte den Täter mitnehmen. Der Vampir hatte lautstark protestiert, und seine wütenden Schreie hätten Bly sicher bis in ihre Träume verfolgt, hätte sich der Anblick der inzwischen toten Frau nicht noch tiefer in ihr Bewusstsein eingebrannt. Das war es, was wirklich ihre Träume heimsuchte: ein verlorenes Leben wegen eines Schulterremplers.
Bly erreichte den Hexenteil des Marktes, in dem jene Waren verkauft wurden, die die Hexen nicht menschlichen Verkäufern anvertrauen wollten. Sie hasste diesen Bereich, genau wie die blauen Augen der Standbetreiberinnen, die farblich zu dem Band an ihrem Handgelenk passten. Sie erinnerten sie an die giftigen Adern der Pilze, an Elises Lippen an jenem verhängnisvollen Tag.
Beim Gedanken daran setzte Blys Herz einen Schlag aus, doch sie biss die Zähne zusammen und näherte sich dem Blutstand. Von den wenigen Menschen einmal abgesehen, die Hexen und Vampire verehrten und hofften, eines Tages wie sie zu sein, hassten fast alle Bewohner des Ödlands eine der beiden Volksgruppen noch mehr als die andere. Vampire waren brutal und blutrünstig, aber wenigstens fielen sie ihre Opfer direkt an, ohne Umschweife. Sie waren wie Berglöwen, unfähig, ihre wahre Natur zu verbergen, trat sie doch überdeutlich zutage, wenn sie lächelten und ihre Eckzähne aufblitzten. Die Hexen hingegen waren hinterhältig, sie versteckten sich hinter ihren Zaubern. Bly fand es viel schlimmer, wenn man vordergründig so tat, als hätte man es nicht auf menschliches Blut abgesehen, während man heimlich auf der Lauer lag. Sie war einmal darauf hereingefallen, ein zweites Mal würde es ihr nicht passieren. Inzwischen stand für sie fest: Das größere Übel war jenes, das einem ohne warnende Eckzähne entgegenlächelte.
Aber sie hatte den Vampiren heute schon Blut verkauft, daher blieb ihr nur der Hexenbereich. Der Blutstand der Hexen wuchs buchstäblich aus dem Boden, ein dichter Strauch, dessen Zweige schachbrettartig miteinander verwoben waren und den Anschein eines Tischs mit Seitenwänden und Dach erweckten. Er war natürlich das Ergebnis eines Hexenzaubers, denn hier im Ödland wuchs fast nichts, schon gar nicht so üppig. Ein junger Hexer lehnte am Stand und pflückte immer wieder ein widerspenstig zur Seite abstehendes Blatt ab, das jedes Mal sofort nachwuchs. Seine dunklen Augenbrauen zogen sich verärgert zusammen, und sein Gesichtsausdruck wurde auch nicht freundlicher, als er zu Bly aufblickte. Er hatte die gleichen seeblauen Augen wie alle anderen Bewohner der Hexenstadt und musterte Bly von ihren schlammverkrusteten Stiefeln bis zu den dunkelvioletten Ringen um ihre dunkelgrünen Augen. Dass sie ein Mensch war, war nur allzu offensichtlich.
»Vergeude nicht meine Zeit«, sagte er und wandte sich wieder seinem Blatt zu.
»Ich will Blut verkaufen.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Er seufzte und stellte sich aufrecht hin, winkte sie mit zwei Fingern zu sich.
Nachdem sie näher an ihn herangetreten war, griff er nach ihrer Hand und zog sie so ruckartig und unsanft nach vorn, dass einige Äste des Tischs durch Blys Rock hindurch ihre Haut zerkratzten. Sie biss sich auf die Lippe, während der Hexer ihren Ärmel bis zum Ellbogen nach oben zerrte und einen blauen Strich an ihrem Handgelenk entblößte. Wenn ein Mensch Blut verkaufte, wurde sein Arm mithilfe eines Zaubers markiert. Der Strich verblasste erst, wenn genügend Zeit verstrichen war und der jeweilige Spender wieder gefahrlos zur Ader gelassen werden konnte. Die Vampire und Hexen brauchten zwar Blut, aber es war auch wichtig für sie, dass möglichst viele Menschen am Leben blieben.
Der Mund des jungen Mannes verzog sich zu einem höhnischen Grinsen. »Meinst du, ich erkenne nicht aus einer Meile Entfernung, dass du ausgeblutet bist? Geh mit deiner Verzweiflung woandershin.«
Er ließ Bly so abrupt los, dass sie nach hinten taumelte und beinahe gestürzt wäre. Am liebsten hätte sie ihn zum Kampf herausgefordert, ihn gezwungen, hinter seinem Stand hervorzukommen, damit sie sein Blut vergießen konnte. Doch er beschäftigte sich schon wieder mit dem Blatt, das eine noch größere Unannehmlichkeit zu sein schien als sie. Ein lästiger Mensch ließ sich leichter beiseiteschieben als ein durch Magie zum Wachsen verurteilter Trieb. Blys Gesicht glühte vor Scham und Wut. Einige Umstehende warfen ihr traurige Blicke zu, und sie fragte sich, was sie wohl dachten. Ihre Eltern hatten bessere Berufe als die meisten anderen. Sie litten keinen Hunger, warum verkaufte ihr Kind also so viel Blut? Die Leute vermuteten bestimmt alle dasselbe.
So kurz vor den Spielen wurde generell mehr Blut auf dem Markt verkauft als sonst.
Bly strich sich den Rock glatt, als könnte sie die Schaulustigen damit ablenken, und nahm Kurs auf den Vampirbereich. Wenn sie Glück hatte, hatte Osmond schon Feierabend. Normalerweise verkaufte sie ihr Blut am liebsten an ihn, denn er war ganz in Ordnung, zumindest für einen Vampir. Aber er duldete nicht, dass sie mehr Blut ließ als erlaubt, und der andere Vampir, der am Blutstand arbeitete, legte die Regeln weniger streng aus. Glaubte man den Gerüchten, zapfte Victor seinen Kunden so viel Blut ab, wie sie ihm zugestanden, und falls sie sich verschätzten, warf er ihre Leichen kurzerhand vor die Tore des Dorfs. Dieses Schicksal hatte offenbar schon mehr als einen hungernden Menschen ereilt.
Im Vampirteil des Markts waren die Stände aus steinernen Säulen und kaltem Stahl errichtet, der in den seltenen Sonnenstrahlen glänzte. Victor lag ausgestreckt auf seinem Stand, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Nur wohlgenährte Vampire ertrugen es, sich in der Sonne aufzuhalten. Vampirkörper funktionierten nicht wie die von Menschen oder Hexen – ihre Herzen schlugen nicht, und die Hexen behaupteten, daran erkenne man, was für abscheuliche Wesen sie seien. In Wahrheit bedeutete es nur, dass sie von Magie am Leben erhalten wurden, und wenn diese Magie ihren Treibstoff nicht bekam, wurde sie schwächer und versagte ihren Dienst. Victor befand sich direkt an der Quelle dieses Treibstoffs, und es war mehr als offensichtlich, dass er reichlich Gebrauch davon machte. Beim Gedanken daran rebellierte Blys Magen. Auch nach über einem Jahr hatte sie sich noch nicht daran gewöhnt, ihr Blut zu verkaufen.
Victor machte sich nicht die Mühe, die Augen zu öffnen, als sie vor ihm stehen blieb. In ihrem Bauch rumorte es erneut, aber sie brauchte das Geld. Entweder sie verkaufte mehr Blut, oder sie musste in den Wald.
Bly räusperte sich, und der Vampir wandte träge den Kopf und machte langsam eins seiner dunkelgrauen Augen auf.
Er sah sie kaum an, bevor er es wieder schloss und sein Gesicht zurück zur Sonne drehte. »Du wirst sterben«, sagte er gelangweilt.
»Du hast nicht mal kontrolliert, ob ich schon eine Markierung habe.«
»Brauche ich nicht.«
»Bitte!« Es gelang ihr nicht, die Verzweiflung aus ihrer Stimme zu verbannen.
Victor setzte sich seufzend auf und rutschte herum, bis seine Füße vom Tisch baumelten. »Ich und mein weiches Herz.« Er grinste, doch seine Augen blieben hart. »Dann lass mal sehen«, forderte er sie auf und wedelte nach ihrem Arm.
Bly hielt ihn Victor hin, und seine kalten Hände zogen ihren Ärmel nach oben, wobei einer seiner Finger den blauen Strich abdeckte. »Sieh an. Ich habe mich wohl geirrt.« Sein Grinsen wurde breiter, und die Erregung, die sie darin erkannte, machte ihr Angst. Er liebte dieses Spiel, liebte es, Menschen zu viel Blut abzunehmen und ein Leben zu riskieren, das nicht seins war.
Bly hätte ihm eigentlich dankbar sein müssen, kam jedoch nicht umhin, auch ein wenig Hass zu empfinden. Victor war es egal, dass sie aus Geldnot ihre Gesundheit gefährdete. Ihm ging es allein um den Nervenkitzel.
Er hüpfte vom Stand und bedeutete ihr, auf die andere Seite zu kommen und sich auf einen Holzhocker zu setzen. Sie legte den Arm auf den Tisch und schob ihren Ärmel noch ein Stück weiter nach oben, entblößte die blau unterlaufene Haut in ihrer Armbeuge. Es würde wehtun, ob er nun vorsichtig war oder nicht. Victor griff nach einem leeren Beutel und einem Schlauch und beugte sich mit seiner Nadel über sie. Als er den Zustand ihres Arms sah, leuchteten seine Augen auf, und er rammte die Nadel ohne Vorwarnung in sie hinein. Das leise Keuchen, das Bly nicht unterdrücken konnte, löste Entzücken in ihm aus. Er biss sich auf die Lippe und riss die Nadel wieder aus ihrem Fleisch. Blut floss an Blys Arm hinunter.
»Entschuldige. Daneben.« Seine Augen waren nun pechschwarz, wie die Augen aller Vampire im Blutrausch.