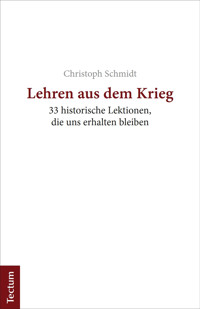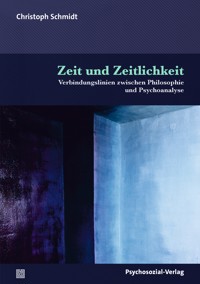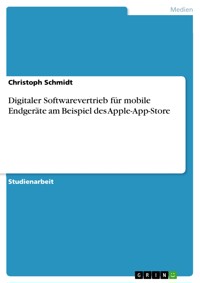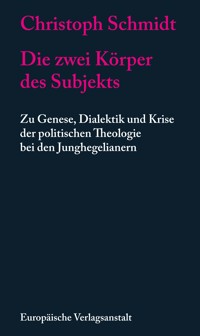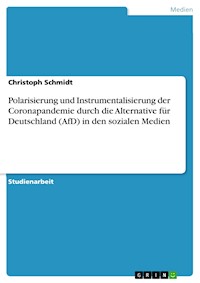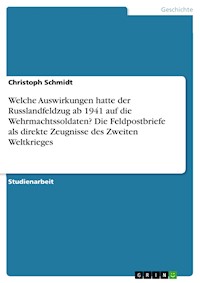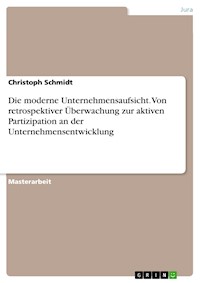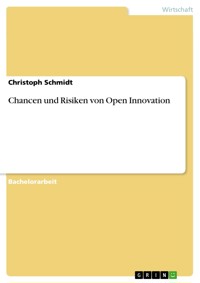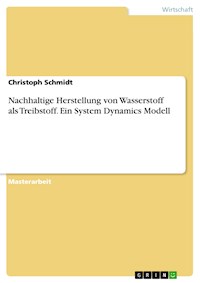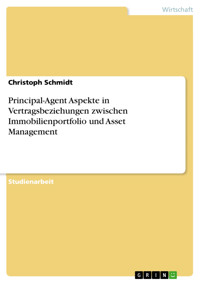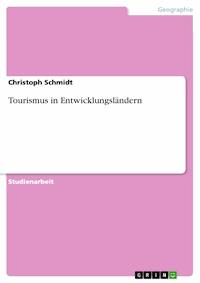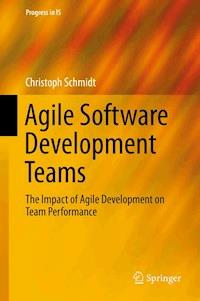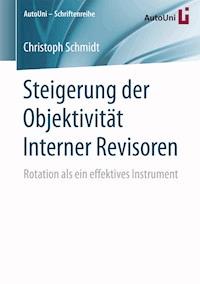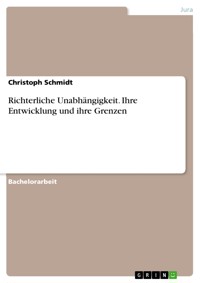
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Jura - Strafrecht, Note: 1, Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für Strafrecht), Sprache: Deutsch, Abstract: „Ein bisschen Justiz oder ein bisschen gute Justiz ist noch immer besser wie gar keine Justiz“. Mit diesem simplen Ausspruch stellte der ehemalige österreichische Justizminister Eduard Herbst, bereits 1861 die Bedeutung einer unabhängigen Justiz dar. Auch in der Philosophie erkannte Friedrich Schiller mit seinem Drama „Maria Stuart“ früh, dass eine Unabhängigkeit von Richtern und Gerichten einen Schutz für alle Rechtsunterworfenen darstellt. Der Ausruf: „Wehe dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, der das Gesetz gab, auch das Urteil spricht“, birgt die richterliche Unabhängigkeit in sich. Genau diese Unabhängigkeit prägt den gerechten Rechtsstaat und sorgt dafür, dass Rechtsfälle nicht von Beteiligten oder Beamten entschieden werden, sondern von einem unbeteiligten Richter. Die vorliegende Arbeit soll sich mit der Entwicklung der richterlichen Unabhängigkeit in Österreich und deren Grenzen beschäftigen. Der erste Teil der Bachelorarbeit geht vor allem auf den geschichtlichen Weg der Unabhängigkeit in der Justiz ein. Ausgangspunkt ist eine Analyse der Situation im 18. Jahrhundert, als auch in der Sozialdemokratie und in den Jahren des Krieges, bis zu heutigen Entwicklungen. Im zweiten Teil der schriftlichen Arbeit, soll vor allem der Stand der Entwicklung im Vordergrund stehen. In diesem Sinne werden Inhalt und Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit im Bundesverfassungsgesetz betrachtet und Einflüsse dargestellt. Die aktuelle Rechtsentwicklung wird in diesem Teil auch eine zentrale Rolle spielen. Ein abschließender Blick dient zur Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Historische Entwicklung
2.1 Die Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert
2.1.1 Die Stellung des Richters
2.1.2 Macht des Monarchen und deren Beschränkung
2.2 Die Sozialdemokratie und die richterliche Unabhängigkeit
2.3 Vom Nationalsozialismus bis zum Stand der heutigen Entwicklung
2.3.1 Entwicklungen nach 1945
3 Richterliche Unabhängigkeit in Österreich
3.1 Der Begriff der Rechtsprechung im sinne der Art. 82 ff Bundes-Verfassungsgesetz
3.1.1 Richter im Sinne des Artikel 86 B-VG
3.2 Richterliche Unabhängigkeit – Gegenstand und Grenzen
3.2.1 Sachliche Unabhängigkeit
3.2.2 Persönliche Unabhängigkeit
3.2.3 Institutionelle Unabhängigkeit
3.2.4 Innere Unabhängigkeit
3.3 Schranken und Grenzen der Unabhängigkeit
3.3.1 Grenzen in Bezug auf die Person Des Richters
3.3.2 Außerrechtliche Grenzen
3.4 Abwehr von Eingriffen in die Unabhängigkeit
3.4.1 Rechtsschutz für Richter
3.4.2 Rechtsschutz für Verfahrenspartein
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
Bücher
Zeitschriften
1 Einleitung
„Ein bisschen Justiz oder ein bisschen gute Justiz ist noch immer besser wie gar keine Justiz“.[1] Mit diesem simplen Ausspruch stellte der ehemalige österreichische Justizminister Eduard Herbst, bereits 1861 die Bedeutung einer unabhängigen Justiz dar. Auch in der Philosophie erkannte Friedrich Schiller mit seinem Drama „Maria Stuart“ früh, dass eine Unabhängigkeit von Richtern und Gerichten einen Schutz für alle Rechtsunterworfenen darstellt. Der Ausruf: „Wehe dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, der das Gesetz gab, auch das Urteil spricht“[2], birgt die richterliche Unabhängigkeit in sich. Genau diese Unabhängigkeit prägt den gerechten Rechtsstaat und sorgt dafür, dass Rechtsfälle nicht von Beteiligten oder Beamten entschieden werden, sondern von einem unbeteiligten Richter.
Die Wichtigkeit der richterlichen Unabhängigkeit, wird vor allem auch durch geschichtliche Darstellungen hervorgehoben. Im Folgenden wird der Ablauf der Justiz in einem Prozess im Jahr 1794 gegen mehrere Jakobiner, aufgrund des Vorwurfs der Vorbereitung eines Aufstandes, dargestellt:
„… Diese Worte, die der österreichische Demokrat und Jakobinder Leutnant Franz Hebenstreit laut Bericht des Polizeispitzels und Agent provocateur Joseph Vinzenz Degen am Abend des 21. Juli 1794 in Wien-Augarten ausgesprochen haben soll, bildeten den Anstoß zum wohl spektakulärsten Prozess des ausgehenden 18. Jhs in Österreich. Mit Hebenstreit wurden mehrere Dutzend österreichische und ungarische Jakobinder unter Anklage gestellt; man warf ihnen die Vorbereitung eines Aufstandes, Verbreitung aufrührerischer Schriften, illegale Verbrüderung sowie die Versendung des Modells einer Kriegsmaschine nach Frankreich vor. Während die ungarischen Mitglieder der Verschwörung an ein ungarisches Gericht überstellt wurden, war man sich am Wiener Hof über die Behandlung der Österreicher zunächst unschlüssig. Daher schlug der stellvertretende Polizeiminister Graf Franz Joseph Saurau, der die Voruntersuchungen leitete, dem österreichischen Monarchen Franz II. zur Aburteilung der Verschwörer die Einsetzung eines Sondergerichts – eines iudicium delegatum cum derogatione omnium instantiarum – vor. Dieses Tribunal sollte aus elf Personen bestehen, in der Mehrzahl Mitglieder der Untersuchungshofkommission, welche die Erhebungen gegen die Angeklagten durchgeführt hatten. Kaiser Franz II. genehmigte diesen Vorschlag und befahl dem Ersten Präsidenten der Obersten Justizstelle Graf Clary das Sondergericht zusammenzustellen. Durch Zufall gelangte dieses Schreiben jedoch in die Hände des zweiten Präsidenten, Karl Anton Freiherr von Martini (1726-1800), einem von der Lehre der Aufklärung und des Naturrechts überzeugten Beamten. Mit einer – vor dem Hintergrund der sich immer stärker politisch durchsetzenden Reaktion – bewundernswerten Zivilcourage bezog Martini in einem Schreiben gegen den kaiserlichen Entschluss Stellung. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen folgende Punkte:
Drei Mitglieder des außerordentlichen Tribunals besäßen nicht die gesetzlich zur Ausübung des Richteramts vorgeschriebenen Qualifikationen.
Die Angeklagten würden dem ordentlichen Rechtsweg entzogen und einer außerordentlichen Hofkommission zur Aburteilung übergeben.
Durch die derogation omnium instantiarum nehme man den Verurteilten die Möglichkeit zur Ergreifung eines Rechtsmittels.