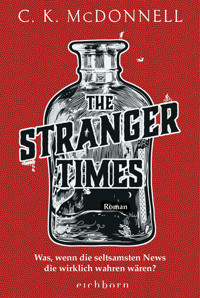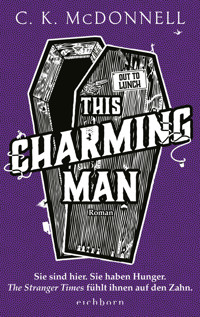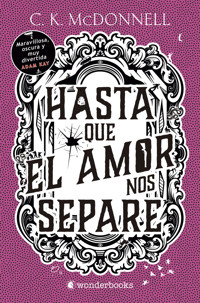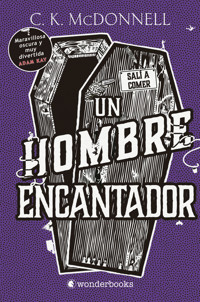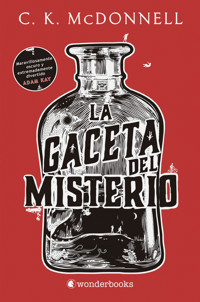14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Stranger Times
- Sprache: Deutsch
Da will man in seinem Buchclub ein wenig Spiritualität ausprobieren und schon hat man aus Versehen den alten Gott Zalas heraufbeschworen. Und Zalas hat natürlich nur eins im Sinn: möglichst viele Gläubige um sich scharen. Doch wer glaubt heutzutage überhaupt noch an irgendwas? Kinder! Mithilfe des unglückseligen Neil Aikens erschafft Zalas ein Winterwunderland, in dem alle Wünsche wahr werden - vom echten Einhorn bis zum Besuch des Opas, der letztes Jahr doch eigentlich das Zeitliche gesegnet hat.
Diese gewaltige Menge an Magie bleibt nicht lange unbemerkt; und die Zeit drängt, denn wenn die vierte Kerze brennt, sind Zalas und seine Anhänger nicht mehr aufzuhalten. Das Team der Stranger Times muss einen Weg finden, um nicht nur Weihnachten, sondern womöglich die ganze Welt zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Epilog
Kostenloser Bonus
Danksagungen
Über den Autor
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Über das Buch
Da will man in seinem Buchclub ein wenig Spiritualität ausprobieren und schon hat man aus Versehen den alten Gott Zalas heraufbeschworen. Und Zalas hat natürlich nur eins im Sinn: möglichst viele Gläubige um sich scharen. Doch wer glaubt heutzutage überhaupt noch an irgendwas? Kinder! Mithilfe des unglückseligen Neil Aikens erschafft Zalas ein Winterwunderland, in dem alle Wünsche wahr werden – vom echten Einhorn bis zum Besuch des Opas, der letztes Jahr doch eigentlich das Zeitliche gesegnet hat.
Diese gewaltige Menge an Magie bleibt nicht lange unbemerkt; und die Zeit drängt, denn wenn die vierte Kerze brennt, sind Zalas und seine Anhänger nicht mehr aufzuhalten. Das Team der Stranger Times muss einen Weg finden, um nicht nur Weihnachten, sondern womöglich die ganze Welt zu retten.
C. K. McDonnell
Nicht jede Bescherung ist ein Geschenk. The Stranger Times packt aus
Übersetzung aus dem Englischen von André Mumot
Prolog
Wir sind tote Wesen, du und ich.
Gespenster? Nein, keine Gespenster. Bilde dir nur nichts ein. Gespenster können mit ihren Ketten rasseln, mit Teetassen werfen, auch mal halb durchsichtig durchs Haus spuken. Es sind Geister, die traumatisiert und unerlöst in dieser Welt gefangen sind. Eiternde Wunden in der weiten Landschaft der Seelen.
Wir? Wir sind die Vergessenen. Rechenfehler des Lebens. Was auch immer nach dem Tod passieren soll – es ist nicht passiert. Nicht bei uns. Eigentlich wie im Sportunterricht – nur, dass wir für keine der beiden Mannschaften ausgewählt wurden. Wir haben nie eine Rolle gespielt. Ganz einfach gesagt: Unsere Leben haben nicht genug Geschichten erzählt. Das ist ein wichtiges Wort, das viel zu oft auf die leichte Schulter genommen wird. Geschichten. Sie sind die Kraft, die dafür sorgt, dass sich die Welt weiterdreht, oder wenigstens dafür, dass wir weiterhin Interesse daran haben, dass sie dies tut. Geschichten sind eine unsichtbare Magie, die die Menschheit verbindet. Liebe und Hass, Leben und Tod, Gut und Böse: Alles verbindet sich zur großen Erzählung.
Die meisten Menschen sind vielleicht nur einen einzigen Absatz wert, womöglich nur eine Fußnote. Wenige sind auserwählt, ganze Bände zu füllen, aber sie alle tragen zur großen, allumfassenden Geschichte bei. Doch du und ich, wir haben es in unserem Leben nicht einmal geschafft, auch nur ein Wort unterzubringen. Und deshalb sind wir nun bis in alle Ewigkeit dazu verflucht, Zuschauer zu sein.
Es hat aber auch Vorteile. Ironischerweise existieren wir nun einzig und allein, um für immer nach Geschichten Ausschau zu halten. Das hat seine Tücken – denn zumindest die wirklich saftigen sind schwer zu finden. Einer, der auch schon lange zu den Toten gehört, hat es mal so ausgedrückt: »Die ganze Welt ist eine Bühne.« Nicht erwähnt hat er leider, dass die meisten Menschen schrecklich schlechte Schauspieler sind, die mit einem schauderhaften Text arbeiten, den die Autoren sich nur aus dem Ärmel geschüttelt haben, weil sie vertraglich dazu verpflichtet waren. Natürlich kommt dann am Ende sowas wie Battlefield Earth dabei heraus – nur leider ohne Spezialeffekte und ohne John Travolta, der großartigerweise wie ein Truthahn aus dem Weltall aussieht.
Das ist es, was dich an diesen Ort gebracht hat und mich an ihn fesselt. Diese heruntergekommene, ehemalige Kirche macht vielleicht nicht allzu viel her, aber sie ist randvoll mit Geschichten. Komm herein, ich führe dich herum.
Tritt durch die Eingangstür – auch wenn sie nur noch von Spanplatten und viel gutem Willen zusammengehalten wird. Wie ist das passiert, warum wurde sie von einem heulenden Mob von Untoten eingetreten? Weil es Teil der Geschichte war, deshalb. Teil einer guten Geschichte. Aber es ist nicht die, für die wir hergekommen sind. Das ist Vergangenheit, wir sind wegen der Zukunft hier. Auch wenn es womöglich nicht mehr allzu viel davon geben wird.
Hinter der Tür da drüben befindet sich die Druckerpresse, die eigentlich sehr viel mehr ist als bloß eine Druckerpresse. Sie wird von einem Rastafari bedient, der ebenfalls viel mehr ist als ein Rastafari. Man kennt ihn unter dem Namen Manny, und er teilt sich seinen Körper mit einem Nachkommen der Alten, einem Engel, dessen Aufgabe es ist, diesen Ort zu schützen und nie zu verlassen. Manny weiß es nicht, aber die Geschichte hat auch mit ihm noch einiges vor. Er glaubt, er habe seine Rolle erfüllt, indem er sich von der Welt zurückgezogen hat, aber das Leben hat andere Pläne mit ihm. In diesem Augenblick befindet sich jemand, der ihm sehr am Herzen liegt, in einem Rettungswagen, der die Oxford Road hinabrast, mit heulender Sirene, und der eine Geschichte in Gang setzt, die bald schon von allen Seiten auf ihn einstürzen wird. Aber so weit sind wir noch nicht.
Am Wochenende ist Weihnachten. Heute, am Donnerstagabend, haben die Geschäfte bereits geschlossen. Dennoch treffen wir auf ein volles Haus. Die Druckerpresse muss schließlich gefüttert werden, und unserer Geschichte sind reguläre Arbeitszeiten völlig egal. Eine Deadline muss eingehalten werden. Bei einer Zeitung muss immer eine Deadline eingehalten werden, aber in diesem Augenblick spürt die Belegschaft der Stranger Times bereits den Atem der Abgabefrist im Nacken. Dies sind alltägliche Probleme, aber keine Sorge, es bahnt sich bereits ein echtes Weltuntergangsproblem an. In diesem Moment ruht es noch in einem Buch, das sich in der Handtasche einer Bibliothekarin befindet, die ebenfalls die Oxford Road hinabeilt, an Passanten vorbei, die sich auf dem Weg zu Weihnachtsfeiern mit ihren Kollegen befinden. Diese bringen dann ihre ganz eigenen winzigen Geschichten und Skandale hervor, in die unter anderem Mandy aus der Rechnungsabteilung und Darren aus der Auslieferung verwickelt sein werden.
Auf dem Weg über den regennassen Bürgersteig treten diese Teilnehmer unseres Bacchanals rasch beiseite, um der Frau möglichst viel Platz zu lassen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Auch die Frau selbst ahnt nicht, welche Rolle sie an diesem regnerischen Abend noch zu spielen hat. Der Kopf der Bibliothekarin ist erfüllt von einer Stimme, die nicht ihre eigene ist – wie in einem Fiebertraum. Sie achtet nicht auf die betrunkenen Partygäste, nicht auf die Bettler, die auf Kleingeld hoffen, nicht auf den Rettungswagen, der mit heulender Sirene an ihr vorbeirauscht. Sie spürt sich selbst nicht, und in absehbarer Zeit wird sie auch nicht mehr sie selbst sein. Ihre guten Absichten wurden korrumpiert. Sie ist nur noch ein Dominostein, der bald schon fallen wird.
Anderswo in der Stadt sitzen die Begründer beieinander und machen sich Sorgen – mächtige Leute, die ihre Seelen für die Unsterblichkeit verkauft haben und die sich nun für die unsichtbaren Hände halten, die die Geschicke dieser Welt lenken. Wovor müssen die Begründer sich fürchten? Nun, vor der Geschichte natürlich. Hör gut zu! Jede Geschichte bringt Veränderung, und die haben sie gar nicht gern. Um ihre Sicherheit aufrechtzuerhalten, müssen die Begründer den Status quo bewahren. Unsterblichkeit ist schließlich nicht dasselbe wie Unverwundbarkeit. Alles kann sterben, und von denen, die es wagen, den Sensenmann warten zu lassen, fordert er einen schrecklichen Preis. Die Begründer wissen: Wer die Geschichten beherrscht, beherrscht die Welt – kein Wunder also, dass sie sich Sorgen machen. Es ist weitaus einfacher, den Tod zurückzuhalten als die Geschichten. Doch während die zarte Bibliothekarin die Handtasche mit dem Buch fest an sich klammert und mit beängstigender Entschlossenheit auf ihr Ziel zumarschiert, sorgen sie sich nicht mal annähernd genug. Was für eine Ironie.
Zurück in der ehemaligen Kirche, steigen wir die Treppe hinauf, lassen die kaputte vierte Stufe von oben aus und finden uns im Empfangsbereich wieder. Dies ist die Domäne von Grace. Sie ist die zweite Beschützerin dieses Ortes und ebenso furchteinflößend wie der Engel, nur eben auf ihre ganz eigene Weise. Die Waffe, zu der sie bevorzugt greift, ist eine Tasse Tee. Das mag sich nicht nach viel anhören, aber du wärst überrascht, was sich damit alles ausrichten lässt. Gerade bringt Grace in der Küche Wasser zum Kochen und nimmt Schokoladenkekse aus der Packung, um zu verhindern, dass die allgemeine Anspannung in Tobsucht umschlägt, während die bunt gemischte Belegschaft darum ringt, die letzte Ausgabe des Jahres rechtzeitig für die Veröffentlichung fertigzustellen.
Bevor du dich den Toten angeschlossen und vergessen hast, wer du einmal warst, hast du womöglich in einer Zeit gelebt, in der Zeitungen ehrfurchtgebietende Institutionen waren, vor denen die Mächtigen gezittert haben. Diese Zeiten sind vorbei. Sie wurden davongespült – von neuer Technologie und der Bereitschaft, die Realität so zu interpretieren, wie es einem am besten gefällt. Heute entscheiden die Menschen selbst, was sie für wahr halten. Das gesamte Konzept von Tatsachen und Fakten ist derartig in die Mangel genommen und pervertiert worden, dass es sich selbst nicht wiedererkennt. Hier jedoch kämpft ein zusammengewürfelter Haufen von Journalistinnen und Journalisten tapfer dagegen an, dass das Licht der Wahrheit endgültig verlischt. Denn dies ist die Stranger Times. Sie berichtet über das, was von vielen lange als bloße Fantasterei abgetan wurde – obgleich es zum Teil sehr viel realer ist als die verzerrten Wahrheiten, an die sich die Skeptiker und Verschwörungsgläubigen so festklammern. Denn die Welt ist voller Magie und voller Ungeheuer, sowohl im metaphorischen als auch im beängstigend realen Sinn.
Der Plastikbaum in der Ecke ist festlich geschmückt mit bunten Kugeln und Lichterketten – weil Grace darauf bestanden hat. Er bezeugt die Tatsache, dass bald Weihnachten ist, eine Erinnerung an die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde. (Zumindest für alle, die immer noch nicht Battlefield Earth gesehen haben.)
Durch diese Tür betreten wir den Bullenstall – das große Gemeinschaftsbüro. Der erste Mensch, dem wir hier begegnen, ist Stella – auch wenn »Mensch« womöglich nicht das richtige Wort ist. Dieser Teenager ist kein Teenager. Sie hat keine Erinnerungen an ihr früheres Leben, weiß nur noch, dass sie davor davongelaufen ist. Einzelne Bruchstücke kehren langsam zu ihr zurück, aber sie bringen mehr Fragen als Antworten. In Stella lebt eine Kraft, die, auf ihre Weise, noch mal sehr viel beängstigender ist als die, die Manny in sich trägt. Nicht zuletzt, weil niemand weiß, worum es sich dabei handelt, nicht einmal sie selbst.
Während Stella arbeitet – sie versucht, Wörter auf einem Bildschirm neu zu ordnen, damit das, was nicht zusammenpasst, doch noch zusammenpasst –, schaut ihr eine Frau skeptisch über die Schulter und versucht angestrengt, sich genau dies nicht anmerken zu lassen. Das ist Hannah, die stellvertretende Chefredakteurin. Nach ihrer Scheidung hat sie erst kürzlich an diesem Ort ein neues Leben begonnen, eine Geschichte, zu der sie sehr viel lieber gehört – auch wenn sie ihre ganz eigenen Probleme mit sich bringt. Beispielsweise wird Hannah von einem wiederkehrenden Traum verfolgt, weigert sich aber, ihn als Vision anzuerkennen, nicht einmal vor sich selbst. Darin sieht sie, wie die süße Stella lachend die Welt in Stücke reißt. Das wäre Problem Nummer eins. Hinzu kommt Nummer zwei. Hannah arbeitet für einen Mann, von dem man sagen könnte, dass er … nein, nicht dass er der leibhaftige Teufel ist. Der Teufel hat mehr Charme. Zumindest aber höhere Standards bei der Körperpflege.
Am Schreibtisch hinter ihr sitzen Ox und Reggie und hauen wie wild in die Tasten. Ox, ein Außenseiter hier in Manchester, der mit seinen ganz eigenen Dämonen kämpft, hat eine schwere Spielsucht besiegt. Die Chancen, dass es dabei bleibt, stehen nicht allzu gut, was ihm schwer zu schaffen macht. Und auch Reggie ist ein Beispiel für jemanden, der vor seiner Vergangenheit flieht. So verzweifelt ist er darum bemüht, sie hinter sich zu lassen, dass er nur allzu gern die Zwangsjacke der Spießigkeit trägt. Auf diese Weise versucht er, die brutalen Narben aus einem früheren Leben zu verbergen – seine und die der anderen.
Und nun, da wir durch die Tür am anderen Ende des Raumes treten, wagen wir uns auch schon in die Höhle des Löwen. Zum Boss. Vincent Banecroft persönlich – Chefredakteur und der erste Mensch, der im Kiosk an der Ecke Hausverbot erhalten hat, bloß, weil »er ist, wie er ist«. Derzeit befindet er sich im Halbschlaf, ein Glas Rum in der einen, eine brennende Zigarette in der anderen Hand. Eigentlich könnte er kaum zufriedener sein. Dank der drohenden Deadline darf er nämlich in Kürze andere anschreien, eine sozial wenig verträgliche Angewohnheit, die er längst zur Kunstform erhoben hat. Doch auch dahinter verbirgt sich eine Tragödie. Trauer und Reue. Einst war er der König der Welt – oder zumindest der Fleet Street, was für die britische Presse lange Zeit dasselbe war. Ach, wie tief ist er gesunken! Schlimmer noch – einst wurde er geliebt. Wahrhaft geliebt. Doch er hat nicht nur diese Liebe verloren, sondern auch schreckliche Dinge getan, in dem fehlgeleiteten Glauben, er könne sie zurückerlangen. Deshalb hat er sich an anderen versündigt. Einige davon befinden sich hier in diesem Gebäude, und diese Schuld wird er nie begleichen können. Deshalb ist er immer noch hier. Nur deshalb und weil die Druckerpresse im Erdgeschoss gefüttert werden muss. Alles Gute in ihm existiert eigentlich nur noch, um die Presse zu füttern.
Doch nun hat der Rettungswagen das Krankenhaus erreicht, und auch die Bibliothekarin ist an ihrem Ziel eingetroffen. Dies ist also ein guter Zeitpunkt – so gut wie jeder andere –, um unseren Beginn auszurufen. Die Mitarbeiter der Stranger Times glauben, sie würden die letzten Geschichten dieses Jahres unter Dach und Fach bringen, aber da irren sie sich. Ihre größte Geschichte rauscht soeben auf sie zu, und sie können ihr nicht ausweichen.
Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Da gibt es noch einen Ghul namens Brian, der mittlerweile im Keller lebt. Du wirst feststellen, dass er dir unerklärlicherweise sympathisch sein wird, und das obwohl er gelegentlich in eine Zimmerecke kackt.
Nun aber weiter.
Kapitel 1
Debra begrüßte die anderen mit einem stummen Nicken und öffnete die Tür zur Bibliothek. Normalerweise traf sich ihre Gruppe am Sonntagabend, nach Ende der Öffnungszeit, aber die Studierenden waren bereits in die Weihnachtsferien aufgebrochen, und die Bibliothek machte früher zu. Die drei anderen Frauen folgten ihr wortlos, und sie schloss hinter ihnen wieder ab. Ihr übliches Geplauder war auffällig abwesend, stattdessen warfen sie einander nervöse Blicke zu. In den Gesichtern ihrer Freundinnen hätte Debra Spuren der Kinder sehen können, die sie einmal gewesen waren und die sich aufgeregt gegenseitig fragten, was ihnen der Weihnachtsmann gebracht hatte. Aber für so etwas hatte sie in diesem Augenblick keinen Kopf.
Man hatte ihnen offiziell gestattet, ihre Treffen hier abzuhalten. Debra war schließlich die stellvertretende Bibliotheksleiterin, und wie hatte es ihre Chefin, Maggie, so treffend gesagt? Wenn sich ein Buchclub nicht in einer Bibliothek treffen kann – wo dann? Debras Wohnung kam jedenfalls nicht infrage, schließlich hatte sie Mr Mittens, und Rose war allergisch. Bei ihr konnten sie sich aber auch nicht treffen, da ihre neue Mitbewohnerin immer zuhause war und es ihr schwerfiel, die Privatsphäre von anderen zu respektieren. Sue wiederum hatte einen Ehemann und zwei Kinder, und Michaela konnte ebenfalls nicht aushelfen, denn ihre Mutter war vor Kurzem bei ihr eingezogen. Der Buchclub stellte ohnehin ihre einzige Möglichkeit dar, an einem Abend in der Woche das Haus zu verlassen, weil ihre ansonsten so nutzlose Schwester einsprang und für ein paar Stunden auf ihre Mum aufpasste.
Während Debra das Licht einschaltete und sich die Gruppe durch den Eingangsbereich bewegte, presste Debra sich die Handtasche an die Brust. Die Tasche fühlte sich warm an, und es kam Debra so vor, als würde sie eine summende Energie verströmen, was natürlich lächerlich war. Seltsamerweise war das Buch selbst eiskalt gewesen, als sie es das erste Mal in Händen gehalten hatte.
Sue sagte etwas, aber Debra hörte nicht zu. Das Flüstern in ihrem Kopf lenkte sie ab.
Bald. Bald ist es soweit. Mach weiter.
Mit ihrer Schlüsselkarte öffnete sie den Durchgang neben dem Ausleihtresen und führte die Gruppe in den Mitarbeiterraum.
Sie hatten als ganz gewöhnlicher Buchclub begonnen. Anfangs wollten sie sich auf anspruchsvollere Literatur konzentrieren, waren stolz darauf, ein bisschen kultivierter zu sein als die Richard-&-Judy-Buchclub-Leute. Bis Michaela eines Tages einen Fantasy-Roman auswählte, der zu einem TikTok-Hype geworden war. Natürlich beschwerte sich Rose bei ihrer Diskussion erst einmal ausgiebig über die Sexualisierung der weiblichen Körper. Aber dann kamen sie ganz selbstverständlich auf das Thema Magie zu sprechen.
Sue war diejenige, die beim nächsten Treffen ein Buch über moderne Hexenzauber mitbrachte. Sie tat so, als wäre es bloß ein Scherz, aber alle merkten, dass das nicht ganz stimmte. Klar, hätten die anderen nichts davon wissen wollen, hätte sie mit ihnen darüber gelacht. Aber alle warfen einen neugierigen Blick hinein. Anschließend fand Rose einen guten Aufsatz im Internet, in dem erklärt wurde, wie der Begriff »Hexe« im Laufe der Geschichte benutzt worden war – hauptsächlich, um Frauen zum Schweigen zu bringen, die es wagten, das heteronormative Patriarchat infrage zu stellen.
Es ging weiter mit harmloser Meditation – Michaela sagte, ihr Hausarzt hätte ihr das schon seit Jahren ans Herz gelegt. Der nächste Schritt waren die Heilkräuter. Das Mittel, das Debra gegen ihr Asthma gefunden hatte, schien wirklich gut zu wirken. Dann braute Rose eine Mischung zusammen, die Debras Nerven beruhigen sollte, die dann jedoch zwei Tage lang für peinlich laute Blähungen sorgte.
Trotzdem fuhren sie fort, Sachen auszuprobieren und zu recherchieren. Es war erstaunlich, was man in einer Bibliothek alles finden – oder bestellen – konnte. Niemand prüfte das nach, solange es sich nicht zufällig um Mein Kampf handelte.
Den ersten »Hexenspruch«, den sie schließlich ausprobierten, widmeten sie einem gewissen Clive, der mit Sue in der Bank arbeitete. Sie versicherte ihnen, er wäre ein ganz reizender Typ, dem sein Mundgeruch schwer zu schaffen machte. Im Gegensatz zu vielen anderen Leidensgenossen, war ihm das Problem bewusst, und im Laufe der letzten Jahre hatte es sein Selbstbewusstsein vollständig zunichtegemacht. Sue nahm unauffällig ein kleines Garfield-Kuscheltier von Clives Schreibtisch, und bei ihrer nächsten Sitzung folgten sie den Anweisungen aus einem Buch, das Rose in einem New-Age-Laden in der Afflecks-Markthalle gefunden hatte. Während sie gemeinsam sangen und alle weiteren Schritte ausführten, kamen sie sich vollkommen albern vor. Doch das war bald vergessen.
Aufgeregt berichtete ihnen Sue, dass Clives Atem, seit sie das Spielzeug wieder auf seinen Tisch gestellt hatte, frisch war wie eine sommerliche Brise. Er war ein neuer Mensch. Leider erhielt besagter neuer Mensch zwei Wochen später eine dienstliche Verwarnung, weil er gegenüber einer weiblichen Kundin eine Bemerkung gemacht hatte, die der Filialleiter als »sexuelle Belästigung« einstufte. Davon ließen sie sich ihr Erfolgsgefühl jedoch nicht verderben. Plötzlich erschien ihnen alles möglich.
In der Tat folgte ein Triumph auf den anderen. Die Heilung der Schuppenflechte von Debras Cousine, ein Glückszauber für Michaelas Neffen, der Ärger an seiner neuen Schule hatte, und ihr Versuch, das »kleine Problem« von Sues Ehemann zu beheben. Kichernd berichtete sie, wie erfolgreich dies gewesen war. So erfolgreich, dass sie zwei Wochen später einen anderen Zauber durchführten, der die Wirkung wieder rückgängig machte.
Ein entscheidender Wendepunkt für die Gruppe trat ein, als Roses Verlobung implodierte, weil sie erfuhr, dass ihr Verlobter sie betrogen hatte. Sie grub eine ganze Reihe von Hexenzaubern aus, um sich an Callum zu rächen, und präsentierte sie den anderen. Sie verbrachten einen gesamten Abend damit, diese zu diskutieren, was ihren Buchclub kurzzeitig in eine Gruppentherapie verwandelte. Am Ende war es im Wesentlichen Sues ausgleichendem Naturell zu verdanken, dass sie es schafften, Rose davon zu überzeugen, dass die beste Rache darin bestünde, wahre Größe zu zeigen und ihr Leben weiterzuleben. Auch dies schweißte sie enger zusammen.
Leider musste Rose anschließend feststellen, dass Callum sich ihre gesamten Hochzeitsersparnisse hatte auszahlen lassen, um mit seiner neuen Freundin in den Urlaub zu fahren. Sie waren sich sofort einig: Der Fall stand wieder zur Disposition. Also griffen sie noch einmal auf den Spruch zurück, den sie bereits genutzt hatten, um die Leistungsfähigkeit von Sues Ehemann zu dämpfen. Diesmal führten sie ihn mit deutlich mehr Verve durch – nur um erfahren zu müssen, dass Callum von den Seychellen nach Hause geflogen werden musste, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Erschrocken berief die Gruppe ein Treffen ein, bei dem sie rasch zu dem Schluss kamen, dass es sich um einen Zufall handeln musste. Das Wort »Zufall« wurde von allen gebetsmühlenartig wiederholt, als wollten sie damit einen weiteren Zauber aussprechen, der ihren Wunsch zur Wahrheit machte. Daraufhin beschlossen sie, ihre Kräfte in Zukunft nur noch für Positives einzusetzen.
Und so kam es auch: Sues neuer Job, die Bekämpfung der Panikattacken von Michaelas Mum, der botanische Garten in Fletcher Moss, der von Hooligans demoliert worden war und dessen Vegetation nun einen »unglaublichen Wachstumsschub« erlebte – was es bis in die Tageszeitungen schaffte. Darauf waren sie besonders stolz. Eine positive Wirkung nach der anderen. Das Problem mit der Magie bestand jedoch darin, dass sie rasch an ihre Grenzen stießen. Schließlich verfügte keine von ihnen über das, was in einem der Bücher als »angeborene Gabe« bezeichnet wurde. Was auch immer das heißen sollte. In der Praxis bedeutete es, dass sie sich Gegenstände mit gewissen Kräften beschaffen mussten, um die Zauber durchzuführen.
Debra mochte keine angeborene Gabe besitzen, aber sie hatte ein gutes Gespür dafür, welche Gegenstände über eine innere Kraft verfügten. Was auch immer dieses Talent war, es stellte sich als absolut essenziell heraus. Ohne wäre sie schließlich nur eine weitere ahnungslose Möchtegernhexe gewesen, die sich den größtenteils wertlosen Plunder in Paulos Emporium andrehen ließ. Und nun, da sie im Mitarbeiterraum der Bibliothek herumstanden, kämpfte eine leise Stimme in Debras Hinterkopf verbissen um ihr Gehör und erinnerte sie daran, dass sie dieses Buch keineswegs bei Paulo gefunden hatte.
Sie standen kurz davor, ihr bisher ambitioniertestes Projekt in Angriff zu nehmen: einen Spruch, der dem Royal Manchester Children’s Hospital eine gewaltige Genesungswelle bescheren sollte. Der Zauber würde nicht alle Patienten heilen, natürlich nicht, aber er würde doch eine signifikante Wirkung zeigen. Rose hatte als Erste den Begriff des »Weihnachtswunders« benutzt. Der Zeitpunkt konnte kein Zufall sein. Wie Michaela sagte, war es, als hätte die Vorsehung sie zu diesem Moment geführt. Und wenn es funktionierte, konnten sie ja vielleicht auch etwas für ihre Mum tun.
Heute Vormittag war Sue zum Garten des Kinderkrankenhauses gegangen und hatte dort einen Setzling eingepflanzt. Nun mussten sie nur noch den Spruch ausführen. Für gewöhnlich gönnten sie sich erstmal eine Tasse Tee und plauderten ein Weilchen, bevor sie zur Tat schritten. Debra brachte immer Kekse mit, denn wenn es etwas gab, bei dem Bibliotheksangestellte keinen Spaß verstanden, dann waren es die Mitarbeiter-Kekse. Der Himmel mochte demjenigen gnädig sein, der sich einfach an den Vorräten bediente. Ganz zu schweigen von dem Espressoautomaten, der auf der Arbeitsfläche im Mitarbeiterraum glänzte wie ein frisch polierter Penny. Vier Angestellte hatten das Geld zusammengelegt, um die Maschine anzuschaffen, und sie war sofort zum Zankapfel geworden. Sie mussten eigens eine Mitarbeiterversammlung einberufen, und nach zähen Verhandlungen fanden sie eine Regelung, die das umständlich formulierte Schild neben der Maschine erklärte: Montags und freitags stand der Automat allen Kollegen zur Verfügung, vorausgesetzt, dass jeder seine eigenen Pads mitbrachte – mit dem Zusatz, dass nur diejenigen Pads benutzt werden durften, die vom Hersteller zugelassen waren. Die Friedensverhandlungen rund um diesen Espressoautomaten hatten mehr Zeit verschlungen als die Beendigung mehrerer handelsüblicher Kriege auf dieser Welt.
Debra öffnete ihre Tasche, doch heute enthielt sie weder Kekse noch Kaffee-Pads. Sie legte das Buch vor sich auf den Tisch.
Rose rümpfte die Nase. »Ist das Leder?«
Debra spürte, wie sie sich gegen jede Kritik an dem Buch sträubte. Bevor sie etwas erwidern konnte, meldete sich Sue zu Wort – wie immer höchst diplomatisch. »Na ja, es ist sehr alt, nicht wahr? Kommt aus einer anderen Zeit.«
Auf dem Einband des Buches war nur eines zu sehen – ein Ouroboros, eine Schlange, die in ihren eigenen Schwanz beißt.
Bald. Bald. Bald. Sehr bald.
»Okay«, sagte Debra. Sie fühlte sich atemlos. »Ich weiß, wir haben alle keine Zeit zu verlieren. Was meint ihr? Legen wir gleich los?« Keine von ihnen musste noch irgendwohin, aber sie alle spürten die besondere Energie im Raum.
Einige verstohlene Blicke wurden getauscht. »Hast du den Spruch mitgebracht?«, fragte Sue.
»Ich hab ihn auswendig gelernt«, erwiderte Debra und schloss die Augen.
Jetzt. Jetzt. Jetzt.
Ohne ein weiteres Wort breitete sie die Arme aus. Nach kurzem Zögern nahm Sue ihre eine Hand und Michaela die andere, und dann vollendeten sie den Kreis, indem sie Rose mit einschlossen.
Als sie die Verbindung hergestellt hatten, begann Debra zu sprechen. Tief in ihrem Inneren war sie sich der Tatsache bewusst, dass die Worte, die ihren Mund verließen, nicht ihre eigenen waren. Nicht nur hatte sie keine Ahnung, woher sie kamen, sie verstand sie nicht einmal. Sie gehörten nicht zu irgendeiner Sprache, die sie wiedererkannt hätte. Ihre Lippen formten fremdartige Silben – gutturale, harsche Laute, die einen bitteren Nachgeschmack in ihrem Mund hinterließen. Sie spürte, wie sich die anderen anspannten, aber es war bereits zu spät.
Etwas in ihr drängte sie verzweifelt, aufzuhören, während die Wörter sich von selbst bildeten. Aus ihr strömten. Schneller und schneller. Das war falsch. Schrecklich falsch.
Sie öffnete die Augen und sah, dass die anderen sie entsetzt anstarrten. Das Licht im Raum flackerte. Obwohl es keinerlei offene Türen und Fenster gab, brauste plötzlich ein unerklärlicher Windstoß durch den Raum und riss Flyer von der Pinnwand. Debra wollte Michaelas und Sues Hände loslassen, aber es gelang ihr nicht. Ihr wurde bewusst, dass die beiden dasselbe versuchten, sich verzweifelt krümmten, die Verbindung unterbrechen wollten – vergeblich. Und bei alledem kamen immer mehr Wörter. Ergossen sich aus ihr wie ein Sturzbach.
Debra sah, dass Roses angsterfüllter Blick sich inzwischen fest auf das Buch richtete, das vor ihnen auf dem Tisch lag. Sie schaute herab und erkannte, dass der Ouroboros blutete. Klebriges, dunkelrotes, fast schwarzes Blut hatte die Prägung erfüllt, rann über den Einband und tropfte auf den Tisch.
Und dann, als sich ihre Stimme zu einem Crescendo erhob, färbte sich ihr gesamtes Blickfeld rot, und sämtliche Glühbirnen im Raum zerplatzten. Die Lämpchen am Weihnachtsbaum barsten in rascher Folge, eine nach der anderen, knallten wie Feuerwerkskörper beim chinesischen Neujahr. Sie fand sich im Auge des Sturms wieder, vom Wirbel getrennt, und das einzige Licht im Raum ging von dem glühenden Buch aus. Ihre drei Freundinnen lagen bewusstlos auf dem Boden.
Sie schaute sich um. Nein, das stimmte nicht. Sie selbst hatte keine Kontrolle mehr, war zur Passagierin in ihrem eigenen Körper geworden. Sie schaute durch ihre Augen, konnte aber nicht mehr selbst entscheiden, wohin sie blickte – auch sonst nichts mehr. In ihrem Kopf schrie sie, aber nichts kam aus ihrem Mund. Stattdessen hallte ein erschreckend tiefes Gelächter in ihrem Inneren wider. Dann fauchte eine Stimme sie an: »Schweig, du Närrin!«
Sie beobachtete, wie sich ihr Körper, ohne eigenes Zutun, im Raum bewegte und den Espressoautomaten hochhob. Das rote Glühen spiegelte sich auf der glänzenden, silbrigen Oberfläche. Sie spürte, wie ihre Hände das Gerät hielten, es hoben, das Gewicht einschätzten.
Sie – oder was auch immer sie jetzt war – wandte sich wieder dem Boden zu. Sie sah, dass die anderen sich rund um den Tisch aufrappelten, während sie sich erschrocken und verwirrt umschauten.
Plötzlich war die winzige Stimme in ihrem Kopf wieder ihre eigene.
Lauf! Lauf! Lauf!
Sie sah sich dabei zu, wie sie durch den Raum ging. Sue blickte mit weit aufgerissenen Augen zu ihr auf. »Was ist passiert? Geht’s dir gut?«
Mit einem hilflosen Entsetzen, das ihr die eigene Seele zerriss, sah Debra dabei zu, wie ihre Hände den Espressoautomaten hoch über ihren Kopf rissen. Dann schlug sie zu.
Kapitel 2
Hannah mischte sich nicht ein.
Stand sie kurz davor, sich einzumischen? Ja. Aber sie war immer noch mindestens dreißig Zentimeter von der Stelle entfernt, wo Stella an ihrem Tisch saß und auf ihrer Tastatur tippte – das konnte man also nicht als Einmischen bezeichnen. Gut möglich, dass es den Unterschied nur in ihrem eigenen Kopf gab, aber dennoch: Sie war die stellvertretende Chefredakteurin, wollte aber eine coole Chefin sein, die ihren Untergebenen genug Raum gab, ihren Instinkten vertraute und – das war am wichtigsten – sich nicht in ihre Arbeit einmischte.
Stella hörte mit dem Tippen auf und überflog ein letztes Mal den Text auf ihrem Monitor. Als sie das Wort ergriff, kam nur ein ungläubiges Flüstern heraus. »Ich … ich glaube, wir sind fertig.«
Hannah widerstand weiter dem Drang, sich vorzubeugen und alles nochmals zu kontrollieren. Schließlich machte Stella grundsätzlich keine Fehler. Wenn es um die Beherrschung der Layout-Software ging, war sie ein echtes Naturtalent. Zudem gestaltete sie die Seiten derartig rasch, dass das menschliche Auge kam noch hinterherkam.
»Wir sind fertig?« Ox schaute auf seine Armbanduhr. »Es ist neunzehn Uhr neunundfünfzig!«
Hannah arbeitete jetzt seit etwas mehr als neun Monaten bei der Stranger Times – auch wenn es ihr vorkam, als wären in dieser Zeit mehrere Lebensspannen abgelaufen. Aber das hatte es wirklich noch nie gegeben! Die Arbeit an der aktuellen Ausgabe war abgeschlossen – an einem Donnerstagabend um 20 Uhr, also genau zu dem Zeitpunkt, zu der sie allwöchentlich tatsächlich in den Druck gehen sollte. Sie waren niemals pünktlich fertig. Niemals! Der Donnerstagabend wurde unweigerlich zum Freitagmorgen, bevor sich die Druckerpresse endlich in Gang setzte. Obwohl die Mitarbeiter der Stranger Times so viele verrückte, absurde und bisweilen welterschütternde Dinge miteinander erlebt hatten, war dies einer der unglaublich seltenen Momente, der ihnen allen die Sprache verschlug.
Allerdings war es kein Zufall. Hannah hatte wochenlang darauf hingearbeitet – seit ihr klargeworden war, wie viel es Grace, ihrer leidgeprüften Büroleiterin, bedeutete, eine ordentliche Weihnachtsfeier zu veranstalten. Zugegeben, »ordentlich« war in diesem Fall ein relativer Begriff. Es hieß lediglich, dass sie zu acht in der Redaktion herumstehen und versuchen würden, Small Talk zu führen. Aber Grace tat so viel für sie alle und verlangte so wenig als Gegenleistung – also ließ Hannah nichts unversucht, um ihr diese Freude zu bereiten.
Mehrere Abende hatte sie Überstunden eingelegt und sichergestellt, dass viele der weniger aktuellen, allgemeiner gehaltenen Artikel frühzeitig fertiggestellt und redigiert wurden. Reggies Rückblick auf die Geistererscheinungen des Jahres zum Beispiel. Und Ox’ euphemistisch betitelte Kolumne »Alles im grünen Bereich«. Darin hakte er die verschiedenen Religionen, Sekten, Hellseher, Wahrsager und, zumindest in einem Fall, Seesäugetiere ab, die vorausgesagt hatten, dass die Welt in diesem Jahr untergehen würde, und drückte seine Enttäuschung drüber aus, dass es doch wieder nicht dazu gekommen war. Beide Rubriken hatten eine lange Tradition. Hannah wusste dies, weil sie sich in einige der Weihnachtsausgaben der vergangenen Jahre eingelesen hatte. Am Überraschendsten war es, wie viele von Ox’ Kandidaten immer wieder in seiner Kolumne auftauchten. Naiverweise hatte Hannah angenommen, dass die Leute keine weitere Apokalypse ankündigen würden, nachdem sie sich mit einer Vorhersage schon einmal spektakulär auf die Nase gelegt hatten. Nun, falsch gedacht.
Neben diesen umfangreichen Artikeln gab es noch die aktuellen Nachrichten der Woche, die den Großteil der Zeitung füllten. Trotz starker Gewissensbisse hatte sie Reggie weisgemacht, sie würden diese Woche einen Tag früher als sonst in den Druck gehen. So hatte er seinen üblichen Abgabe-Nervenzusammenbruch schon gestern ausleben und hinter sich bringen können. Er wirkte ziemlich verletzt, als er die Wahrheit erfuhr, aber auch er wusste, warum sie ihn angelogen hatte.
Wenn sie ganz ehrlich war, konnte Hannah nicht begreifen, warum Grace sich die fixe Idee dieser Weihnachtsfeier überhaupt in den Kopf gesetzt hatte. Reggie und Ox sagten, sie hätten noch nie eine gehabt, nicht mal in der Zeit vor Banecroft, als die Stranger Times noch ganz anders geführt worden war. Kurz überlegten sie, einfach in ein Restaurant zu gehen, verwarfen die Idee aber gleich wieder. Schließlich konnte Manny das Gebäude nicht verlassen. Und Brian, dem Ghul, der mittlerweile in ihrem Keller residierte, fehlte noch immer das feinere Gespür dafür, wann und wo man optimalerweise sein großes Geschäft verrichten sollte. Hannah wäre es allerdings immer noch lieber gewesen, sich in der Öffentlichkeit von Brian blamieren zu lassen als von Banecroft. Ein ganzes Wochenende hatte sie mit dem Versuch verbracht, sich ihren Chef in einer Karaokebar oder einem gediegeneren Restaurant vorzustellen. Doch ihr Gehirn stieß diese Vorstellung schlicht ab – in etwa so, wie ein menschlicher Körper einen Sandwichtoaster abstoßen würde, wenn man versuchte, ihn gegen seine Nieren zu ersetzen.
Also würde es eine Weihnachtsfeier in ihrer Redaktion geben. Grace hatte keinen Aufwand gescheut, und dank ihrer festlichen Dekoration machte das alte Gebäude tatsächlich einen sehr weihnachtlichen Eindruck. Banecroft hatte sich erbittert gegen jeglichen überteuerten Tand ausgesprochen, worauf Grace unbekümmert versicherte, sie würde mit größter Freude alles selbst basteln. Sie hatte auch wirklich ein Händchen dafür. Aus Cupcake-Förmchen fertigte sie Kugeln, aus Garderobenhaken glitzernde Sterne, aus Kiefernzapfen Schwäne … die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Nun war die gesamte Redaktion über und über mit handgemachter Weihnachtsseligkeit behängt. Und schon den ganzen Tag lang bestand die größte Herausforderung darin, bei der Arbeit die köstlichen Gerüche zu ignorieren, die aus ihrer bescheidenen kleinen Küche drangen. Grace hatte für den Anlass sogar eine Playlist erstellt, und Stella berichtete Hannah hinter vorgehaltener Hand, dass sich der Anteil frommer Jesus-Gesänge zum Glück in erträglichen Grenzen hielt.
Nun war es acht Uhr, und entgegen aller Wahrscheinlichkeit und bisherigen Erfahrungen, war die aktuelle Ausgabe tatsächlich bereit, in trockene Tücher gebracht zu werden.
»Vielleicht sollte ich lieber noch mal …«, begann Reggie.
»Nein!« Ox fiel ihm sofort ins Wort. »Du bist fertig. Wir sind fertig. Es ist geschafft.«
Reggie biss sich auf die Lippe und nickte.
»Also schön«, sagte Stella und schaute Hannah an. »Zeit, dass du Ebenezer Scrooge Bescheid sagst.«
Alle zuckten zusammen, als Banecrofts Stimme ertönte. »Nicht nötig. Und fertig sind wir erst, wenn ich sage, dass wir fertig sind.«
Hannah wirbelte herum und sah, dass er nur einen guten Meter hinter ihr stand. »Es kommt ja nicht oft vor, aber wenn Sie wollen, können Sie bemerkenswert leise sein, Vincent.«
»Ich bin wie der Wind«, erwiderte er. »Leise wispernd husche ich durch jede Nische und jeden Winkel in diesem Haus.« Eine Feststellung, die er mit einem munteren Furz unterstrich. Hannah hatte schon lange resigniert und sich damit abgefunden, dass er dies auf Knopfdruck hinbekam.
»Vincent!«, rief Grace missbilligend und kam aus dem Empfangsbereich in den Raum marschiert. »Bitte benehmen Sie sich und wahren Sie wenigstens das erwartbare Mindestmaß an Anstand.«
»Also unerwartet war das nun wirklich nicht«, sagte Reggie.
»Habe ich das richtig verstanden, wir sind fertig?«, fragte Grace. Ihre Augen strahlten hoffnungsvoll.
»Fertig sind wir, wenn ich sage, dass wir fertig sind«, wiederholte Banecroft eingeschnappt. Er wandte sich an Stella. »Hast du den Graffiti sprühenden Geist …«
»Auf Seite vier versetzt?«, beendete sie seinen Satz. »Ja, hab ich.«
»Was ist mit …«
»Die Außerirdischen-Entführung habe ich auf Seite zwei verlegt, zusammen mit dem Foto des Überlebenden besagter Entführung, der eine Ausgabe des Buches hochhält, das er über seine Erfahrung geschrieben hat. Direkt daneben ist Ihre Kritik, in der Sie darauf hinweisen, dass er zum großen Teil beim Drehbuch von E.T. und Leonard Nimoys Autobiografie ›Ich bin Spock‹ abgeschrieben hat.«
»Der Mann ist ein Scharlatan.«
Hannah ging davon aus, dass Banecroft sich auf den Außerirdischen-Entführungs-Autor bezog und nicht auf Nimoy. Aber wenn man vorankommen wollte, empfahl es sich, keine Nachfragen zu stellen.
»Ich habe auch das Kreuzworträtsel dreimal gegengeprüft«, fuhr Stella fort, »die Kleinanzeigen alphabetisch geordnet, Seite sechs umgestaltet, wie Sie es wollten, und die vierte Zeile des ›Spuk im Rathaus‹-Artikels gestrichen.«
»So ein feines Stück Prosa«, warf Reggie bekümmert ein.
»Sie sollen keine Prosa schreiben!«, blaffte Banecroft. »Sie sollen Nachrichten schreiben!«
»Das hat er«, sagte Hannah. »Das haben wir. Es ist vollbracht. Vincent, können wir jetzt bitte einfach beschließen, dass die Ausgabe fertig ist, und sie in Druck geben?«
Hannahs Blick kreuzte sich mit dem ihres Chefs. Sie hatte auch ihm im Vorfeld dringend nahegelegt, einmal in seinem Leben keinen Aufstand zu machen, wenn es darum ging, den Druck zu starten. Er hatte sich nicht im klassischen Sinne einverstanden erklärt – Banecroft erklärte sich niemals mit irgendetwas einverstanden –, aber er hatte auch nicht groß protestiert. Mehr konnte man wirklich nicht von ihm erwarten.
Nach einer langen Pause gab Banecroft schließlich nach. »Na schön.« Sein Gesichtsausdruck deutete stark darauf hin, dass ihm diese beiden Wörter körperliche Schmerzen verursachten.
»Okay«, sagte Stella, nachdem alle im Raum einen kollektiven Erleichterungsseufzer ausgestoßen hatten. »Dann sind wir startbereit. Ich muss nur noch …«
Ihr Computer stieß einen jener nervtötenden Synthi-Trompetenstöße aus.
»Was zum gottverd…«
»Stella!«, rief Grace empört.
Stella ignorierte sie. Sie schob ihren Stuhl zurück und deutete auf den Monitor. Ein Totenkopf mit Weihnachtsmannmütze war darauf aufgetaucht. »Ist das … will mich hier irgendwer auf den Arm nehmen?«
»Auf meinem Bildschirm ist das auch«, sagte Reggie.
»Auf meinem auch«, ergänzte Ox.
»Wenn irgendjemand von euch das für einen Scherz hält …«, begann Hannah. »Wir lachen alle gern, wenn’s passt, aber das ist jetzt wirklich nicht der beste Zeitpunkt für solche Streiche.« Angestrengt versuchte sie, nicht Ox anzuschauen.
»Nein«, erwiderte dieser. Sein beleidigter Ton ließ keinen Zweifel, dass er genau wusste, an wen sich Hannahs Worte richteten. »Das ist eindeutig kein Streich.«
Der grob animierte Schädel stieß ein schepperndes Lachen aus, das unvermittelt aus jedem einzelnen PC-Lautsprecher in den Raum drang. Alle schauten sich um.
»Was für eine Hollywood-Resterampen-Albernheit soll das denn nun wieder sein?«, blaffte Banecroft. »Ich mag es gar nicht, wenn hier jemand lacht! Schon gar nicht irgendwelche lächerlichen technischen Geräte!«
Der Schädel verschwand von den Bildschirmen, und schon füllten sie sich mit jeder Menge Text.
»Oh Gott«, sagte Ox. »Comic Sans. Das wahre Anzeichen eines gestörten Geistes.«
»Liebe Stranger Times …« Stella begann, den anderen die Nachricht vorzulesen. »Der Jüngste Tag ist nahe.«
Grace bekreuzigte sich zweimal.
»›Zu lange haben Sie sich geweigert, die Wahrheit mit der Welt zu teilen. Damit ist es nun vorbei, oder Sie werden niemals wieder eine Ausgabe veröffentlichen. Sie wissen, was Sie zu tun haben.‹ Und dann kommt eine Signatur: C. A. Horntail.« Stella hämmerte auf ihre Tastatur ein, versuchte vergeblich, die Kontrolle zurückzugewinnen.
»Klick bloß nichts an!«, sagte Reggie. »Könnte ein Virus sein.«
»Danke für die Warnung«, sagte Stella. »Nur haben wir erstens bereits einen Virus, und zweitens hat dieses Ding längst meinen gesamten Rechner gekapert.«
»Wer zur Hölle ist C. A. Horntail?«, fragte Hannah.
»Spielt keine Rolle«, knurrte Banecroft. »Wir verhandeln nicht mit Terroristen!«
Grace seufzte, und Hannah verspürte sofort ein schlechtes Gewissen. »Natürlich nicht, aber vielleicht könnten wir …«
»Niemals! Und niemand verlässt den Raum, bis wir das geklärt haben. Erst einmal würde ich gern erfahren, wie es sein kann, dass unser Sicherheitssystem kompromittiert wurde. Vielleicht kann der Leiter unser IT-Security das erklären?«
Banecroft drehte sich um und funkelte Ox wütend an. Dieser hob abwehrend die Hände. »Whoa, whoa, whoa! Seit wann bin ich hier der IT-Experte? Bloß weil ich Asiate bin?«
»Herrgott«, sagte Reggie. »Das ist wieder mal sowas von rassistisch.«
»Jep«, stimmte Stella zu.
Grace schnalzte vielsagend mit der Zunge und schüttelte den Kopf.
»Das ist tatsächlich ein bisschen …«, begann Hannah unsicher.
»Wenn ihr dann alle fertig damit seid, auf euren hohen Rössern durch die Gegend zu galoppieren«, sagte Banecroft. »Er ist der Leiter unserer IT, weil diese Zeitung vor drei Jahren viel Geld investiert hat, um ihn auf eine Sicherheitsfortbildung zu schicken.«
»Ist das so?«, fragte Reggie überrascht. »Woher wollen Sie das überhaupt wissen? Sie waren doch vor drei Jahren noch gar nicht hier. Ich übrigens auch nicht.«
»Es steht in seiner Personalakte.«
»Okay«, sagte Ox und trat vor. »Jetzt, wo Sie’s erwähnen, ich sollte damals zu diesem einwöchigen Kurs gehen, aber … im Geiste uneingeschränkter Aufrichtigkeit gebe ich lieber zu, dass ich mit dem Geld stattdessen drängende Spielschulden beglichen habe.«
Hannah zuckte zusammen. Wie sie alle wussten, hatte Ox gerade erst seine Spielsucht besiegt. Sie hatte mehrmals mit Banecroft darüber gesprochen und ihn gebeten, sensibel mit diesem heiklen Thema umzugehen. Gut, das war ein bisschen so, als wolle man den Klimawandel damit beenden, dass man der Sonne sagte, sie solle sich doch bitte mal mit dem Scheinen zurückhalten. Aber sie hatte es wenigstens versucht.
»Nun«, sagte Banecroft, »ironischerweise haben Sie dabei wohl mit unserer Sicherheit gespielt – und verloren.«
»Das ist Jahre her«, entgegnete Ox. »Was auch immer ich damals gelernt hätte, wäre heute sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Die Hacker lassen sich ja dauernd was Neues einfallen. Da könnte man genauso gut mit Pfeil und Bogen auf Panzer schießen.«
»Wir haben nicht mal eine Anti-Virus-Software«, fügte Reggie hinzu.
»Was wohl daran liegt, dass wir unser gesamtes IT-Budget auf der Pferderennbahn in Kempton verpulvert haben«, sagte Banecroft.
»Bleiben Sie fair«, warf Stella ein. »Unser System ist derartig veraltet, dass es auf kurz oder lang so kommen musste. Ich meine, ganz im Ernst, auf unseren Rechnern läuft immer noch ein Betriebssystem, das sich Windows 98 nennt. Das stammt aus … na ja, dem letzten Jahrhundert.«
»Ja«, sagte Reggie. »Wir sind die einzigen Menschen auf diesem Planeten, die immer noch die Microsoft-Büroklammer zu sehen kriegen. Das Ding ist letzte Woche auf meinem Monitor aufgeploppt und hat mich gefragt, warum ich es nicht endlich sterben lasse. Das war äußerst verstörend.«
»Nur ein schlechter Arbeiter gibt seinem Werkzeug die Schuld.«
»Und Arbeiter, die mit schlechten Werkzeugen arbeiten müssen«, entgegnete Reggie.
»Durchaus ein gutes Argument«, sagte Hannah. »Aber was noch wichtiger ist: Diese gegenseitigen Schuldzuweisungen bringen uns kein Stück weiter.«
Banecroft verengte die Augen. »Klingt ganz nach jemandem, der unklugerweise einen verdächtigen Anhang geöffnet hat.«
»Wir alle öffnen Anhänge. Die Leute schicken uns Woche für Woche die komischsten Sachen.«
»Genau«, bestätigte Stella. »Fast der gesamte Inhalt von Seite neun stammt aus einem Mail-Anhang.« Sie schaute niedergeschlagen auf ihren Bildschirm. »Zumindest war das bis eben noch der Fall …«
»Haben wir kein Back-up?«, fragte Hannah.
»Wo denn? Wir haben ja nicht mal mehr einen Drucker seit dem … Vorfall von letzter Woche.«
»Oh, ich verstehe«, sagte Banecroft. »Jetzt versuchen wir, mir die Schuld an dieser Katastrophe in die Schuhe zu schieben, ja? Als wäre ich irgendwie dafür verantwortlich, dass unser Drucker weder drucken konnte noch dazu in der Lage war, mit einem resoluten Versuch umzugehen, das Problem zu lösen.«
»Zu lösen?«, wiederholte Grace fassungslos. »Sie haben ihn aus dem Fenster geworfen!«
»Diamanten entstehen ausschließlich unter Druck«, erwiderte Banecroft.
»Wo soll da bitte der Zusammenhang sein?«, fragte Reggie. »Wollen Sie behaupten, es wäre die Schuld des Druckers, dass er einen Sturz aus dem zweiten Stock nicht überlebt hat?«
»Heutzutage wird einfach nichts mehr für die Ewigkeit gebaut.«
»Also schön«, sagte Hannah mit lauter Stimme. »Das reicht! Jetzt beruhigen sich alle mal wieder. Ich bin mir sicher, wir können eine Lösung finden, wenn wir als Team zusammenarbeiten.«
Mit einem strengen Blick gab sie Stella zu verstehen, dass sie ihr verächtliches Schnaufen gehört hatte und in keiner Weise hilfreich fand. »Wartet mal«, warf sie ein. »Wir haben es doch schon mal geschafft, die Zeitung zu drucken, obwohl die Polizei unsere Rechner konfisziert hatte.«
»Ja«, sagte Stella, »aber damals hatte Manny bereits alle Fotos, und die Artikel waren auf meinem Handy. Diesmal habe ich weder das eine noch das andere …«
»Hannah hat Recht«, sagte Banecroft. »Hier werden jetzt augenblicklich alle Schotten dichtgemacht. Weihnachten fällt aus, und niemand verlässt das Haus, bis wir das geklärt haben.«
»Moment. Was? Das habe ich nicht gesagt. Wann habe ich das gesagt?«, rief Hannah.
Banecroft schlug die Hände zusammen und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Grace?«
Grace schüttelte den Kopf. »Dann gehe ich mal los und hole die Groll-Akte mit den Beschwerdebriefen.«
»Die Groll-Akte?«, wiederholte Stella.
»Kleinen Moment mal«, warf Ox ein. »Apropos Akte – können wir kurz noch mal darauf zurückkommen, dass es hier offenbar Personalakten über uns gibt?«
»Ich habe sie letzte Woche in der untersten Schublade von meinem Schreibtisch gefunden«, sagte Banecroft. »Während ich nach etwas gesucht habe, das ich verlegt hatte.«
»Verlegt oder ausgetrunken?«, fragte Stella.
Banecroft ignorierte ihren gehässigen Einwurf. Sie war die Einzige, der der Luxus vergönnt war, mit so etwas durchzukommen. »Mein Vorgänger muss die Akten dort abgelegt haben.«
»Barry hat Akten über uns geführt?«, fragte Ox, der ziemlich entsetzt aussah.
»Ja, sowie einen Ordner voller Fan-Fiction erotischer Natur, die er über ein Fernsehmoderatoren-Duo geschrieben hatte. Ehrlich gesagt, ist der Text verstörend explizit.«
»Ich verlange, das zu sehen!«, sagte Reggie. Dann errötete er. »Meine Personalakte, meine ich.«
»Natürlich«, sagte Banecroft. »Wir sind das Opfer eines Cyber-Angriffs, aber gönnen wir uns doch ruhig die Zeit, um in aller Ruhe Ihre Rechte auf Informationsfreiheit zu diskutieren. Grace, warum dauert das so lange?«
»Wie immer, Vincent, besteht kein Grund, zu schreien«, sagte sie, als sie mit einem großen Pappordner im Arm zurückkehrte. »Bitte sehr.«
»Das ist die Groll-Akte?«, fragte Hannah – schockiert über den gewaltigen Umfang der Unterlagen.
Grace stieß ein freudloses Lachen aus. »Oh nein, das ist bloß der Bereich A bis D.« Sie warf Banecroft einen vielsagenden Blick zu. »So schwer es auch zu glauben ist, wir haben in letzter Zeit ziemlich viele Leute verärgert.«
»Wenn man Leute nicht gegen sich aufbringt«, sagte Banecroft, »macht man keinen guten Journalismus.«
Ox ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen. »Herzlichen Glückwunsch, Chef. Dann kann Ihnen wirklich kein Journalist auf dieser Welt das Wasser reichen.«
Kapitel 3
Eines hatte Detective Inspector Sturgess gelernt: Ein Anruf mitten in der Nacht hatte nie etwas Gutes zu bedeuten. Auf der Fahrt ins Stadtzentrum dachte er darüber nach, was um diese Uhrzeit überhaupt als gute Nachricht durchgehen würde. »Glückwunsch, Sie sind Großmutter/Großvater geworden, Mutter und Kind geht es gut.« Das wäre wohl eine Möglichkeit. Unwahrscheinlich in seinem Fall, schließlich hatte er keine Kinder, und bedachte man, in welchem Zustand sich sein Liebesleben befand, würde sich wohl auch so bald nichts daran ändern. Mit spontanen Sex-Dates konnte er gleichfalls kaum rechnen. Dabei war er gerade mal Mitte dreißig, Single und recht gut in Form. Er konnte sich den Gedanken nicht verkneifen, dass solche Verabredungen eigentlich nicht außerhalb seiner Möglichkeiten lagen. Leider gab es ein doppeltes Problem: erstens seine zwanghafte Arbeitswut, zweitens seine Unfähigkeit, eine Beziehung am Leben zu erhalten …
Nun blieb ihm aber sowieso keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Eins stand fest: Sollte er jemals mitten in der Nacht einen Anruf mit guten Nachrichten erhalten, dann garantiert nicht von DI Sam Clarke. Die beiden waren nie gut miteinander ausgekommen, nicht einmal, bevor Sturgess sein »besonderes Steckenpferd« gefunden hatte – eine euphemistische Formulierung von einem seiner Vorgesetzten. Er wusste mit Sicherheit, dass der weitaus deutlichere Ausdruck »übernatürlicher Stuss« von Clarke stammte, und natürlich hatte dieser sich bei all seinen Kollegen durchgesetzt. Clarke hatte ein Talent, wenn es um das Erfinden solcher Gehässigkeiten ging, das war immer so bei Leuten, denen es eine Freude machte, andere zu tyrannisieren. Sturgess fand solch ein Verhalten instinktiv abstoßend, ihre gegenseitige Antipathie war also gewissermaßen naturgegeben. Bedauerlicherweise war Clarke nicht nur ein echter Experte darin, andere herunterzumachen, sondern auch darin, die Karriereleiter hochzuklettern. Trotz minimaler Begabung war er so zu einem der aufgehenden Sterne am Himmel der Greater Manchester Police geworden. Im Gegensatz zu Sturgess. Soweit er wusste, war er der einzige Beamte, dem man jemals ein Büro außerhalb einer Dienststelle zugewiesen hatte – nur, um leichter vergessen zu können, dass er überhaupt existierte.
Der Anruf überraschte ihn umso mehr, da Sturgess schon seit mehreren Monaten nichts mehr von Clarke gehört hatte. Genauer gesagt, seit dem Herbst, als Clarke mit seiner hoch gepriesenen Drogensonderkommission aufgrund der von Sturgess beschafften Informationen eine Farm draußen in Saddleworth gestürmt hatte. Die ganze Aktion war als leichter Sieg gedacht gewesen und als gute Gelegenheit, um ein paar heldenhafte Fotos in die Presse zu bekommen. Sturgess hatte vergeblich versucht, ihnen das auszureden. Dann aber hatten sie dem übernatürlichen Stuss Auge in Auge gegenübergestanden. Nicht einmal Clarke war in der Lage gewesen, all das mit logischen Erklärungen abzutun. Seitdem galt auch er nicht mehr als vielversprechender Hoffnungsträger. Zwei Mitglieder des bewaffneten Einsatzkommandos hatten ihr Leben verloren, und rasch war eine interne Untersuchung angeordnet worden. Das offizielle Ergebnis hatte nicht das Geringste mit der Wahrheit zu tun, Clarkes weiße Weste aber war seitdem befleckt.
Der Anruf hatte nicht lange gedauert. »Wir brauchen Sie bei der Man Met Universitätsbibliothek im John Dalton Building. Sofort. Befehl vom Boss.«
Sturgess hatte sein Ziel erreicht und parkte hinter einem Wagen, den er sofort erkannte. DS Andrea Wilkerson stand daneben, einen Becher Kaffee in der einen, eine Dose Cola light in der anderen Hand. Sie nickte ihm zu. »Chef.«
»Tut mir leid, Andrea.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Schlaf wird überbewertet. Jetzt muss ich wenigstens nicht ins Fitnessstudio.« Sie reichte ihm die Dose, während sie auf dem Weg zum Gebäude in ihren üblichen Gleichschritt fielen.
»Sie retten mir das Leben«, sagte Sturgess und öffnete die Cola.
»Hör ich nicht zum ersten Mal. Gibt’s irgendwelche weiteren Infos?«
»Nichts. Es hieß bloß: Kommen Sie sofort her.«
»Clarke – hilfreich wie eh und je.«
Wenn das überhaupt möglich war, schien Wilkerson eine noch geringere Meinung vom Detective Inspector zu haben als Sturgess. Er war jedoch nie dahintergekommen, was dieser Abneigung zugrunde lag. Vor Kurzem war sie dazu abbestellt worden, in Vollzeit für Sturgess zu arbeiten, ein stillschweigendes Zugeständnis, dass es im Laufe der vergangenen sechs Monate einen dramatischen Anstieg von Vorfällen gegeben hatte, die in seinen »Spezialbereich« fielen. Er bezweifelte stark, dass es in der gesamten Maschinerie der Greater Manchester Police auch nur ein einziges offizielles Dokument gab, in dem geschrieben stand, was genau das überhaupt war.
Die Manchester Met University, kurz MMU, war eine von zwei großen Universitäten der Stadt. Beide Bildungseinrichtungen schienen beständig zu wachsen, denn nicht nur hatten sie einen hervorragenden Ruf, die jungen Leute zogen auch gern nach Manchester, weil ihnen das Nachtleben hier deutlich vielversprechender erschien als beispielsweise in Hull. Dies brachte mit sich, dass die hohen Tiere sehr sensibel reagierten, wenn eine der beiden Hochschulen in polizeiliche Ermittlungen verstrickt wurde.
Das Bibliotheksgebäude wirkte mit seinem 70er-Jahre-Flair im Kontrast zu den modernen Hochglanzbauwerken, die es umgaben, völlig veraltet. Sturgess meinte sich schwach zu erinnern, dass man die alte Bibliothek abreißen und gegen ein funkelndes dreizehnstöckiges Monstrum ersetzen wollte, das zweifelsohne vor Wissen nur so überquellen würde.
Um 3:32 Uhr war es auf dem Campus so ruhig, wie man es an einer belebten Straße wie der Oxford Road erwarten konnte. Einige versprengte Nachteulen, die gerade aus den Clubs kamen, zogen an ihnen vorbei und kreuzten die Wege mit Frühaufstehern, die im verbissenen Powerwalk-Modus dem Beginn ihrer Arbeitsschicht entgegeneilten.
Sturgess und Wilkerson marschierten auf die beiden Polizistinnen zu, die vor dem Absperrband Position bezogen hatten und eine Handvoll Gaffer auf Abstand hielten. Zu ihnen gehörte auch ein junges Mädchen, das sich schwer an seinen großen Freund lehnte. Vieles deutete darauf hin, dass sie sich dringend hinlegen sollte, bevor sie einfach umfiel.
Als sie sich näherten, schnappte Sturgess einige Worte des jungen Burschen auf – leicht lallend, aber voller Selbstvertrauen: »Ich bin Student an dieser Universität, also habe ich ein Recht darauf, zu erfahren, was hier los ist!«
»Nein«, erwiderte die ältere der beiden Kolleginnen und klang dabei so müde, wie Sturgess sich fühlte. »Das haben Sie nicht, Sir. Und jetzt gehen Sie bitte weiter.«
Sie schenkte Sturgess und Wilkerson zur Begrüßung ein kurzes Nicken. Beeindruckenderweise schaffte sie es, dabei nicht die Augen zu verdrehen.
»Ich verlange, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen!«, forderte der junge Bursche.
»Jacob«, sagte seine Freundin in einem erschöpften Jammerton, »können wir nicht einfach …«
»Hier geht’s ums Prinzip!«
Wilkerson blieb stehen. »DS Andrea Wilkerson, Sir. Ich stehe Ihnen gern zur …« Sie hielt inne. »Verzeihen Sie, aber ich komme nicht umhin, zu bemerken, dass Ihre Wangen gerötet und Ihre Pupillen geweitet sind. Sie haben nicht zufällig ungesetzliche Betäubungsmittel konsumiert?«
Mit einem plötzlichen Anfall neu gewonnener Energie befreite sich die Freundin aus Jacobs Arm und marschierte eilig davon. Die Rötung verschwand aus Jacobs Gesicht. »A-absolut nicht«, stammelte er. »Ich bin … ich sehe, Sie sind beschäftigt, Officer. Machen Sie weiter.«
Damit wirbelte er auf dem Absatz herum und versuchte, seine Freundin einzuholen, die bereits in Sprintgeschwindigkeit ausgebrochen war.
Wilkerson wandte sich ihren uniformierten Kolleginnen zu und grinste. »Hat dieser kleine Wichser mir gerade gesagt, dass ich weitermachen soll?«
Sturgess biss sich auf die Zunge, während sie sich unter dem Absperrband hindurchduckten und ihren Weg zu dem Bibliotheksgebäude fortsetzten. Dann schaute er Wilkerson mit hochgezogener Augenbraue an.
»Schadet nichts, die Kollegen bei Laune zu halten«, sagte sie.
»Und es hat Ihnen Spaß gemacht.«
»Und es hat mir Spaß gemacht.«
Als sie am Campus-Park vorbeigingen, bemerkte Sturgess hinter einem der großen Bibliotheksfenster einen Mann im Spurensicherungsanzug. Er sprang so vehement über das Drehkreuz und stürmte mit derartigem Nachdruck zur Tür hinaus, dass der bereitstehende Beamte vor Schreck zusammenzuckte. Als sie um die Ecke bogen, sahen Wilkerson und Sturgess, wie der Kollege von der Spurensicherung sich die Maske vom Gesicht riss und sich erbrach. Sie tauschten einen weiteren Blick. Nun, da die Maske entfernt war, bemerkten sie den unverkennbaren roten Schnurrbart von John Brooker. Ein Polizeiveteran mit mehr als nur ein bisschen Berufsverfahrung.
Sie sagten kein Wort, aber der Schock stand ihnen überdeutlich ins Gesicht geschrieben. Was zur Hölle hatte dafür gesorgt, dass ein langgedienter Profi wie Brooker sein Abendessen wieder loswurde? Sturgess erhaschte noch einen kurzen Blick darauf, wie Brooker den Kollegen am Eingang von sich wegschob. Sie bewiesen genug Taktgefühl, ihn nicht weiter zu beachten, während sie das Gebäude betraten.
Hinter den Drehkreuzen erblickte Sturgess DI Clarke, der sich leise mit einem DS unterhielt, den er nicht kannte. Vier weitere Leute hielten sich im Eingangsbereich auf. Neben einem verängstigt aussehenden jungen Sicherheitsmann stand eine Frau im Reinigungskittel, die stinksauer zu sein schien. In der Nähe tröstete eine Frau von etwa sechzig Jahren einen untersetzten Mann von Mitte dreißig, der in ein Taschentuch weinte.
Als Clarke die Ankunft seiner Kollegen bemerkte, setzte er einen betont neutralen Gesichtsausdruck auf. »Tom. Andrea.« Er deutete mit dem Kopf zur Seite. »Es ist hier drüben.«
Nachdem sie ein paar Schritte zurückgelegt hatten, blieb Clarke stehen und sprach mit gesenkter Stimme. »Wir haben es mit mehreren Tötungsopfern zu tun.«
»Okay«, sagte Sturgess. »Wer hat sie gefunden – die Putzkraft oder der Sicherheitsmann?«
»Weder noch. Es war einer der Bibliotheksmitarbeiter. Ein gewisser Richard Duff.«
Wilkerson drehte sich noch einmal zu der Gruppe am Empfang um. »Und der ist mitten in der Nacht zu seinem Arbeitsplatz gekommen?«
»Sieht ganz so aus. Er hatte das vorher mit seiner Vorgesetzten so abgesprochen. Eigentlich wollte er heute im Laufe des Tages einen Flieger nehmen und keinen zusätzlichen Urlaubstag verschwenden.« Clarke blies die Wangen auf. »Nach allem, was er jetzt durchgemacht hat, kann er nun auch noch seinen gesamten Urlaub abschreiben. Das arme Schwein.«
Sturgess war schon angespannt genug, aber dass Clarke Mitgefühl für jemanden zeigte, der nicht er selbst war, ließ auch noch die letzten Alarmglocken läuten. »Was wissen wir sonst noch?«, fragte er.
»Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Opfern um die Mitglieder eines Buchclubs handelt – ist das zu fassen? Sie halten ihre Treffen abends in einem Mitarbeiterraum ab. Normalerweise wäre die Bibliothek noch offen gewesen, aber wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage hatte sie früher geschlossen.«
»Die Mitglieder sind also alle Mitarbeiter der Bibliothek?«
Clarke schüttelte den Kopf. »Nein. Wir glauben, nur zwei von ihnen, einschließlich Debra Brimson, auf die wir noch zu sprechen kommen – die anderen waren vermutlich Uni-Angestellte oder arbeiteten ganz woanders. Ich habe Rhys gesagt, dass er die Überwachungskameras auswerten und zweifelsfrei feststellen soll, wer heute Nacht die Bibliothek betreten und wieder verlassen hat. Wir …« Er hielt inne. »Wir sind uns nicht ganz sicher, was die Zahl der Opfer anbelangt. Drei oder vier.« Clarke schnappte Wilkersons verwirrten Blick auf. »Die Identifikation ist eine Katastrophe, wie Sie gleich sehen werden. Der Tatort … sieht nicht gut aus.«
Sturgess nickte. So hatte er Clarke noch nie erlebt. »Und niemandem ist irgendetwas aufgefallen, bis Mr Duff …«
Clarke schüttelte den Kopf und stieß ein kurzes Lachen aus, dem jede Freude fehlte. »So dumm sich das auch anhört, weder die Sicherheitsleute noch die Putzkräfte sind in den letzten vierzehn Tagen im Mitarbeiterbereich gewesen. Wie’s aussieht, hat es da ein ziemliches Zerwürfnis gegeben, nachdem zwei Drittel einer Geburtstagstorte verschwunden waren.«
»Herrgott«, murmelte Wilkerson.
»Ja. Es wurde erst Alarm geschlagen, als die Putzkraft Duffs Schreie gehört hat.«
»Aber wir wissen, dass diese Debra Brimson eines der Opfer ist?«, fragte Sturgess.
Clarke schüttelte erneut den Kopf. »Nein. Wir haben sie bereits auf den Aufnahmen der Überwachungskameras gesehen. Vor zwei Stunden hat sie seelenruhig das Gebäude verlassen – über und über mit Blut bedeckt.«
»Wir gehen also davon aus, dass sie die Taten begangen hat?«
»Ich nehm’s an«, sagte Clarke.
»Sie nehmen es an?« Sturgess gelang es nicht, den ungläubigen Ton in seiner Stimme zu verbergen.
Clarke schien wieder zu sich zu kommen, aber er sträubte sich sichtbar. »Ich habe einen Haftbefehl gegen sie erlassen und mehrere Einheiten vor ihrem Haus in Stellung gebracht. In ihrem Zustand kann sie nicht allzu weit gekommen sein. Aber Sie haben den Tatort nicht gesehen. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Frau – eine einzelne Frau – sowas getan haben soll.«
»Verstehe. Klingt nach einer ziemlichen Sauerei. Aber Sie sind sich sicher, dass dies … ein Fall für uns ist?«
Clarke war dafür bekannt, Sturgess und sein Spezialgebiet lautstark in den Dreck zu ziehen, wenn es so aussah, als könne es seine ach-so-wichtige Statistik der erfolgreich abgeschlossenen Fälle verschlechtern. Dieser Fall würde viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und er verfügte bereits über eine wasserdichte Hauptverdächtige. Was auch immer hinter seinem Verhalten steckte, politische Machtspielchen waren es diesmal nicht.
»Es ist …« Clarke schaute auf und stellte zum ersten Mal Blickkontakt mit Sturgess her. »Das Beste wird sein, Sie schauen es sich selber an.«
Und damit führte er sie auf die Ausleihtresen zu und zum Tatort.
Kapitel 4
Keine Party ist so schön wie eine Party bei der Stranger Times!« Zumindest behauptete dies das Schild an der Wand. Wobei – nicht mehr. Es hatte auf der ursprünglichen Version gestanden, die von Grace angefertigt worden war. Dann aber hatte Hannah bemerkt, dass Grace jedes Mal einen kurzen Blick darauf warf, wenn sie durch den Empfangsbereich marschierte. Bis etwa drei Uhr morgens war es in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben, dann hatten sie einige Worte durchgestrichen. Nun stand da: »Keine Party bei der Stranger Times« – was der düsteren Stimmung in der Redaktion weitaus mehr entsprach.
Wobei sich durchaus einiges erfüllte, was für die Festivitäten des Abends vorgesehen gewesen war: Die Belegschaft saß herum und redete, und nach einigen Stunden teilte Grace auch die Partysnacks aus, die sie so liebevoll zubereitet hatte. Das, was Banecroft immer wieder hämisch lachend als das »IT-System der Stranger Times« bezeichnete, war gehackt worden – und es war klar, dass sich dieses Problem nicht so einfach lösen ließ. Hannah fühlte sich schrecklich, aber unglücklicherweise hatte ihr derzeitiges Missgeschick all die schönen Pläne ihrer Büroleiterin zunichtegemacht.
Hannah warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Großer Gott! Es war tatsächlich schon sechseinhalb Stunden her, seit der geheimnisvolle und äußerst ärgerliche C. A. Horntail jeden einzelnen Computer in diesem Gebäude unter seine Kontrolle gebracht hatte. Inzwischen war ihr Hacker auch noch dazu übergangen, eine Art Kommunikation mit ihnen aufzunehmen. Dann und wann verschwand der lachende Schädel mit der Weihnachtsmannmütze von ihren Bildschirmen. Dann tauchten entweder Katzenfotos auf oder animierte Frösche, die intimen Umgang miteinander pflegten.