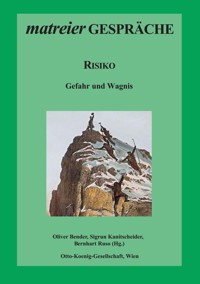
Risiko E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Matreier Gespräche zur Kulturethologie
- Sprache: Deutsch
Das Lehnwort "Risiko" soll dem griechisch-lateinischen Wort (rhiza/risco) für eine Klippe oder dem arabischen (rizq) für den schicksalsabhängigen Lebensunterhalt entstammen. Fachsprachlich wird es heute für eine Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses mit der Schadensschwere bei dessen Eintritt verwendet. Inhaltlich verwandte Begriffe sind "Gefahr" und "Wagnis", deren Bedeutungen sich mit "Risiko" überschneiden, was gelegentlich zu Missverständnissen führt. Die 47. Matreier Gespräche 2022 standen im Zeichen der großen Themen der Zeit - Klimawandel und Krieg -, befassten sich aber auch mit anscheinend weniger gravierenden Risikobeispielen, wie sie bei der Sprachverwendung, dem Klaubauflaufen, der Kapitalanlage oder im Hochgebirge entstehen können. In diesem Band beleuchten zwölf Tagungsbeiträge das Thema "Risiko" aus unterschiedlichsten fachlichen Perspektiven, um inter- und transdisziplinäre Querverbindungen herzustellen. Ein weiterer Beitrag blickt zurück auf 50 Jahre Matreier Gespräche und die Entstehungsgeschichte der Kulturethologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Wolfgang Bonß
Das Risiko und seine Grenzen. Zum Umgang mit Unsicherheit in modernen Gesellschaften
Dagmar Schmauks
Drückeberger oder Draufgänger? Der Umgang mit Risiken in Redewendungen
Achim Würker
Das Risiko, sich nicht korrekt auszudrücken. Die Gefahr von Ausgrenzung durch das falsche Wort.
Daniel Zerbin
Der Ukraine-Konflikt: Analyse eines riskanten Krieges in Europa
Thomas Simon
Unsicherheit und Risikoverhalten auf Kapitalmärkten
Martin Tiefenthaler
Die Risiken eines alten Brauchs – was eigentlich soll am Matreier Klaubauf-Gien gefährlich sein?
Christa Sütterlin
Kandinsky und der gelbe Klang. Zur Innovation des Blauen Reiters
Oliver Bender
Risiko Hochgebirge? – Eine kleine Risikogeschichte der Alpen
Martin Schönberg
Klimarisiken in der Energiewirtschaft
Klaus Nagel
Risiko – Simulationen und Berechnungen
Uwe Krebs
Risikoerhöhung durch Risikovermeidung?
Hans Winkler
Das Unbekannte: ein Problem mit vielen Lösungen
Max Liedtke
50 Jahre Matreier Gespräche – zur Entstehungsgeschichte einer Wissenschaft. Das Beispiel der ‚Kulturethologie‘, die Evolution von Kultur.
Verzeichnis der Autoren und Herausgeber
Vorwort
Die aktuellen globalen Entwicklungen im Zusammenhang von Klimakrise, Pandemie, Krieg und Versorgungsknappheit haben auch uns in der scheinbar saturierten ‚Ersten Welt‘ das Wissen um die Bedingtheit der menschlichen Existenz (vgl. Jaspers 1949) wieder deutlicher ins Bewusstsein gebracht. In ‚Zeiten wie diesen‘, wie es schon während der COVID-19-Pan-demie oft hieß, sind die großen Lebensrisiken wie tödliche Krankheiten, Krieg und Vernichtung, die wir in den letzten Jahrzehnten recht gut zu verdrängen gelernt hatten, subjektiv und objektiv wieder näher gerückt – und dies gilt erst recht für die permanenten Risiken des menschlichen Zusammenlebens wie wirtschaftliche Probleme und gesellschaftlicher Abstieg, gegen die wir uns zunehmend gut versichert gesehen hatten.
In der Etymologie wird als Herkunft des Lehnworts ‚Risiko‘ je nach Quelle meist entweder das griechisch-lateinische Wort (rhiza/risco) für eine Klippe als Schifffahrtshindernis oder das arabische Wort (rizq) für den vom Schicksal abhängigen Lebensunterhalt angeführt. Fachsprachlich versteht man heute unter einem Risiko eine Kombination der (im Gegensatz zur Unsicherheit/Ungewissheit zumindest begrenzt kalkulierbaren) Eintrittswahrscheinlichkeit eines als negativ angesehenen/unerwünschten Ereignisses in Kombination mit der Schadensschwere bei dessen Eintritt. Inhaltlich verwandte Begriffe sind ‚Gefahr‘ und ‚Wagnis‘, deren Bedeutungen sich teilweise mit ‚Risiko‘ überschneiden, was gelegentlich zu Missverständnissen Anlass gibt. Eine Gefahr besteht, sobald sich aus einer bestimmten Sachlage grundsätzlich eine schädliche Wirkung ergeben kann; daraus entsteht schließlich ein Risiko, wenn eine Person/ein Gegenstand dieser Gefahr ausgesetzt wird (Exposition). Im Gegensatz dazu ist ein Wagnis stets mit einer Handlung und einer ethischen Komponente verbunden. Ein Unfall lässt sich (fahrlässig) riskieren, aber nicht wagen. Wagnisse benötigen Risiken – Risiken können auch ohne Wagnis bestehen. Ein erweiterter Risikobegriff inkludiert neben der Verlustgefahr eine spekulative Gewinnchance: ‚kein Risiko ohne Chance, aber auch keine Chance ohne Risiko‘.
Eine Binsenweisheit verkündet, dass alle Risiken auch Chancen sind. Das wird von der Mode des positive thinking so umgedeutet, dass es nur noch Herausforderungen gäbe. In diesem Sinne könnte man auf Folgenabschätzungen verzichten und unkalkulierbare Wagnisse eingehen. Jedenfalls macht die ‚hohe Politik‘ immer mehr diesen Eindruck. Wie anders soll man auf die Idee kommen, in Europa einen Krieg zu provozieren, der leicht noch in einer Weise eskalieren kann, dass wir die Klima-Apokalypse gar nicht mehr abwenden müssen. Mit einer exakten Berechnung der Eskalationswahrscheinlichkeiten – bis hin zu einem Übergreifen des Krieges auf weitere Teile Europas und der Welt) brauchen wir uns gar nicht lange zu befassen, wenn der dann eintretende Schaden derart gigantisch ist (vgl. Bender 2022).
Der Risikobegriff ist in verschiedenen Disziplinen verankert, was im Folgenden nur ausschnitthaft und sehr vereinfachend angerissen werden kann. In den Umwelt-/Ingenieurwissenschaften ist ein Risiko im oben genannten Sinn als Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß nach ISO-Standard definiert. Im Vordergrund der Betrachtungen stehen methodische Probleme der Prognose. Innerhalb der Mathematik befassen sich Stochastik und Statistik mit entsprechenden Quantifizierungen (Wahrscheinlichkeitsrechnungen). Die Geographie als Brückenfach zwischen Natur- und Humanwissenschaften interessiert sich für objektive Risiken im Mensch-Umwelt-Verhältnis ebenso wie für deren Wahrnehmung und Begegnung durch soziale Gruppen und Gemeinschaften. Überschneidend damit ist in den Sozialwissenschaften die ‚Risikogesellschaft‘ (Beck 1986) intensiv rezipiert worden. Soziologie und deren ‚Systemtheorie‘ (Luhmann 1984) verwenden den Risikobegriff im Zusammenhang mit Entscheidungen von ‚Akteuren‘, die sich bestimmte Folgen in der Abwägung von Nutzen/Schaden davon erwarten. Die Ökonomie nutzt die Entscheidungstheorie als betriebswirtschaftliches Instrument; Unternehmens-, bankbetriebliche und Versicherungsrisiken zählen zu den Hauptanwendungsgebieten. In der Philosophie werden Risiko und Wagnis schließlich als ethische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Sinnhaftigkeit des Lebens betrachtet.
Für eine kulturethologische Betrachtung ist weniger das Risiko als solches zugänglich, sondern der menschliche Umgang damit, etwa dessen Entwicklung, ökologische Bedingtheit und Abhängigkeit von angeborenen Verhaltensweisen (vgl. Koenig 1970, 17). Alle Menschen sind allein wie auch besonders in ihrem Zusammenwirken Risiken ausgesetzt, denen sie infolge ihrer Risikowahrnehmung und -einstellung mit bestimmtem Risikoverhalten (Risikovermeidung, -minderung, -vorsorge etc.) begegnen können, diese aber letztlich nie in Gänze ausschließen können (Lebens-, Gesellschafts-, Umwelt-, Naturrisiken).
Eine aktuelle Ausgabe des ‚Spiegel Geschichte-Newsletters‘ (Leffers & Schnurr, 01.12.2022, unter Berufung auf Haffner 1940) behauptet, die Deutschen hätten 1933 „das drohende Unheil erkennen können“. Welches Unheil sollten wir heute erkennen und wie lange dürfen wir dafür brauchen? Beim Klimawandel hat es Jahrzehnte gebraucht, bis die Wissenschaft über den anthropogenen Temperaturanstieg hinreichend Sicherheit hatte. Können und müssen Politik und Gesellschaft jetzt nicht viel schneller sein, wenn wir noch ein erfolgreiches Risikomanagement zustande bringen wollen?
Als Risikomanagement versteht man die planvolle Aussteuerung von Risiken (Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung, -controlling) im Rahmen von Organisationsprozessen. Ein ‚Restrisiko‘ verbleibt, nachdem Adaptions- und/oder Schutzmaßnahmen getroffen worden sind. Als ‚Risikokultur‘ kann man in einem größeren Zusammenhang den gesellschaftlichen Umgang mit verschiedenen Risiken ansehen und einer vergleichenden Betrachtung unterziehen.
Die 47. Matreier Gespräche im Dezember 2022 knüpften an das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ der im April vorangegangenen 46. Tagung an, die mit der Feststellung von Nachhaltigkeitsdefiziten schon einige Aspekte vorskizziert hatte. Die Gespräche standen damit im Zeichen der großen Themen der Zeit – Klimawandel und Krieg –, befassten sich aber auch mit scheinbar weniger gravierenden Risikobeispielen, wie zum Beispiel Sprachverwendung, Klaubauflaufen, Ehebruch, Kapitalanlage und Waldbau, die aus unterschiedlichster fachlicher Perspektive vorgetragen und anschließend in inter-und transdisziplinärer Sichtweise diskutiert wurden. In die Tagung war eine Exkursion zum Hochgebirgsjägerbatallion nach Lienz integriert, die sich dem Thema Katastrophenschutz widmete. Leider konnten einige der Vorträge keinen Eingang in den Band finden. Insgesamt 13 Beiträge wurden schließlich für den vorliegenden Tagungsband aufbereitet, darunter ein Thema, das bei den Gesprächen nicht vorgetragen werden konnte.
Die einleitende Abhandlung von Wolfgang Bonß bietet eine Einführung in das Rahmenthema aus vorwiegend soziologischer Sicht, indem er ‚Risiko‘ als speziellen Typ der ‚Unsicherheit‘ historisch wie systematisch rekonstruiert und für eine neue ‚Risikokultur‘ plädiert.
Anschließend behandeln eine erste Gruppe von Beiträgen das ‚Risiko der Kommunikation‘: Dagmar Schmauks untersucht aus semiotischer Sicht Redewendungen, die den Umgang mit Risiken beschreiben. Achim Würker befasst sich mit dem Risiko, das der Gebrauch eines ‚falschen‘ Wortes bewirken kann, nämlich deswegen ausgegrenzt, ‚gecancelt‘ oder zensiert zu werden. Daniel Zerbin analysiert den aktuellen Ukraine-Krieg mithilfe der Allgemeinen Evolutionstheorie und ergänzt den Beitrag von Bender (2022) im letztjährigen Tagungsband um eine gänzlich andere Perspektive.
In einer zweiten Einheit geht es um das Risiko des Verhaltens. Thomas Simon beleuchtet Unsicherheit und Risikoverhalten auf Kapitalmärkten mittels der Entscheidungstheorie. Martin Tiefenthaler überprüft das alte Matreier Brauchtum des Klaubauf-Giens auf seine Gefährlichkeit. Und schließlich untersucht Christa Sütterlin das Risiko künstlerischer Innovationen am Beispiel von Kandinskys Blauem Reiter.
Die dritte Einheit verbindet einen Rück- und in einen Ausblick in sozialökologische Risiken. Oliver Bender versucht anhand einer Risikogeschichte der Alpen mit einem ‚Risikenkatalog‘ hochgebirgsspezifische Formen des Risikos herauszuarbeiten, während Martin Schönberg vor dem Hintergrund des aktuellen Klimawandels aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive Risiken für die Energiewirtschaft mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen zur Nachhaltigkeit abgleicht.
Die letzte thematische Einheit unter dem Titel ‚Leben in Unsicherheit‘ verhandelt allgemeinere und methodische Überlegungen. Klaus Nagel seziert das Thema Risiko anhand mathematischer Simulationen und Berechnungen auf Basis der Wahrscheinlichkeitstheorie. Uwe Krebs widmet sich anhand mehrerer Beispiele – besonders prominent aus der Landesverteidigung – der Frage, ob das Bemühen, Risiken zu vermeiden, diese nicht letztlich erhöhen kann. Der Beitrag von Hans Winkler studiert den Umgang mit dem Problem des Unbekannten anhand von Beispielen aus der Verhaltensforschung und verweist damit wieder auf die eingangs von Bonß erörterte Unsicherheit.
Die 47. Matreier Gespräche wollten auch zurückblicken und gedenken, wozu es im Jahr 2022 vielerlei Anlass gab. Max Liedtke blickt mit seiner langen persönlichen Teilnehmergeschichte auf 50 Jahre Matreier Gespräche zurück. Während der Tagung war auch zweier hochverdienter langjähriger Teilnehmer zu gedenken, die dem Matreier Kreis sehr viel gegeben hatten und im Jahr 2022 verstorben sind: Walther L. Fischer und Jürgen Zwernemann. Und last not least war daran zu erinnern, dass Otto Koenig, dem die Matreier Gespräche und die Formulierung der Kulturethologie überhaupt zu verdanken sind, vor 30 Jahren am 05.12.1992 – also während der laufenden Matreier Tagung – in Klosterneuburg verstorben ist.
Literatur
Beck, U. 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp. Frankfurt a. M.
Bender, O. 2022: Der Ukraine-Konflikt. Anmerkungen zur Nachhaltigkeit in der Geopolitik. – In: Bender, O., Kanitscheider, S., Ruso, B. (Hg.), Nachhaltigkeit. Das Fortbestehen komplexer Systeme. (= 46. Matreier Gespräche zur Kulturethologie 2022. Schriftenreihe der Otto-Koenig-Gesellschaft). BoD, Norderstedt, 113–153.
Haffner, S. 1940: Germany. Jekyll & Hyde. Translated from the German by W. David. Secker & Warburg. London. – Deutsch: Germany: Jekyll and Hyde. 1939. Deutschland von innen betrachtet. Aus dem Englischen von K. Baudisch. Verlag 1900. Berlin 1996.
Jaspers, K. 1949: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Piper. München.
Koenig, O.: 1970: Kultur und Verhaltensforschung. Einführung in die Kulturethologie. dtv. München.
Leffers, J., Schnurr, E.-M. 01.12.2022: Warum die Deutschen dem Nationalsozialismus verfielen. (= Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter). – www.spiegel.de/geschichte/geschichte-newsletter-warum-die-deutschen-dem-nationalsozialismus-verfielen-a-da0a81d6-c92a-4d86-8d92-ec1b1fb34c61 (Zugriff: 20.02.2023).
Luhmann, N. 1984: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp. Frankfurt a. M.
***
Zum Schluss bleibt wieder herzlich zu danken: der Gemeinde Matrei in Osttirol und der Familie Hradecky im Gasthof Hinteregger für die Gastfreundschaft, der Otto-Koenig-Gesellschaft und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern für die Ausrichtung der Tagung, dem Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für das Lektorat des Bandes und vor allem denjenigen bei der Tagung referierenden Kolleginnen und Kollegen, die wiederum rechtzeitig ihre Manuskripte zur Verfügung gestellt haben.
Innsbruck, im Oktober 2023
Die Herausgeber
Oliver Bender, Sigrun Kanitscheider und Bernhart Ruso
Wolfgang Bonß
Das Risiko und seine Grenzen. Zum Umgang mit Unsicherheit in modernen Gesellschaften
Zusammenfassung
‚Unsicherheit‘ wird in modernen Gesellschaften unterschiedlich perzipiert und eingeschätzt. Für die einen – und dies ist die Mehrheit – sind Unsicherheiten ein (negatives) ‚Ärgernis‘, das es zu beseitigen gilt. Für die anderen stellen sich Unsicherheiten als eine Herausforderung dar, die prinzipiell positiv ist, weil sie zu einem Umdenken und Innovation zwingt. In beiden Fällen wird Unsicherheit zumeist in einer spezifischen Form konstruiert und wahrgenommen, nämlich als ‚Risiko‘. Bei Risiken handelt es sich um einen besonderen Unsicherheitstypus, nämlich um Unsicherheiten, die handlungs- und entscheidungsbezogen entstehen, als haftbar perzipiert werden und in irgendeiner Weise als ‚kalkulierbar‘ gelten. Der vorliegende Beitrag zielt darauf ab, den Unsicherheitstypus ‚Risiko‘ historisch wie systematisch zu rekonstruieren und zu verdeutlichen, dass und wie er sich verändert – und damit auch der Umgang mit ihm. Dies zeigt nicht zuletzt die Unterscheidung zwischen ‚alten‘ und ‚neuen‘ Risiken. Letztere macht deutlich, dass es unter Umständen eines veränderten Umgangs mit ‚Risiken‘ bedarf und damit einer neuen ‚Risikokultur‘.
1 Unsicherheit als Ausgangsthema
Unsicherheit ist ein Phänomen, das nicht nur Menschen betrifft. Auch Tieren kann es passieren, dass sie nicht recht wissen, was zu tun ist. Allerdings sind deren Reaktionen instinktgesteuert und damit recht vorhersehbar. Bei Menschen hingegen ist die Instinktprägung nur noch in Schwundformen vorhanden. Zwar weist auch der Mensch in seinem Verhalten ‚Automatismen‘ auf. Aber sofern er grundsätzlich so oder auch anders handeln kann, ist er ‚weltoffen‘ und verfügt genau deshalb über eine grundsätzliche Erfahrung von Unsicherheit. Interessanter als diese existentielle Unsicherheit (die letztlich eine entscheidende Voraussetzung von Handlungsfähigkeit darstellt) ist freilich, dass der Umgang mit Unsicherheit bei den Menschen keineswegs einheitlich ausfällt. Wie die Menschen mit Unsicherheit umgehen, unterscheidet sich sowohl individuell wie gesellschaftlich. Oder anders formuliert: Was als Unsicherheit wahrgenommen wird, ist gesellschaftlich ebenso geprägt wie die Art und Weise, wie auf Unsicherheiten reagiert wird.
Was hiermit gemeint ist, lässt sich an dem von Mary Douglas und Aaron Wildavsky beschriebenen Fall der Lele verdeutlichen. Die Mitglieder dieses Stammes in der heutigen Republik Kongo haben eine relativ geringe Lebenserwartung und sind tagtäglich durch diverse Bedrohungen gefährdet. Diese reichen vom Schlangenbiss bis hin zu Infektionskrankheiten (vgl. Douglas & Wildavsky 1982, 7). Von der Vielzahl der Bedrohungen werden allerdings nur drei explizit wahrgenommen: Unfruchtbarkeit, die Möglichkeit vom Blitz erschlagen zu werden und Bronchitis. Die ‚Sicherheitsstrategien‘, also die Maßnahmen, mit denen sich die Lele vor Blitzschlag, Unfruchtbarkeit und Bronchitis zu schützen versuchen, entsprechen dabei kaum den Rationalitätskriterien, wie sie für Mitglieder okzidentaler Kulturen ‚normal‘ sind. So besteht die Bronchitisprävention nicht darin, sich um ‚heilklimatische Bedingungen‘ zu bemühen. Stattdessen kommen magische Praktiken zum Einsatz, wie Beschwörungen oder Amulette, und Ähnliches gilt für die Maßnahmen im Umgang mit Unfruchtbarkeit und Blitzschlag.
Für die Angehörigen des Lele-Stammes haben Bronchitis und Unfruchtbarkeit keine ‚somatischen‘ Ursachen; sie ‚erklären‘ sich vielmehr aus irgendwelchen Verfehlungen der Einzelnen, die aus okzidentaler Perspektive eher diffus anmuten. Denn die potentiellen Verfehlungen werden für die Lele letztlich nur ex post sichtbar und können den Handelnden selbst kaum aktiv zugerechnet werden. Sie verweisen auf das Wirken unheilvoller Kräfte, die andauernd wirken und gleichermaßen belohnen wie strafen können. Sie können die Menschen mit Krankheiten und Strafen überziehen, von denen man nicht weiß, ob und warum genau sie kommen. Sie sind den eigenen Handlungsmöglichkeiten entzogen, und gerade deshalb kann man den Gefahren auch nur mit magischen Praktiken begegnen.
Derartige magische Praktiken lassen sich nicht nur in Jäger- und Sammlergesellschaften beobachten. So waren abergläubische Sicherungsstrategien im europäischen Mittelalter ebenso verbreitet wie die traditionelle Naturfurcht, die erst mit der Aufklärung an Bedeutung verlor. Aber auch in modernen Gesellschaften sind magische Elemente bei der ‚Sicherheitsherstellung‘ verbreitet. Erinnert sei nur an die Beliebtheit des (vierblättrigen) Kleeblatts als Glücksbringer oder an die ‚Christophorus-Plakette‘, die das Fahrzeug (katholischer) Autobesitzer vor Unfällen schützen soll. Und auch auf Computergehäusen und Bildschirmen prangen nicht selten irgendwelche Talismane. Andererseits sind Kleeblatt, Christophorus-Plakette oder sonstige Glücksbringer nicht der Normalfall im Umgang mit Unsicherheit. Als typisch moderne Form kann vielmehr ein ganz spezifisches Unsicherheitskonzept gelten, nämlich das des Risikos. Letzteres wird meist in Abgrenzung vom Konzept der Gefahr beschrieben, und in der Tat gibt es Risiko und Gefahr als unterschiedliche Formen der Konstitution und Handhabung von Unsicherheit nur in der Moderne. Oder am Beispiel formuliert: Die Lele kennen sehr wohl Gefahren, die ‚irgendwie‘ von außen kommen; sie kennen aber keine Risiken, da dieser Typus von Unsicherheit an ein modernes Welt-und Selbstverständnis gebunden ist.
2 Die neuzeitliche Konzeption von Unsicherheit: Risiko
Eine solche, rational kalkulierende Einstellung gegenüber Unsicherheiten konnte erst zu einer bestimmten Zeit unter angebbaren gesellschaftlichen Voraussetzungen entstehen. Sie setzt das voraus, was Max Weber (1919, 16) als ‚okzidentale‘ „Rationalisierung“ und „Entzauberung der Welt“ bezeichnet hat. Für Weber verwies die okzidentale Rationalisierung weniger auf
„[...] eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne“ (ebd.).
Zwar konnte der italienische Kaufmann der frühen Neuzeit ebenso wenig wie seine Vorfahren dem Sturm Einhalt gebieten, und er besaß auch nicht unbedingt die Macht, Überfälle zu verhindern. Aber derartige Unsicherheiten wurden kaum noch als ‚schicksalhafte Bedrohung‘ angesehen. Stattdessen traten sie als ‚zu- und berechenbare Wagnisse‘ in den Blick, das heißt als Probleme, die sich nur dann negativ bemerkbar machten, wenn man falsch kalkulierte und keine Vorsichtsmaßnahmen traf. Der Gegensatz von ‚schicksalhafter Bedrohung‘ und ‚zurechenbarem Wagnis‘ verweist auf die entscheidende Veränderung. Wenn jemand, wie für Deutschland seit dem
16. Jahrhundert bezeugt, etwas uf unser Rysign nimmt, so gibt er damit zu erkennen, dass er die in Frage stehende Ungewissheit nicht als eine unbeeinflussbare Gefahr begreift, die durch Götter, Geister oder andere Mächte verursacht wird. Die Ungewissheit wird vielmehr als eine durch ihn selbst hervorgerufene und ihm daher auch selbst zurechenbare Schwierigkeit wahrgenommen. Nicht mehr das unkalkulierbare Wirken kosmologischer Mächte bestimmt die Welt. Ausschlaggebend ist vielmehr der Horizont der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Mit der Unterscheidung von gottbestimmten und menschlichen Unsicherheiten wird die Abgrenzung zwischen verschiedenen Unsicherheiten ebenso möglich wie die ‚Entdeckung‘ einer neuen Form unsicherer Wirklichkeiten – eben jene Ungewissheiten, die beispielsweise der risikobereite Kaufmann eingeht. Denn dessen Unsicherheiten wären gar nicht existent, wenn er nicht irgendeine Ware erlangen oder verkaufen wollte, und sie entstehen letztlich nur, weil er im Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten davon ausgeht, die unsichere Situation erfolgreich bewältigen zu können.
Systematisch gewendet bedeutet dies, dass als erstes und wichtigstes Charakteristikum des Risikokonzepts die ‚Handlungs- und Entscheidungsbezogenheit‘ von Risiken zu sehen ist. Ungewissheiten vom Typus ‚Gefahr‘ existieren unabhängig von den Handelnden; Unsicherheiten vom Typus ‚Risiko‘ hingegen entstehen im Lichte von Handlungsabsichten und deren Umsetzung. Oder anders ausgedrückt: ‚Gefahren‘ sind ‚subjekt- und situationsunabhängig‘; ‚Risiken‘ hingegen setzen stets die subjektbezogene Entscheidung für eine wie auch immer geartete Unsicherheit voraus, also die mehr oder weniger bewusste Entscheidung des beziehungsweise der Risikohandelnden. Oder am Beispiel formuliert: Ein drohender Felssturz in den Bergen ist eine ‚Gefahr‘, der Versuch, eine Bergwand zu besteigen, hingegen ein ‚Risiko‘. Diese Differenz wird auch in der modernen Entscheidungstheorie betont, wie sie in verschiedenen Varianten von der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre über die allgemeine Spieltheorie bis hin zu den aktuellen Rational Choice-Konzepten entwickelt worden ist (vgl. Laux 2003, 105ff.). Die Entscheidungstheorie definiert ‚Risiken‘ als ‚Entscheidungen unter Unsicherheit‘, die als solche ganz anders bewertet werden als die entscheidungsunabhängigen ‚Gefahren‘. Während Gefahren als subjektunabhängige Bedrohungen prinzipiell negativ bewertet werden, gilt dies für Risiken nicht. Risiken erscheinen nicht nur als Bedrohung, sondern ebenso sehr als Chance. Sie einzugehen bedeutet, etwas qua Entscheidung auszuprobieren, das zwar schiefgehen kann, aber im Erfolgsfall unter Umständen erhebliche Vorteile bietet. Letzteres ist in den letzten Jahrzehnten allerdings zunehmend in Vergessenheit geraten – angesichts von Atom- und Gentechnologie werden ‚Risiken‘ meist negativ bewertet. Aber sie sind eben keine Gefahren. Denn wer Risiken eingeht, hofft auf einen wie auch immer gearteten Gewinn und Vorteil, der nur dann zustande kommen kann, wenn die Handelnden etwas ‚wagen‘ und damit ‚riskieren‘.
Mit der Handlungs- und Entscheidungsbezogenheit eng verknüpft ist ein zweites Charakteristikum der Risiken, nämlich ihre ‚Zurechenbarkeit‘ und ‚Verantwortbarkeit‘. Zurechenbarkeit und Verantwortbarkeit spielen auch bei der alltäglichen Abgrenzung von Risiko und Gefahr eine Rolle. Als subjektunabhängige und letztlich unbeherrschbare Unsicherheiten können Gefahren nicht verantwortet werden. Bei Risiken hingegen sieht dies anders aus. Geht ein riskantes Unternehmen schief, dann kann (und muss) man einen Schuldigen finden. Denn als Versuch, etwas Neues zu erreichen, sind Risiken ein bewusstes Wagnis, für dessen Folgen die Handelnden, sofern sie als Handlungsträger identifizierbar sind, grundsätzlich geradestehen müssen. Und dies heißt auch: Unsicherheiten werden nur dann als Risiken wahrgenommen, wenn sie qua sozialer Konstruktion zurechenbar gemacht werden können (und zwar idealiter einem Aktor). Lässt sich diese Unterstellung, aus welchen Gründen auch immer, nicht sinnvoll machen, so erscheinen sie hingegen als Gefahren beziehungsweise verwandeln sich in solche. Letzteres ist gar nicht so selten. Bei der Explosion der Challenger-Raumfähre im Jahre 1986 beispielsweise war zunächst völlig unklar, warum es zur Explosion gekommen war. Solange hier keine Klarheit herrschte (ungefähr eine Woche lang), wurde daher durchaus erwogen, das Raumfahrtprogramm insgesamt abzubrechen – eben weil die mit ihm verknüpften Unsicherheiten nicht als zurechenbares und verantwortbares ‚Risiko‘ darstellbar waren (was sich in diesem Fall aber sehr schnell geändert hat).
Niklas Luhmann (1990 und 1991) hat freilich schon früh darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung von Risiko und Gefahr keineswegs eindeutig ist. Was sich für den einen als ein freiwillig eingegangenes Wagnis darstellt, das er zu verantworten hat, kann für den anderen eine unfreiwillige Bedrohung sein. So waren die Unsicherheiten, die der frühneuzeitliche Kaufmann im Seehandel einging, für die von ihm abhängigen Matrosen nur begrenzt ein Entscheidungsgegenstand; aus ihrer Perspektive, als Entscheidungsabhängige, handelt es sich eher um Gefahren, die unter Umständen tödlich enden konnten. Dass ein und derselbe Sachverhalt zugleich die Gestalt von Risiko und Gefahr annehmen kann, zeigt sich auch an neueren Beispielen. So fährt ein Geisterfahrer riskant, aber für alle anderen Straßenverkehrsteilnehmer ist er zunächst einmal eine Gefahr. Desgleichen sind die meisten Investitionsentscheidungen (ebenso wie ihre Unterlassung) ein Risiko für den Unternehmer und eine Gefahr für die Arbeitsplätze. Eine ähnliche Doppelstruktur kennzeichnet Prozesse wie die Zulassung von neuen Medikamenten, die Standortentscheidung für eine Mülldeponie oder die Gewährung der Betriebserlaubnis für eine gentechnologische Produktionsanlage. Hier handelt es sich um Risikoentscheidungen mit möglicherweise irreversiblen Negativfolgen, deren Realisierung zum Entscheidungszeitpunkt unter Umständen gar nicht absehbar war. In diesem Fall verwandelt sich also die Unsicherheit vom Typus Risiko unmerklich in eine Unsicherheit von Typus Gefahr (wobei in der Literatur von „Gefahren zweiter Ordnung“ (Bonß 1995, 80ff.) gesprochen wird, da sie ursprünglich als Risiken begonnen haben).
Ungeachtet dessen bleibt festzuhalten, dass Risiken handlungs- und entscheidungsbezogen und genau deshalb zurechenbar und verantwortbar sind. Allerdings – und damit kommen wir zum dritten Kriterium – ergeben Zurechenbarkeit und Verantwortbarkeit nur Sinn, wenn man davon überzeugt ist, das jeweilige Risiko auch tatsächlich beherrschen zu können. So waren die Fernkaufleute in der Regel weder verrückt noch tollkühn. Sie verfügten vielmehr über ein gesundes Selbstvertrauen und einen grundlegenden Glauben an die Berechenbarkeit der Welt, der seinen konkreten Ausdruck im Prinzip der rationalen Kalkulation findet. Als drittes Kennzeichen der Unsicherheiten vom Typus ‚Risiko‘ ist demnach die Unterstellung ihrer rationalen Beherrschbarkeit – oder genauer: ihrer ‚Berechenbarkeit‘ beziehungsweise ‚Kalkulierbarkeit‘ zu nennen. Denn die Kaufleute, die ihre Schiffe hinausschickten, waren davon überzeugt, die Risiken ihrer Unternehmungen aktiv bewältigen zu können. Zwar hatte der Gottesglaube in diesem Zusammenhang nach wie vor Bestand, und Unsicherheiten erschienen oftmals als gleichermaßen gestaltbar wie unbeeinflussbar (vgl. Scheller 2019, 10f.). Aber auch wenn das Wirken Gottes nicht ausgeschlossen wurde, so vertrauten die Kaufleute zunächst und vor allem auf ihre eigenen Fähigkeiten und Kalkulationen.
Der erfolgreiche Umgang mit Risiken galt dabei ursprünglich als eine Art ‚Kunst‘, die auf individuellen Fähigkeiten, Glück, Erfahrung und/oder Charisma beruht. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit unsicheren Situationen – und damit der Versuch, die ‚Kunst‘ der Risikobeherrschung in Wissen und Strategie zu verwandeln – setzte erst im 17. Jahrhundert ein. Entscheidend für die Ablösung der Verknüpfung von Risikobewältigung und ‚Kunst‘ war die Entdeckung beziehungsweise Erfindung der Wahrscheinlichkeitsrechnung (vgl. Hacking 1975; Desrosières 1993). Am Anfang der Wahrscheinlichkeitsrechnung als Strategie zum Umgang mit Unsicherheit stand dabei die Frage nach den Gewinnmöglichkeiten bei Würfelspielen. Hiermit befassten sich unter anderen Blaise Pascal (1623–1662) und später Jacob Bernoulli (1655–1705), dessen ‚Ars conjectandi‘ eines der ersten Bücher zur Wahrscheinlichkeitsrechnung bildete (Bernoulli 1713). Das Beispiel des Glückspiels verweist zugleich auf eine spezifische Perspektivsetzung. Denn im Vordergrund aller Überlegungen standen zunächst die Gewinnchancen und damit die ‚positiven‘ Risiken; die Verlustmöglichkeiten, also die ‚negativen‘ Risiken, rückten erst später ins Zentrum des Interesses. Wenn heute zwischen ‚Chancen und Risiken‘ einer Entscheidung, einer Technologie oder einer Entwicklung unterschieden wird, so macht dies deutlich, dass die ‚positiven‘ und ‚negativen‘ Aspekte des Risikos kaum mehr zusammen gedacht werden. Sie erscheinen vielmehr als zwei unterschiedliche Aspekte, die in der Regel mit verschiedenen Wörtern bedacht und strikt gegenübergestellt werden. Zwar gibt es auch hier Ausnahmen, etwa seitens der Welthandelsorganisation (WTO). Aber insbesondere im ‚Risikomanagement‘ sind die ‚Chancen‘ in der Regel kein Thema, sondern Risiken werden ausschließlich ‚negativ‘, also unter der Perspektive potentieller ‚Verlustgefahren‘ diskutiert (vgl. z. B. Romeike 2018).
Ungeachtet dessen – und dies ist hier wichtiger – kam es durch das Denken in Wahrscheinlichkeiten zu völlig neuen Kontingenzen im Umgang mit Unsicherheit. Wer in Wahrscheinlichkeiten denkt, relativiert die lebensweltlich erfahrene, vorgängige Strukturiertheit und Komplexität der Wirklichkeit. Wer die Welt als einen Zusammenhang von Wahrscheinlichkeiten begreift, nimmt die Struktur des Erscheinenden in reflexiver Distanz und unter einem größeren Zeithorizont wahr. Die Wirklichkeit wird gleichsam virtualisiert, nämlich in einen abstrakten Raum von Möglichkeiten aufgelöst, die kombiniert und kalkuliert werden können, und deren Realisierung sich gleichsam ‚hinter dem Rücken‘ der Handelnden vollzieht. Dass sich eine solche Perspektive nur sehr zögernd durchsetzen konnte, erstaunt kaum, und in der Alltagspraxis spielen probabilistische Kalkulationen bis heute nur eine begrenzte Rolle. Denn auch wenn alle und jeder von Risiken und Risikowahrscheinlichkeiten reden, so werden letztere oft falsch verstanden und eingeschätzt, und im Konfliktfall beruft man sich letztlich doch eher auf Kunst, Charisma und Glück (oder Pech).
Was Risikokalkulation bedeutet und wie sie funktioniert, lässt sich weiterführend an der Unterscheidung von risk und uncertainties studieren, wie sie vor rund einem Jahrhundert von Frank H. Knight (1921) formuliert worden ist. Für Knight waren risks ‚measurable uncertainties‘, also messbare Unsicherheiten. Bei messbaren Unsicherheiten handelt es sich um kalkulierbare und damit handhabbare Unsicherheiten. Technisch gesprochen sind hierunter Situationen zu verstehen, die als ein geschlossener Ereignisraum beschrieben werden können, dessen mögliche Ausgänge zwar nicht im Einzelnen, wohl aber in ihrer Gesamtheit bekannt sind. Das paradigmatische Beispiel hierfür ist das Würfelspiel. Das Würfelspiel ist insofern eine unsichere Angelegenheit, als niemand vorher wissen kann, wie der Würfel fallen wird. Bekannt ist allerdings die Gesamtheit der möglichen Ereignisse. Der Ereignisraum ist somit insofern ‚geschlossen‘, als es nur sechs unterschiedliche Ergebnisse geben kann; sollte ein Würfel einmal eine Sieben zeigen, so kann man getrost davon ausgehen, dass er falsch beschriftet worden ist. Und weil es sich um ein geschlossenes System mit klar definierten Rahmenbedingungen und eindeutigen Ergebnissen handelt, lässt sich problemlos eine Verteilungsfunktion erstellen und die Ereigniswahrscheinlichkeit berechnen, die in diesem Fall gleichverteilt ist – die Chance, eine bestimmte Zahl zu würfeln, beträgt bei einem geeichten Würfel mit sechs Seiten bekanntlich 1/6.
Weit häufiger als die eindeutigen Risiken, wie sie beim Würfelspiel, beim Lotto oder beim Roulette vorliegen, sind freilich jene Unsicherheiten, die den strengen Anforderungen der Messbarkeit nicht genügen und von Knight als uncertainties definiert wurden. Uncertainties zeichnen sich dadurch aus, dass bei ihnen kein geschlossener Ereignisraum gegeben und/oder die relative Wahrscheinlichkeit möglicher Einzelergebnisse unbekannt ist. Oder in Analogie zum Würfelbeispiel formuliert: Bei uncertainties sind auch Ergebnisse wie ‚Sieben‘ oder ‚Vierkommadrei‘ nicht ausgeschlossen, da unerwartete Resultate beziehungsweise Ergebnisvarianten auftreten können. Darüber hinaus – und dies ist letztlich noch wichtiger – besteht Unklarheit über die für die möglichen Ergebnisse verantwortlichen Wirkungsfaktoren, die oft nur zum Teil bekannt oder bestimmbar sind, so dass auch die relative Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses kaum so exakt berechnet werden kann wie von Knight gefordert.
Zwar zielt insbesondere die probabilistisch orientierte Risikoforschung darauf ab, uncertainties in berechenbare risks zu verwandeln. Aber diese dem Modell nach einleuchtende Strategie ist in der Praxis nur begrenzt realisierbar und auch nicht immer sinnvoll. So sind die gängigen Risikomodelle insbesondere bei ‚offenen‘ Risikosystemen angesichts des nur begrenzt bekannten Ereignisraums zwangsläufig unterkomplex und können gar nicht alle möglichen Einflussfaktoren erfassen und überprüfen. Hinzu kommt die in den letzten Jahren verstärkt thematisierte Beobachtung, dass Entscheidungen unter Unsicherheit offensichtlich nicht allein auf der Grundlage rationaler Kalkulation erfolgen. Sie sind vielmehr immer auch ‚Bauchentscheidungen‘ (Gigerenzer 2007), bei denen ‚Intuition‘ (Traufetter 2007) und Erfahrungen ebenso wichtig sind wie Kalkulation. Überdies haben die Untersuchungen von Unfällen bei Risikotechnologien gezeigt, dass die meisten kritischen Ereignisse eher als uncertainties zu charakterisieren sind. Denn Unfälle werden häufig dadurch ausgelöst, dass es zu „unerwarteten Interaktionen“ (Perrow 1987, 107) zwischen den Elementen eines Systems kommt, die in dieser Form in keinem Risikoszenario zu besagtem System vorgesehen waren und somit auch gar nicht vorab kalkuliert und überprüft sein konnten.
Zwar handelt es sich ausgerechnet bei dem Unglück von Tschernobyl nicht unbedingt um eine ‚unerwartete Interaktion‘, sondern um eine aus dem Ruder gelaufene Notabschaltung. Aber der (als paradigmatischer Fall ähnlich wichtige) Unfall von Three Mile Island bei Harrisburg (USA) im Jahre 1979 geht eindeutig auf unvorhergesehene beziehungsweise „komplexe Interaktionen“ (Perrow 1987, 115) zurück. Ähnliches gilt für zahlreiche andere spektakuläre Unglücke bis hin zum GAU in Fukushima im Jahre 2011. Und selbst der Anschlag auf das World Trade Center in New York im Jahre 2001 lässt sich in mancher Hinsicht als eine ‚unerwartete Interaktion‘ interpretieren. Denn dass voll besetzte und betankte Passagierflugzeuge zum Angriff auf Hochhäuser benutzt werden, war vor dem 11.09.2001 praktisch undenkbar und beim Bau der Häuser auch nicht einkalkuliert worden. Zwar werden derartige Möglichkeiten seither in den einschlägigen Szenarien berücksichtigt und treten daher nicht mehr als unerwartete Interaktionen in das Blickfeld (was übrigens zu vermehrten ‚erwarteten‘ Unsicherheiten geführt hat). Aber das Beispiel macht vor allem deutlich, dass Risikoentscheidungen und -systeme offener und komplexer sind als in den meisten probabilistischen Modellen unterstellt. Denn berücksichtigt werden kann letztlich immer nur ein Teil der potentiellen Probleme. Wenn aber nie alle Eventualitäten berücksichtigt werden können, dann wirft dies die (nach wie vor offene) Frage auf, welche Unsicherheiten in der Praxis wie berücksichtigt werden können und ob hier eher Erfahrung oder Berechenbarkeit die entscheidende Rolle spielen.
3 Zwischen Ärgernis und Herausforderung. Optionen zur Unsicherheit in der Moderne
Bei der Einschätzung von Unsicherheit und Ungewissheit für das menschliche Handeln lassen sich in der Moderne (und zwar in der Wissenschaft ebenso wie in der gesellschaftlichen Selbstthematisierung) unterschiedliche Positionen feststellen. Vorherrschend (und zugleich leitend für die konventionelle Risikoforschung) ist zunächst das, was man als ‚Standardposition‘ der Moderne im Verhältnis zur Unsicherheit bezeichnen könnte. Verdeutlichen lässt sich diese Standardposition an einem Statement von Talcott Parsons, einem der bedeutendsten Soziologen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts:
“Exposure to uncertainty is perhaps the most important negative aspect of what many have considered tobe the central feature of human life and action distinguished from lower forms of living systems” (Parsons 1980, 148).
Unsicherheit und Ungewissheit sind hiernach zum einen eine spezifisch menschliche Angelegenheit, und sie verweisen zugleich auf einen grundlegenden ‚Negativaspekt‘ des menschlichen Lebens. Denn das mit der Unsicherheit verbundene Nicht-Wissen um die Folgen des eigenen Tuns, so Parsons, schafft Bedrohungen, setzt Grenzen und schränkt die Beherrschbarkeit der Welt ein. Für Parsons ist uncertainty daher eine anthropologisch tiefsitzende ‚Negativerfahrung‘, und mit dieser Überzeugung stand er in der soziologischen Community keineswegs allein: Ähnliche Einschätzungen finden sich auch bei Autoren wie Durkheim oder Merton, für die Unsicherheit zugleich auf Entstrukturierung und Anomie verwies.
Aber bleiben wir bei Parsons: Sofern Unsicherheit und Ungewissheit die Menschen an der vollständigen Beherrschung der inneren und äußeren Natur hindern, sind sie für ihn nicht nur eine Negativerfahrung, sondern zugleich ein ‚Ärgernis‘, das beseitigt werden muss und auch kann, da die Fähigkeiten im Umgang mit Ungewissheit im Laufe der Evolution systematisch steigen. Zwar mag der Mensch am Anfang seiner Karriere von Unsicherheiten überwältigt gewesen sein, aber mit der Zeit lernt er, zunehmend bewusst und erfolgreich mit ihnen umzugehen. Oder in Parsons eigenen Worten:
“[...] in the process by which human individuals have become increasingly selfconscious and increasingly concerned to apply consciously formulated knowledge, the capacity to cope with uncertain contingencies very substantially increased” (ebd., 148).
Diese Feststellung verweist bereits auf den wichtigen, zweiten Teil der Standardposition der Moderne: Sofern durch den evolutionären Fortschritt die kognitiven Kapazitäten im Umgang mit Unsicherheit wachsen und die Berechenbarkeit der Welt durch den Fortschritt der Wissenschaft zunimmt, kommt es laut Parsons zu einer unaufhaltsamen Abnahme von Unsicherheit, die letztlich nach der Devise verläuft: ‚Zeit und Geld vorausgesetzt, lässt sich alles sicher machen.‘ Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik erscheint dementsprechend als fortschreitende Verbesserung der Kapazitäten zur Beherrschung der äußeren und inneren Natur und gleichzeitig als systematischer Anstieg von technischer, sozialer und kognitiver Sicherheit – eine Überzeugung, die nicht nur für Parsons, sondern für die meisten Theoretiker seiner Zeit kennzeichnend war.
Parsons ist bekanntlich 1979 gestorben. Ob er seine Überzeugungen auch noch nach den Erfahrungen von Harrisburg, Tschernobyl oder Nine Eleven umstandslos aufrechterhalten hätte, darf bezweifelt werden. Aber er hätte sich sicherlich nicht einer Position angeschlossen, wie sie zum Beispiel von (dem inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratenen) Felix von Cube formuliert wurde. Von Cube ging davon aus, dass die Menschen stets aktiv Unsicherheiten suchen, um Sicherheit zu gewinnen. Da „das Verwandeln von Unsicherheit in Sicherheit [...] mit Lust belohnt“ (von Cube 1990, 11) werde, sei Ungewissheit nicht nur ein unverzichtbares, sondern zugleich ein prinzipiell positives Element des evolutionären Fortschritts. Zwar wurden diese Thesen mit ihrer theoretischen Fundierung nur begrenzt aufgegriffen. Aber mit seiner positiven Charakterisierung der Ungewissheit traf sich von Cube mit anderen Autoren, und zwar insbesondere aus dem Bereich der Ökonomie. Exemplarisch sei auf den amerikanischen Unsicherheitstheoretiker Ronald Heiner (1983 und 1985) hingewiesen. Ausgehend von der These ‘Uncertainty generates flexibilityʼ beschreibt Heiner Unsicherheit als ein möglichkeitseröffnendes Moment, ohne das weder Innovationen noch gesellschaftliche Entwicklung denkbar wären. Für Heiner bleibt eine Gesellschaft nur dann entwicklungsfähig, wenn sie ein gewisses ‚Unsicherheitsniveau‘ bewahrt, also nicht darauf abzielt, Unsicherheiten zu beseitigen, sondern sie als ‚Herausforderung‘ begreift und als ‚Produktivitätsressource‘ bewusst zulässt (vgl. Heiner 1985, 364).
Ähnlich positive Einschätzungen der Unsicherheit finden sich etwa bei Aaron Wildavsky (1989a und b) oder bei der Bayerischen Rückversicherung (1987), die folgende These vertritt:
„Unsicherheit ist neben existentieller Vielfalt ein wichtiger struktureller Faktor gesellschaftlicher Entwicklung. Eine allgemeine Garantie permanenter Sicherheit dagegen bedeutet Stillstand, Stagnation, Erstarrung“ (ebd., 7).
Auch diese Formulierung markiert eine Gegenposition zu Parsons, die freilich weit undifferenzierter ist als die von Heiner. Denn Letzterer war und ist kein Unsicherheitsapologet. Ihm geht es eher um die bewusste Kultivierung von Unsicherheit und um die Bewahrung angemessener Unsicherheitsniveaus. Hiermit steht er wiederum in Gegensatz zu von Cube. Zwar ging auch von Cube davon aus, dass die Umwandlung von Ungewissheit in Sicherheit zur Institutionalisierung wachsender Sicherheitsniveaus führt. Aber genau diese Entwicklung, so seine These, setzt zugleich deren Gegenteil frei. Denn wachsende Sicherheitserfolge ermöglichen das Eingehen neuer, zuvor unbekannter Risiken, die immer größer und zum Teil zu ‚totalen‘ werden – ein Befund, der angesichts der Großkatastrophen im 20. Jahrhundert von unterschiedlichen Autoren geteilt wird, auch wenn sie von Cube im Detail keineswegs zustimmen.
Die Argumentationen von Parsons, Heiner und von Cube verdeutlichen sowohl die Bandbreite als auch die wichtigsten Varianten der heutigen Diskussion über den gesellschaftlichen Stellenwert von Unsicherheit und Ungewissheit. Dominierend ist nach wie vor die Lesart von Parsons, die letztlich auf eine Abwehr und Verdrängung von Unsicherheit bei gleichzeitig hochgradiger ‚Sicherheitsorientierung‘ hinausläuft. Denn uncertainties erscheinen als ein unabwendbares Ärgernis, das nur dadurch bewältigt werden kann, dass sie möglichst zum Verschwinden gebracht werden, also Unsicherheit in Sicherheit, Uneindeutigkeit in Eindeutigkeit und Chaos in Planung verwandelt wird. Wie Helmut Wiesenthal in seiner Diskussion der Figur des homo oeconomicus gezeigt hat, ist diese Optik in den Sozialwissenschaften ähnlich tief verwurzelt wie in den gängigen Common Sense-Ideologien. Letztlich wird hier wie dort „eine Pathologie der Unsicherheit suggeriert. Handelnde, Handlungen und Situationen erscheinen in dem Maße defizient, wie sie von Unsicherheit affiziert sind“ (Wiesenthal 1990, 47). Umgekehrt gelten Intentionalität und Situationskontrolle als Ausweis eines nicht-defizienten Handelns, das weiß, was es will und darauf abzielt, den Raum des Beherrschbaren zu vergrößern und das gesellschaftliche Sicherheitsniveau zu erhöhen.
Zwar ist die Behauptung sukzessiv sinkender Unsicherheits- beziehungsweise steigender Sicherheitsniveaus nach wie vor verbreitet. Aber angesichts spektakulärer technischer Katastrophen und neuer politisch-sozialer Ungewissheiten hat sie an Überzeugungskraft verloren, und zugleich fällt auf, dass sie letztlich nie unbestritten war. So wird in der sozialpolitischen Diskussion schon lange davon ausgegangen, dass „Unsicherheit [...] das kennzeichnende Erlebnis menschlichen Daseins im 20. Jahrhunderts [ist]“ (Möller 1960, 25). Wird dies akzeptiert, kann umgekehrt uncertainty nicht länger als ein letztlich zu vernachlässigendes Negativthema begriffen werden. Stattdessen stellt sie sich als ein issue dar, der unter den Bedingungen der ‚modernisierten Moderne‘ an Relevanz gewinnt und neue Theorieperspektiven erzwingt. In diesem Sinne fordert auch Helmut Wiesenthal eine Umkehr der ordnungspolitischen Optik à la Parsons. Basis und Bezugspunkt soziologischer Rekonstruktionen dürfe nicht das nach sicherer Naturbeherrschung strebende Individuum sein; statt Sicherheit müssten vielmehr „genuine Unsicherheit als raison d’être intentionaler Akteure und unsichere Handlungskontexte als Produkte des unsicherheitsbewußten Handelns angenommen werden“ (Wiesenthal 1990, 48) – ein Perspektivenwechsel, durch den letztlich der Blick von der Komplexität hin zur Kontingenz (und damit zur Unsicherheit) des Sozialen verschoben wird.
Dass sich die Theoriebildung eher an Unsicherheiten als an angeblich wachsenden Sicherheiten orientieren sollte, scheint nicht nur angesichts der empirisch beobachtbaren ‚Unsicherheitseinbrüche‘ erwägenswert. In systematischer Hinsicht spricht hierfür auch die “indeterministic structure of events” (Bonatti 1984, 111), wie sie in den wissenschafts- und wahrscheinlichkeitstheoretischen Diskussionen zunehmend behauptet wird. Allerdings ist dieses Bekenntnis zur Unsicherheit kein eindeutiges Votum. Ganz abgesehen von denen, die nach wie vor an der tradierten Sicherheitsoptik festhalten, lässt sich die Hinwendung zur Unsicherheit völlig unterschiedlich akzentuieren, nämlich als Chance und Bedrohung gleichermaßen. Oder am Beispiel von Heiner und von Cube formuliert: Für die einen (in diesem Falle Heiner) ist das Bekenntnis zur Unsicherheit gewollt und positiv; Unsicherheit verweist für Heiner auf neue Flexibilitäten, größere Kontingenz und mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Für die anderen (in diesem Fall von Cube) ist es erzwungen und negativ; für von Cube deutet die wachsende Unsicherheit auf (letztlich selbstverschuldete) neue Bedrohungen, die kaum mehr bewältigt werden können, sondern die Gefahr der Selbstvernichtung heraufbeschwören.
4 Entwicklungsphasen der Risikoforschung
Parsons, von Cube und Heiner haben keine Risikoforschung im engeren Sinne betrieben, sondern ‚nur‘ unterschiedliche Basisperspektiven der Einschätzung von (Un-)Sicherheit formuliert. Die bei ihnen beobachtbaren Differenzen zwischen der ‚Standard-‘ und der ‚Alternativposition‘ zur Unsicherheit in der Moderne sind aber auch in der Entwicklung der Risikoforschung selbst nachweisbar. Wie die einschlägigen Darstellungen (z. B. Banse 1996; Bechmann 1993) zeigen, lassen sich hier zumindest drei Phasen voneinander abgrenzen: Den Auftakt bildete das ‚Risk Assessment der ersten Generation‘, das zwischen 1950 und 1975 vorherrschend war. Diese stark naturwissenschaftlich-technisch orientierte Konzeption operierte mit der Idee wissenschaftlich ‚objektiver‘ Risiken, die vor dem Hintergrund probabilistischer Ansätze von Experten eindeutig festgestellt und bewertet werden (vgl. z. B. Rowe 1977 und 1983). Allerdings stieß dieses mit der ‚Standardposition‘ der Moderne höchst kompatible Konzept im Laufe der Zeit auf zwei Probleme: Zum einen erwiesen sich die einschlägigen Modelle insbesondere bei komplexen Anwendungsfällen wie Kernkraftwerken als unvollständig und nur begrenzt überprüfbar. Zum anderen stellte sich gerade bei den politischen Auseinandersetzungen heraus, dass die Laien die von den Experten festgestellten ‚objektiven‘ Risiken ganz anders bewerteten und beispielsweise Rauchen für vergleichsweise ungefährlich hielten, Kernkraftwerke hingegen nicht.





























