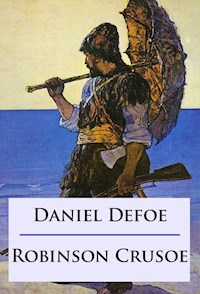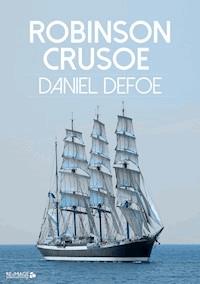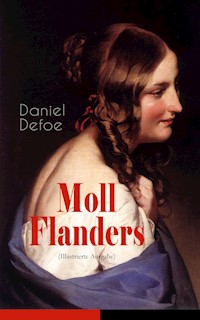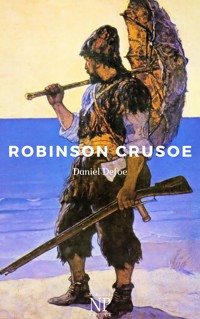
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Illustrierte und überarbeitete Ausgabe Robinson Crusoe ist ein Roman von Daniel Defoe, der die Geschichte eines Seemannes erzählt, der mehrere Jahre auf einer Insel als Schiffbrüchiger verbringt. Das Buch erschien 1719 und gilt als der erste englische Roman. Der junge Kaufmannssohn Robinson Crusoe setzt trotz der Ermahnungen seines Vaters die gesicherte Existenz in England aufs Spiel und versucht sein Glück im Überseehandel. Er erlebt spannende Abenteuer auf seinen ersten Reisen, bis er schließlich bei einem Sturm in der Karibik Schiffbruch erleidet und allein auf einerabgelegenen Insel strandet. Für Crusoe beginnt ein jahrelanger, abenteuerreicher Kampf ums Überleben. Die Geschichte von Robinson Crusoe kann auf das Leben des Abenteurers Alexander Selkirk zurückgeführt werden. Selkirk blieb vier Jahre und vier Monate auf einer Insel, auf die er nach einem Streit mit seinem Kapitän ausgesetzt wurde, bis er am 2. Februar 1709 gerettet wurde. Durch Selkirks Erlebnisse ließ sich Daniel Defoe vermutlich zu seinem Roman Robinson Crusoe anregen. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Illustrierte Fassung
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Illustrierte Fassung
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Carl Offterdinger, A. F. LydonÜbersetzung: Karl Altmüller EV: Bibliogr. Institut, Leipzig, Wien, 1917 5. Auflage, ISBN 978-3-954180-70-7
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Zum Roman
1. Robinsons Jugendjahre und erste Reisen
2. Sklaverei und Flucht
3. Aufenthalt in Brasilien, Reise und Schiffbruch
4. Arbeiten auf dem Schiffe und an seiner Wohnung
5. Das Erbeben
6. Die Krankheit
7. Erste Entdeckungsreise zu Lande
8. Die Ernte
9. Der Schiffsbau
10. Entdeckungsreise zu Wasser
11. Die Ziegenherde
12. Vestigia me terrant
13. Die Grotte
14. Das spanische Schiff
15. Die Kannibalen
16. Freitag
17. Erkundigungen
18. Die Geretteten
19. Die Freibeuter
20. Robinsons Abreise
21. Reisen
22. Neue Seereise
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Zum Roman
Robinson Crusoe ist ein Roman von Daniel Defoe, der die Geschichte eines Seemannes erzählt, der mehrere Jahre auf einer Insel als Schiffbrüchiger verbringt. Das Buch erschien 1719 und gilt als der erste englische Roman.
Der junge Kaufmannssohn Robinson Crusoe setzt trotz der Ermahnungen seines Vaters die gesicherte Existenz in England aufs Spiel und versucht sein Glück im Überseehandel. Er erlebt spannende Abenteuer auf seinen ersten Reisen, bis er schließlich bei einem Sturm in der Karibik Schiffbruch erleidet und allein auf einerabgelegenen Insel strandet. Für Crusoe beginnt ein jahrelanger, abenteuerreicher Kampf ums Überleben.
Die Geschichte von Robinson Crusoe kann auf das Leben des Abenteurers Alexander Selkirk zurückgeführt werden. Selkirk blieb vier Jahre und vier Monate auf einer Insel, auf die er nach einem Streit mit seinem Kapitän ausgesetzt wurde, bis er am 2. Februar 1709 gerettet wurde. Durch Selkirks Erlebnisse ließ sich Daniel Defoe vermutlich zu seinem Roman Robinson Crusoe anregen.
1. Robinsons Jugendjahre und erste Reisen
Ich bin geboren zu York im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich nicht aus jener Gegend stammten. Mein Vater, ein Ausländer, aus Bremen gebürtig, hatte sich zuerst in Hull1 niedergelassen, war dort als Kaufmann zu hübschem Vermögen gekommen und dann, nachdem er sein Geschäft aufgegeben hatte, nach York gezogen. Hier heiratete er meine Mutter, eine geborene Robinson. Nach der geachteten Familie, welcher sie angehörte, wurde ich Robinson Kreuznaer genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten, und so heißen wir jetzt Crusoe, nennen und schreiben uns sogar selbst so, und diesen Namen habe auch ich von jeher unter meinen Bekannten geführt.
Ich hatte zwei ältere Brüder. Der eine von ihnen, welcher als Oberstlieutenant bei einem englischen, früher von dem berühmten Oberst Lockhart befehligten Infanterieregiment in Flandern diente, fiel in der Schlacht bei Dünkirchen. Was aus dem jüngeren geworden ist, habe ich ebensowenig in Erfahrung bringen können, als meine Eltern je Kenntnis von meinen eignen Schicksalen erhalten haben.
Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Mein bereits bejahrter Vater hatte mich so viel lernen lassen, als durch die Erziehung im Hause und den Besuch einer Freischule auf dem Lande möglich ist. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Kein anderer Gedanke aber in Bezug auf meinen künftigen Beruf wollte mir behagen als der, Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem Zureden meiner Mutter, wie auch sonstiger mir freundlich gesinnter Menschen. Es schien, als habe das Schicksal in meine Natur einen unwiderstehlichen Drang gelegt, der mich gerades Wegs in künftiges Elend treiben sollte.
Mein Vater, der ein verständiger und ernster Mann war, durchschaute meine Pläne und suchte mich durch eindringliche Gegenvorstellungen von denselben abzubringen. Eines Morgens ließ er mich in sein Zimmer, das er wegen der Gicht hüten musste, kommen und sprach sich über jene Angelegenheit mit großer Wärme gegen mich aus. »Was für andere Gründe«, sagte er, »als die bloße Vorliebe für ein unstetes Leben, können dich bewegen, Vaterhaus und Heimat verlassen zu wollen, wo du dein gutes Unterkommen hast und bei Fleiß und Ausdauer in ruhigem und behaglichem Leben dein Glück machen kannst. Nur Leute in verzweifelter Lage, oder solche, die nach großen Dingen streben, gehen außer Landes auf Abenteuer aus, um sich durch Unternehmungen empor zu bringen und berühmt zu machen, die außerhalb der gewöhnlichen Bahn liegen. Solche Unternehmungen aber sind für dich entweder zu hoch oder zu gering. Du gehörst in den Mittelstand, in die Sphäre, welche man die höhere Region des gemeinen Lebens nennen könnte. Die aber ist, wie mich lange Erfahrung gelehrt hat, die beste in der Welt; in ihr gelangt man am sichersten zu irdischem Glück. Sie ist weder dem Elend und der Mühsal der nur von Händearbeit lebenden Menschenklasse ausgesetzt, noch wird sie von dem Hochmut, der Üppigkeit, dem Ehrgeiz und dem Neid, die in den höheren Sphären der Menschenwelt zu Hause sind, heimgesucht.«
»Am besten«, fügte er hinzu, »kannst du die Glückseligkeit des Mittelstandes daraus erkennen, dass er von Allen, die ihm nicht angehören, beneidet wird. Selbst Könige haben oft über die Misslichkeiten, die ihre hohe Geburt mit sich bringt, geklagt und gewünscht, in die Mitte der Extreme zwischen Hohe und Niedrige gestellt zu sein. Auch der Weise bezeugt, dass jener Stand der des wahren Glückes ist, indem er betet: ›Armut und Reichtum gib mir nicht‹.«
»Habe nur darauf Acht«, fuhr mein Vater fort, »so wirst du finden, dass das Elend der Menschheit zumeist an die höheren und niederen Schichten der Gesellschaft verteilt ist. Die, welche in der mittleren leben, werden am seltensten vom Missgeschick getroffen, sie sind minder den Wechselfällen des Glücks ausgesetzt, sie leiden bei weitem weniger an Missvergnügen und Unbehagen des Leibes und der Seele wie jene, die durch ausschweifend üppiges Leben auf der einen, durch harte Arbeit, Mangel am Notwendigen oder schlechten und unzulänglichen Lebensunterhalt auf der anderen Seite, in Folge ihrer natürlichen Lebensstellung geplagt sind. Der Mittelstand ist dazu angetan, alle Arten von Tugenden und Freuden gedeihen zu lassen. Friede und Genügsamkeit sind im Gefolge eines mäßigen Vermögens. Gemütsruhe, Geselligkeit, Gesundheit, Mäßigkeit, alle wirklich angenehmen Vergnügungen und wünschenswerten Erheiterungen sind die segensreichen Gefährten einer mittleren Lebensstellung. Auf der Mittelstraße kommt man still und gemächlich durch die Welt und sanft wieder heraus, ungeplagt von allzu schwerer Hand- oder Kopfarbeit, frei vom Sklavendienst ums tägliche Brot, unbeirrt durch verwickelte Verhältnisse, die der Seele die Ruhe, dem Leib die Rast entziehen, ohne Aufregung durch Neid, oder die im Herzen heimlich glühende Ehrbegierde nach großen Dingen. Dieser Weg führt vielmehr in gelassener Behaglichkeit durch das Dasein, gibt nur dessen Süßigkeiten, nicht aber auch seine Bitternisse zu kosten, er lässt die auf ihm wandeln mit jedem Tage mehr erfahren, wie gut es ihnen geworden ist.«
Hierauf drang mein Vater ernstlich und inständigst in mich, ich solle mich nicht gewaltsam in eine elende Lage stürzen, vor welcher die Natur, indem sie mich in meine jetzige Lebensstellung gebracht, mich sichtbarlich habe behüten wollen. Ich sei ja nicht gezwungen, meinen Unterhalt zu suchen. Er habe es gut mit mir vor und werde sich bemühen, mich in bequemer Weise in die Lebensbahn zu bringen, die er mir soeben gerühmt habe. Wenn es mir nicht wohl ergehe in der Welt, so sei das lediglich meine Schuld. Er habe keine Verantwortung dafür, nachdem er mich vor Unternehmungen gewarnt habe, die, wie er bestimmt wisse, zu meinem Verderben gereichen müssten. Er wolle alles Mögliche für mich tun, wenn ich daheim bleibe und seiner Anweisung gemäß meine Existenz begründe. Dagegen werde er sich dadurch nicht zum Mitschuldigen an meinem Missgeschick machen, dass er mein Vorhaben, in die Fremde zu gehen, irgendwie unterstütze. Schließlich hielt er mir das Beispiel meines älteren Bruders vor. Den habe er auch durch ernstliches Zureden abhalten wollen, in den niederländischen Krieg zu gehen. Dennoch sei derselbe seinen Gelüsten gefolgt und habe darum einen frühen Tod gefunden. »Ich werde zwar«, so endete mein Vater, »nicht aufhören, für dich zu beten, aber das sage ich dir im Voraus: wenn du deine törichten Pläne verfolgst, wird Gott seinen Segen nicht dazu geben, und du wirst vielleicht einmal Muße genug haben, darüber nachzudenken, dass du meinen Rat in den Wind geschlagen hast. Dann aber möchte wohl niemand da sein, der dir zur Umkehr behilflich sein kann.«
Bei diesen letzten Worten, die, was mein Vater wohl selbst kaum ahnte, wahrhaft prophetisch waren, strömten ihm, besonders als er meinen gefallenen Bruder erwähnte, die Tränen reichlich über das Gesicht. Als er von der Zeit der zu späten Reue sprach, geriet er in eine solche Bewegung, dass er nicht weiter reden konnte.
Ich war durch seine Worte in innerster Seele ergriffen, und wie hätte das anders sein können! Mein Entschluss stand fest, den Gedanken an die Fremde aufzugeben und mich, den Wünschen meines Vaters gemäß, zu Hause niederzulassen. Aber ach, schon nach wenigen Tagen waren diese guten Vorsätze verflogen, und um dem peinlichen Zureden meines Vaters zu entgehen, beschloss ich einige Wochen später, mich heimlich davon zu machen. Indes führte ich diese Absicht nicht in der Hitze des ersten Entschlusses aus, sondern nahm eines Tages meine Mutter, als sie ungewöhnlich guter Laune schien, bei Seite und erklärte ihr, mein Verlangen die Welt zu sehen gehe mir Tag und Nacht so sehr im Kopfe herum, dass ich Nichts zu Hause anfangen könnte, wobei ich Ausdauer genug zur Durchführung haben würde. »Mein Vater«, sagte ich, »täte besser, mich mit seiner Einwilligung gehen zu lassen als ohne sie. Ich bin im neunzehnten Jahre und zu alt, um noch die Kaufmannschaft zu erlernen oder mich auf eine Advokatur vorzubereiten. Wollte ich’s doch versuchen, so würde ich sicherlich nicht die gehörige Zeit aushalten, sondern meinem Prinzipal2 entlaufen und dann doch zur See gehen.« Ich bat die Mutter bei dem Vater zu befürworten, dass er mich eine Seereise zum Versuch machen lasse. Käme ich dann wieder und die Sache hätte mir nicht gefallen, so wollte ich nimmer fort und verspräche für diesen Fall, durch doppelten Fleiß das Versäumte wieder einzuholen.
Meine Mutter geriet über diese Mitteilung in große Bestürzung. Es würde vergebens sein, erwiderte sie, mit meinem Vater darüber zu sprechen, der wisse zu gut, was zu meinem Besten diene, um mir seine Einwilligung zu so gefährlichen Unternehmungen zu geben. »Ich wundere mich«, setzte sie hinzu, »dass du nach der Unterredung mit deinem Vater und nach seinen liebreichen Ermahnungen noch an so Etwas denken kannst. Wenn du dich absolut ins Verderben stürzen willst, so ist dir eben nicht zu helfen. Darauf aber darfst du dich verlassen, dass ich meine Einwilligung dir nie gebe und an deinem Unglück nicht irgend welchen Teil haben will. Auch werde ich niemals in Etwas einwilligen, was nicht die Zustimmung deines Vaters hat.«
Wie ich später erfuhr, war diese Unterredung von meiner Mutter, trotz ihrer Versicherung, dem Vater davon Nichts mitteilen zu wollen, ihm doch von Anfang bis zu Ende erzählt worden. Er war davon sehr betroffen gewesen und hatte seufzend geäußert: »Der Junge könnte nun zu Hause sein Glück machen, geht er aber in die Fremde, wird er der unglücklichste Mensch von der Welt werden; meine Zustimmung bekommt er nicht.«
Es währte beinahe noch ein volles Jahr, bis ich dennoch meinen Vorsatz ausführte. In dieser ganzen Zeit aber blieb ich taub gegen alle Vorschläge, ein Geschäft anzufangen, und machte meinen Eltern oftmals Vorwürfe darüber, dass sie sich dem, worauf meine ganze Neigung ging, so entschieden widersetzten.
Eines Tages befand ich mich zu Hull, wohin ich jedoch zufällig und ohne etwa Fluchtgedanken zu hegen, mich begeben hatte. Ich traf dort einen meiner Kameraden, der im Begriff stand, mit seines Vaters Schiff zur See nach London zu gehen. Er drang in mich, ihn zu begleiten, indem er nur die gewöhnliche Lockspeise der Seeleute, nämlich freie Fahrt, anbot. So geschah es, dass ich, ohne Vater oder Mutter um Rat zu fragen, ja ohne ihnen auch nur ein Wort zu sagen, unbegleitet von ihrem und Gottes Segen und ohne Rücksicht auf die Umstände und Folgen meiner Handlung, in böser Stunde (das weiß Gott!) am ersten September 1651 an Bord des nach London bestimmten Schiffes ging.
Niemals, glaube ich, haben die Missgeschicke eines jungen Abenteurers rascher ihren Anfang genommen und länger angehalten als die meinigen. Unser Schiff war kaum aus dem Humberfluss, als der Wind sich erhob und die See anfing fürchterlich hoch zu gehen. Ich war früher nie auf dem Meere gewesen und wurde daher leiblich unaussprechlich elend und im Gemüt von furchtbarem Schrecken erfüllt. Jetzt begann ich ernstlich darüber nachzudenken, was ich unternommen, und wie die gerechte Strafe des Himmels meiner böswilligen Entfernung vom Vaterhaus und meiner Pflichtvergessenheit alsbald auf dem Fuße gefolgt sei. Alle guten Ratschläge meiner Eltern, die Tränen des Vaters und der Mutter Bitten traten mir wieder vor die Seele, und mein damals noch nicht wie später abgehärtetes Gewissen machte mir bittere Vorwürfe über meine Pflichtwidrigkeit gegen Gott und die Eltern.
Inzwischen steigerte sich der Sturm, und das Meer schwoll stark, wenn auch bei weitem nicht so hoch, wie ich es später oft erlebt und schon einige Tage nachher gesehen habe. Doch reichte es hin, mich, als einen Neuling zur See und da ich völlig unerfahren in solchen Dingen war, zu entsetzen. Von jeder Woge meinte ich, sie würde uns verschlingen, und so oft das Schiff sich in einem Wellental befand war mir, als kämen wir nimmer wieder auf die Höhe. In dieser Seelenangst tat ich Gelübde in Menge und fasste die besten Entschlüsse. Wenn es Gott gefalle, mir das Leben auf dieser Reise zu erhalten, wenn ich jemals wieder den Fuß auf festes Land setzen dürfe, so wollte ich alsbald heim zu meinem Vater gehen und nie im Leben wieder ein Schiff betreten. Dann wollte ich den väterlichen Rat befolgen und mich nicht wieder in ein ähnliches Elend begeben. Jetzt erkannte ich klar die Richtigkeit der Bemerkungen über die goldene Mittelstraße des Lebens. Wie ruhig und behaglich hatte mein Vater sein Leben lang sich befunden, der sich nie den Stürmen des Meeres und den Kümmernissen zu Lande ausgesetzt hatte. Kurz, ich beschloss fest, mich aufzumachen gleich dem verlorenen Sohne und reuig zu meinem Vater zurückzukehren.
Diese weisen und verständigen Gedanken hielten jedoch nur Stand, so lange der Sturm währte und noch ein Weniges darüber. Am nächsten Tage legte sich der Wind, die See ging ruhiger, und ich ward die Sache ein wenig gewohnt. Doch blieb ich den ganzen Tag still und ernst und litt noch immer etwas an der Seekrankheit. Am Nachmittag aber klärte sich das Wetter auf, der Wind legte sich völlig, und es folgte ein köstlicher Abend. Die Sonne ging leuchtend unter und am nächsten Morgen ebenso schön auf. Wir hatten wenig oder gar keinen Wind, die See war glatt, die Sonne strahlte darauf, und ich hatte einen Anblick so herrlich wie nie zuvor.
Nach einem gesunden Schlaf, frei von der Seekrankheit, in bester Laune betrachtete ich voll Bewunderung das Meer, das gestern so wild und fürchterlich gewesen und nun so friedlich und anmutig war. Und gerade jetzt, damit meine guten Vorsätze ja nicht Stand halten sollten, trat mein Kamerad, der mich verführt hatte, zu mir. »Nun, mein Junge«, sagte er, mich mit der Hand auf die Schulter klopfend, »wie ist’s bekommen? Ich wette, du hast Angst ausgestanden, bei der Hand voll Wind, die wir gestern hatten, wie?« – »Eine Hand voll Wind nennst du das?« erwiderte ich; »es war ein grässlicher Sturm.« – »Ein Sturm? Narr, der du bist; hältst du das für einen Sturm? Gib uns ein gutes Schiff und offene See, so fragen wir den Teufel was nach einer solchen elenden Brise. Aber du bist nur ein Süßwassersegler; komm, lass uns eine Bowle Punsch machen, und du wirst bald nicht mehr an die Affaire denken. Schau, was ein prächtiges Wetter wir haben!«
Um es kurz zu machen, wir taten nach Seemannsbrauch. Der Punsch wurde gebraut und ich gehörig angetrunken. Der Leichtsinn dieses einen Abends ersäufte alle meine Reue, all meine Gedanken über das Vergangene, alle meine Vorsätze für die Zukunft. Wie die See, als der Sturm sich gelegt, wieder ihre glatte Miene und friedliche Stille angenommen hatte, so war auch der Aufruhr in meiner Seele vorüber. Meine Befürchtungen, von den Wogen verschlungen zu werden, hatte ich vergessen, meine alten Wünsche kehrten zurück, und die Gelübde und Verheißungen, die ich in meinem Jammer getan, waren mir aus dem Sinn. Hin und wieder stellten sich indessen meine Bedenken wiederum ein, und ernsthafte Besorgnisse kehrten von Zeit zu Zeit in meine Seele zurück. Jedoch ich schüttelte sie ab und machte mich davon los gleich als von einer Krankheit, hielt mich ans Trinken und an die lustige Gesellschaft und wurde so Herr über diese »Anfälle«, wie ich sie nannte. Nach fünf oder sechs Tagen war ich so vollkommen Sieger über mein Gewissen, wie es ein junger Mensch, der entschlossen ist, sich nicht davon beunruhigen zu lassen, nur sein kann.
Aber ich sollte noch eine neue Probe bestehen. Die Vorsehung hatte, wie in solchen Fällen gewöhnlich, es so geordnet, dass mir keine Entschuldigung bleiben konnte. Denn wenn ich das erste Mal mich nicht für gerettet ansehen wollte, so war die nächste Gelegenheit so beschaffen, dass der gottloseste und verhärtetste Bösewicht sowohl die Größe der Gefahr, als die der göttlichen Barmherzigkeit dabei hätte anerkennen müssen.
Am sechsten Tage unserer Fahrt gelangten wir auf die Rhede von Yarmouth. Der Wind war uns entgegen und das Wetter ruhig gewesen, und so hatten wir nach dem Sturm nur eine geringe Strecke zurückgelegt. Dort sahen wir uns genötigt, vor Anker zu gehen, und lagen, weil der Wind ungünstig, nämlich aus Südwest blies, sieben oder acht Tage daselbst, während welcher Zeit viele andere Schiffe von New-Castle her aus eben dieser Rhede, welche den gemeinsamen Hafen für die guten Wind die Themse hinauf erwartenden Schiffe abgab, vor Anker gingen.
Wir wären jedoch nicht so lange hier geblieben, sondern mit der Flut allmählich stromaufwärts gegangen, hätte der Wind nicht zu heftig geweht. Nach dem vierten oder fünften Tag blies er besonders scharf. Da aber die Rhede für einen guten Hafen galt, der Ankergrund gut und unser Ankertau sehr stark war, machten unsre Leute sich Nichts daraus, sondern verbrachten ohne die geringste Furcht die Zeit nach Seemannsart mit Schlafen und Zechen. Den achten Tag aber ward des Morgens der Wind stärker, und wir hatten alle Hände voll zu tun, die Topmasten einzuziehn und alles zu dichten und festzumachen, dass das Schiff so ruhig wie möglich vor Anker liegen könnte. Um Mittag ging die See sehr hoch. Es schlugen große Wellen über das Deck, und ein- oder zweimal meinten wir, der Anker sei losgewichen, worauf unser Kapitän sogleich den Notanker loszumachen befahl, sodass wir nun von zwei Ankern gehalten wurden.
Unterdessen erhob sich ein wahrhaft fürchterlicher Sturm, und jetzt sah ich zum ersten Mal Angst und Bestürzung auch in den Mienen unsrer Seeleute. Ich hörte den Kapitän, der mit aller Aufmerksamkeit auf die Erhaltung des Schiffes bedacht war, mehrmals, während er neben mir zu seiner Kajüte hinein- und herausging, leise vor sich hinsagen: »Gott sei uns gnädig, wir sind alle verloren« und dergleichen Äußerungen mehr.
Während der ersten Verwirrung lag ich ganz still in meiner Koje, die sich im Zwischendeck befand, und war in einer unbeschreiblichen Stimmung. Es war mir nicht möglich, die vorigen reuigen Gedanken, die ich so offenbar von mir gestoßen hatte, wieder aufzunehmen. Ich hatte geglaubt die Todesgefahr überstanden zu haben, und gemeint, es würde jetzt nicht so schlimm werden wie das erste Mal. Jedoch als der Kapitän in meine Nähe kam und die erwähnten Worte sprach, erschrak ich fürchterlich. Ich ging aus meiner Kajüte und sah mich um. Niemals hatte ich einen so furchtbaren Anblick gehabt. Das Meer ging bergehoch und überschüttete uns alle drei bis vier Minuten. Wenn ich überhaupt Etwas sehen konnte, nahm ich Nichts als Jammer und Not ringsum wahr. Zwei Schiffe, die nahe vor uns vor Anker lagen, hatten, weil sie zu schwer beladen waren, ihre Mastbäume kappen und über Bord werfen müssen, und unsre Leute riefen einander zu, dass ein Schiff, welches etwa eine halbe Stunde von uns ankerte, gesunken sei. Zwei andere Schiffe, deren Anker nachgegeben hatten, waren von der Rhede auf die See getrieben und, aller Masten beraubt, jeder Gefahr preisgegeben. Die leichten Fahrzeuge waren am besten daran, da sie der See nicht so vielen Widerstand entgegensetzen konnten; aber zwei oder drei trieben auch von ihnen hinter uns her und wurden vom Winde, dem sie nur das Sprietsegel boten, hin und her gejagt.
Gegen Abend fragten der Steuermann und der Hochbootsmann den Kapitän, ob sie den Fockmast kappen dürften. Er wollte anfangs nicht daran, als aber der Hochbootsmann ihm entgegen hielt, dass, wenn es nicht geschähe, das Schiff sinken würde, willigte er ein. Als man den vorderen Mast beseitigt hatte, stand der Hauptmast so lose und erschütterte das Schiff dermaßen, dass die Mannschaft genötigt war, auch ihn zu kappen und das Deck frei zu machen.
Jedermann kann sich denken, in welchem Zustand bei diesem Allen ich, als Neuling zur See, und nachdem ich so kurz vorher eine solche Angst ausgestanden, mich befand. Doch wenn ich jetzt die Gedanken, die ich damals hatte, noch richtig anzugeben vermag, so war mein Gemüt zehnmal mehr in Trauer darüber, dass ich meine früheren Absichten aufgegeben und wieder zu den vorhergefassten Plänen zurückgekehrt war, als über den Gedanken an den Tod selbst. Diese Gefühle, im Verein mit dem Schreck vor dem Sturm, versetzten mich in eine Gemütslage, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Das Schlimmste aber sollte noch kommen!
Der Sturm wütete dermaßen fort, dass die Matrosen selbst bekannten, sie hätten niemals einen schlimmern erlebt. Unser Schiff war zwar gut, doch hatte es zu schwer geladen und schwankte so stark, dass die Matrosen wiederholt riefen, es werde umschlagen. In gewisser Hinsicht war es gut für mich, dass ich die Bedeutung dieses Worts nicht kannte, bis ich später danach fragte.
Mittlerweile wurde der Sturm so heftig, dass ich sah, was man nicht oft zu sehen bekommt, nämlich wie der Kapitän, der Hochbootsmann und etliche andere, die nicht ganz gefühllos waren, zum Gebet ihre Zuflucht nahmen. Sie erwarteten nämlich jeden Augenblick, das Schiff untergehen zu sehen. Mitten in der Nacht schrie, um unsre Not vollzumachen, ein Matrose, dem aufgetragen war darauf ein Augenmerk zu haben, aus dem Schiffsraum, das Schiff sei leck und habe schon vier Fuß Wasser geschöpft. Alsbald wurde jedermann an die Pumpen gerufen. Bei diesem Ruf glaubte ich das Herz in der Brust erstarren zu fühlen. Ich fiel rücklings neben mein Bett, auf dem ich in der Kajüte saß, die Bootsleute aber rüttelten mich auf und sagten, wenn ich auch sonst zu Nichts nütze sei, so tauge ich doch zum Pumpen so gut wie jeder andere. Da raffte ich mich auf, eilte zur Pumpe und arbeitete mich rechtschaffen ab.
Inzwischen hatte der Kapitän bemerkt, wie einige leichtbeladene Kohlenschiffe, weil sie den Sturm vor Anker nicht auszuhalten vermochten, in die freie See stachen und sich uns näherten. Daher befahl er ein Geschütz zu lösen und dadurch ein Notsignal zu geben. Ich, der ich nicht wusste, was das zu bedeuten hatte, wurde, weil ich glaubte, das Schiff sei aus den Fugen gegangen, oder es sei sonst etwas Entsetzliches geschehen, so erschreckt, dass ich in Ohnmacht fiel. Weil aber jeder nur an Erhaltung des eignen Lebens dachte, bekümmerte sich keine Seele um mich. Ein anderer nahm meine Stelle an der Pumpe ein, stieß mich mit dem Fuß bei Seite und ließ mich für tot liegen, bis ich nach geraumer Zeit wieder zu mir kam.
Wir arbeiteten wacker fort, aber das Wasser stieg im Schiffsraum immer höher, und das Schiff begann augenscheinlich zu sinken. Zwar legte sich jetzt der Sturm ein wenig, allein unmöglich konnte unser Fahrzeug sich so lange über Wasser halten, bis wir einen Hafen erreichten. Deshalb ließ der Kapitän fortwährend Notschüsse abfeuern. Endlich wagte ein leichtes Schiff, das gerade vor uns vor Anker lag, ein Hilfsboot auszusenden. Mit äußerster Gefahr nahete dieses sich uns, doch schien unmöglich, dass wir hineinsteigen könnten oder dass es auch nur an unser Schiff anzulegen vermöchte. Endlich kamen die Matrosen mit Lebensgefahr durch mächtiges Rudern so nahe, dass unsre Leute ihnen vom Hinterteil des Schiffes ein Tau mit einer Boje zuwerfen konnten. Als sie unter großer Mühe und Not des Seils habhaft geworden, zogen sie sich damit dicht an den Stern unseres Fahrzeugs heran, worauf wir denn sämtlich uns in das ihrige begaben. Aber nun war gar kein Gedanke daran, dass wir mit dem Boote das Schiff, zu dem es gehörte, erreichen könnten. Daher beschlossen wir einmütig, das Boot vom Wind treiben zu lassen und es nur so viel wie möglich nach der Küste zu steuern. Der Kapitän versprach den fremden Leuten, ihr Fahrzeug, wenn es am Strande scheitern sollte, zu bezahlen. So gelangten wir denn, teils durch Rudern, teils vom Winde getrieben, nordwärts etwa in der Gegend von Winterton-Neß nahe an die Küste heran.
Der erste Schiffbruch
Kaum eine Viertelstunde hatten wir unser Schiff verlassen, als wir es schon untergehen sahen. Jetzt begriff ich, was es heißt, wenn ein Schiff in See leck wird. Ich gestehe, dass ich kaum den Mut hatte hinzusehen, als die Matrosen mir sagten, das Schiff sei im Sinken. Denn seit dem Augenblick, wo ich in das Boot mehr geworfen als gestiegen war, stand mir das Herz vor Schrecken und Gemütsbewegung und vor den Gedanken an die Zukunft, so zu sagen, stille.
Während die Bootsleute sich müheten uns an Land zu bringen, bemerkten wir (denn sobald uns die Woge in die Höhe trug, vermochten wir die Küste zu sehen), wie eine Menge Menschen am Strande hin- und herliefen, um uns, wenn wir herankämen, Hilfe zu leisten. Doch gelangten wir nur langsam vorwärts und konnten das Land nicht eher erreichen, bis wir den Leuchtturm von Winterton passiert hatten. Hier flacht sich die Küste von Cromer westwärts ab, und so vermochte das Land die Heftigkeit des Windes ein wenig zu brechen. Dort legten wir an, gelangten sämtlich, wiewohl nicht ohne große Anstrengungen ans Ufer und gingen hierauf zu Fuße nach Yarmouth. Als Schiffbrüchige wurden wir in dieser Stadt, sowohl von den Behörden, welche uns gute Quartiere anwiesen, als auch von Privatleuten und Schiffseignern, mit großer Humanität behandelt und mit so viel Geld versehen, dass es hingereicht hätte, uns, je nachdem wir Lust hatten, die Reise nach London oder nach Hull zu ermöglichen.
Hätte ich nun Vernunft genug gehabt, in meine Heimat zurückzukehren, so wäre das mein Glück gewesen, und mein Vater würde, um mit dem Gleichnis unseres Heilandes zu reden, das fetteste Kalb zur Feier meiner Heimkehr geschlachtet haben. Nachdem er gehört, das Schiff, mit dem ich von Hull abgegangen war, sei auf der Rhede von Yarmouth untergegangen, hat er lange in der Meinung gelebt, ich sei ertrunken.
Jedoch mein böses Schicksal trieb mich mit unwiderstehlicher Hartnäckigkeit vorwärts. Zuweilen zwar sprach mir meine Vernunft und mein besonnenes Urteil laut zu, heimzukehren, aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Ich weiß nicht, ob es eine geheimnisvolle zwingende Macht, oder wie ich es sonst nennen soll, gibt, die uns treibt, Werkzeuge unseres eigenen Verderbens zu werden, wenn es auch unmittelbar vor uns liegt und wir mit offenen Augen ihm uns nähern. Gewiss ist aber, dass nur ein unabwendbar über mich beschlossenes Verhängnis, dem ich in keiner Weise entrinnen konnte, mich, trotz den ruhigen Gründen und dem Zureden meiner Überlegung, und ungeachtet zweier so deutlichen Lehren, wie ich sie bei meinem ersten Versuch erhalten hatte, vorwärts drängte.
Mein Kamerad, der mich früher in meiner Gewissensverhärtung bestärkt hatte (er war, wie ich schon sagte, der Sohn des Eigentümers unseres untergegangenen Schiffs), war nun verzagter als ich. Als wir uns das erste Mal in Yarmouth sprachen, zwei oder drei Tage nach unserer Ankunft, – wir lagen in verschiedenen Quartieren, – schien der Ton seiner Stimme verändert, und mit melancholischer Miene fragte er mich, wie es mir gehe. Nachdem er seinem Vater mitgeteilt hatte, wer ich sei und dass ich diese Reise nur zum Versuche gemacht habe, und zwar in der Absicht, später in die Fremde zu gehen, wandte sich dieser zu mir und sagte in einem sehr ernsten feierlichen Ton: »Junger Mann, Ihr dürft niemals wieder zur See gehen; Ihr müsst dies Erlebnis für ein sichtbares und deutliches Zeichen ansehen, dass Ihr nicht zum Seemann bestimmt seid«. – »Wie, Herr«, erwiderte ich, »wollt Ihr selbst denn nie wieder auf das Meer?« – »Das ist etwas anderes«, antwortete er. »Es ist mein Beruf und daher meine Pflicht; allein Ihr habt bei Dieser Versuchsreise vom Himmel eine Probe von dem erhalten, was Euch zu erwarten steht, wenn Ihr auf Eurem Sinne beharret. Vielleicht hat uns dies alles nur Euretwegen betroffen, wie es mit Jona in dem Schiffe von Tarsis ging. Sagt mir«, fuhr er fort, »was in aller Welt hat Euch bewegen können, diese Reise mitzumachen?«
Hierauf erzählte ich ihm einen Teil meiner Lebensgeschichte. Als ich geendet, brach er leidenschaftlich in die Worte aus: »Was habe ich nun verbrochen, dass solch ein Unglücksmensch in mein Schiff geraten musste! Ich würde nicht um tausend Pfund meinen Fuß wieder mit Euch in dasselbe Fahrzeug setzen.«
Dieser Ausbruch war durch die Erinnerung an den von ihm erlittenen Verlust hervorgerufen, und der Mann hatte eigentlich kein Recht dazu, sich mir gegenüber so stark zu äußern. Doch redete er mir auch später noch sehr ernst zu und ermahnte mich, zu meinem Vater zurückzukehren und nicht noch einmal die Vorsehung zu versuchen. Ich würde sehen, sagte er, dass die Hand des Himmels sichtbar mir entgegenarbeite. »Verlasst Euch darauf, junger Mann«, fügte er hinzu, »wenn Ihr nicht nach Hause geht, werdet Ihr, wohin Ihr Euch auch wendet, nur mit Missgeschick und Not zu ringen haben, bis die Worte Eures Vaters sich an Euch erfüllt haben.«
Bald darauf trennten wir uns. Ich hatte ihm nur kurz geantwortet und sah ihn nachher nicht wieder, weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist.
Ich meinesteils begab mich, da ich jetzt etwas Geld in der Tasche hatte, zu Lande nach London. Sowohl dort wie schon unterwegs hatte ich manchen inneren Kampf zu bestehen durch den Zweifel, ob ich heimkehren oder zur See gehen sollte. Was die erstere Absicht betraf, so stellte sich den bessern Regungen meiner Seele alsbald die Scham entgegen. Es fiel mir ein, wie ich von den Nachbarn ausgelacht werden und wie beschämt ich nicht nur vor Vater und Mutter, sondern auch vor allen anderen Leuten stehen würde. Seit jener Zeit habe ich oft beobachtet, wie ungereimt und töricht die Artung des Menschenherzens, besonders in der Jugend, gegenüber der Vernunft, die es in solchen Fällen allein leiten sollte, sich zeigt: dass wir nämlich uns nicht schämen zu sündigen, aber wohl zu bereuen; dass wir keine Bedenken haben vor der Handlung, derentwegen wir für einen Narren angesehen werden müssen, aber wohl vor der Buße, die allein uns wieder die Achtung vernünftiger Menschen verschaffen könnte.
In jener Unentschlossenheit darüber, was ich ergreifen und welchen Lebensweg ich einschlagen sollte, verharrte ich geraume Zeit. Ein unwiderstehlicher Widerwille hielt mich auch ferner ab heimzukehren. Nach einer Weile aber verblasste die Erinnerung an das Missgeschick, das ich erlebt, und als diese sich erst gemildert hatte, war mit ihr auch der letzte Rest des Verlangens nach Hause geschwunden. Und kaum hatte ich alle Gedanken an die Rückkehr aufgegeben, so sah ich mich auch schon nach der Gelegenheit zu einer neuen Reise um.
Das Unheil, welches mich zuerst aus meines Vaters Hause getrieben; das mich in dem unreifen und tollen Gedanken verstrickt hatte, in der Ferne mein Glück zu suchen; das diesen Plan in mir so fest hatte einwurzeln lassen, dass ich für allen guten Rat, für Bitten und Befehle meines Vaters taub gewesen war, dasselbe Unheil veranstaltete jetzt auch, dass ich mich auf die allerunglückseligste Unternehmung von der Welt einließ. Ich begab mich nämlich an Bord eines nach der afrikanischen Küste bestimmten Schiffes, oder, wie unsre Seeleute zu sagen pflegen, eines Guineafahrers. Jedoch, und dies war ein besonders schlimmer Umstand, verdingte ich mich nicht etwa als ordentlicher Seemann auf das Schiff. Dadurch, ob ich gleich ein wenig härter hätte arbeiten müssen, würde ich doch den seemännischen Dienst gründlich erlernt und mich allmählich zum Matrosen oder Lieutenant, wenn nicht gar zum Kapitän hinaufgearbeitet haben. Nein, wie es immer mein Schicksal war, dass ich das Schlimmste wählte, so tat ich es auch diesmal. Denn da ich Geld in der Tasche und gute Kleider auf dem Leibe hatte, wollte ich nur wie ein großer Herr an Bord gehen, und hatte somit auf dem Schiffe weder etwas Ordentliches zu tun, noch lernte ich den Seemannsdienst vollständig kennen.
In London hatte ich gleich anfangs das Glück, in gute Gesellschaft zu geraten, was einem so unbesonnenen und unbändigen Gesellen nicht oft zu Teil wird. Denn ob zwar der Teufel gern bei Zeiten nach solchen seine Netze auswirft, hatte er’s bei mir doch unterlassen. Ich machte die Bekanntschaft eines Schiffskapitäns, der eben von der guineischen Küste zurückgekehrt war und, da er dort gute Geschäfte gemacht hatte, im Begriffe stand, eine neue Reise dahin zu unternehmen. Er fand Gefallen an meiner damals nicht ganz reizlosen Unterhaltung, und als er vernommen, dass ich Lust hatte, die Welt zu sehen, bot er mir an, kostenfrei mit ihm zu reisen. Ich könne mit ihm den Tisch und den Schlafraum teilen, und wenn ich etwa einige Waren mitnehmen wolle, sie auf eigene Rechnung in Afrika verkaufen und vielleicht dadurch zu weiteren Unternehmungen ermutigt werden.
Dies Anerbieten nahm ich an und schloss mit dem Kapitän, einem redlichen und aufrichtigen Manne, innige Freundschaft. Durch seine Uneigennützigkeit trug mir ein kleiner Kram, den ich mitgenommen, bedeutenden Gewinn ein. Ich hatte nämlich für ungefähr 40 Pfund Sterling Spielwaren und dergleichen Kleinigkeiten auf den Rat des Kapitäns eingekauft, wofür ich das Geld mit Hilfe einiger Verwandten, an die ich mich brieflich gewendet, zusammenbrachte, welche, wie ich vermute, auch meine Eltern oder wenigstens meine Mutter vermocht hatten, etwas zu meiner ersten Unternehmung beizusteuern.
Dies war die einzige unter meinen Reisen, die ich eine glückliche nennen kann. Ich verdanke das nur der Rechtschaffenheit meines Freundes, durch dessen Anleitung ich auch eine ziemliche Kenntnis in der Mathematik und dem Schifffahrtswesen erlangte. Er lehrte mich, den Kurs des Schiffs zu verzeichnen, Beobachtungen anzustellen, überhaupt alles Notwendigste, was ein Seemann wissen muss. Da es ihm Freude machte, mich zu belehren, hatte ich auch Freude, von ihm zu lernen, und so wurde ich auf dieser Reise zugleich Kaufmann und Seemann. Ich brachte für meine Waren fünf Pfund und neun Unzen Goldstaub zurück, wofür ich in London dreihundert Guineen löste; aber leider füllte mir gerade dieser Gewinn den Kopf mit ehrgeizigen Plänen, die mich ins Verderben bringen sollten.
Übrigens war jedoch auch diese Reise nicht ganz ohne Missgeschick für mich abgelaufen. Insbesondere rechne ich dahin, dass ich während der ganzen Dauer derselben mich unwohl fühlte und in Folge der übermäßigen afrikanischen Hitze (wir trieben nämlich unsern Handel hauptsächlich an der Küste vom 15. Grad nördlicher Breite bis zum Äquator hin) von einem hitzigen Fieber befallen wurde.
Nunmehr galt ich für einen ordentlichen Guineahändler. Nachdem mein Freund zu meinem großen Unheil bald nach der Rückkehr gestorben war, beschloss ich, dieselbe Reise zu wiederholen, und schiffte mich auf dem früheren Schiffe, das jetzt der ehemalige Steuermann führte, ein. Nie hat ein Mensch eine unglücklichere Fahrt erlebt. Ich nahm zwar nur für hundert Pfund Sterling Waren mit und ließ den Rest meines Gewinns in den Händen der Wittwe meines Freundes, die sehr rechtschaffen gegen mich handelte; dennoch aber erlitt ich furchtbares Missgeschick.
Das Erste war, dass uns, als wir zwischen den kanarischen Inseln und der afrikanischen Küste segelten, in der Morgendämmerung ein türkischer Korsar aus Saleh überraschte und mit allen Segeln Jagd auf uns machte. Wir spannten, um zu entrinnen, unsere Segel gleichfalls sämtlich aus, soviel nur die Masten halten wollten. Da wir aber sahen, dass der Pirat uns überhole und uns in wenigen Stunden erreicht haben würde, blieb uns Nichts übrig, als uns kampfbereit zu machen.
Wir hatten zwölf Kanonen, der türkische Schuft aber führte deren achtzehn an Bord. Gegen drei Uhr Nachmittags hatte er uns eingeholt. Da er uns jedoch aus Versehen in der Flanke angriff, statt am Vorderteil, wie er wohl ursprünglich beabsichtigt hatte, schafften wir acht von unsern Kanonen auf die angegriffene Seite und gaben ihm eine Salve. Nachdem der Feind unser Feuer erwidert und dazu eine Musketensalve von 200 Mann, die er an Bord führte, gefügt hatte (ohne dass jedoch ein einziger unserer Leute, die sich gut gedeckt hielten, getroffen wurde), wich er zurück. Alsbald aber bereitete er einen neuen Angriff vor, und auch wir machten uns abermals zur Verteidigung fertig. Diesmal jedoch griff er uns auf der anderen Seite an, legte sich dicht an unsern Bord, und sofort sprangen sechzig Mann von den Türken auf unser Deck und begannen unser Segelwerk zu zerhauen.
Wir empfingen sie zwar mit Musketen, Enterhaken und anderen Waffen, machten auch zweimal unser Deck frei; trotzdem aber, um sogleich das traurige Ende des Kampfes zu berichten, mussten wir, nachdem unser Schiff seeuntüchtig gemacht und drei unsrer Leute getötet waren, uns ergeben und wurden als Gefangene nach Saleh, einer Hafenstadt der Neger, gebracht.
Dort ging es mir nicht so schlecht, als ich anfangs befürchtet hatte. Ich wurde nicht wie die anderen ins Innere nach der kaiserlichen Residenz gebracht, sondern der Kapitän der Seeräuber behielt mich unter seiner eignen Beute, da ich als junger Bursch ihm brauchbar schien. Die furchtbare Verwandlung meines Standes, durch welche ich aus einem stolzen Kaufmann zu einem armen Sklaven geworden war, beugte mich tief. Jetzt gedachte ich der prophetischen Worte meines Vaters, dass ich ins Elend geraten und ganz hilflos werden würde. Ich wähnte, diese Vorhersagung habe sich nun bereits erfüllt und es könne nichts Schlimmeres mehr für mich kommen. Schon habe mich, dachte ich, die Hand des Himmels erreicht, und ich sei rettungslos verloren. Aber ach, es war nur der Vorschmack der Leiden, die ich noch, wie der Verlauf dieser Geschichte lehren wird, durchmachen sollte.
Als mein neuer Herr mich für sein eigenes Haus zurückbehielt, tauchte die Hoffnung in mir auf, er werde mich demnächst mit zur See nehmen und ich könne dann, wenn ihn etwa ein spanisches oder portugiesisches Kriegsschiff kapern würde, wieder meine Freiheit erlangen. Dieser schöne Wahn entschwand bald. Denn so oft sich mein Patron einschiffte, ließ er mich zurück, um die Arbeit im Garten und den gewöhnlichen Sklavendienst im Hause zu verrichten, und wenn er dann von seinen Streifzügen heimkam, musste ich in der Kajüte seines Schiffes schlafen und dieses überwachen.
Während ich hier auf Nichts als meine Flucht dachte, wollte sich doch nicht die mindeste Möglichkeit zur Ausführung derselben zeigen. Auch war niemand da, dem ich meine Pläne hätte mitteilen, und der mich hätte begleiten können. Denn unter meinen Mitsklaven befand sich kein Europäer. So bot sich mir denn zwei Jahre hindurch, so oft ich mich auch in der Einbildung damit beschäftigte, nicht die mindeste hoffnungerweckende Aussicht auf ein Entrinnen dar.
Kingston upon Hull, kurz Hull, ist eine englische Stadt, die am Nordufer der Flussmündung des Hull River in den Humber gelegen ist. <<<
Chef, Auftraggeber, Brotherr <<<
2. Sklaverei und Flucht
Ungefähr nach Ablauf dieser Zeit rief mir ein seltsamer Umstand meine Fluchtpläne wieder ins Gedächtnis. Eine geraume Weile hindurch blieb nämlich mein Herr, wie ich hörte aus Geldmangel, gegen seine Gewohnheit zu Hause liegen. Während dieser Zeit fuhr er jede Woche ein oder mehre Mal in seinem kleinen Schiffsboot auf die Rhede zum Fischen, wobei er stets mich und einen kleinen Moresken zum Rudern mitnahm. Wir machten ihm auf diesen Fahrten allerlei Späße vor, und da ich mich zum Fischfang anstellig zeigte, erlaubte er, dass ich nebst einem seiner Verwandten und dem Mohrenjungen auch bisweilen allein hinausfuhr und ihm ein Gericht Fische holte.
Als wir einst an einem sehr windstillen Morgen solch eine Fahrt machten, entstand ein so dicker Nebel, dass wir die Küste, von der wir kaum eine Stunde entfernt waren, aus dem Gesicht verloren. Wir ruderten unablässig, ohne zu wissen, ob wir vorwärts oder zurück kämen, den ganzen Tag und die folgende Nacht hindurch und wurden erst am nächsten Morgen gewahr, dass wir, statt uns dem Lande zu nähern, nach der offenen See hin geraten und mindestens zwei deutsche Meilen vom Ufer entfernt waren. Dennoch erreichten wir dieses, völlig ausgehungert, unter nicht geringer Mühe und Gefahr wieder, nachdem sich des Morgens ein scharfer Wind landwärts erhoben hatte.
Unser Gebieter, durch dies Ereignis gewarnt, beschloss, künftig für seine Person größere Vorsicht anzuwenden und nicht mehr ohne Kompass und Proviant auf den Fischfang zu gehen. Da er das Langboot unseres von ihm genommenen Schiffes zu seiner Verfügung hatte, trug er seinem Schiffszimmermann, der wie ich Sklave und geborener Engländer war, auf, in diesem Boot eine kleine Kajüte zu errichten, ähnlich der in einer Barke, und zwar so, dass hinter derselben Jemand Platz habe, um zu steuern und das große Segel zu regieren, davor aber zwei Personen Raum fänden, um die anderen Segel zu handhaben.
Das Langboot führte ein sogenanntes Gieksegel und die Raa ragte über die Kajüte hinaus, welche schmal und niedrig war und höchstens für den Kapitän und ein Paar Sklaven, sowie einen Tisch und ein Schränkchen zur Aufbewahrung von Brot, Reis, Kaffee und dergleichen Raum bot. In diesem Fahrzeug fuhren wir dann fleißig zum Fischen aus, und da ich mich gut auf das Geschäft verstand, ließ mein Herr mich nie zu Hause.
Eines Tages wollte dieser mit ein paar vornehmen Mohren zum Vergnügen oder zum Fischfang eine Fahrt machen und ließ dazu ungewöhnliche Anstalten treffen. Schon abends zuvor hatte er Mundvorrat an Bord geschickt und mir aufgetragen, drei Flinten mit dem im Boot befindlichen Pulver und Blei bereit zu halten, damit er und seine Freunde sich auch durch die Vogeljagd vergnügen könnten. Ich tat wie mir befohlen, und wartete in dem sauber geputzten Boot, darauf Flagge und Wimpel lustig weheten, auf die Ankunft meines Gebieters und seiner Gäste. Bald nachher aber kam jener allein, sagte mir, die letzteren seien durch Geschäfte verhindert, ich solle daher mit dem Mohren und dem kleinen Jungen wie gewöhnlich allein hinausfahren und für seine Freunde zum Abendessen ein Gericht Fische fangen.
In diesem Augenblick kamen mir meine Fluchtgedanken wieder in den Sinn. Ich sah jetzt ein kleines Schiff ganz zu meiner Verfügung gestellt und bereitete, als mein Herr fort war, sogleich alles statt für den Fischfang zu einer langen Fahrt vor. Freilich wusste ich nicht, wohin diese gehen sollte, aber das kümmerte mich nicht, da ich nur von dort wegzukommen bedacht war.
Zunächst sann ich auf einen Vorwand, um den Mohren nach Proviant auszuschicken. Ich sagte ihm, es zieme sich nicht für uns, von dem Mundvorrat unsers Gebieters zu nehmen. Dies leuchtete ihm ein, und er brachte denn auch bald einen großen Korb mit geröstetem Zwieback, wie solcher dort zu Lande bereitet wurde, nebst drei Krügen mit frischem Wasser herbei. Ich wusste, wo mein Herr seinen Flaschenkorb hatte, der, nach der Façon zu schließen, auch von einem englischen Schiffe erbeutet sein musste. Diesen stellte ich in das Boot, wie wenn er dort für unsern Herrn schon gestanden habe. Dann trug ich einen etwa fünfzig Pfund schweren Wachsklumpen hinein, sowie einen Knäuel Bindfaden, ein Beil, eine Säge und einen Hammer, lauter nützliche Dinge, besonders das Wachs, aus dem ich Lichter machen wollte. Dann drehete ich dem Mohren, welcher Ismael hieß, aber Muley genannt wurde, eine weitere Nase. »Muley«, sagte ich zu ihm, »die Gewehre unsers Herrn sind an Bord. Könnten wir nicht auch ein wenig Pulver und Schrot bekommen? Es wäre doch hübsch, wenn wir für uns einige Alkamies (eine Art Seevögel) schießen könnten. Ich weiß, der Schießbedarf liegt im großen Schiff.« – »Gut«, erwiderte er, »ich will’s holen.« Bald darauf kam er wirklich mit einem großen Lederbeutel, in welchem sich etwa anderthalb Pfund Pulver, fünf bis sechs Pfund Schrot und etliche Kugeln befanden, und trug dies alles zusammen ins Boot. Unterdeß hatte ich auch in meines Herrn Kajüte etwas Pulver gefunden, das ich in eine der großen Flaschen im Flaschenkorb, die beinahe leer war und deren Inhalt ich in eine andere goss, füllte. So, mit dem Nötigsten versehen, segelten wir aus dem Hafen zum Fischfang. Der Wind ging leider aus Nordnordost; wäre er von Süden gekommen, hätte ich leicht die spanische Küste, oder wenigstens die Bai von Cadix erreichen können. Trotz dem aber, mochte der Wind auch noch so ungünstig wehen, blieb mein Entschluss fest, von diesem schrecklichen Orte zu entrinnen, das Übrige aber dem Geschick anheim zu stellen.
Nachdem wir einige Zeit gefischt hatten, ohne Etwas zu fangen (denn wenn ich auch einen Fisch an der Angel spürte, zog ich ihn nicht heraus), sagte ich zu dem Mohren: »Hier hat’s keine Art; wir werden von hier unserm Herrn Nichts heimbringen, wir müssen es weiter draußen versuchen«. Er, sich nichts Arges versehend, willigte ein und zog, da er am Stern des Schiffes stand, die Segel auf. Ich steuerte dann das Boot beinahe eine deutsche Meile auf die offene See hinaus. Hierauf brachte ich es in die Stellung, als ob ich fischen wolle, gab dem Jungen das Steuerruder, ging nach vorn, wo der Mohr stand, tat, wie wenn ich beabsichtigte, hinter ihm Etwas aufzuheben, fasste ihn rücklings an und warf ihn kurzer Hand über Bord. Sofort tauchte er wieder auf, denn er schwamm wie Kork, und bat mich, ihn wieder herein zu heben. Er wolle ja, sagte er, mit mir in die weite weite Welt gehen. Da er rasch hinter dem Boot her schwamm, würde er mich bei dem schwachen Wind bald erreicht haben. Ich aber eilte in die Kajüte, ergriff eine der Vogelflinten und rief ihm zu: »Wenn du dich ruhig verhältst, werde ich dir Nichts zu Leide tun. Du schwimmst gut genug, um das Land erreichen zu können, und die See ist ruhig. Mach, dass du fortkommst, so will ich dich verschonen; wagst du dich aber an das Boot heran, so brenne ich dir eins vor den Kopf, denn ich bin entschlossen, mich zu befreien.« Hierauf wandte er sich um, schwamm nach der Küste und hat diese auch jedenfalls mit Leichtigkeit erreicht; denn er war ein ausgezeichneter Schwimmer.
Ebenso gut freilich hätte ich auch den Mohren mit mir nehmen und den Jungen statt seiner ersäufen können, aber es war Jenem nicht zu trauen. Als er sich fort gemacht, sagte ich zu dem kleinen Burschen, welcher Xury hieß: »Höre, wenn du mir treu bleibst, will ich etwas Großes aus dir machen; willst du mir aber nicht beim Barte Mahomeds und seines Vaters Treue schwören, so muss ich dich ins Wasser werfen.« Der Junge lächelte mir ins Gesicht und antwortete mir so treuherzig, dass ich ihm nicht misstrauen konnte: er verspreche mir treu zu sein und mit mir zu gehen, wohin ich wolle.
So lange mich der schwimmende Mohr im Auge zu behalten vermochte, steuerte ich das Boot dem hohen Meer zu, und zwar so, dass man meinen sollte, wir hätten uns der Meerenge von Gibraltar zugewandt. Jeder vernünftige Mensch musste an Stelle der Neger dies auch annehmen. Denn wer hätte denken sollen, dass wir südwärts gesegelt wären, recht eigentlich nach der Barbarenküste hin, an der ganze Völkerschaften von Negern wohnten, die uns mit ihren Kähnen umzingeln und uns umbringen konnten; wo wir auch nirgends zu landen vermochten, ohne Gefahr zu laufen, von wilden Bestien oder noch unbarmherzigern wilden Menschen zerrissen zu werden. Dennoch aber änderte ich, sobald die Abenddämmerung kam, die Richtung unseres Bootes und steuerte direkt nach Südost. Diesen Kurs schlug ich ein, um in der Nähe der Küste zu bleiben. Da wir guten frischen Wind hatten, kamen wir so schnell vorwärts, dass wir am nächsten Nachmittag gegen drei Uhr uns schon beinahe 150 Meilen südlich von Saleh, weit entfernt von dem Reich des Kaisers von Marokko und irgend eines anderen Herrschers (wir sahen wenigstens keinen Menschen am Lande) befanden.
Meine Furcht vor den Mohren war so groß, und ich bangte so sehr davor, ihnen in die Hände zu fallen, dass ich mich nicht entschließen konnte, an Land oder auch nur vor Anker zu gehen. Der Wind wehte noch volle fünf Tage hindurch uns günstig. Nachdem er sich dann südwärts gedreht hatte, durfte ich glauben, dass, wenn man auch zu Schiffe auf uns Jagd gemacht haben sollte, diese doch nun aufgegeben sein würde. Daher wagte ich mich jetzt an die Küste und warf Anker an der Mündung eines kleinen Flusses. Ich wusste weder, unter welchem Breitengrade, noch in welchem Land, noch bei welchem Volk ich mich befinde. Keine Menschenseele ließ sich sehen; auch hatte ich kein Verlangen danach, denn das Einzige, wonach ich mich sehnte, war frisches Wasser.
Wir gelangten abends in die Flussmündung und beschlossen, sobald es dunkel sei, an Land zu schwimmen und die Gegend auszukundschaften. Jedoch vernahmen wir, als es Nacht geworden, einen so fürchterlichen Lärm, ein solches Bellen, Brüllen und Heulen wilder Tiere, Gott weiß welcher Art, dass mein armer Junge vor Angst sterben wollte und mich flehentlich bat, nicht vor Tagesanbruch an das Ufer zu gehen. »Gut, Xury«, sagte ich, »dann wollen wir es lassen; aber vielleicht bekommen wir bei Tage Menschen zu sehen, die es gerade so schlecht mit uns meinen als diese Löwen.« – »Ei, dann wir schicken ihnen einige Kugeln aufs Fell«, erwiderte Xury lachend, »die ihnen machen Beine.« – Ein wenig Englisch nämlich hatte der Junge durch den Verkehr mit uns Sklaven gelernt.
Ich war froh, den Jungen so lustig zu sehen, und ließ ihn zur Ermutigung einen Schluck Rum aus einer der Flaschen meines Patrons tun. Übrigens war Xury’s Rat gut, daher ich ihn auch befolgte. Wir warfen unsern kleinen Anker aus und lagen die Nacht über still. An Schlafen war jedoch kein Gedanke. Denn nach einigen Stunden sahen wir gewaltig große Bestien verschiedener Art, die wir nicht zu nennen wussten, an den Strand kommen und sich ins Wasser stürzen. Sie machten sich das Vergnügen einer Abkühlung und heulten und brüllten dabei in einer Art, wie ich es mein Lebtag nicht wieder gehört habe.
Xury war furchtbar erschrocken und ich nicht minder. Aber wie entsetzten wir uns erst, als eines der Untiere auf unser Boot zugeschwommen kam. Wir konnten es nicht sehen, doch an seinem Schnauben war zu hören, dass es eine ungeheuer große und grimmige Bestie sein musste. Xury behauptete, es sei ein Löwe, und es mochte wohl auch einer sein. Der arme Junge schrie, ich sollte den Anker lichten und wegrudern. »Nein«, erwiderte ich, »wir wollen nur das Kabeltau verlängern und nach der See hinsteuern, dann können die Tiere uns nicht folgen.« Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, als ich das Ungeheuer zu meiner großen Überraschung schon bis auf zwei Ruderlängen uns nahe erblickte. Sofort eilte ich nach der Kajüte, ergriff ein Gewehr und gab Feuer, worauf die Bestie sich alsbald umwandte und wieder nach dem Lande schwamm.
Es ist unmöglich, den fürchterlichen Lärm, das Geschrei und Geheul zu beschreiben, das unmittelbar an der Küste und weiter ins Land hinein nach meinem Schusse entstand. So Etwas hatten diese Kreaturen wahrscheinlich früher nie gehört. Ich zog daraus den Schluss, dass wir während der Nacht nicht hier ans Land gehen dürften, und es schien sogar fraglich, ob wir es bei Tage wagen dürften; denn den wilden Menschen in die Hände zu geraten, war um Nichts besser, als in die Gewalt der wilden Tiere zu kommen, zum wenigsten hatten wir vor beiden gleich große Angst. Trotzdem aber gebot uns die Notwendigkeit, irgendwo zu landen, um Wasser zu holen, wovon wir keine Pinte mehr im Boote hatten. Es fragte sich nur, wo wir es wagen sollten. Xury sagte mir, wenn er mit einem der Krüge ans Ufer gehen dürfe und es da überhaupt Wasser gäbe, wolle er es schon bekommen. Ich fragte ihn, warum denn er gehen wolle und er nicht lieber sehe, wenn ich es täte. Er antwortete mir darauf mit solcher Treuherzigkeit, dass ich ihn dadurch für immer lieb gewann. »Wenn kommen wilde Männer«, sagte er, »sie essen mich, du weggehen.« »Nun, Xury«, erwiderte ich, »dann wollen wir alle beide gehen, und wenn die wilden Männer kommen, schießen wir sie nieder, dann können sie keinen von uns fressen.« Hierauf gab ich ihm ein Stück Zwieback und ließ ihn einen Schluck Rum aus dem Flaschenkorb tun. Dann ruderten wir das Boot möglichst nahe ans Ufer und wateten, nur mit unsern Gewehren und zwei Wasserkrügen ausgerüstet, ans Land.
Ich wagte nicht das Boot aus den Augen zu verlieren, weil ich fürchtete, die Wilden möchten in Kähnen den Fluss herunter kommen. Der Junge aber, welcher etwa eine Meile landeinwärts eine Niederung gewahrte, eilte danach hin, und gleich darauf sah ich ihn wieder zurückkehren. Ich glaubte, er sei von Wilden verfolgt oder durch ein Tier erschreckt, und rannte, um ihm zu helfen, ihm entgegen. Als ich jedoch näher kam, sah ich, dass er Etwas über die Schultern hängen hatte, das ich als ein von ihm getötetes Tier erkannte. Es glich einem Hasen, war aber von anderer Farbe und länger von Beinen. Wir hatten große Freude darüber, da es uns eine herrliche Mahlzeit lieferte. Das Beste aber, was Xury mitbrachte, war die Nachricht, dass er gutes Wasser gefunden und keine Wilden gesehen hatte.
Bald darauf wurden wir gewahr, dass wir uns um Wasser nicht so große Sorgen hätten zu machen brauchen. Denn ein wenig höher in der Bucht hinauf, in der wir lagen, fanden wir, sobald die Flut, die nicht tief den Fluss hinein ging, verlaufen war, das Wasser süß und frisch. So füllten wir denn unsere Krüge, verschmausten unser Wildpret und machten uns wieder reisefertig. Spuren eines menschlichen Wesens hatten wir in dieser Gegend nicht wahrgenommen.
Weil ich schon früher einmal an dieser Küste gewesen war, wusste ich, dass die kanarischen Inseln, sowie die des grünen Vorgebirgs von hier nicht weit abliegen konnten. Da mir’s aber an Instrumenten zur Untersuchung des Breitengrads, unter dem wir uns befanden, gebrach, und ich auch leider nicht genau die Lage jener Inseln kannte, war ich im Zweifel über die Richtung, die ich nach ihnen einzuschlagen hätte. Außerdem wäre es eine Leichtigkeit gewesen, sie zu erreichen.
Ich hatte meine Hoffnung darauf gesetzt, dass mir, wenn ich mich immer längs der Küste hielte, bis ich in die Region käme, wo die Engländer ihren Handel trieben, eins von ihren Schiffen aufstoßen und uns aufnehmen werde. Soviel ich nach meiner Berechnung herausgebracht, musste ich damals in der Gegend sein, die zwischen dem Kaiserreich Marokko und den Negerstaaten liegt und wo die Küste nur von Bestien bewohnt ist. Die Neger haben diesen Landstrich verlassen und sich aus Furcht vor den Mohren nach Süden zurückgezogen, während die Mohren die Gegend wegen ihrer Unfruchtbarkeit nicht des Anbaus wert halten. Beide Völkerschaften haben auch deshalb jene Strecke aufgegeben, weil so erstaunlich viel Tiger, Löwen, Leoparden und andere wilde Tiere dort hausen. Die Mohren benutzen die Gegend daher nur zum Jagen, indem sie armeenweis zu zwei- bis dreitausend Mann dorthin ziehen. Beinahe hundert Meilen lang sahen wir an der Küste nur wüstes Land, bei Tage wie ausgestorben, des Nachts erfüllt vom Geheul und Gebrüll der Bestien.
Ein- oder zweimal glaubte ich den Pik von Teneriffa zu erblicken und hatte große Lust, nach ihm hin zu steuern; nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen aber, durch widrigen Wind genötigt und auch weil die See für mein kleines Fahrzeug zu hoch ging, beschloss ich, nach meinem früheren Plane mich längs der Küste zu halten.
Mehrmals war ich genötigt, ans Land zu gehen, um frisches Wasser zu holen. Eines Tages warfen wir früh am Morgen unter einem ziemlich hoch gelegenen Küstenpunkt Anker. Die Flut begann und wir wollten sie abwarten, um mit ihr weiter zu gehen. Xury, der seine Augen flinker als ich überall hatte, rief mir leise zu, es sei besser, wenn wir von der Küste uns abwendeten, »denn«, sagte er, »dort liegt ein schreckliches Ungeheuer neben dem Hügel und schläft«.
Ich sah nach der angedeuteten Richtung und erblickte wirklich ein scheußliches Untier. Es war ein sehr großer Löwe, der am Ufer im Schatten eines Hügelvorsprungs lag. »Xury«, sagte ich, »du musst ans Land und ihn abmucksen.« Xury schauderte und erwiderte: »Ich mucksen? Er mich essen auf einen Bissen.« Da ließ ich den Jungen sich still verhalten, nahm unsre größte Flinte, lud sie stark mit Pulver und mit zwei Kugeln und legte sie neben mich. In ein anderes Gewehr tat ich zwei Kugeln, in ein drittes (denn wir hatten drei) fünf Kugeln von kleinerem Kaliber. Beim ersten Schuss hielt ich der Bestie scharf nach dem Kopf, allein sie hatte die Tatze ein wenig über die Schnauze gelegt, sodass die Kugeln sie über dem Knie trafen und ihr nur den Gelenkknochen zerschmetterten. Der Löwe sprang auf, knurrte anfangs leise, fühlte aber sein Bein entzwei, sank nieder und stellte sich dann auf drei Beine, indem er das schrecklichste Gebrüll los ließ, das ich je vernommen. Ich war erschrocken, dass ich den Kopf verfehlt, griff aber sofort nach dem zweiten Gewehr und gab abermals Feuer; wiewohl der Feind ausreißen wollte, traf ich ihn diesmal doch in den Kopf und sah mit Vergnügen, wie er zusammenbrach und ohne großen Lärm seinen Todeskampf kämpfte. Jetzt bekam Xury Courage und wollte ans Land. »Gut«, sagte ich, »geh.« Darauf sprang er ins Wasser, nahm in die eine Hand eine kleine Flinte, schwamm mit der anderen ans Ufer, begab sich dicht an das Tier heran, hielt ihm das Gewehr nahe vor’s Ohr und machte ihm mit einem neuen Schuss durch den Kopf vollends den Garaus.
Dies Wildpret lieferte uns aber Nichts zu essen, und es tat mir leid, drei Schüsse an ein Tier verschwendet zu haben, mit dem wir Nichts anfangen konnten. Xury aber sagte, Etwas wolle er doch davontragen, und bat mich um das Beil. »Wozu, Xury?« fragte ich. »Kopf abhauen«, antwortete er. Jedoch gelang ihm das nicht, und er brachte nur eine ungeheure Tatze mit sich zurück.
Ich hatte unterdessen überlegt, dass uns vielleicht das Fell von einigem Wert sein könnte, und beschloss es abzuziehen. So machte ich mich denn mit Xury ans Werk; der Junge aber leistete dabei viel mehr als ich, denn ich verstand mich schlecht auf die Sache. Die Arbeit nahm einen ganzen Tag in Anspruch, bis wir zuletzt das Fell davontrugen. Wir spannten es über das Dach unserer Kajüte aus, wo es die Sonne rasch trocknete; dann benutzte ich es als Decke für mein Lager.
Nach diesem Aufenthalt segelten wir zehn bis zwölf Tage in einem fort südwärts. Jetzt gingen wir mit unserm Proviant, der stark ins Abnehmen geraten war, sehr sparsam um. Ans Land wagten wir uns nur, um Wasser zu nehmen.
Mein Plan war, zu versuchen, ob wir den Gambia oder Senegal, das heißt die Gegend des grünen Vorgebirgs zu erreichen vermöchten, wo ich hoffen durfte, einem europäischen Schiffe zu begegnen. Geschah dies nicht, so blieb mir Nichts übrig, als nach den kapverdischen Inseln zu steuern oder unter den Negern umzukommen. Ich wusste, dass alle europäischen Schiffe, die nach der Küste von Guinea oder nach Brasilien oder Ostindien gehen, auf dem grünen Vorgebirg oder jenen Inseln Station machen. So setzte ich denn mein ganzes Geschick auf die eine Nummer: entweder begegnete ich einem Schiff, oder ich war verloren.
Als ich in dieser Ungewissheit etwa zehn Tage hindurch geregelt war, begann ich wahrzunehmen, dass die Küste bewohnt sei. An mehren Stellen sahen wir im Vorbeifahren Leute an dem Ufer stehen, die uns beobachteten. Wir konnten auch erkennen, dass sie ganz schwarz und völlig nackt waren. Einmal wandelte mich die Lust an, ans Land zu ihnen zu gehen, aber Xury riet mir ab und sagte: »Nicht gehen, ja nicht gehen.«