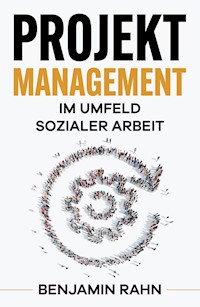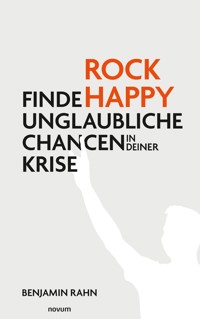
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten, in denen wir gerne immer glücklich wären. Aber jeder von uns weiß nur allzu gut: Beziehungsabbrüche, der Verlust eines nahestehenden Menschen oder ungewollte Veränderungen im Arbeitsleben sind Krisen, die nahezu jeden im Verlauf seines Lebens treffen können. Benjamin Rahn erläutert in seinem Buch die grundlegenden Krisenreaktionen von Menschen und die Mechanismen, die bei Krisenerlebnissen wirken. Neben ganz persönlichen Einblicken in seine eigene Biografie gibt er den Leserinnen und Lesern Hintergrundwissen und Hilfestellungen für den Umgang mit der Krise an die Hand. Der Herausforderung, eine Krise zu meistern, werden mögliche Strategien als Werkzeuge für ein neues Ich nach der Krise gegenübergestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0211-4
ISBN e-book: 978-3-7116-0212-1
Lektorat: Andrea Sprenger
Umschlagabbildung: Benjamin Rahn
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Benjamin Rahn; Abbildung 1: von Benjamin Rahn mit dem Programm Adobe Firefly gestaltet
www.novumverlag.com
Widmung
Meinen Töchtern gewidmet
Vorwort
In dem vorliegenden Buch werden alle Menschen gleichermaßen angesprochen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch die männliche Form verwendet, teilweise die weibliche sowie beide und eine neutrale Bezeichnung. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.
Rock happy: Finde unglaubliche Chancen in deiner Krise
„Oh nein, nicht noch ein Selbsthilfebuch“, werden die einen denken, während sich andere beim Griff ins (virtuelle) Regal dachten: „Vielleicht hilft mir das ja endlich.“ So oder so freue ich mich, dass Sie dieses Buch in Händen halten und mir somit einen Vertrauensvorschuss gewähren. Herzlichen Dank dafür!
Wir haben eine Reise vor uns, die persönlicher nicht sein könnte. Von schweren Schicksalsschlägen hin zu Verarbeitungs- und Abwehrmechanismen sowie persönlichen Glaubensmustern haben wir einige Themenblöcke auf unserer Route. Die nachfolgenden Seiten werden Sie teils mehr oder weniger berühren, je nachdem, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind für Menschen wie Sie geschrieben. Menschen, die nach Antworten suchen. Menschen, die sich allzu oft im Leben die Frage stellten: „Warum ausgerechnet ich?“
Nein, ich bin kein geläuterter Manager, der in seinen späteren Berufsjahren nach einem Burnout erleuchtet aus einem indischen Ashram zurückkehrt, jetzt eine Praxis für „High Performance Coaching“ hat und aus Marketinggründen schnell ein Buch zum Thema veröffentlicht. Ich stehe mit Anfang vierzig mitten im Leben, führe ein bürgerliches Leben und habe eine wundervolle kleine Familie. Und ich habe zwar einen anstrengenden, aber tollen und sinnstiftenden Beruf als Geschäftsführer und Vorstand einer Organisation, dessen Kernaufgabe die Inklusion psychisch kranker Menschen ist. Keine Sorge: Die Seriosität und der Konservatismus, die man solchen Positionen zuschreibt, werden sich in den nachfolgenden Zeilen nicht widerspiegeln, versprochen.
Die Idee zu diesem Buch entstand bereits während meines Studiums, festigte sich aber aus meiner Lehrveranstaltung „Psychosoziale Krisenintervention“, die ich einige Jahre an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg hielt. Das Buch hat sowohl einen theoretischen Unterbau sowie einen Bezug zu meiner beruflichen Erfahrung in der Begleitung von Krisen. Wenngleich ich diese intensive und fordernde Krisenarbeit nicht lange und nur punktuell gemacht habe und mich mehr dem Management und der Organisationsentwicklung zuwandte, konnte ich nebenberuflich in Coachings vorwiegend berufliche, aber auch persönliche Krisen begleiten und freute mich, wenn jemand dadurch vorankam.
Ich selbst hatte im Leben einige Unterstützer, die mir Wege bereiteten, sowie Freundinnen und Freunde, die für mich da waren, wenn es schwer wurde. Das vorliegende Buch ist also eine Wertschätzung für diese Menschen, die sich alle direkt angesprochen fühlen dürfen, wenn sie dieses Exemplar in Händen halten. Und wenn es mir einmal nicht so gut ging, griff ich selbst zu Büchern wie diesem hier und kam so zu neuen Erkenntnissen.
Der Titel des Buches ist eine kleine Hommage an eine Dorfdisco, in der ich als Jugendlicher viel Zeit mit meinen Freunden an den Wochenenden verbrachte. Im „Happy Rock“ trafen sich alle, die sonst nirgends hinkamen oder für die alles andere zu weit entfernt war. Wie der Name erahnen lässt, lief vorwiegend Rockmusik. Der Laden war trashig und irgendwie trotzdem schön, weil eben sehr viele Bekannte dort waren. Zu dem Untertitel inspirierte mich Petra Bocks „Mindfuck“-Buchreihe, deren Bücher ich im Übrigen uneingeschränkt empfehlen kann. Ich suchte nach einem griffigen Akronym, das Lust auf mehr macht. Nicht ganz wissenschaftlich, aber durchaus ansprechend, nicht wahr? Wie Sie richtig erahnen, schreibe ich hier gerne so, wie ich rede und denke. Um dabei nahe am Leser zu bleiben, habe ich mich dazu entschieden, das formelle „Sie“ für dieses Buch ad acta zu legen, und rede dich ab jetzt mit einem ebenso höflichen „Du“ an. Denn persönliche Themen bearbeite ich gerne auf einer persönlichen Ebene. Wäre bei so schwerer Kost eine formelle Anrede wirklich passend?
Ich lade dich auf eine Reise durch die in der Fachwelt genannten „psychosozialen Krisen“ ein, bei denen es auf der einen Seite ans Eingemachte geht. Auf der anderen Seite geht es jedoch auch um die Möglichkeiten in noch so scheinbar ausweglosen Situationen. Eine notwendige Veränderung, der Verlust eines nahen Angehörigen und der Abbruch langjähriger Beziehungen finden sich in den nachfolgenden Zeilen fachlich beleuchtet, gespickt mit einer gesunden Portion Humor, wieder. Das Buch eignet sich leider nicht ganz als Fachbuch für die Hochschule, dennoch findest du am Ende eine ganze Reihe von verwendeter Literatur und Literaturempfehlungen, die hochschultauglich sind. Ich verfolge mit diesem Buch also keinen wissenschaftlichen Ansatz.
Stattdessen nehme ich dich mit auf eine persönliche Reise durch die Höhen und Tiefen des Menschseins und ich freue mich, wenn dir die kommenden Zeilen eine Hilfestellung für deine eigenen Themen oder auch deine berufliche Praxis sind.
Herzlich,
Ben
I. Intro: Persönliche Krisen verstehen
„Instrumente zum Mitnehmen“
2003. Ich schraubte gerade an meinem Computer, als das Telefon klingelte. „In den Proberaum wurde eingebrochen und einiges geklaut“, hörte ich meinen Freund Mario, mit dessen Band wir uns die Räume teilten, am anderen Ende sagen. „MEINE GITARRE!“, rief ich laut, und nachdem der Rest der Band informiert war, trafen wir uns wenig später an besagtem Proberaum mit der Polizei zur Bestandsaufnahme. Es fehlten alle Gitarren und ein Teil unseres technischen Equipments.
In einem ersten Aktionismus räumten wir alles Verbliebene aus dem Raum heraus und fuhren die paar Kabel und Stühle nach Hause. Wut, Ärger, Ohnmacht. Unsere zwar nicht besonders teuren, aber ideell wertvollen Instrumente waren weg. Eine handfeste Bandkrise.
Ich begann Songs zu schreiben über den Verlust meiner ersten E-Gitarre, verfluchte den Proberaum und war froh, dass meine Westerngitarre noch daheim war. In den darauffolgenden Tagen hatten wir nur dieses eine Thema. Wir fragten im Pfandleihhaus nach, ob dort Instrumente aufgetaucht waren und studierten die Kleinanzeigen. Dann regten wir uns über die Polizei auf, die ohnehin nichts machen würde. Wir ärgerten uns über die mangelnde Sicherung des Proberaums und die schlechten Schlösser. Die undichten und leicht zu öffnenden Fenster und überhaupt über alles. Auch über uns selbst, denn wir hätten die Gitarren auch einfach mitnehmen können nach unseren Treffen. Darüber hinaus haben wir wenige Wochen zuvor einen zwielichtigen LKW-Fahrer in den Raum gelassen, der im Industriegebiet unweit unserer Proberäume Rast machte und Lust hatte uns zuzuhören. Wir hätten auch gleich ein Schild an die Tür draußen hängen können: „Instrumente zum Mitnehmen“, so dachten wir verärgert über uns.
Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, an dem wir entscheiden mussten, wie es weitergehen soll. Mario wollte uns in dem Proberaum behalten. Nicht, weil unsere Musik besonders klangvoll war, sondern einfach, weil wir gute Freunde waren und er wusste, was er an uns hatte. Also redete er mit dem Vermieter, der unseren Ärger gut verstand und uns verschiedene Maßnahmen durchführen ließ, wie etwa Gitter an die Fenster anzubringen. Was darauf folgte, machte uns allen wieder Spaß. Wir fuhren bei nächstbester Gelegenheit Instrumente shoppen. Zwar mit überschaubarem Budget, aber zuversichtlich, enthusiastisch und wieder gestärkt als Band. Wir räumten den Raum neu ein und die ersten Probesessions danach haben uns richtig Spaß gemacht. Letztlich hatten wir neue Instrumente, haben uns neu sortiert und haben, obwohl es zunächst nicht danach aussah, weitergemacht. Die Krise war überwunden.
Krise. Dieses Wort war damals wie heute im alltäglichen Sprachgebrauch präsent und ich selbst habe es oft einfach so gesagt. „Ich hab ’ne Krise“ konnte dann „Ich bekomme keine Karten mehr für das Ärzte-Konzert“ oder auch „Mein Computer braucht ein neues Mainboard“ bedeuten. Wie oft spricht man diesen Begriff so unbedacht aus und wie oft hat gleichzeitig eine ernste psychische Krise für einen Menschen eine nicht unerhebliche Bedeutung. Niemand kann sich vor ihr schützen und niemand kann von sich behaupten, nie eine gehabt zu haben. Das lässt sich so deutlich sagen, weil die Psychologie sehr gut erforscht hat, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens mehrfach Krisen durchlebt.
Eine der ersten ist die Pubertät. Man probiert vieles aus, verliebt sich zum ersten Mal und die eigenen Eltern werden besonders anstrengend. Die erste große Lebenslaufkrise ist da. In ihr festigen sich oder wechseln Freundschaften und Interessen gleichermaßen in rasanten Abständen. Das Abgrenzen vom Elternhaus und Ausprobieren von unterschiedlichen persönlichen Stilen in Form von Kleidung und Musik gehören dazu und markieren diesen besonderen Zeitpunkt von Heranwachsenden, der im späteren Leben in der Rückschau nur allzu nostalgisch verklärt wird. Als Teenager wissen wir nicht um die Flausen, sind unreflektiert und neurotisch egozentrisch im eigenen Kosmos kreisend. Für heranwachsende Teenager sind all diese besonderen Momente und Themen dieser Zeit Entwicklungsschritte auf dem Weg zum erwachsenen Menschen. Vieles aus diesen Phasen, die bei den einen heftiger ausfallen und bei den anderen ruhiger, führt ein Stück mehr ins Erwachsenwerden. Manche Themen bleiben vielleicht ein Leben lang und werden in die individuelle Entwicklung integriert. Dazu gehören positive wie negative Erfahrungen.
Deine Krise
Der jugendliche Rap-Musik-Fan in übergroßen Hosen mit regelmäßig wechselnder Frisur weiß selbst nicht, dass er sich in einer der größten Veränderungen seines Lebens befindet. Deshalb ist die Beziehung zu den Eltern auch so anstrengend in dieser Zeit und erst in der Rückschau können Menschen wie ich heute sagen: „Oh Gott, was meine Eltern alles tolerieren mussten!“
Diese Beziehung kann auch das Verhalten eines Jugendlichen beeinflussen und kann zu positiven wie negativen Bewältigungsmechanismen führen. Eine Krise hat also auch mit dem Thema „Beziehung“ zu tun. Die durchaus einige Jahre anhaltende Krise, die gerade zu Beginn am heftigsten ist, wenn die Hormoncocktails beginnen, den Körper zu überschwemmen, kann also auch eine positive oder negative Richtung bekommen. Jugendliche, die sich zum ersten Mal ritzen, an Suizid als Bewältigung des Konflikts mit den Eltern denken oder aus dem Elternhaus ausreißen, um auf der Straße zu leben, wären entsprechende Negativbeispiele. Eine positivere Richtung sind die üblichen Differenzen, wie mit den Eltern über die Frisur, die laute Musik oder die nicht erledigten Hausaufgaben zu streiten, um dann wieder an anderen Tagen versöhnlich zusammen shoppen zu gehen und die neueste CD von „The 2 Live Crew“ von seinem naserümpfenden Papa geschenkt zu bekommen.
Eine Krise kann also unterschiedliche Richtungen annehmen. Im Gegensatz zu unserem westlichen Verständnis einer Krise, nämlich die Assoziation mit etwas grundsätzlich Negativem, ist im chinesischen Verständnis im gleichen Zuge die Chance mit bedacht:
Gefahr (wei) – Chance (ji)
Dass es neben der Gefahr einer negativen Entwicklung für das eigene Leben auch Chancen geben kann, hat sich zwar auch hierzulande herumgesprochen, dennoch steht bei uns die Bedrohung im Vordergrund. Dabei kommt das europäische Wort für „Krise“, so wie wir es heute kennen, aus dem Altgriechischen „crisis“ und steht für eine Wende, einen Umschlagpunkt oder eine Entscheidung. Verglichen mit dieser ursprünglichen Wortherkunft, hat das gesellschaftliche Verständnis einer Krise nicht mehr diese positive Konnotation. Das liegt vorwiegend daran, dass Menschen Veränderungen nicht gerne mögen. Ja, es gibt unterschiedliche individuelle Ausprägungen von Veränderungsakzeptanz, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Eins, das feste Strukturen und Routinen in seinem Alltag braucht, verlässliche soziale Bindungen und ein Gefühl von Sicherheit. Eine persönliche Krise zwingt den Menschen jedoch zur Anpassung seines Verhaltens, seines Denkens und Handelns. Das ist erst einmal unbequem, weil die üblichen Routinen verlassen werden müssen.
Ich lade dich deshalb auf ein schnelles und einfaches Experiment ein, das ich bei dem großartigen Mentalisten Thorsten Havener gesehen habe. Verschränke einmal die Arme, so wie du es immer machst. Achte darauf, welcher Arm unten und welcher oben liegt. Jetzt lasse die Arme wieder entspannt hängen und nimm eine Veränderung vor, indem du erneut die Arme verschränkst, aber dieses Mal mit dem anderen Arm oben. Klappt nicht? Versuche es noch einmal – so lange, bis der andere Arm oben ist. Wie viele Ansätze hast du gebraucht, bis es geklappt hat?
Dieser scheinbar simple Vorgang erfordert schon im Kleinen einiges an Anstrengung. Wahrscheinlich hast du es ein paarmal probiert und doch wieder die alte Verschränkung gehabt, dann überlegt, deine Arme angesehen, geschmunzelt und dir gedacht: „Das kann doch nicht so schwer sein.“ Und als es geklappt hat, hast du es noch einmal versucht und vielleicht noch einmal und so langsam hast du eine Idee davon, worauf ich hinaus möchte. In diesem kleinen Experiment bist du körperlich gefordert, musst aktiv nachdenken und viele Male wiederholen, bevor es wie von alleine klappt. Das Ausbrechen aus gewohnten Mustern ist also offensichtlich anstrengend, kostet Zeit und Energie auf mehreren Ebenen.
Nicht deine Krise
Nicht nur deshalb ist die Gesellschaft auch von Krisen in der Welt mehr oder minder tangiert. Wenn in einem Land, weit weg auf irgendeinem Kontinent, täglich Terror herrscht, dieser aber keine Auswirkungen auf dich zu Hause in deinem Wohnzimmer hat, tangiert dich diese Krise allenfalls in Form von Betroffenheit. Vielleicht spendest du sogar etwas in der Weihnachtszeit, weil du gerne Karmapunkte sammelst. Aber richtig beeinflusst bist du dadurch nicht. Du musst nicht umdenken, brauchst kein neues Verhalten und kannst deinen Alltag weiterleben wie bisher.
Wenn aber aufgrund anderer Geschehnisse in der Welt plötzlich eine Energiekrise droht, Lebensmittel in den Supermärkten knapp werden oder die Stromkosten sprichwörtlich explodieren, betrifft es dich. Vielleicht hast du schnell ein paar Solarpanels an deinem Balkon oder auf dem Dach angebracht. Oder du hast die Heizung im Winter heruntergedreht und dir wirklich einen Pulli mehr angezogen und dich mit Waschlappen gewaschen statt zu duschen, so wie von Politikern vorgeschlagen. Vielleicht, und das möchte ich dir nicht unterstellen, aber ich kenne dich nicht persönlich, hast du dir sogar in deinem sozialen Umfeld (online wie offline) Luft über deinen Unmut gemacht und die Politik beschuldigt, falsch zu handeln. Der Zwang zur Anpassung und das gleichzeitige Gefühl ausgeliefert zu sein, ist eine Ohnmachtserfahrung, die sich wahlweise in Hass, Schuldzuweisungen oder Resignation äußern kann. Es ist weniger anstrengend, die Negativität nach außen zu verlagern, als sich selbst aktiv und bewusst zu verändern.
Eine Krise
„Menschen geraten in eine Krise, wenn sie durch bestimmte Ereignisse, Erlebnisse oder Veränderungen so umfassend und belastend in Mitleidenschaft gezogen werden, dass der Fortgang ihres bisherigen Erlebens und Handelns unterbrochen wird.“ In dieser Beschreibung von Margret Dross (2001, S. 10) findet sich die Unterbrechung der bisherigen Lebens-Routinen eines Menschen wieder.
Im Umkehrschluss bedeutet es, wenn alle deine Pläne und Erwartungen im Leben immer aufgingen, wurdest du nicht in irgendeiner Weise belastend in deinem bisherigen Handeln und Erleben unterbrochen. Sofern du nicht unter Stoikern1 aufgewachsen bist, vermute ich jedoch ganz stark, dass das nicht der Fall ist, und es hat vermutlich auch einen Grund, warum du diese Zeilen hier gerade liest. Wie zuvor erwähnt, gibt es kein krisenfreies Leben, denn das Leben ist progressiv und alleine durch die Entwicklungsphasen in der Lebensspanne krisenanfällig.
Wenn du nun kurz innehältst und an die Zeiten der Krisen und des Umbruchs in deinem Leben zurückdenkst, dann waren diese Phasen stets durch folgende Faktoren gekennzeichnet:
Überforderung der Bewältigungsmechanismen
Bisherige Bewältigungsstrategien funktionieren nicht mehr. Die Nutzung bestimmter Verhaltensweisen zum Abbau emotionaler Anspannung (zum Beispiel Fußballspielen, Klettern gehen, mit Freunden etwas unternehmen) bleibt ohne Wirkung.
Bedrohung der Identität
Das Ich, die eigene Wesenseinheit, ist bedroht. Sich als selbstwirksamen Menschen mit stabilen Säulen im Leben wahrzunehmen, wird brüchig und gerät ins Wanken. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt auf dieses Thema genauer eingehen, denn besagte Säulen tauchen in einem interessanten Konzept auf, durch das man sehr gut eine Identitätskrise erkennen und bearbeiten kann.
Emotionaler Ausnahmezustand
Es erfolgt keine bewusste Veränderung, der Zwang ist jedoch da. Das bringt einen Menschen in ein Dilemma zwischen diesen beiden Polen: Anforderung zur Veränderung versus geringe Bereitschaft dazu.
Extreme psychische Belastung (ggf. auch physisch)
Wenn die Gedanken nur um das eine Thema kreisen, ein Ausbrechen aus diesem Karussell kaum möglich und der Schlaf beeinträchtigt ist, dann greifen sowohl psychische als auch physische Belastungsfaktoren, die sich gegenseitig verstärken (kreisende Gedanken, wenig Schlaf, schlechter körperlicher und seelischer Allgemeinzustand).
Zeitliche Begrenzung
Das ist die gute Nachricht: Eine Krise ist zeitlich begrenzt. Wenn du dich jetzt mit geschlossenen Augen hinsetzt und einmal innerlich zurückblickst, dann hast du bis heute jede Krise bewältigt. Das ist eine wichtige Ressource für deine Zukunft.
Zwang zum Fähigkeitserwerb
In der einschlägigen Fachliteratur wird auch von „Zwang zu kognitiver Umstrukturierung“ gesprochen oder anders: Es ist ein Umdenken erforderlich und man benötigt neue Fähigkeiten für ein Leben nach der Krise.
Gerade die letzten beiden Punkte haben im Kontext psychiatrischer Arbeit eine besondere Relevanz. Denn wird eine Krise in einem bestimmten Zeitraum nicht bewältigt, kann sie chronisch werden, wodurch ein Mensch dauerhaft durch das Krisenereignis belastet sein kann. Das bedeutet nicht, wenn du heute dasitzt und dich noch ein Thema aus deiner Vergangenheit belastet, dass du eine chronische Krise hast. Vielmehr ist es dann so, dass Betroffene aus diesem Krisenerleben nicht mehr oder nur phasenweise herauskommen. Die Ursachen sind vielfältig und durchaus plausibel, wie etwa eine posttraumatische Belastungsstörung von Soldaten, die aus Kriegsgebieten zurückgekehrt sind. Körperliche Veränderungen, wie der Verlust von Gliedmaßen durch einen Unfall oder eine lebensbedrohliche Erkrankung, können einen Menschen jedes Mal erneut an sein Problem erinnern und es abermals durchleben lassen. Alleine deshalb ist es sinnvoll, sich in so einer Lage psychologisch eng begleiten zu lassen.
„Ein Teil der Heilung war noch immer, geheilt werden zu wollen.“
Seneca (Römischer Philosoph und Dramatiker)
Worauf dieses Zitat hindeutet, ist eine weitere Ursache: der soziale Krankheitsgewinn. Es gibt Menschen, die keine Lösung für ihre Situation haben möchten, was gleich mehrere Ursachen haben kann – zum Beispiel das Umsorgtwerden durch das persönliche soziale Umfeld, die ökonomische Absicherung in Form einer Erwerbsminderungsrente oder auch als Erklärung für sich selbst, warum man einer bestimmten Sache oder Aufgabe nicht nachkommen kann.
Aufgabe versus Aufgabe: Der Beziehungsabbruch
Für die genannten Kennzeichen einer Krise ist ein einseitiger Beziehungsabbruch ein gutes Beispiel. Während sich der eine Partner nur in einer schwierigen Phase der Beziehung sieht und gedanklich am Aufschwung arbeitet, zieht der andere für sich die Reißleine und gibt den Trennungswunsch bekannt, gibt die Beziehung auf. Für den verlassenen Teil, der zuvor noch Pläne zum Kitten der Beziehung machte, bedeutet das den sprichwörtlichen Boden, der unter den Füßen weggezogen wird.
Diese Formulierung beschreibt am besten das Gefühl der Ohnmacht und die damit einhergehende Überforderung. Was dann folgt, ist sehr individuell und kann von leisem Kopfnicken bis hin zu einem Wutanfall alles sein und zeigt damit die Intensität des emotionalen Ausnahmezustands mit einhergehender psychischer Belastung an. Letztlich ist die eigene Identität dahingehend in Form des „Ich als liebenswerter Mensch mit Partner“ bedroht. Der oder die Verlassene hat dann zwar noch die Option des Versuchs, den jeweils anderen umzustimmen, in den meisten Fällen sieht er/sie sich jedoch der Anforderung für eine neue Ausrichtung des eigenen Lebens gegenüber (Fähigkeitserwerb), er hat eine neue Aufgabe.
Verläuft eine derartige Veränderung mit einer positiven Bewältigung (im Fachjargon „Coping“), kommt es nicht selten vor, dass Betroffene erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand sagen: „Es war besser so und ich bin froh, dass er/sie den Schritt gewagt hat.“ Was glaubst du, wie viele Menschen mit ihrem Partner noch zusammen sind, weil sie die Veränderung fürchten? Gründe gibt es sicher vielfältige. Ein gemeinsames Haus, die Kinder, das Vermögen, die Eltern, die Zahnfee oder was auch immer. Diese Form der Abwehrmechanismen, die im Grunde nur vor der Veränderung und der Überforderung schützen sollen, werden wir uns noch an anderer Stelle ansehen.
Verstehe mich bitte richtig: Ich bin ein absoluter Fan davon, an einer Beziehung zu arbeiten, wenn es mal nicht gut läuft und auch für einen längeren Zeitraum. Wenn ich aber Menschen kennenlerne, die von fünfundzwanzig Jahren Ehe fünfzehn Jahre lang unzufrieden waren, dann bedauere ich das für diese Menschen sehr. So viel Lebenszeit in einem unglücklichen und unerfüllten Leben wegen der Angst vor der Veränderung. Ist es das wirklich wert? So viel Lebenszeit?
Es würde mich interessieren, ob es tatsächlich Untersuchungen dazu gibt. Im Rahmen der Recherchen für dieses Buch wurde ich dazu nicht fündig. Es wäre sicher eine interessante Erhebung, die wissenschaftlich recht herausfordernd sein könnte. Ich fand es schon immer spannend, dass es offensichtlich Leute gibt, die lieber im Status quo verharren und sich mit ihrer Situation abfinden, als aktiv zu werden. Dabei handeln die Menschen gegen ihre inneren Werte, gegen ihr eigentliches Sein und werden Schritt für Schritt unglücklicher.
So entstehen dann schleichend Probleme wie Depressionen oder Alkoholmissbrauch, um die inneren Spannungen und die eigenen negativen Gedanken zu dämpfen. Veränderungen können wehtun und das, obwohl wir alle wissen, dass es danach oft auch besser werden kann, weil wir etwas längst Quälendes losgeworden sind. Egal ob es der Arbeitsplatz war oder das längst fällige Gespräch mit dem Partner: Wenn der Schritt getan ist, macht sich Erleichterung breit und es öffnen sich neue Türen. Ab da entstehen viele Chancen, sich persönlich weiterzuentwickeln und an neuen Themen zu wachsen.
Persönliches Wachstum
Viele Menschen befassen sich heute mehr denn je mit ihrem persönlichen Wachstum und egal wie wir auf eine persönliche Krise blicken, wir haben die Aufgabe, uns dabei zu entwickeln. Die lebenslange Entwicklung des eigenen Ichs ist heute für die einen zu einem Instagram-Lifestyle-Zwang geworden, dem sie nicht nachgeben möchten und irgendwie trotzdem denken, es tun zu müssen. Für die anderen ist es eine Chance, Neues zu lernen und neue Inhalte in das eigene Leben zu integrieren.
Was viele schon immer wussten, zeigen die Untersuchungen der zurückliegenden Jahrzehnte: Wir Menschen haben äußerst ungern tiefgreifende persönliche Veränderungen, egal ob im beruflichen Alltag oder im privaten Umfeld. Bitte einmal deinen Partner, deinen Kleiderschrank komplett umzuräumen, verschiebe willkürlich alle Symbole auf deinem Desktop oder sortiere dein CD/DVD-Regal neu (falls du so etwas noch hast). An den darauffolgenden Tagen wirst du immer wieder in die eine Ecke greifen, in der du eigentlich das Kleidungsstück vermutest, die Symbole am falschen Ort suchen oder die CD nicht finden, obwohl du genau weißt, dass du umgeräumt hast oder umräumen hast lassen. Achte dabei auf deinen Stresspegel und überlege einmal, wie du dich mit so einer simplen Veränderung fühlst. Einige bekommen sicher beim Lesen der Zeilen schon erhöhten Puls.
Unser Gehirn funktioniert am besten in Routinen und ist auf diese Weise am effizientesten, was an sich eine gute Sache ist, uns aber auch einschränkt. Du möchtest nicht jeden Morgen nach dem Aufstehen aktiv darüber nachdenken, in welcher Art und Weise du deine Zähne putzt oder überlegen, wo die Kaffeemaschine heute steht. Stattdessen hast du täglich in genau solchen Situationen die gleichen Abläufe, über die du nicht nachdenken musst. Es würde dein Gehirn anstrengen, ja regelrecht Unmut auslösen, müsstest du jeden Morgen die Kaffeemaschine in deiner Wohnung oder deinem Haus aufs Neue suchen müssen.
Mein Selbstversuch
Genau das habe ich vor einigen Jahren, inspiriert durch verschiedene Coachingbücher, vierzehn Tage lang probiert, um herauszufinden, wie ich selbst auf immer neue Veränderungen, seien sie noch so klein, reagieren würde. Wohlgemerkt solche, die ich selbst unmittelbar beeinflussen konnte. Bevor ich zu Bett ging, habe ich mir jeden Abend überlegt, wie ich für den kommenden Morgen meine Abläufe durchkreuzen kann. Also stellte ich den Zahnputzbecher samt Zahnbürste ins Schlafzimmer oder die Kaffeemaschine auf meinen Schreibtisch im Büro. Weitere Gegenstände folgten, sodass ich eines Morgens mein Besteck im Bad holen musste, meine Müslischüssel aus meinem Kleiderschrank oder bei einer meiner letzten Aktionen morgens auf den Dachboden gehen musste, weil ich sonst nicht mit meinem Auto hätte wegfahren können. Es waren durchaus auch witzige Aktionen, bei denen man mich nicht hätte beobachten dürfen. Denn von Fluchen bis hin zu lautem Lachen war alles dabei. Treibt man das Spiel nämlich mit zu vielen Gegenständen, so verliert man schnell den Überblick. Was dann passiert, kannst du sicher erahnen. Genau, man tut einfach nichts. Frühstück inklusive Kaffee beim Bäcker am Eck holen und daheim einfach alles so lassen. Kapitulation vor dem eigenen Daily Change! Auch das ist eine Antwort: Ändere zu viele Dinge gleichzeitig und es entsteht Chaos oder einfach nichts mehr.
Nach einer Woche
Unabhängig von dieser Erkenntnis beobachtete ich in den ersten Tagen dieser Übung meine routinierten Muster. Obwohl ich den Zahnputzbecher gleich nach dem Aufstehen aus dem Schlafzimmer hätte mitnehmen können (was ich nicht tat), ging ich nach meiner Morgendusche fluchend aus dem Bad zurück ins Schlafzimmer, um ihn zu holen. Erst einmal meckern! Bereits an diesem Tag dachte ich auf dem Weg zur Arbeit daran, das persönliche Experiment abzubrechen. Nur weil der Zahnputzbecher woanders war! Dennoch brachte ich an diesem Abend die Kaffeemaschine ins Wohnzimmer. Nicht weit weg von der Küche, wo ich stets morgens täglich meinen Kaffee durch die Maschine laufen ließ, während ich mir mein Müsli zubereitete. Nun, ich hätte natürlich schlicht und einfach die Kaffeemaschine aus dem Wohnzimmer in die Küche stellen müssen, um mir dort wie immer meinen Kaffee zu machen. Ich habe es nicht getan. Stattdessen habe ich mich wieder geärgert, mein Müsli in der Küche gegessen und bin, ohne einen Kaffee zu trinken, in die Arbeit gefahren. Immerhin konnte ich mir dort einen aus der Kantine holen. Die Rebellion steckt im Detail!
Nach einer Woche fiel mir auf, wie auch schon die kleinsten Veränderungen großes Unbehagen in einem auslösen können. Nach und nach gewöhnte ich mich jedoch daran, dass ich jeden Morgen irgendwo anders meine Kaffeemaschine oder mein Geschirr herholen musste, um meinen bisherigen Ablauf verfolgen zu können. Ich merkte mir im Bett, was am nächsten Morgen zu tun ist, stand auf und brachte alles schnell an seinen Platz, um dann meine bisherige Routine zu verfolgen. Ist das echte Veränderung? Nein. Warum nicht? Im Prinzip habe ich mein Gehirn mit jedem Tag mehr darauf trainiert, sich diesen Veränderungen zu stellen und es hat ganz ökonomisch gearbeitet, indem es ein neues Muster erkannte und danach handelte: Die Gegenstände einfach wieder an den Ursprung der Abläufe bringen und dann die übliche Routine vollziehen. Es musste also eine Regel her, denn das Spiel machte mir auch Spaß: Ich darf die Gegenstände nicht zurückbringen. Zähneputzen in der Küche, Kaffee machen am Schreibtisch, Müsli essen im Schlafzimmer (die Milch draußen vom Fenstersims nehmen statt aus dem Kühlschrank) und als krönenden Abschluss den Autoschlüssel auf dem Dachboden holen, damit ich endlich zur Arbeit fahren konnte. Eine lustige und auch wertvolle Erfahrung.
Fazit nach zwei Wochen
Wenn derartige, verhältnismäßig kleine Veränderungen einen zunächst durchaus wütend werden lassen, wie ist es dann erst bei einem großen persönlichen Wandel oder gar im Unternehmen, so dachte ich mir. Immerhin stand ich gerade an der Schwelle, mehr Verantwortung in meiner Organisation zu übernehmen und Veränderungen anzustoßen. Die gute Nachricht ist: Was ich im Kleinen Schritt für Schritt langsam zu meiner neuen Routine werden ließ, funktioniert ebenso im Großen. Ich habe mich abends darauf eingestellt, morgens etwas anderes zu tun als sonst und merkte, wie ich nach und nach neue Routinen erlernt hatte, die einem neuen Leitsatz folgten: Veränderung ist mein neues Normal. Hast du dieses Prinzip verstanden, so hast du einen der wichtigsten Grundsätze für persönliches Wachstum verinnerlicht.
Meine Erkenntnisse aus dieser Erfahrung
Fordere dich immer wieder mit kleinen Veränderungen heraus, um auf die Großen vorbereitet zu sein.Veränderung ohne Widerstand ist keine Veränderung.Lasse Veränderung zu deiner Normalität werden.Ändere nicht zu viele Dinge gleichzeitig.Antizipiere anstehende Veränderungen.Ein positiver Blick auf Veränderungen ist eine wichtige Ressource für persönliche Krisen und ein Baustein für deine Resilienz (dazu später mehr). Denn jede Krise fordert dich heraus. Sie verlangt geradezu nach Veränderung, nach einem Kompetenzerwerb und einem positiven Umgang damit. Passiert das nicht, schlägst du die umgekehrte Richtung ein. Sozialer Rückzug, Depression, Substanzmissbrauch, schlimmstenfalls Tod. So harsch diese Aneinanderreihung klingt, so real ist sie Tag für Tag auf der ganzen Welt. Verarbeitet ein Mensch über einen gewissen Zeitraum eine Krise nicht, so drohen die genannten Faktoren. Lass uns also gemeinsam auf das Thema der Veränderungskrisen schauen, die so häufig in einem Leben vorkommen, dass es hilfreich ist, sie zu verstehen.
Veränderungskrisen meistern
Der Wissenschaftler Gerald Caplan befasste sich in den 1960er-Jahren mit dem Verlauf der Lebensveränderungskrise. Wie das klingt: eine Krise, die das Leben verändert! Bezogen auf das Beispiel des Beziehungsabbruchs scheint keine Alternative zu bleiben, als das eigene Leben zu verändern. In der Formulierung hört man es heraus: Die Kunst liegt in der aktiven Veränderung. Auch wenn sie zunächst einmal von außen kommt, kannst du sofort beginnen, selbst das Ruder in die Hand zu nehmen und die Richtung, in die es gehen soll, selbst bestimmen. Nun, mir ist bewusst, dass das für jemanden in der akuten Veränderungszwang-Situation alles andere als leicht ist und ich mich während des Schreibens dieser Zeilen leicht tue, dir das so lapidar mitzuteilen. Mir persönlich hat dieses Wissen jedoch immer gut geholfen, die Dinge einordnen zu können.
Wissen hilft, sich selbst und andere besser zu verstehen und so lade ich dich ein, mit mir die Untersuchung von Caplan einmal genauer am Beispiel des Einstiegs in den Beruf nach der Schule oder dem Studium zu beleuchten. Er fand vier hauptsächliche Phasen heraus, die Menschen bei gravierenden Veränderungen durchleben.
Konfrontation mit dem Ereignis: Begegnung mit dem krisenauslösenden Ereignis und die üblichen Problemlösungsstrategien bleiben ohne Wirkung.Du hast viele Jahre die Schulbank gedrückt oder im Anschluss noch studiert, vielleicht ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und fühlst dich eigentlich gewappnet für die Arbeitswelt. In deinen ersten Tagen am neuen Arbeitsplatz bemerkst du: „Okay, die Leute sind komisch, die Arbeit ist komisch.“
Versagen/Überforderung: Die Belastung wird nicht bewältigt und der Betroffene nimmt sich als versagend wahr. Der persönliche Selbstwert sinkt und die inneren Spannungen nehmen zu.Nach einigen Wochen stellst du dir die Frage: „Bin ich komisch oder bin ich einfach nicht für die Arbeitswelt geschaffen?“ Es kann sein, dass du Erkältungssymptome bekommst und dich allgemein kränklich fühlst, weil du weniger schläfst und dich die Situation belastet.
Mobilisierung: Bewältigungsstrategien werden aktiviert und haben einen offenen Ausgang. Mögliche Aktivitäten können sein, dass sich jemand auf seine Freizeitaktivitäten oder die Arbeit stürzt, mit Freunden über sein Thema spricht oder sich schlicht anderweitig ablenkt.Du suchst in Gesprächen mit Freunden nach Antworten und sie versuchen dich zu beruhigen mit Sätzen wie: „Das ist am Anfang ganz normal“ oder „Durchhalten, das wird schon“.
Krisenbewältigung versus Vollbild der KriseBewältigung
Vollbild der Krise
Nach erfolgreicher Mobilisierung wird die Krise verarbeitet und es erfolgt eine Anpassung als Neuorientierung an die neuen Gegebenheiten => erfolgreiche Veränderung.
Du hältst tatsächlich durch, weil dir die Meinung deiner Freunde wichtig ist und nach einer Weile bekommst du guten Kontakt zu deinen Kolleginnen und Kollegen. Langsam kommst du nach und nach auch in die Aufgaben rein und fühlst dich nach einiger Zeit wohler und immer sicherer am Arbeitsplatz.
Die Bewältigungsversuche der Mobilisierungsphase funktionieren nicht und es droht das Vollbild der Krise, das Rückzug, Isolation oder die Entwicklung von Erkrankungsbildern zur Folge haben kann.
Einer deiner Freunde war bereits selbst in dieser Situation und hat in der Probezeit seinen Job verloren. Seine Worte und die deiner Freunde beruhigen dich überhaupt nicht. Von Tag zu Tag wirst du ängstlicher, schläfst schlechter und hast schließlich deshalb dein erstes Kritikgespräch mit deinem Vorgesetzten. Nach dem Gespräch bist du vollends verunsichert, zweifelst an dir und deinen Kompetenzen und überlegst, selbst zu kündigen.
Im Anschluss an das Vollbild der Krise erfolgt dann die Bearbeitung und dann wieder die Neuorientierung.