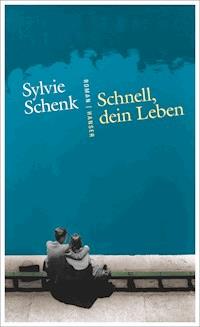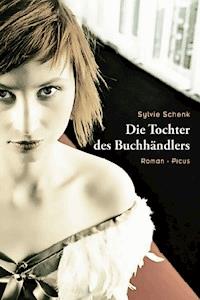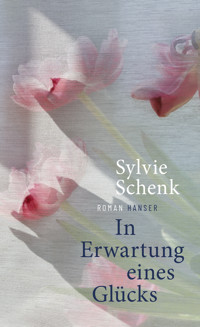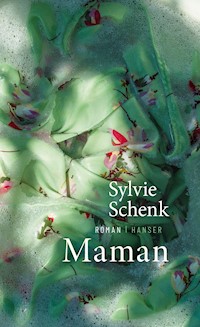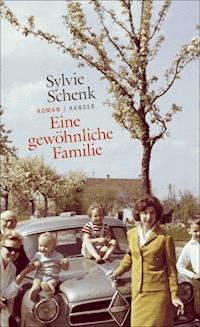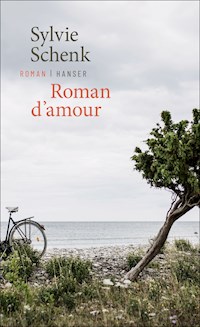
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sylvie Schenks fein gesponnener Ehebruchroman, voller Lebenserfahrung und Weisheit Charlotte Moire hat einen Roman über eine Affäre geschrieben, die sie vor Jahrzehnten mit einem verheirateten Mann hatte. Aus der Erinnerung an Verlangen und Leidenschaft ist Fiktion geworden. Nun aber sitzt ihr, der über Siebzigjährigen, eine beharrlich insistierende Interviewerin gegenüber, vor der sie immer wieder abstreiten muss, diese Geschichte selbst erlebt zu haben. Immer schwerer fällt es Charlotte in ihren Auskünften, zwischen Werk und eigenem Leben zu unterscheiden. Unmerklich fließen die Geschichten zweier Frauen ineinander, die nichts miteinander zu tun haben sollen und doch viel gemein haben. „Roman d’amour“ ist ein dichtes und kluges Buch über die Liebe und das Erzählen von Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Charlotte Moire hat einen Roman über eine Affäre geschrieben, die sie vor Jahrzehnten mit einem verheirateten Mann hatte. Aus der Erinnerung an Verlangen und Leidenschaft ist Fiktion geworden. Nun aber sitzt ihr, der über Siebzigjährigen, eine beharrlich insistierende Interviewerin gegenüber, vor der sie immer wieder abstreiten muss, diese Geschichte selbst erlebt zu haben. Immer schwerer fällt es Charlotte in ihren Auskünften, zwischen Werk und eigenem Leben zu unterscheiden. Unmerklich fließen die Geschichten zweier Frauen ineinander, die nichts miteinander zu tun haben sollen und doch viel gemein haben. »Roman d’amour« ist ein dichtes und kluges Buch über die Liebe und das Erzählen von Liebe.
Sylvie Schenk
Roman d’amour
Roman
Carl Hanser Verlag
Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse,
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis,
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits
Qui compriment le cœur comme un papier qu’on froisse?
Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse?
Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine,
Les poings crispés dans l’ombre et les larmes de fiel,
Quand la Vengeance bat son infernal rappel,
Et de nos facultés se fait le capitaine?
Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine?
Charles Baudelaire, »Réversibilité«
Sie sprechen Englisch. Poor thing. Gedämpfte Stimmen. Sie murmeln, dass du dich habest umbringen wollen. Unsinn. Es wird wieder alles verdreht und verfälscht. Wenn du die Augen einen Spaltbreit öffnest, wähnst du einen Priester an deinem Bett. Unmöglich. Im Raum schwebt ein dunkler Nebel. Oder es liegt an deiner Sehschärfe. Wo ist deine Brille? Dein Mund ist trocken. Du liegst in einem Bett. Einem fremden Bett. Ja, du bist noch in Irland, aber dieses Bett ist kein Hotelbett, und du hast dich nicht selbst gebettet. Der Priester (ist er ein Priester?) bückt sich zu dir und fragt: Did you want …? Du verstehst das Wort nicht. Commit suicide? Kill yourself. Sich umbringen? Das Wort springt auf dich zu, ein hartes Wort, to kill, wolltest du dich umbringen? Du schließt wieder die Lider, müde. Der Schlag einer Welle ins Gesicht, du kippst nach hinten. Ein Meer. Blinzeln. Und wieder das Gesicht des Priesters über dir, schwarz und rund, seine Visage ist dein Horizont, sinkt in die See. So viele Wolken. Sie reiten aufeinander, ineinander. Um dich also das Meer. Dein Kopf ein Kaulquappenkopf. Augen zu und durch: Du willst durch das raue Meer pflügen. You wanted to commit suicide …? Sein schwarzes Haar hängt ihm über der Stirn, es erinnert dich an den Mann, den du liebtest. Vielleicht ist er das und kein Priester. Du würdest gern schreien, um ihn zu erschrecken, ihm das Gesicht mit der Hand zurückschieben, kannst aber nur die Finger bewegen. Zu schwer, so müde, kraftlos. Sorry, I want to sleep. Hast du gesprochen? Das Zimmer kannst du nicht auskundschaften, ein Nebel aus weißen, grünen und gelben Farben, der Priester schwarz oder dunkelblau. Pulli oder Robe? Bist du im Krankenhaus? Du erkennst deine eigene Stimme nicht. Zu dumpf. Ja, es hängt ein Infusionsschlauch an deinem Arm. Wer hat Sie gerufen? Was fehlt mir? Fragst du. Alles, sagt er, alles fehlt dir. Du verstehst ihn nicht. Wo ist meine Brille? Ich brauche meine Brille, ich sehe schlecht. Lassen Sie mich bitte schlafen. Du schließt wieder die Augen und fühlst dich besser. Ob du sterben wirst und dich deshalb ein Priester besucht? Warum bist du hier, und wo bist du? Ich glaube nicht an Gott, sagst du. Muss ich beichten? Willst du beichten?, sagt er. Mach es, wenn es dir hilft. Du hörst ein kleines Lachen, ob es deins ist? Ich höre dich kaum, sagt er. Selbstmord ist eine Todsünde. Du bewegst die Beine, versuchst Schwimmbewegungen zu machen, es geht nicht. Wolltest du ertrinken? Wolltest du den Freitod? Warum spricht er Deutsch? Wieder siehst du die Wellen auf dich zukommen. Nicht mal hoch, ganz regelmäßig prallen sie zuerst gegen deine Knie, gegen deine Brüste, dann gegen dein Kinn, deine Stirn. Ein unendliches Feld mit grauen Wogen, du gleitest unter grauen Wolken. Du schwimmst mühelos. Noch ist das Meer ruhig und willig und repetitiv. Es wellt sich ins Unendliche. Du kraulst dem Ende der Gezeiten entgegen. Bist nicht mehr allein. Gott ist in deiner Nähe: ein lachender Seehund. Und dann, kurz danach: bleiern, hart, eiskalt, zuerst ein kaum wahrnehmbarer Kinnhaken, dann eine Watsche, ein Faustschlag, der Kampf beginnt gegen aufgetürmte Wellen, die sich hoch und frostig über deinen Kopf erheben; und sie schlagen zu, drücken dich nieder, du würgst, spuckst die Kälte aus, das Wasser lässt dir nie Zeit, Luft zu holen, bevor es dich wieder anspringt, ach, was soll’s? Du willst doch, dass die Kälte dich zerfrisst, dass die Welle dich erschlägt. Du hättest ein Gedicht über die Wellen schreiben sollen. Über den Sand darin, über das Öl darin, über die vielen Toten darin. Du hast so gern Gedichte geschrieben und gelesen. Die Franzosen, Baudelaire, Rimbaud, die Deutschen, Sarah Kirsch, Hannah Arendt. Man wird davon nicht klüger. Aber Gedichte sind Wegmarkierungen, die helfen aus dem Gestrüpp. Hättest du nur ein Gedicht über den Atlantik auswendig gelernt, bevor du ins Wasser gingst, das hätte dir gegen die Versuchung zurückzuschwimmen geholfen, zu spät, so wird’s auch gehen, du versuchst kraulend und stimmlos dein Lieblingsgedicht im Kopf zu rezitieren, wie früher als Kind im Bett, schweigend, um deine Geschwister nicht zu wecken, ein französisches Gedicht von Baudelaire, ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse? Engel voll Heiterkeit, kennst du die Todesängste? Mit dieser Kälte hast du nicht gerechnet. Dein Kraulen wird immer langsamer, nur noch kreisende, kleine, ausholende Bewegungen. Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine? Engel voll Güte, kennst du den Hass? Jetzt umhüllt dich das Meer, legt dich in tückische Falten, überrollt dich, drückt dich nach unten, du erlebst, wie es dich mit Milliarden von Zungen und glucksenden Mündern einsaugt, du bist erschöpft und ergeben, glücklich und unglücklich, hoffnungsvoll und verzweifelt, kraftlos, du schluckst und schnüffelst bitteres Wasser, und dir dämmert endlich, dass du nicht mehr ringen musst, dass du an dem Punkt angekommen bist, den du erreichen wolltest, dem kreisenden Ort, wo sich Freud und Leid treffen, wo sich Schlaf und Wachsein küssen, wo Lüge und Wahrheit eins werden. Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres? Engel voll Gesundheit, kennst du das Fieber? Nur noch ein kurzes Aufbegehren, ein Schlucken, ein Würgen, im Hals ein sandiger Knoten, ein letztes Mal die Wolken erblicken, bist endlich eine Gescheiterte. Und das All geifert und sabbert und lacht dich tot, nicht mehr kämpfen, es hat schon deine Glieder, deinen Bauch, deine Schulter. Du bist längst ausgeweidet. Lass dich doch schmecken und verdauen. Gib nach.
Vor meinem Mittagsschlaf hätte ich diese Szene aus Roman d’amour nicht noch einmal lesen dürfen. Klara ertrinkt im Atlantik, oder auch nicht. Nun wachte ich auf, lag noch im Bett, in den Ohren ein Brummen, ein Rauschen, im Kopf das Gedicht von Baudelaire, das ich in der Schule gelernt hatte, und mein welliges Gerede. Ein paar Fetzen schwammen noch auf dem Wasser, ich bekam sie zu fassen: Der Mann ist aufgestanden, kein Priester. Was hast du da gemacht?, sagt er. Ich will doch, dass du lebst, ich mag dich am Leben, lebendig, verstehst du? Ich mag dich nicht, sage ich, ich liebe dich, aber dich gibt es nicht mehr.
Ich wachte zum zweiten Mal auf, und da war keiner. Und ich fragte mich wieder, ob ich die erste Szene aus Roman d’amour vorlesen würde oder lieber nicht.
Vormittags hatte ich mit Frau Sittich telefoniert, der Lebensgefährtin des Bibliothekars. Ich wusste noch nicht, dass sie die Lebensgefährtin des Bibliothekars war. Und mit ihm zusammenarbeitete. Sie hatte sich als Journalistin vorgestellt und wollte mir nachmittags einige Fragen für einen Radiobeitrag stellen. Ja, das Interview über Roman d’amour würde schon morgen ausgestrahlt. Sie fand es originell, dass ich eine literarische Gattung, ein Genre als Titel des Buchs gewählt hatte.
Nach meinem Mittagsschlaf war ich bleischwer. Der Meerestraum spukte mir noch durch den Kopf, ich wurde niedergewalzt und erstickte. Ich klammerte mich an das Kopfkissen und wollte mich ins durchgewühlte Bett verkriechen, musste aber aufstehen und mich beeilen. Ich schob die Vorhänge zur Seite, um auf die Nordsee zu schauen, aber mein Zimmer ging hinaus zum Garten des Hotels. Vielleicht, dachte ich, könnte ich am nächsten Tag schnell zum Strand gehen, bevor ich nach Hause zurückfahre, ich mache mir viel aus dem Meer, egal ob Wattenmeer, Sandstrand oder Felsen, Hauptsache, das Meer. Unten schimmerte nur der Hotelgarten, in dem sich zwei gelb-rote Bäume im Wind wiegten. Der Wind fegte durch welke Dahlien, Ahornblätter wirbelten durch die Luft. Ich sah, wie aus den braun gesprenkelten Zweigen eines größeren Baums eine Kastanie fiel und unten aus ihrer grünen Stachelhülle sprang. Durch das gekippte Fenster drang der leicht moderige Geruch feuchter Blätter zu mir, Erde und Sonne gemischt. Der Herbst ist schon immer meine Lieblingsjahreszeit gewesen, für mich nicht die Jahreszeit des Verendens, sondern des Vollendens. Im Grunde steht man hier am Anfang eines Werkes, dessen Samen unterirdisch im Winter keimen, um im Frühjahr oder Sommer aufzublühen. Der Gedanke stammt aus meiner Schulzeit, weil der Oktober in Frankreich den Beginn des Schuljahres markierte, man sammelte buntes Laub, um es im Kunstunterricht nachzumalen. Oft habe ich im Herbst die ersten Zeilen meiner Romane geschrieben, wenn eben die Kastanien aus den Schalen platzten.
Ich nahm mein Kleid aus dem Koffer. Ein schickes rotes Kleid, extra für diese Gelegenheit gekauft, leider wie so oft auf die Schnelle und ohne es anzuprobieren. Das Kleid war für mein Alter zu kurz, ich hatte das schon zu Hause festgestellt, aber keine Zeit mehr gefunden oder keine Lust mehr gehabt, es im Geschäft umzutauschen. Ich schminkte in drei Minuten mein müdes Gesicht, kaschierte die Altersflecken mit einem Stift, versuchte meine Augen mit dem Kajalstift zur Geltung zu bringen, auch jetzt alles zu rasch, mit zitternder Hand. Im Spiegel schaute mir ein welker Narziss entgegen. Es schien aber noch das Gesicht der Radfahrerin von Irland durch. Die Züge, die Locken, die Vergissmeinnicht-Iris, die Vergangenheit sah mich an, eingedickt.
Frau Sittich wartete schon am Empfang. Sie bemerkte mich nicht sofort, als ich die Treppe herunterkam. Sie ging nervös auf und ab, drehte sich um die Achse, stand jetzt vor dem Spiegel der Garderobe, ließ ihre Finger durch eine rote Lockenfrisur gleiten, glättete eine eng anliegende Jeans und zog an einem flauschigen lila Pulli. Sie war viel jünger als ich, doch älter, als ihre Stimme am Telefon es hatte vermuten lassen. Sie kramte in ihrer Handtasche, fischte einen Lippenstift heraus und zeichnete ihre Lippen nach, nahm dann ein Stofftaschentuch, spuckte darauf, wischte etwas, vielleicht ein Zuviel an Farbe von der Lippe, drehte sich wieder um. Die Rezeptionistin stand hinter ihrem Tresen und beobachtete sie auf eine Art, die mir gierig erschien. Ich traute mich nicht, mich zu bewegen, wollte die Journalistin bei ihrem peinlichen Zurechtmachen nicht stören. Sie verstaute den Lippenstift wieder in ihrer großen Tasche, nahm noch etwas heraus, ein Bonbon oder einen kleinen Kaugummi, den sie in den Mund steckte, machte eine ruckartige Kopfbewegung synchron mit dem Klick des Taschenverschlusses. Dann erblickte sie mich, stieß einen Willkommensgruß hervor, hastig, begeistert, übersteigert. Bonjour, Charlotte Moire! Jede Silbe gedehnt. Mit den knallroten Lippen, den geschminkten Wangenknochen, der hektischen Gestik gehörte sie zu der Art von Frauen, die in ihrer demonstrativen Art, das Leben aufregend zu finden, mich vom Gegenteil überzeugen. Sie zückte jetzt ein kleines Aufnahmegerät aus der Tasche und wünschte, ihr Interview sofort mit mir zu führen, hier in der Lobby, danach würde sie mich zur Bibliothek kutschieren, aber wir würden dort von einer Menge Menschen gestört werden, also bitte, lieber gleich hier, Klara, wir haben noch ein paar Stunden, die Preisverleihung fängt um achtzehn Uhr an. »Ich heiße Charlotte«, sagte ich. »Sie haben mich gerade Klara genannt.« Sie schlug dreimal ihre künstlichen Wimpern nieder und die Hände über den Mund: »Oh Pardon! Sie merken, liebe Charlotte, wie die Persönlichkeit Ihrer Protagonistin in mir nachwirkt, eine tolle Figur, Ihre Klara, so lebendig, so real.«
Es war ein völlig unbekannter Literaturpreis zweiter Klasse, der mich hierhergeführt hatte, ein Preis, der zum ersten Mal verliehen wurde und dessen bescheidenen Geldbetrag prominentere Kollegen als eine Herabstufung ihres Talents empfunden hätten. Ich war trotz meines Alters froh, ihn zu bekommen, und bereit, dafür sechshundert Kilometer in einem vollen und halb defekten ICE zu fahren. Tapetenwechsel, Aufmerksamkeit, freundliche Menschen, lobende Worte, ein Blumenstrauß, dies alles auf einer Nordseeinsel. Ich werde von Inseln angezogen, auch wenn sie einen gefangen halten können. Viele Inseln, ob Alcatraz, die Teufelsinsel oder die Île d’If, wurden missbraucht, unter anderem als Gefängnisse. Mir geben sie Hoffnung, sie sind Vorboten der Kontinente, strahlen noch etwas Unverbrauchtes aus, nach allen Himmelsrichtungen rotieren Wünsche, Nester mitten im Meer, Rettungsorte für Gestrandete. Und ich liebe das Meer. Als Einsteigerin in die deutsche Sprache habe ich früher »Mehr« statt »Meer« geschrieben, und in meinem Kopf schreibt es sich heute noch so, ein Mehr an Horizont, ein Mehr an Träumen, ein Mehr an Leben und Tod. Mehr Exzess, mehr Tiefe. Hoffentlich würde mir bei der Preisverleihung verraten werden, warum mein Buch diese Auszeichnung, den »Kaskade-Preis« bekam: Eine Kaskade ist ein halsbrecherischer Sprung, bei dem ein Akrobat einen Absturz vortäuscht. Und manchmal auch realisiert. Und sein Leben riskiert. Der Preis wird also an einen Schriftsteller verliehen, dessen Roman eine Art Drahtseilakt bedeutet. Der Preis sollte besser, dachte ich, ein Buch ehren, das in einem Krisengebiet geschrieben wurde, nicht das Werk einer französischen Autorin, das sie in ihrem komfortablen deutschen Arbeitszimmer verfasst hat. Denkbar wäre auch ein Roman, der Mafiosi entlarvte, Killer, die der kühnen Schriftstellerin im Schatten der Buchhandlungen auflauern würden. Passen könnte ein Enthüllungsskandal, das Enttarnen von beeinflussbaren einflussreichen Politikern, die sich nicht scheuen würden, einen Prozess anzuzetteln, um das Buch verbieten zu lassen.
Was hatte ich denn riskiert? Ich wusste es nicht, mein Verleger auch nicht. Vielleicht, sagte mein Lektor, empfindet man Ihren Stil als mutig? Sein Lächeln war zu wohlwollend. Ich hatte einen klassischen Liebesroman geschrieben. Kein avantgardistisches Werk, keinen gewagten Porno. Es war eine einfache Liebesgeschichte, die zum Teil auf der grünen Insel Irland spielte. Es werden jeden Tag Liebesromane verfasst und veröffentlicht, gelesen, kritisiert, ignoriert und zermahlen. Aber lieber wollte ich diesen Preis annehmen, um so zu verhindern, dass mein Buch bald eingestampft, mein Leben makuliert würde. Deshalb war ich da.
Ich hatte die Geschichte eines Mannes, Lew, eines Lehrers zwischen zwei Frauen erzählt. Eher deprimierend, da sie dramatisch mit dem Suizid oder besser Suizidversuch einer der Frauen endete, der Versagerin Klara, einer ehemaligen Schuldirektorin. Ob der Selbstmord erfolgreich begangen wurde, hatte ich auf Bitten meines Lektors offengelassen. Die Leserin brauche Hoffnung. Sie dürfe sich das Ende selbst zusammenstricken, mit Klara zittern, sie anschwimmen und per Achselschleppgriff zur Küste zurückziehen. Ich hatte nicht lange an diesem Buch gearbeitet. Ohne mein Wissen hatte sich der Text in mir zusammengepresst, und als ich beim Aufräumen meines Arbeitszimmers einen Schuhkarton mit alten Notizen umstieß und die Erinnerung an eine Reise in Irland mir einen Stich versetzte, erlag ich der Versuchung, längst verblasste Liebeserfahrungen aufleben zu lassen und literarisch auszubeuten. Es war dann, als hätte ich ein Stück Faden gefasst und nicht mehr aufgehört, daran zu ziehen, bis ein ganzer alter Mantel aufgetrennt war. Und er war flott wieder neu gestrickt worden. Ich schickte meine Protagonisten Lew und Klara nach Irland. Ich schickte Lew zu seiner Frau Marie zurück, ich schickte Klara ins Meer. So einfach war das. Ich brauche manchmal Jahrzehnte, um die Bedeutung, die Komik und die Tragik der Geschichte zu erfassen, wenn sie zu mir gehört. Nach dieser langen Inkubationszeit tritt das Geschehene hervor und wird mit erfundenen Elementen bardiert. Erst dann sprudeln, wimmeln und drängen die Worte. Dieses Mal rochen sie nach Salz, nach Algen, nach angeschwemmtem Holz, nach Torf und nach Körpersäften.
Die erste Frage von Frau Sittich war ungenau, die zweite flau und grob. Nach einem Blick in ihr Notizbuch hatte sie sich an der Stirn gekratzt, Speichel geschluckt und mich verschwörerisch angeschaut: Also, wie hat es angefangen?
Was meinte sie mit es? Meine ersten Schritte als Schriftstellerin? Den Hintergrund, die Prämissen des Romans, die Begegnung von Lew und Klara oder den Beginn vom Ende, Klaras Scheitern? Die Frage brachte mich aus dem Gleichgewicht. Als schließe sie eine vage Drohung ein, eine Anschuldigung oder eine Andeutung auf den Schlamassel meines Liebeslebens. Als wisse die Journalistin von dem Mann, der für die Figur von Lew das Aktmodell war, als wolle sie jetzt erfahren, wann ich den Boden unter den Füßen verlor. Ich bat sie (mit erstickter Stimme?), ihre Frage präziser zu formulieren. Sie gluckste. Natürlich meine sie die Entstehung des Romans, wie ich auf die Idee gekommen sei, auf Irland, die Fahrradtour, die Protagonisten et cetera. Diese lateinischen Buchstaben tänzelten ungeduldig auf ihren Lippen, als ich von irischen Songs erzählte, die Dubliners, A Song for Ireland. »Beim Zuhören habe ich mich an eine Reise mit Freunden nach Irland erinnert«, sagte ich, »lange her, in der Jugend, eine sehr beeindruckende Fahrradtour, Dublin, Galway, Westport et cetera, und die Musik, die Volkslieder, die Bilder, die sie hervorriefen, dies alles hat mich zu dem Roman gebracht oder eher zu dessen Rahmen, Irland, und nach und nach, Frau Sittich, klopften sie an, die drei Hauptpersonen dieser Erzählung.« — »Eine romantische Geschichte«, sagte Frau Sittich, »in einer kalten und nüchternen Zeit veröffentlicht.« Und ich: »In einer schwierigen, aufwühlenden Zeit.« — »Ein Liebesroman«, sagte sie. »Ja, schon lange habe ich einen Liebesroman schreiben wollen, und ich dachte, ich tue es, bevor ich zu alt bin und mich gar nicht mehr erinnere, wie es war, verliebt zu sein.« Bei diesen Worten kicherten wir beide, und die Journalistin beeilte sich hinzuzufügen, lieben könne man in jedem Alter, sie hoffe das sehr. Und die Liebe, wissen Sie, et cetera.
Ich fragte mich sofort, warum ich mir so viel Mühe machte, die Entstehungsgeschichte dieses Romans zu verfälschen. Es konnte mir doch piepegal sein, wenn diese Frau und die Leser erfuhren, dass ich mit meinem Geliebten, dem echten Lew (geben wir ihm den falschen und spielerischen Namen Ludo), vor fünfundzwanzig Jahren eine Reise nach Irland unternommen hatte. Eros veranstaltet sein Bockspringen rund um den Globus, jeder kennt die Leiden eines Liebeskummers. Wer noch nie, dem fehlte etwas, das er per procura in meinem Buch erfahren durfte. Ludo war nun über siebzig, hatte sich längst, dachte ich, in meinem Buch erkannt, falls er es überhaupt gelesen hatte. Wir waren uns vor Jahren zufällig noch einmal begegnet, vor dem Schaufenster eines Tabakladens, in dem er die Pfeifen bewunderte, die er nie mehr rauchen würde. Zwanzig Jahre waren vergangen seit Irland. Er sah blass und aufgequollen aus. Er lebte allein. Dreimal die Woche ging er zur Dialyse. Der ehemalige Freund war gefangen in einem blassen dicken Fleischkokon, in dem ich noch den Schmetterling erkannte, der einmal so schön mit der Liebe Versteck gespielt hatte. Ich gab ihm einen flüchtigen Kuss. Inzwischen ist auch das Tabakgeschäft verschwunden.
Hatte ich gelogen, weil mein Privatgarten mir heilig war? Ach was. Die Zeit macht einen bescheiden und schamlos. Wovor hatte ich denn Angst? Vor der kleinen Welt des Literaturbetriebs? Vor den Preis- und Schande-Etiketten, die dort verteilt wurden? Kaum. Auch dort hatte ich längst nichts mehr zu verlieren. Wenn ich mich nicht zu sehr outen wollte, dann wegen der verschlungenen Gedanken, die in dem Thema herumschwammen, weil es schwieriger ist, eine gefühlte Wahrheit mit Sätzen einzufangen als eine Forelle in den Niagarafällen. Mir fiel es leichter, die Fiktion, das Spiel der Illusionen zu spinnen, ein Trompe-l’Œil schlau zu präsentieren und vielleicht sogar effizienter. Das Kind dreht sich auch auf dem Karussell um die Welt.