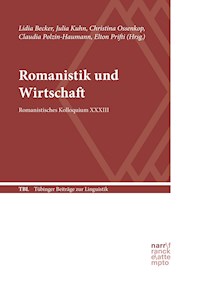
Romanistik und Wirtschaft E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Romanistik und Wirtschaft – diese Beziehungen sind vielfäl¬tig und aktuell. Der Band spannt einen weiten Bogen und ana¬lysiert linguistisch aktuelle Phänomene wie: die Versprachlichung rezenter Entwicklungen wie Digitalisierung des Arbeitsmarktes und neuer Wirtschaftsformen; die sprachliche Verschleierung prekärer Beschäftigungsverhältnisse; die Fachsprachlichkeit französischer Wirtschaftstexte; semantisch-konzeptionelle Asymmetrien zwischen deutscher und spanischer Wirtschaftssprache; Nachhaltigkeitsberichte in intertextueller und interkultureller Hinsicht; (fehlende) kogniti¬onslinguistische Ansätze in der Marketingtheorie mit Blick auf Metonymie und Synonymie; Markennamen, Benennungen und Assoziationen; Auswirkungen der Sprachenpolitik länderübergreifender Handelsorganisationen; sowie historisch die textuelle Darstellung wirtschaftlicher Realitäten Frankreichs im 12. Jahrhundert. Ein weiterführender Ausblick auf zukünftig noch zu erschließende Bereiche und Desiderata rundet den Band ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lidia Becker / Julia Kuhn
Romanistik und Wirtschaft
Romanistisches Kolloquium XXXIII
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8420-5 (Print)
ISBN 978-3-8233-0277-3 (ePub)
Inhalt
Einleitung
Das XXXIII. Romanistische Kolloquium, das vom 31. Mai bis 2. Juni 2018 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena veranstaltet wurde, widmete sich dem Thema „Romanistik und Wirtschaft“. In einer Zeit, in der Wirtschaft und Arbeitsmarkt durch rezente Phänomene wie Globalisierung, gemeinsame Märkte, länderübergreifende Handelsorganisationen, Zollunionen, Digitalisierung, neue Wirtschaftsformen – die mitunter sozial prekäre Beschäftigungsverhältnisse implizieren – starken Veränderungen unterworfen sind, ist es eine der zentralen Aufgaben der Linguistik, die sprachlichen Auswirkungen und Implikationen dieser rezenten Entwicklungen zu thematisieren und aufzuzeigen, welche diskursiven Realitäten konstruiert, welche sprachlichen Verschleierungsstrategien angewandt werden, welche neuen Textsorten interkulturell hervorgebracht werden, welche konzeptionellen Asymmetrien in den Wirtschaftssprachen verschiedener Länder auftreten, welche assoziativen ergonymischen Strategien angewandt werden, welche machtpolitischen Auswirkungen die Sprachenwahl gemeinsamer Märkte mit sich bringt u.v.m..
Die Beiträge des Bandes widmen sich dementsprechend in erster Linie zwei großen Themenbereichen: einerseits der Auseinandersetzung mit der aktuellen Fachsprache Wirtschaft in der Romania, andererseits der Ergonymik und Neologismenbildung in den romanischen Sprachen. Daran schließen sich zusätzlich Ausblicke auf die Sprachpolitik gemeinsamer Märkte, auf die textuelle Darstellung historischer wirtschaftlicher Realitäten, auf universitäre Studienmöglichkeiten von Wirtschaft und Sprache, sowie auf zukünftige Betätigungsfelder und Desiderata an.
Konkret thematisiert dieser Band verschiedene Zusammenhänge, die zwischen Romanistik und Wirtschaft bestehen. Ausgehend von der Frage, ob die Annahme einer klaren Dichotomie zwischen wirtschaftlicher Fachsprache und Allgemeinsprache ausreiche, oder eine „Mittlere Schicht“ zusätzlich anzusetzen sei, führt der Band weiter zu neuen, digital bedingten Wirtschaftsformen und der Sprachverwendung in diesen neuen Kontexten. In der Folge wird die relative Einheitlichkeit von Fachsprache durch die Hegemonie des Englischen thematisiert, gleichzeitig auf bestehende fehlende Bedeutungsentsprechungen deutscher und spanischer Wirtschaftstermini eingegangen. Der Band führt weiter zu einem innerhispanophonen Vergleich kultureller Anpassung anhand der Textsorte Nachhaltigkeitsbericht. In der Folge wird der bestehende linguistische Informationsbedarf im Bereich des Marketings thematisiert und ausgehend von kognitionslinguistischen Theorien das funktionale Spektrum von Metonymien im Marketing beschrieben. Es folgt eine Betrachtung von Synonymie und Konzernabschlüssen. Weiter führt der Band in den Bereich der Produktonomastik, geht auf romanische Namen sowohl in Deutschland als auch in Italien ein und zeigt Benennungsstrategien von WLAN-Netzen in Frankreich und Italien. Im Anschluss werden anthroponymbasierte blendings in der Mediensprache thematisiert. Es folgt die Auseinandersetzung mit der Sprachenfrage von Handelsorganisationen wie CARICOM und deren Auswirkungen. Die historische Perspektive wird mit der Betrachtung der Pesme Aventures in Chrestiens Yvain (um 1170) als Abbildung der wirtschaftlichen Realität der Zeit und Hinterfragung deren Funktion aufgegriffen. Der Band schließt mit Ausblicken auf Studienmöglichkeiten von Romanistik und Wirtschaft an deutschen Universitäten und der Formulierung von nach wie vor bestehenden Desiderata in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Romanistik und Wirtschaft.
Die einzelnen Beiträge gestalten sich dabei wie folgt: Den Einstieg bildet der Beitrag von Eva Lavric („Zwischen Terminologie und Allgemeinsprache“), die argumentiert, dass das Ansetzen einer Dichotomie Allgemeinsprache vs. Fachsprache Wirtschaft nicht ausreicht, sondern vielmehr zusätzlich eine „Mittlere Schicht“ anzunehmen ist. Darunter versteht Lavric nicht-terminologische sprachliche Elemente, die durch ihre Frequenz und Funktion bestimmte – aber nicht alle – fachsprachlichen Diskurse kennzeichnen, wobei verwandte Fächer quasi gebündelt gewisse semantische (beispielsweise Sport-Metaphern wie Wettrennen) und syntaktische Elemente bevorzugen.
Im Anschluss thematisiert Antje Lobin die „Sprachverwendung im digitalen Arbeitsmarkt“. Sie zeigt, dass die Digitalisierung zu tiefgreifenden Veränderungen des Arbeitsmarktes geführt hat, die neue Wirtschaftsformen und Beschäftigungsmodelle, wie etwa die Gig-Economy, hervorgebracht haben. Diese gesellschaftlichen und unternehmerischen Entwicklungen schlagen sich auch im Sprachgebrauch nieder. Um den hier implizierten vielfach geringeren Grad an Bindung und Verantwortung gegenüber den (Gelegenheits-)Beschäftigten zu kaschieren, werden euphemistisch Argumente wie Selbstbestimmung und Autonomie angeführt sowie eine Rhetorik der Vergemeinschaftung gewählt. Die entsprechenden Begrifflichkeiten und Benennungsmuster können zu den Konzepten der political correctness oder des doublespeak in Beziehung gesetzt werden. In einer Fallstudie zum Italienischen und Französischen beleuchtet und systematisiert die Verfasserin diese.
Weiterführend geht Franz Rainer („Semantisch-konzeptuelle Asymmetrien zwischen deutscher und spanischer Wirtschaftssprache“) auf die Fachsprache der Wirtschaft ein. Er zeigt, dass diese vor allem durch die Hegemonie des Englischen, in ihrer begrifflichen Struktur über die Sprachen hinweg außerordentlich homogen ist. Dennoch stößt man bei der Suche nach Entsprechungen zwischen deutschen und spanischen Wirtschaftstermini immer wieder auf Fälle, in denen keine genaue Übereinstimmung in den Bedeutungen gegeben ist. In Franz Rainers Beitrag, der aus der lexikographischen Praxis erwachsen ist, wird auf der Basis von Andreas Blanks Bedeutungsbegriff eine Systematisierung der angetroffenen Asymmetrien unternommen.
Auf die Textsorte Nachhaltigkeitsbericht gehen im Anschluss Pilar Pérez Cañizares und Johannes Schnitzer ein („Corporate Social Responsibility kommunizieren: Intertextuelle Beziehungen in den Nachhaltigkeitsberichten des spanischen Unternehmens Gas Natural Fenosa“): Corporate (Social) Responsibility (CSR) und Nachhaltigkeit sind in der kurzen Zeit ihres massiven Gebrauchs zu Schlüsselwörtern in der Unternehmenskommunikation avanciert. Die Textsorte Nachhaltigkeitsbericht ist bisher jedoch aus linguistischer Perspektive eher wenig untersucht worden. Insbesondere die Frage ihrer Entwicklung und ihrer Anpassung an unterschiedliche Kulturräume ist weitgehend unerforscht. Beiden Fragen wird in diesem Beitrag anhand einer exemplarischen Analyse nachgegangen. Zu diesem Zweck wurden die CSR-Berichte eines spanischen Unternehmens mit starker Präsenz in lateinamerikanischen Ländern unter zeitlicher und regionaler Perspektive miteinander verglichen, um Unterschiede und Parallelitäten zwischen diesen Dokumenten festzustellen. Die Ergebnisse dieser ersten Untersuchung weisen darauf hin, dass sich das Spannungsfeld zwischen Adaptierung und Beibehaltung einer konzernweiten Identität komplexer darstellt, als man intuitiv vermuten würde.
Im Kontext von Marketing und Linguistik ist Regina Gökes Beitrag „Das funktionale Spektrum der Metonymie. Beispiele aus Marketingtheorie und -praxis“ angesiedelt, der von kognitonslinguistischen Theorien ausgehend Metonymie und deren funktionales Spektrum beschreibt. Denn obwohl das Fach Marketing tendenziell eher quantitativ ausgerichtet ist, gibt es qualitative, sprachorientierte Forschungsansätze. Diese Arbeiten stellen vor allem Metaphern ins Zentrum ihrer Betrachtungen. Andere Tropen wie die Metonymie oder die Synekdoche bleiben eher ausgeklammert oder werden als Unterarten der Metapher aufgefasst. Zudem werden aktuelle kognitionslinguistische Theorien kaum berücksichtigt. Insgesamt besteht innerhalb des Marketings also ein linguistischer Informationsbedarf, und dieser wird neuerdings auch von qualitativ orientierten Marketingforschern aufgezeigt. An dieser Schnittstelle zwischen Marketing und Linguistik ist Regina Gökes Beitrag zu verorten. Er geht von aktuellen kognitionslinguistischen Theorien aus und beschreibt anhand verschiedener Beispiele aus Marketingtheorie und -praxis das funktionale Spektrum von Metonymien. Darüber hinaus werden Forschungsdesiderata in diesem interdisziplinären Grenzbereich benannt.
Lexikalische Relationen behandelt auch Miriam Leibbrand in ihrem Beitrag „Zur Synonymie in der französischen Wirtschaftssprache am Beispiel einer Textsorte der externen Unternehmenskommunikation“. Die Verfasserin setzt sich mit Synonymie am Beispiel von Konzernabschlüssen börsennotierter Unternehmen auseinander und orientiert sich dabei an empirisch erhobenen Daten authentischen Sprachgeschehens.
Es folgt eine Reihe von Beiträgen, die (produkt-)onomastische Fragestellungen thematisieren. So der Beitrag von Elke Ronneberger Sibold („Carlo Colucci Uomo Mare und Chevalier de Bayard. Romanische Sprachen in deutschen Markennamen (1894 – 2008)“), in dem die Verfasserin zeigt, dass romanische Sprachen in deutschen Markennamen vor allem verwendet werden, um sowohl das benannte Produkt durch positive Assoziationen mit den entsprechenden Ländern als auch seinen Käufer oder seine Käuferin durch die (unterstellte) Kenntnis der romanischen Sprachen und Kulturen aufzuwerten. In beiden Hinsichten unterscheiden sich vor allem das Französische einerseits und die Sprachen der Mittelmeerreiseländer Italienisch, Spanisch und Portugiesisch (im Beitrag „romanisch“ genannt) andererseits. Auch die vorwiegenden sprachlichen Mittel zur Erzeugung der positiven Assoziationen und die bevorzugt benannten Waren sind verschieden. Von 1894 bis 1994 wechselten sich „französische“ und „romanische“ Epochen ab. Erst im neuen Jahrtausend werden die französischen Namen durch spezifisch italienisch markierte abgelöst. Die historische Entwicklung lässt sich weitgehend durch die parallele politische, soziokulturelle und wirtschaftliche Geschichte Deutschlands erklären.
Während sich Ronneberger-Sibold mit romanischen Namen in Deutschland auseinandersetzt, thematisiert Paola Cotticelli in ihrem Beitrag „Echo der anderen romanischen Sprachen in italienischen Markennamen. Konnotationen im Vergleich“ fremdsprachige Ergonyme in Italien. Sie untersucht die Verwendung von Fremdsprachen in italienischen Markennamen und zeigt, dass diese den wechselnden sprachpolitischen Tendenzen im Laufe des 20. Jahrhunderts entsprechen. Waren demnach am Anfang des 20. Jahrhunderts fremdsprachliche Markennamen noch selten zu finden, und wenn überhaupt, nur für bestimmte Produkte, werden vor allem anglisierte Namen seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger gebraucht. Cotticelli zeigt jedoch, wie es sich mit Markennamen verhält, die sprachlich den romanischen Sprachen näherstehen und analysiert ihre Verwendung in Bezug auf die damit verbundenen Konnotationen.
Nadine Rentel stellt in ihrem Beitrag „Strategien der Benennung von WLAN-Netzen in der Romania“ französisch- und italienischsprachige Benennungen von öffentlichen und privaten WLAN-Netzen gegenüber und zeigt, dass die bei klassischen Produktnamen zu beobachtende werbende und valorisierende Funktion bei der Benennung von WLAN-Netzen eine weit geringere Rolle spielt. Daher sind z. B. öffentliche, frei zugängliche WLAN-Netze wenig originell, dafür aber transparent benannt, während private Access-points selbstcharakterisierende oder zitierende Benennungen aufweisen.
Einen Blick auf die Mediensprache und die hier intendierte werbende bzw. Aufmerksamkeiterregende Funktion von diskursiven Elementen werfen Holger Wochele und Fiorenza Fischer in ihrem Beitrag „Neologismen in der italienischen Mediensprache. Entwicklungstendenzen in der Wortbildung und Erklärungsversuche zu möglichen auslösenden Faktoren“. Sie thematisieren als Neologismen in der Mediensprache auftretende binäre anthroponymbasierte blendings wie z. B. Renzusconi und analysieren diese phonologisch, semantisch und pragmatisch.
Auf die Betrachtung von Benennungsstrategien im (weiten) Marketingkontext folgt die Auseinandersetzung mit der Sprachpolitik gemeinsamer Märkte. So thematisiert Andre Klump in seinem Beitrag „Lang kreyòl kòm dezyèm lang ofisyel“ die Sprachenfrage in der regionalen Handelsorganisation CARICOM. Es zeigt sich, dass ähnlich wie im Falle des Gemeinsamen Marktes Südamerikas, dem MERCOSUR, bei dem im Jahre 2006 eine indigene Sprache – das Guaraní – als dritte offizielle Sprache neben dem Spanischen und Portugiesischen eingeführt wurde, auch die Karibische Gemeinschaft CARICOM seit 2011 die strategische Frage der Institutionalisierung einer neuen Verwaltungs- und Arbeitssprache neben dem Englischen bewegt. Die damalige Forderung des haitianischen Präsidenten Michael Martelly, diesen Status dem Französischen zu verleihen, löste in seinem Land eine lebhafte Sprach(en)debatte zum Stellenwert des Kreyòl ayisyen aus. Andre Klumps Beitrag dokumentiert am Beispiel Haitis, wie die Sprachpolitik länderübergreifender Handelsorganisationen, regionaler Märkte und Zollunionen einen öffentlichen nationalen Diskurs um Potential, Wertigkeit und Funktionalität des eigenen Idioms auslösen können.
Historisch ausgerichtet ist der Beitrag von Philipp Burdy „S’est riches de nostre desserte Cil, por cui nos nos traveillons. Ein früher französischer Wirtschaftsdiskurs (Chrestien de Troyes, Yvain, vv. 5191–5337)“, der die Episode der Pesme Aventure in Chrestiens Yvain (um 1170) thematisiert. Diese ist bereits vielfach kommentiert und gedeutet worden, und zwar mehrheitlich als Abbildung sozialer und wirtschaftlicher Realität im Frankreich des 12. Jahrhunderts. Burdys Beitrag liefert einen Überblick über die fachwissenschaftliche und publizistische Rezeptionsgeschichte dieser Textstelle, die durch ihre ökonomische Aktualität überrascht, geht auf textkritische Probleme ein und wirft erneut die Frage nach möglichen Quellen und der Funktion der Passage auf.
Die beiden abschließenden Beiträge von Anna Scheer („ʻWirtschaft und Sprachenʼ. Vorstellung eines interdisziplinären Studienprogramms der Friedrich-Schiller-Universität Jena“) und Otto Winkelmann („Wirtschaftsromanistik. Erfahrungen und Perspektiven“) führen zurück in die Gegenwart und blicken in die Zukunft. Die VerfasserInnen stellen Studiengänge an deutschen Universitäten (wie die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Justus-Liebig-Universität Gießen) vor, die Romanistik und Wirtschaft verbinden. Otto Winkelmann formuliert zudem ausblickend aus seiner Sicht weiterhin bestehende Desiderata und zeigt auf, welche Bereiche im Kontext „Romanistik und Wirtschaft“ zukünftig noch zu bearbeiten bleiben.
Die HerausgeberInnen bedanken sich bei Kathrin Heyng (Narr Francke Attempto Verlag) für die Betreuung der vorliegenden Publikation sowie bei Claudia Brauer für ihre unermüdliche, umsichtige und sorgfältige Unterstützung bei der Erstellung der Druckvorlage.
Lidia Becker
Julia Kuhn
Christina Ossenkop
Claudia Polzin-Haumann
Elton Prifti
Zwischen Terminologie und Allgemeinsprache
Fachdiskurse haben eine „Mittlere Schicht“1
1Ein Beispiel
Kann sich nach dem Brexit Paris Hoffnungen darauf machen, London als europäisches Finanzzentrum abzulösen? Und wäre das überhaupt gut für die „Stadt der Liebe“? Lesen wir, was der Kommentator des „Figaro“ dazu zu sagen hat:
1)
Londres est la plus grande place financière mondiale. Elle gère 20 % des actifs des hedge funds mondiaux, 85 % des actifs des hedge funds européens et 45 % du marché des dérivés de gré à gré. […] Elle est la première place mondiale pour le marché des changes, contrôlant plus de 40 % du marché des devises […]. Elle est première aussi pour les crédits bancaires internationaux, les produits dérivés, les marchés des métaux et de l'assurance. Elle occupe la deuxième place du palmarès mondial (derrière New-York) pour les emprunts internationaux, dont elle fournit près de 20 % des prêts. Elle assure 60 % des mouvements financiers européens et est la seule place financière européenne vraiment globale. […]
Paris ne peut ni ne doit chercher à remplacer Londres.
Si Paris devenait le nouveau hub financier de l'Europe et attirait les 400 000 professionnels de la finance de la City, avec leur fort pouvoir d'achat, cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier, déjà astronomique dans la capitale française. Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres où les prix ont bondi de 76 % de 2009 à 2016 (alors que les salaires britanniques n'ont pas augmenté). Socialement, un coût de l'immobilier élevé contribue à la montée des injustices et des inégalités et met en difficulté des pans entiers de la population, reléguant les plus faibles loin des métropoles.1
Das ist ein Wirtschafts-Text, aber aus einer Tageszeitung, es spricht also ein Experte zu einem – wahrscheinlich interessierten und eher gut informierten – Publikum. Um zu zeigen, was mit der „Mittleren Schicht“ und der Zone „zwischen Terminologie und Allgemeinsprache“ gemeint ist, werde ich in diesem Text verschiedene Arten von Elementen unterstreichen.
Ich beginne (unterstrichen) mit jenen Ausdrücken, die man als wirtschaftliche Fachtermini bezeichnen kann; diese Termini sind für ein (Mehr-oder-weniger-)Laien-Publikum mehr oder weniger transparent; ihre Dichte und ihre partielle Opazität genügen, um diesen Text gegenüber einem allgemeinsprachlichen Diskurs als fachsprachlich zu kennzeichnen:
1)
Londres est la plus grande place financière mondiale. Elle gère 20 % des actifs des hedge funds mondiaux, 85 % des actifs des hedge funds européens et 45 % du marché des dérivés de gré à gré […]. Elle est la premièreplacemondiale pour le marché des changes, contrôlant plus de 40 % du marché des devises […]. Elle est première aussi pour les crédits bancaires internationaux, les produits dérivés, les marchés des métaux et de l'assurance. Elle occupe la deuxième place du palmarès mondial (derrière New-York) pour les emprunts internationaux, dont elle fournit près de 20 % des prêts. Elle assure 60 % des mouvements financiers européens et est la seule place financière européenne vraiment globale. […]
Paris ne peut ni ne doit chercher à remplacer Londres.
Si Paris devenait le nouveau hub financier de l'Europe et attirait les 400 000 professionnels de la finance de la City, avec leur fort pouvoir d'achat, cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier, déjà astronomique dans la capitale française. Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres où les prix ont bondi de 76 % de 2009 à 2016 (alors que les salaires britanniques n'ont pas augmenté). Socialement, uncoût de l'immobilier élevé contribue à la montée des injustices et des inégalités et met en difficulté des pans entiers de la population, reléguant les plus faibles loin des métropoles.
Ich habe diese Termini eigentlich nur deswegen unterstrichen, weil ich zeigen möchte, dass sie nicht die Gesamtheit des Texts ausmachen, sondern dass zwischen ihnen etwas bleibt, was als „Umfeld der Termini“ bezeichnet werden kann. Dieses „Umfeld“ ist das Eigentliche, was mich in diesem Beitrag interessiert. Die Umgebung der Termini im Fachdiskurs besteht nämlich nicht ganz einfach aus „Allgemeinsprache“, „Alltagssprache“, oder wie immer man all das bezeichnen will, was nicht der Fachsprache zugeordnet werden kann. Ein Großteil des Umfelds der Termini besteht aus Elementen, die zwar nicht terminologisch, aber für die jeweilige Fachsprache bzw. den jeweiligen Fachdikurs in hohem Maße charakteristisch sind (fett):
1)
Londres est la plus grandeplace financière mondiale. Elle gère 20 % desactifs des hedge fundsmondiaux, 85 % desactifs des hedge fundseuropéens et 45 % dumarché des dérivés de gré à gré. […] Elle est la première place mondiale pour le marché des changes, contrôlant plus de 40 % dumarché des devises […]. Elle est première aussi pourles crédits bancaires internationaux, les produits dérivés, les marchés des métaux et de l'assurance. Elle occupe la deuxième place du palmarès mondial (derrière New-York) pourles emprunts internationaux, dont elle fournit près de 20 % desprêts. Elle assure 60 % desmouvements financiers européens et est la seuleplace financière européenne vraiment globale. […]
Paris ne peut ni ne doit chercher à remplacer Londres.
Si Paris devenait le nouveau hub financier de l'Europe et attirait les 400 000professionnels de la finance de la City, avec leur fortpouvoir d'achat, cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier, déjà astronomique dans la capitale française. Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres où les prix ont bondi de 76 % de 2009 à 2016 (alors que les salaires britanniques n'ont pas augmenté). Socialement, un coût de l'immobilierélevé contribue à la montée des injustices et des inégalités et met en difficulté des pans entiers de la population, reléguant les plus faibles loin des métropoles.
Die sprachlichen Mittel in Fettdruck sind charakteristisch für Wirtschaftsdiskurse, und zwar durch ihre Frequenz wie auch durch ihre spezielle Funktion. Sie können auch in Diskursen verwandter Disziplinen auftreten, aber ihre Frequenz in der „Allgemeinsprache“ wie auch in den Sprachen entfernterer Disziplinen ist deutlich niedriger, sie sind dort nicht als besonders typisch anzusehen. Beschränken wir uns bei den Hervorhebungen nun ausschließlich auf die im Fokus stehenden Elemente:
1)
Londres est la plus grande place financière mondiale. Elle gère 20 % des actifs des hedge funds mondiaux, 85 % des actifs des hedge funds européens et 45 % du marché des dérivés de gré à gré. […] Elle est la première place mondiale pour le marché des changes, contrôlant plus de 40 % du marché des devises […]. Elle est première aussi pour les crédits bancaires internationaux, les produits dérivés, les marchés des métaux et de l'assurance. Elle occupe la deuxième place du palmarès mondial (derrière New-York) pour les emprunts internationaux, dont elle fournit près de 20 % des prêts. Elle assure 60 % des mouvements financiers européens et est la seule place financière européenne vraiment globale. […]
Paris ne peut ni ne doit chercher à remplacer Londres.
Si Paris devenait le nouveau hub financier de l'Europe et attirait les 400 000 professionnels de la finance de la City, avec leur fort pouvoir d'achat, cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier, déjà astronomique dans la capitale française. Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres où les prix ont bondi de 76 % de 2009 à 2016 (alors que les salaires britanniques n'ont pas augmenté). Socialement, un coût de l'immobilier élevé contribue à la montée des injustices et des inégalités et met en difficulté des pans entiers de la population, reléguant les plus faibles loin des métropoles.
In dieser kurzen Textpassage stoßen wir auf:
Nominalisierungen (explosion, montée, difficulté), Relationsverben (provoquer, contribuer à) und weitere typische Kennzeichen des Nominalstils;
Zahlen (400 000), Prozentsätze (25 %, 85 %, 45 % etc.), Steigen-und-fallen-Verben (bondir, augmenter) mit der ganzen für sie charakteristischen Syntax (ont bondi de 76 % de 2009 à 2016), quantitative Adjektive (fort, cher, élevé), Modulatoren (près de) usw. usf., also jede Menge quantitative Ausdrücke;
und schließlich eine Vielfalt an Ausdrücken aus dem Bereich der Rankings: Superlative und Ausdrücke der Unizität (la plus grande, la seule, la plus chère), Ordinalzahlen (première, deuxième), Adjektive, die die Grundgesamtheit eines Vergleichs anzeigen (européen/ne, mondial/e); weiters Ausdrücke, die das Ranking selbst (palmarès), oder einen Rang darin bezeichen (place), mit den dazugehörigen Verben (occuper); nicht zu vergessen die Präposition pour, die das Kriterium des Rankings (pour le marché des changes, pour les crédits bancaires internationaux) und die Präposition derrière, die das vorangehende Element im Ranking einleitet (derrière New-York, derrière Londres).
2Einleitung
In diesem Beitrag soll es um all das gehen, was – wie die soeben aufgezählten Elemente – abgesehen von der Terminologie für Fachdiskurse bestimmter Fächer oder verwandter Fächerbündel charakteristisch ist. Denn die Terminologie allein reicht nicht aus, um einen Text zu konstituieren; sie braucht die Ergänzung durch nicht-terminologische Mittel auf lexikalischer und syntaktischer Ebene, die die terminologischen Elemente als Umfeld, als Umwelt, als Biotop einbetten.
In diesem Zusammenhang steht zunächst das Konzept des „Fachstils“, also jener „allgemeinen wissenschaftlichen Fachsprache“, die für das Französische in etlichen Publikationen von Werner Forner beschrieben worden ist und der in jüngerer Zeit eine Sondernummer der « Revue française de linguistique appliquée » (Tutin 2007a) gewidmet war. Es geht um sprachlich-stilistische Procédés bzw. eine gewisse „allgemeine wissenschaftssprachliche Lexik“, die Fachzeitschriften bzw. -publikationen und divulgativen Fachtexten so gut wie sämtlicher Disziplinen bzw. breiter Disziplinenbündel (technische Wissenschaften, Sozialwissenschaften) gemeinsam sind; aber das ist es nicht, was uns hier primär interessieren wird.
Was ich beschreiben möchte, das ist eine bestimmte Schicht lexikalisch-syntaktischer Mittel, die nicht allen Disziplinen gemeinsam sind, sondern ganz bestimmten Bündeln verwandter Disziplinen: zum Beispiel der Sprache der Wirtschaft oder jener des Sports. Jedes Fach und jedes Fächerbündel verfügt jenseits der Terminologie über charakteristische sprachliche Mittel, die zwar aus der Allgemeinsprache übernommen, aber durch ihre Frequenz und spezielle Funktion doch für das jeweilige Fach/die jeweiligen Fächer charakteristisch sind; weswegen man auch Fachsprachen und Fachdiskurse nur dann zutreffend beschreiben oder lehren kann, wenn man diese Ausdrucksmittel mit einbezieht. Dazu gehören für Wirtschaftstexte die Ausdrücke für das Steigen und Fallen von Zahlen und Werten, und für die Wirtschaftssprache und die Sportsprache gemeinsam, die Ausdrücke für Rankings und deren Veränderung.
Anhand dieser Beispiele möchte ich jenes Phänomen beschreiben und illustrieren, das ich als die „Mittlere Schicht“ der fachsprachlichen Diskurse bezeichne. Es zeigt sich, dass diese „Mittlere Schicht“ in jedem Fach eng mit jenen grundlegenden Konzeptualisierungen der jeweiligen Disziplin verbunden ist, welche in Form von fachspezifischen Grundmetaphern das Weltbild des Faches prägen.
Abschließend werde ich versuchen, in Form einer konzeptuellen Metapher das Feld der Fachdiskurse mit seinen mehr oder weniger zentralen versus peripheren Elementen zu beschreiben und in diesem Rahmen die „Mittlere Schicht“ zu situieren.
3„Allgemeine Wissenschaftssprache“ und „Fachstil“ nach Forner und Tutin 2007a
Ich beginne hier mit der Beschreibung dessen, was eigentlich nicht im Zentrum meines Interesses steht, was also nicht die „Mittlere Schicht“ ist, aber von ihr abgegrenzt werden muss. Es handelt sich um ein bestimmtes Register bzw. Repertoire sprachlicher Mittel, das in der Forschung als « langue scientifique générale » (Phal 1968, 8) oder als „allgemeine wissenschaftliche Fachsprache“ (Hoffmann 21984, 63) bezeichnet worden ist. Es entspricht der Gesamtheit jener sprachlichen Mittel, die den Fachdiskursen der verschiedensten Fächer gemeinsam sind. Diese Kategorie „allgemeine Wissenschaftssprache“ und noch mehr „allgemeine wissenschaftliche Fachsprache“ ist in gewisser Weise paradox, denn das Besondere an Fachsprache und damit auch an Wissenschaftssprache ist ja, dass sie für ein bestimmtes Fach – und eben nicht für sämtliche Fächer gemeinsam – charakteristisch ist. Es existieren aber sehr wohl einige interessante Versuche, eine solche „allgemeine Wissenschaftssprache“ zu definieren und zu beschreiben.
Gemeint ist im Wesentlichen eine Art genrespezifisches Register1: die Sprache wissenschaftlicher Publikationen bzw. auch anspruchsvoller populärwissenschaftlicher Artikel. Man kann sich diesem Register aus verschiedenen Perspektiven annähern, einerseits über die Stilistik und Syntax und andererseits über die Lexik. Ersterer „Approach“ ist der von Werner Forner, letzterer wird von den Pionieren Phal (1968 und 1971) und Coxhead (1998 und 2000) vorgegeben und in der Sondernummer Tutin 2007a der «Revue française de linguistique appliquée » vertieft.
Definiert man die „allgemeine Wissenschaftssprache“ als eine Art „Fachstil“ mit spezifischen Ausdrucksmitteln, die – allerdings in geringerer Frequenz – auch in der Allgemeinsprache anzutreffen sind, so kann man versuchen, diese « langue scientifique générale » über ihre spezifischen stilistischen Merkmale zu beschreiben. Der Forscher, der sich diesem Programm für das Französische Jahrzehnte hindurch gewidmet hat, ist Werner Forner2. Er spricht von « style scientifique » bzw. von „registerspezifischen Vertextungsstrategien“ (stratégies de textualisation propres au registre scientifique). Um einen ersten Eindruck davon zu geben, was unter diese Bezeichnung fällt, kann man gewisse Konjunktionen anführen, weiters Aufzählungen, metatextuelle Verweise und andere Eigenheiten der Wissenschaftssprache:
2)
d’une part – de l’autre/d’autre part ; d’un côté – de l’autre ; d’un autre côté
premièrement… deuxièmement… troisièmement ; d’abord… ensuite… enfin
ci-dessus, ci-dessous, ci-contre
nous venons de voir que…
Elemente wie diese interessieren Werner Forner allerdings nur am Rande. Was er wirklich beschreibt, das ist eine Reihe von sprachlichen Procédés, die dazu beitragen, einem Text ein « air de spécialité », einen Anschein von Fachlichkeit, zu verleihen, die es also – in einer Art syntaktischer Kosmetik – genügt anzuwenden, damit ein Text sofort fachlich bzw. wissenschaftlich klingt (vgl. Forner 1985 und v.a. 1998). Hier ist die Liste jener sprachlichen Mittel, die laut Forner dieses « air de spécialité » ausmachen (vgl. Forner 1985, 206-207):
die Nominalspaltung, durch die ein simples, bedeutungstragendes Substantiv sich in eine komplexe nominale Struktur verwandelt, in der der nominale Kern nur mehr eine sehr allgemeine kategoriale Bedeutung transportiert, während der eigentliche semantische Inhalt in ein spezifizierendes Relationsadjektiv verlagert wurde:
3)
les forêts → le patrimoine forestier
les mines → les ressources minières
la production → l’activité de production
die Verbalspaltung, die ein einfaches, bedeutungstragendes Verb in einen komplexen Verbalausdruck überführt, in dem das neue Verb nur mehr eine sehr blasse, allgemeine Bedeutung hat und die eigentliche semantische Last auf ein nominales Objekt übergegangen ist:
4)
investir → effectuer un investissement
planifier qc. → faire la planification de qc.
s’accroître → connaître un accroissement
Die Verbalspaltung ist ein Sonderfall der Nominalisierung; diese Nominalisierung ist das dritte charakteristische Procédé, das den „Fachstil“ nach Forner ausmacht. Durch sie verwandeln sich ganze Haupt- oder Gliedsätze in simple Nominalsyntagmen, die auf diese Weise als Module fungieren können, deren Kombination inhaltlich hoch komplexe, mit Bedeutung geradezu vollgestopfte Sätze ergibt; die Nominalisierung dient also vor allem der inhaltlichen Verdichtung:
5)
la bourse est instable → l’instabilité boursière
les ventes ont fortement augmenté → la forte augmentation des ventes
la crise persistera encore plusieurs années → la persistance de la crise dans les années à venir
Erinnern wir uns an dieser Stelle an die Nominalisierungen in unserem Beispiel (1):
6)
l’immobilier coûte cher → un coût de l’immobilier élevé
il y a plus d’injustices et d’inégalités → la montée des injustices et des inégalités
l’immobilier devient rapidement plus cher → une explosion du coût de l'immobilier
Die durch Komprimierung erzeugten nominalen Module fungieren charakteristischerweise als Argumente von Relationsverben, das sind Verben, die genau genommen Konjunktionen ersetzen:
7)
résulter de, empêcher, conduire à, précéder, signifier, être dû à, expliquer, impliquer, comporter…
Aus komplexen Sätzen werden so einfache Sätze mit Relationsverb und inhaltlich satzwertigen nominalen Argumenten. Nominalisierungen kombiniert mit Relationsverben bilden das komplexeste und wichtigste Procédé bei der von Forner beschriebenen Transformation eines allgemeinsprachlichen in einen fachsprachlichen Stil; hier eines seiner Beispiele für eine solche Transformation:
8)
il y a moins d’exportations et pour cette raison il y a plus de chômage
→ le déclin des exportations a conduit à une augmentation du chômage
Dazu passen zwei charakteristische Passagen aus unserem Beispiel (1):
9)
(Si Paris […] attirait les 400 000 professionnels de la finance de la City […],…)
l’immobilier deviendrait rapidement plus cher
→ cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier
Lorsque l’immobilier coûte cher, il y a plus d’injustices et d’inégalités et la situation de la population devient plus difficile
→ un coût de l'immobilier élevé contribue à la montée des injustices et des inégalités et met en difficulté […] la population
Nun, da wir die von Forner ins Zentrum gerückten sprachlichen Mittel illustriert haben, stellt sich tatsächlich die Frage, ob es sich um Eigenheiten der Fachdiskurse, um Besonderheiten der Wissenschaftsdiskurse (als Teilmenge der Fachdiskurse) oder um Phänomene auf Registerebene handelt? Weder um Fachdiskurse noch um Wissenschaftsdiskurse ganz allgemein, würde ich meinen; denn der „Fachstil“, wie ihn Forner beschreibt, ist nicht für sämtliche Fachdiskurse charakteristisch, und auch nicht für sämtliche Wissenschaftsdiskurse. Er hat z. B. sehr viel mit Schriftlichkeit oder jedenfalls mit Distanzsprache im Sinne von Koch/Oesterreicher 1990 zu tun, sei es nun in wissenschaftlichen Publikationen oder in anspruchsvollen Divulgationstexten, wie man sie z. B. in der Qualitätspresse oder in Enzyklopädien findet. Es geht um das spezifische Register bestimmer Textsorten bzw. des „deskriptiv-argumentativen“ Texttyps. Deren Stil und seine typischen Procédés unterscheiden diese « Genres » deutlich von anderen, nicht-fachlichen Diskursen, z. B. von narrativen Texten (vgl. Wilde 1994, 101, apud Forner 2000, 219). Die beschriebenen sprachlichen Mittel verdienen also durchaus eine Analyse im Rahmen der Fachsprachenforschung.
Andererseits ist aber auch bekannt, dass Fachdiskurse weitaus vielfältiger sind als nur ihre schriftlich-formellen Varianten. Es gibt auch informelle, nähesprachliche Formen des Fachdiskurses, z. B. im schriftlichen Bereich fachspezifische Diskussionsforen im Internet, und natürlich im mündlichen Bereich die ganze Bandbreite mehr oder weniger spontaner, mehr oder weniger informeller Varianten, z. B. Diskussionen bei Tagungen und Projektmeetings. Dieser weniger formelle und v.a. mündliche Anteil an den Fachdiskursen sollte bei deren Untersuchung und Beschreibung immer auch mitgedacht werden.
Derselbe Einwand ist natürlich auch gegen den zweiten hier vorzustellenden Approach zu erheben, jenen, der über die „allgemein wissenschaftssprachliche“ Lexik geht, denn auch dieser beschränkt sich auf Fachdiskurse in der Form von schriftlichen wissenschaftlichen Publikationen (bzw. gelegentlich wissenschaftlichen Divulgationstexten). Gegenüber der „Fachstilistik“ von Forner konzentriert sich die Analyse hier auf die Lexik, ursprünglich in Form von Einzelwörtern, in jüngeren Studien auch vermehrt in Form von Phraseologismen und Kollokationen. Diese wird mit elektronischen Mitteln aus großen Korpora extrahiert und zu Ergebnissen in Form von Wortlisten verdichtet. Pionier ist für das Französische der bereits erwähnte Phal mit seinem Buch aus 1971 « Vocabulaire général d’orientation scientifique (VGOS) » (dazu auch schon Phal 1968). Die englische Entsprechung dazu stammt übrigens von Coxhead 1998 „An academic word list“ (bzw. 2000 „A new academic word list“).
Le vocabulaire scientifique général est […] commun à toutes les spécialités. Il sert à exprimer les notions élémentaires dont elles ont toutes également besoin (mesure, poids, rapport, vitesse, etc.) et les opérations intellectuelles que suppose toute démarche méthodique de la pensée (hypothèse, mise en relation, déduction et induction, etc.). (Phal 1971, 9 apud Pecman 2007, 85)
Man muss bis 2007 warten, bis eine Sondernummer der Revue française de linguistique appliquée sich dieses Themas vertiefend annimmt. Unter dem Titel « Autour du lexique et de la phraséologie des écrits scientifiques » sammelt Agnès Tutin Beiträge zur allgemeinen wissenschaftlichen Lexik und Phraseologie. Ich möchte darunter insbesondere Tutins Einleitung (Tutin 2007b) sowie die Artikel von Drouin 2007, Pecman 2007 und Blumenthal 2007 hervorheben.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte man hier auf eine systematische Analyse der „Mittleren Schicht“ gestoßen sein: Spricht doch Tutin in ihrer Einleitung von « un lexique de genre, entre terminologie et langue générale » (S. 5),3 und sie illustriert das Gemeinte (wie übrigens auch Pecman 2007), wie ich es oben getan habe, mit einer Passage aus einem wissenschaftlichen Text, in der nicht die Fachtermini hervorgehoben sind, sondern jene sprachlichen Mittel, die das diskursive Umfeld dieser Termini bilden. Hoch anzurechnen ist ihr auch, dass sie innerhalb des analysierten Texts mehrere Schichten (« strates lexicales ») unterscheidet und sogar noch innerhalb der nicht-allgemeinsprachlichen und nicht-terminologischen Elemente weiter differenziert, vgl. die Punkte 1, 2 und 3 im folgenden Zitat (S. 7):
Le lexique propre aux écrits scientifiques […]
Le lexique abstrait non spécialisé […]
Le lexique méthodologique disciplinaire […]
Le lexique terminologique […]
Le lexique de la langue « générale » ou « commune » […]
Sieht man sich jedoch die einzelnen Studien in dieser Sondernummer genauer an, so muss man erkennen, dass es den AutorInnen gerade nicht darum geht, disziplinspezifische nicht-terminologische Lexik zu erheben (das wäre in etwa Tutins Schicht 3, wobei ich ja nicht nur an methodologischer Lexik interessiert bin). Sie sammeln vielmehr (wie schon Phal und Coxhead) gezielt jene Lexik und jene Phraseologismen/Kollokationen, die in einer möglichst breiten Auswahl möglichst disparater Disziplinen gleichermaßen zur Anwendung kommen (also Tutins Schicht 1).
So arbeitet Drouin 2007 an einem Korpus französischer Dissertationen aus den Bereichen Psychologie, Recht, Geschichte, Geographie, Archäologie, Physik, Technik, Informatik und Chemie, das er gegen ein Vergleichskorpus der Zeitung « Le Monde » abhebt. Kriterium für seine Wortlisten ist, dass ein Ausdruck oder eine Kollokation in mindestens der Hälfte der von ihm untersuchten Fächerkorpora signifikant oft vorkommt.
Pecman 2007, der die Phraseolexik – also die Ausdrücke plus ihre syntaktische Konstruktion und Umgebung – untersucht, arbeitet an einem Korpus wissenschaftlicher Texte aus den « sciences dures », konkret aus den Disziplinen Biochemie, molekulare Chemie, Botanik, Biowissenschaften, Erdwissenschaften, Physik, Mechanik, Astronomie und Astrophysik. Auch ihm geht es darum, lexikalische Einheiten zu identifizieren, die sämtlichen Disziplinen gemeinsam sind. Er kommt zu dem Schluss, dass es eine „allgemeine Wissenschaftssprache“ auf der Ebene der Phraseolexik (im Gegensatz zur terminologischen Ebene) tatsächlich gibt. Auch hier bleiben wir allerdings in Tutins erster Schicht, auch wenn nicht der Anspruch erhoben wird, Aussagen über die lexikalischen Überschneidungen sämtlicher existierender Disziplinen zu treffen.
Sehr breiten Disziplinenbündeln widmet sich auch Blumenthal 2007, der zwei (populär-)wissenschaftliche Korpora vergleicht, eines aus den « Sciences de l’Homme » und eines aus den « Sciences exactes » (beide aus Enzyklopädien). Ihm geht es darum, durch das Studium der transdisziplinären Lexik der beiden Bereiche nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um zwei ganz unterschiedliche Wissenschaftskulturen handelt. Auch hier sind die Fächerbündel zu breit, um meinem eigenen Interesse zu entsprechen, das ja jenen sprachlichen Mitteln gilt, die, ohne terminologisch zu sein, für eine Disziplin oder auch für ein kleines Bündel verwandter Disziplinen charakteristisch sind. Eben jene „Mittlere Schicht“, bei der noch immer eine regelrechte Forschungslücke klafft, die ich hier ein wenig zu schließen versuchen werde.
4Augmenter, diminuer…: Quantitive Ausdrücke in Wirtschaftsdiskursen1
Ich komme mit diesem Kapitel zum Kern meines Beitrags, denn die quantitativen Ausdrücke entsprechen im Rahmen der Wirtschaftssprache genau dem, was ich als „Mittlere Schicht“ beschreiben möchte. Im Gegensatz zur Terminologie und in ähnlicher Weise wie die Rankings, denen das folgende Kapitel 5 gewidmet sein wird, sind die quantitativen Ausdrücke nicht nur für ein Fach charakteristisch, sondern für ganze Bündel verwandter Disziplinen. Zum Beispiel kann man die sprachlichen Mittel untersuchen, mit denen Statistiken wiedergegeben werden, und das betrifft dann eine ganze Reihe von Fächern, in den Natur- wie auch in den Sozialwissenschaften, zwischen denen es allerdings signifikante Unterschiede geben dürfte. Und – um ein weiteres Beispiel zu geben – die Ausdrücke für Ursachen und Wirkungen sind wahrscheinlich nicht identisch in Diskursen der technischen und der naturwissenschaftlichen Disziplinen, wobei es auch Überschneidungen geben könnte.
Beginnen wir also mit den quantitativen Ausdrücken, und hier mit dem Teilbereich der sprachlichen Mittel für das Steigen und Fallen von Zahlen und Werten; es handelt sich um einen Bedeutungsbereich, der im Sinne der kognitiven Linguistik auch als „Frame“2 beschrieben werden kann. Schon in unserem Text (1) gab es mehrere Beispiele dafür:
10)
…cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier, déjà astronomique dans la capitale française. Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres où les prix ont bondi de 76 % de 2009 à 2016 (alors que les salaires britanniques n'ont pas augmenté). Socialement, un coût de l'immobilier élevé contribue à la montée des injustices et des inégalités
Diese kurze Passage ist deswegen interessant, weil das Steigen und Fallen in mehreren syntaktischen und semantischen Varianten vorkommt: von der Standard-Variante in verbaler (augmenter) und nominaler (montée) Form, bis zu metaphorischen Ausdrücken für denselben Sachverhalt, ebenfalls verbal (bondir) und nominal (explosion). Auffällig ist auch die Präpositionalsyntax, die diese Einheiten umgibt: V augmente (V ist der Wert – la valeur – deren Veränderungen man verfolgt), V bondit de n (n symbolisiert eine Zahl, hier einen Prozentsatz), une explosion de V, la montée de V. Ich beginne mit einer kurzen semantischen Einteilung dieser Ausdrücke, um dann deren Metaphorik und schließlich die sie umgebende Syntax zu analysieren.
Die sprachlichen Mittel des Bedeutungsfelds/Frames Steigen/Fallen können nach folgenden Kriterien eingeteilt werden:3
Der entscheidende Schritt von der direkten zu einer metaphorischen Ausdrucksweise geschieht durch die Projizierung der quantitativen Äußerung in den Raum. […] Die erste Stufe, bei der nicht immer klar entscheidbar ist, ob es sich um eine metaphorische handelt, ist die Transposition des Mehr- bzw. Wenigerwerdens in ein Größer- bzw. Kleinerwerden, d.h. die Sicht der Anzahl als räumliche Dimension. […]
Bei Aufwärtsbewegungen geht es mit den Meßzahlen ‚nach oben‘ […], bei Abwärtsbewegungen ‚nach unten‘ […], wohl einem menschlichen Urempfinden entsprechend, welches auch bei den die Daten begleitenden Graphiken zum Ausdruck kommt […]. Die Bewegung kann abstrakt oder konkretisiert als Fliegen, Tauchen, Klettern, Graben, etc., in Erscheinung treten.
Wenn man es genauer betrachtet (Abb. 1), erkennt man allerdings, dass die Basismetapher über die simple Vertikalität hinausgeht und einem wesentlich komplexeren Schema entspricht. Der Schlüssel liegt in jenen Graphiken, die bereits von Schifko (s.o.) erwähnt werden: Das Steigen und Fallen von Werten wird im Allgemeinen in Form von Kurvengraphiken visualisiert, mit der Zeit auf der X-Achse und den Werten auf der Y-Achse. Auf genau diese Art von Graphiken beziehen sich die entsprechenden sprachlichen Ausdrücke.
Kurvengraphik – steigen – fallen – gleichbleiben
Quelle: http://lelabodanissa.blogspot.com/2015/11/analyser-un-graphique.html [30/12/2018]
Es gibt übrigens noch eine weitere sekundäre Metaphorisierung (Abb. 2), die diese graphische Darstellung überlagern kann: Wenn die Fluktuationen der Werte eine Zeichnung ergeben, die einer Gebirgslandschaft ähnelt, dann kann man das so interpretieren, dass die Werte klettern (grimpent) oder einen Gipfel erreichen (atteignent un sommet).4 Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Metapher der Kurvengraphik für sämtliche Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaft absolut fundamental ist. Wahrscheinlich ist sie es auch noch für eine Reihe anderer Fächer, nämlich für all jene, in denen Statistiken eine wichtige Rolle spielen. Die auf die Kurvengraphik referierenden sprachlichen Mittel zu analysieren, ist daher unabdingbar für jede Beschreibung der Wirtschaftssprache wie auch für deren Unterricht – und das, obwohl die entsprechenden Ausdrücke nicht als terminologisch angesehen werden können. Diese Feststellung unterstreicht die Bedeutung der „Mittleren Schicht“ für das Verständnis der grundlegenden kognitiven Strukturen der betreffenden Fächer.
Beispiel einer Kurvengraphik vom Typ „Bergkette“
Quelle: http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-creer-des-graphiques-qui-reagissent-a-vos-donnees.htm [30/12/2018]
Aus Freude an der Vielfalt der fachsprachlichen Mittel möchte ich hier eine Auswahl an weiteren sekundären Metaphern anschließen, die die Kurvengraphik- oder jedenfalls Vertikalitäts-Metapher überlagern und sich teilweise auf sie stützen. Diese Metaphern sind unterschiedlich, je nachdem ob die Entwicklung positiv oder negativ bewertet wird, und sie sind überall dort zahlreicher, wo eine Evaluierung stattfindet und nicht einfach eine neutrale Berichterstattung; vgl. die Ausdrücke s’envoler und bondir im Vergleich zu exploser, aber auch das nicht ganz so dynamische s’alourdir (z. B. über Schulden), alle im Sinne der Vertikalität.5 Häufig wird die Steigerung auch als eine Beschleunigung (accélération) dargestellt, die Verringerung dementsprechend als Verlangsamung (ralentissement, z. B. der wirtschaftlichen Aktivität), das entspricht der Interpretation der Kurve als Bewegung. Dabei besteht ein Zusammenhang mit den Maschinen- und insbesondere mit den Verkehrsmittel-Metaphern (les moteurs de la croissance, un coup de frein aux exportations). Architektur-Metaphern (der Vertikalität) kommen vor, wenn ein Grenzwert (un plafond / un plancher) über- oder unterschritten wird. Dazu gibt es auch eine Bewegungs-Metapher aus dem Bereich der Seefahrt: passer le cap des mille milliards de dollars. Nicht zu vergessen natürlich die anthropomorphischen oder generell die Lebewesen-Metaphern, die so gut wie immer eine positive oder negative Evaluierung mit sich führen: le gonflement des carnets de commandes versus une cure d’amaigrissement de la fonction publique, le ramollissement des critères de convergence versus le redressement de l’emploi, l’entreprise XY redresse la tête après plusieurs exercices difficiles versus le fléchissement de la conjoncture; auch hier ist fast immer oben positiv.
Wozu aber sind all diese Metaphern gut? Warum werden sie so gerne eingesetzt und unendlich variiert? Meines Erachtens dienen sie vor allem der stilistischen Variation – denn im Wirtschaftsjournalismus geht es ja eigentlich immer um dieselbe Art von Fakten, um ein Steigen oder Fallen des Wachstums, der Beschäftigung, der Exporte etc. für ein Land, bzw. des Personalstands, der Gewinne, der Marktanteile für ein Unternehmen. Was kann man tun, um sich da nicht endlos zu wiederholen? Vor dieses Dilemma gestellt, sind die JournalistInnen wenn schon nicht um Innovation, dann doch zumindest um größtmögliche Variaton bemüht. Nur sehr selten stößt man in der Tat auf wirklich Originelles, oft allerdings auf extreme Vielfalt, die aus dem reichen Fundus der Steigen-Fallen-Ausdrücke schöpft und so die Lektüre der Wirtschaftsberichte mit einer Prise von Infotainment zu würzen versteht.
Bevor wir nun zu einem verwandten und von denselben stilitischen Variations-Zwängen geprägten Bereich übergehen – den Ranking-Ausdrücken im Sport und in der Wirschaft –, möchte ich noch einige interessante syntaktische Aspekte beleuchten, die mit den Steigen-Fallen-Ausdrücken verbunden sind. Konkret soll beschrieben werden, wie sich rund um die verbalen und nominalen Ausdrücke des Steigens und Fallens herum der Ausdruck wichtiger „Frame“-Elemente gestaltet; zu diesem „Frame“ gehören ja z. B. die Variable, die am Steigen und Fallen ist (diese ist ein Pflicht-Element), die Ursache bzw. der Urheber der Veränderung (fakultativ) und vor allem auch (hochfrequent), der Umfang der beobachteten Veränderung in Form einer Zahl, häufig eines Prozentsatzes. Wir werden uns ganz besonders diesem letzteren Element zuwenden, das sich in einer speziellen Syntax ausdrückt, die (jedenfalls im Vergleich zum Deutschen) allerlei Überraschendes zu bieten hat.
Vorher sei uns noch ein kleiner Exkurs zur allgemeinen Syntax der Ausdrücke für Zahlen und Werte im Französischen gestattet, also ausnahmsweise ohne Bezug auf das Steigen oder Fallen. Die Angabe eines Wertes ohne Erwähnung einer Veränderung geschieht mit Hilfe von speziellen verbalen Ausdrücken, die jeweils eine eigene Präposition (meist de oder à) regieren: s’élever à, être de, correspondre à, se chiffrer à… Es gibt aber auch transitive Verben, die den Wert als Objekt nehmen, wie z. B.: l’Autriche connaît une inflation de 2,1 %, ce pays compte 8 millions d’habitants, il enregistre une croissance de 2 % etc. Wenn der Wert oder Prozentsatz ein Nomen ergänzt, geschieht das mittels der Präposition de, manchmal auch mit à hauteur de: des dépenses de 6 milliards, des recettes à hauteur de 8 milliards; aber die Rollen können auch vertauscht werden: 6 milliards de dépenses. Die Präposition avec erscheint, wenn der Wert in Form einer Apposition hinzugefürgt wird: Seule la Suisse, avec 3 %, se voit attribuer un score meilleur. Ein Sonderfall ergibt sich, wenn ein und derselbe Wert mittels zweier unterschiedlicher Zahlen ausgedrückt wird, einer absoluten Zahl und eines Prozentsatzes. Der Standard-Ausdruck ist in diesem Fall soit: 4 milliards d’euros, soit 3,6 % du PIB. Handelt es sich um einen Einheits- oder Durchschnittswert, z. B. einen Wert pro Einwohner oder pro Tag, dann verwendet man par: 23 800 US dollars par tête d’habitant. Interessant sind auch die Ausdrücke für Approximation: de l’ordre de, environ, autour de, aber auch plus de und moins de sowie dessen Äquivalent près de, letztere für Annäherungen von oben oder von unten. Und nicht zuletzt verfügt das Französische über eine systematische Reihe von approximativen Zahl-Substantiven: dizaine, douzaine, quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, centaine und millier.
Nach diesem kurzen Exkurs zur Syntax der numerischen Werte ganz allgemein kommen wir nun zum Steigen und Fallen zurück und werden die in diesem Bereich ganz spezifische (Präpositional-)Syntax beschreiben. Der Steigen-und-Fallen-Frame umfasst grundsätzlich drei numerische Elemente (Abb. 3): den Ausgangswert (A), den Endwert (B) und die Differenz (C).
Steigen/Fallen: Ausgangswert (A), Endwert (B), Differenz (C)
Quelle: Eigengraphik (E.L.)
Das Deutsche hat für jeden dieser drei Werte eine spezifische Präposition: steigen / fallen von A auf B um C; von ist für den Ausgangswert zuständig, auf für den Endwert, und um für den Unterschied zwischen den beiden. Im Französischen ist die Sache allerdings nicht so einfach, denn dieser Sprache stehen in demselben Bereich nur zwei Präpositionen, de und à, zur Verfügung. Für eine/n Germanophone/n erscheint das als eine echte sprachliche Lücke, denn sie zwingt die französische Sprache zu einer Reihe von Umschreibungen und komplizierten Konstruktionen (die, nebenbei gesagt, LernerInnen erhebliche Schwierigkeiten bereiten). So muss das Französische, wenn es alle drei Elemente gleichzeitig nennen will, auf Kombinationen von zwei verschiedenen Verben zurückgreifen: augmenter de 6 points pour s’inscrire à 20 % / pour se fixer à 20 % / passant ainsi à 20 %. Konkret sieht das System aus wie folgt:
de ist die Standard-Präposition für die Differenz C: s’accoître de 3 %, se réduire de 3 millions de dollars;
Will man den Ausgangs- und den Endwert, also A und B, ausdrücken, kann man daher eben gerade nicht auf de und à zurückgreifen, weil de ja schon vergeben ist; daraus ergeben sich übrigens sogar Schwierigkeiten, wenn man den Endwert mit à einleiten will.6





























