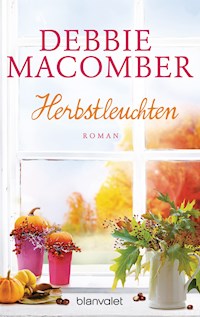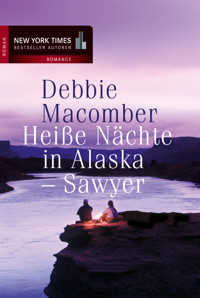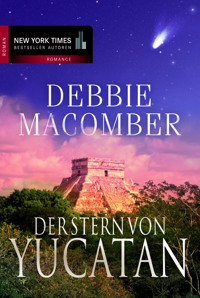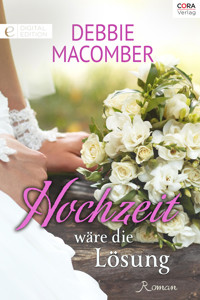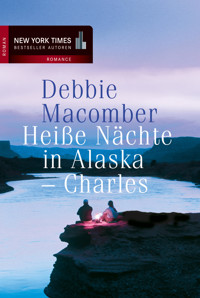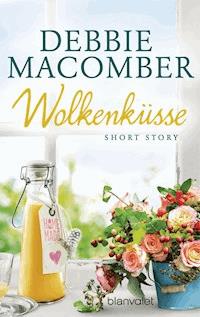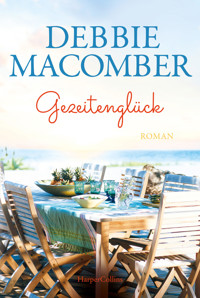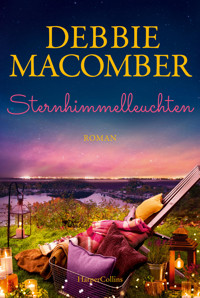8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ROSE HARBOR-REIHE
- Sprache: Deutsch
Alte Leidenschaften, neues Glück ...
Vor neun Monaten gestand Mark Taylor Jo Marie Rose seine Liebe. Und verließ sie und das Städtchen Cedar Cove danach Hals über Kopf. Doch Jo Marie will sich nicht ein weiteres Mal in Trauer um einen Mann verlieren – sie ist fest entschlossen, ihr Glück wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Auch Emily Gaffney, ihr neuester Gast, hat Pläne für die Zukunft: Sie sucht in Cedar Cove nach ihrem Traumhaus – und hat auch schon eines im Auge. Der Besitzer, Nick Schwartz, ist allerdings alles andere als begeistert, als sie ihn kontaktiert. Doch Emily gibt nicht auf, und aus einem holprigen Start wird bald eine enge Freundschaft – oder sogar mehr …
Die Rose-Harbor-Reihe:
Band 1: Winterglück
Band 2: Frühlingsnächte
Band 3: Sommersterne
Band 4: Wolkenküsse (Short Story)
Band 5: Herbstleuchten
Band 6: Rosenstunden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Vor neun Monaten gestand Mark Taylor Jo Marie Rose seine Liebe. Und verließ sie und das Städtchen Cedar Cove danach Hals über Kopf. Doch Jo Marie will sich nicht ein weiteres Mal in Trauer um einen Mann verlieren – sie ist fest entschlossen, ihr Glück wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Auch Emily Gaffney, ihr neuester Gast, hat Pläne für die Zukunft: Sie sucht in Cedar Cove nach ihrem Traumhaus – und hat auch schon eines im Auge. Der Besitzer, Nick Schwartz, ist allerdings alles andere als begeistert, als sie ihn kontaktiert. Doch Emily gibt nicht auf, und aus einem holprigen Start wird bald eine enge Freundschaft – oder sogar mehr …
Autorin
Debbie Macomber ist mit einer Gesamtauflage von über 170 Millionen Büchern eine der erfolgreichsten Autorinnen überhaupt. Wenn sie nicht gerade schreibt, ist sie eine begeisterte Strickerin und verbringt mit Vorliebe viel Zeit mit ihren Enkelkindern. Sie lebt mit ihrem Mann in Port Orchard, Washington, und im Winter in Florida.
Von Debbie Macomber bereits erschienen:
Winterglück · Frühlingsträume · Sommersterne · Wolkenküsse · Herbstleuchten
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
DEBBIE MACOMBER
Rosenstunden
Roman
Aus dem Amerikanischen von Nina Bader
Liebe Freunde,
hier ist er, der fünfte und letzte Band der Rose-Harbor-Inn-Serie. Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Geschichten zu schreiben, und ich hoffe, ihr habt sie gerne gelesen. Als ich Mark Taylor das erste Mal auf der Bildfläche erscheinen ließ, war ich mir nicht sicher, ob er der richtige Mann für Jo Marie wäre. Aber genau wie meine Heldin wuchs auch er mir ans Herz, wurde mein Held, und so fällt mir jetzt von beiden der Abschied gleichermaßen schwer. Zum Trost: Neue Projekte warten darauf, in Angriff genommen zu werden – und ihr dürft gespannt sein.
Dieses Buch ist einer ungewöhnlichen und großartigen Frau gewidmet: Margo Day. Und ich betrachte es als eine Ehre, sie als meine Freundin bezeichnen zu dürfen. Während eines Aufenthalts in Kenia rettete sie vierunddreißig junge Frauen vor einem schrecklichen Schicksal. Sie waren von daheim davongelaufen, um der Beschneidung und einer viel zu frühen Ehe zu entgehen. Beides ist in ihrer Heimat gang und gäbe. Um ihnen eine Unterkunft zu verschaffen und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen, nahm Margo sich ein Jahr Auszeit von ihrem Job. In Zusammenarbeit mit World Vision brachte sie persönlich genug Geld auf, um diesen Mädchen zu einem Heim, einer Ausbildung und einer Zukunft zu verhelfen. Einige von ihnen besuchen inzwischen ein College.
Doch Margo bot ihnen mehr als das – sie schenkte ihnen Liebe. Und sie inspirierte meinen Mann und mich, ebenfalls nach Kenia zu reisen und uns anzuhören, was diese jungen Frauen zu erzählen hatten.
Was diesen speziellen Band angeht, so gilt mein besonderer Dank Wayne Ashby, einem Kriegsveteranen der U.S. Army, der vier Dienstzeiten im Irak ableistete und mir bei der Beschreibung von Marks Abenteuern dort eine unschätzbare Hilfe war. Ihm und seiner Frau Laura ein herzliches Dankeschön.
Ich betone immer wieder, dass ich mich freue, von meinen Lesern zu hören. Und das meine ich wirklich ernst und schaue mir alles an, was in meinem Büro oder auf meiner Website ankommt. Eure Kommentare und Meinungen sind mir sehr wichtig, haben mir vielfältige Anregungen gegeben und damit die Richtung meines Schreibens beeinflusst. Dafür vielen Dank und weiter so!
Ihr erreicht mich über meine Website DebbieMacomber.com oder über Facebook, Twitter und Instagram, oder ihr schreibt mir an die Adresse P.O. Box 1458, Port Orchard, WA 98366.
Also zieht eure Schuhe aus, legt die Füße hoch und macht es euch mit einem schönen Glas kaltem Eistee bequem. Jo Marie und Mark warten auf euch.
Herzlichst
Debbie Macomber
FÜR MARGO DAY
Wer sagt denn, dass ein einzelner Mensch
nicht die Welt verändern kann?
1
Jo Marie
Im Leben geschieht immer das Unerwartete. Ich weiß, dass das ziemlich dramatisch klingt, ungefähr wie: Es war die beste aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten. Glaubt mir, ich habe beides durchgemacht, aber vermutlich geht es jedem so ähnlich.
Früher war ich in einer großen Bank in Seattle angestellt, habe mich dort von der Kassiererin immer weiter hochgearbeitet und immer mehr Verantwortung übernommen. Ich mochte meinen Job, freute mich, dass ich auf der Karriereleiter unaufhaltsam nach oben stieg und meine Perspektiven nahezu unbegrenzt zu sein schienen.
Doch für diesen brennenden Ehrgeiz musste ich einen hohen Preis zahlen.
Ich ging so in meiner Karriere auf und konzentrierte mich auf nichts anderes, dass mir für Beziehungen keine Zeit blieb. Natürlich hatte ich ein paar gute Freundinnen – in puncto Affären und Dates hingegen sah es ziemlich trübe aus. Von der großen Liebe ganz zu schweigen. Ich redete mir einfach ein, für all das bleibe später noch genug Zeit.
Irgendwann aber stellte ich mit Schrecken fest, dass der Zug mir davonzufahren drohte. Der größte Teil meiner Freundinnen war inzwischen verheiratet und hatte eine Familie gegründet. Es wurde höchste Zeit, sagte mir meine biologische Uhr. Als ich jedoch ernsthaft Ausschau nach einem passenden Partner zu halten begann, mit dem mich auch eine gewisse Seelenverwandtschaft verbinden sollte, erlebte ich, um es gelinde auszudrücken, eine herbe Enttäuschung nach der anderen.
Bis ich Paul Rose kennenlernte und mich bis über beide Ohren in ihn verliebte.
Bereits innerhalb der ersten Woche wusste ich, dass er der Richtige für mich war. Er war Berufssoldat, gehörte zu den Airborne Rangers, einer hochspezialisierten Luftlandetruppe, die in allen möglichen Krisengebieten weltweit zum Einsatz kam, und war, vielleicht deshalb, unverheiratet. Für mich ein Wunder, ein unerwartetes Geschenk des Schicksals, einem so tollen Mann zu begegnen, nachdem ich im Grunde schon jede Hoffnung aufgegeben hatte.
Wir heirateten wie im Rausch, aber ein paar Monate nachdem er mir einen Diamantring an den Finger gesteckt hatte, wurde er nach Afghanistan versetzt und kam bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Der Mann, den ich so sehr geliebt hatte, war mir bereits nach kurzer Zeit wieder genommen worden.
Meine Welt geriet aus den Fugen.
Ich begann Bücher zu lesen, die die verschiedenen Phasen der Trauer beschrieben. Sie vermochten mir indes keinen Trost zu geben, und die darin enthaltenen Ratschläge ignorierte ich größtenteils. Nichts vermochte meinen Schmerz zu durchdringen, ich funktionierte bestenfalls noch. Und selbst das kostete mich den letzten Rest meiner Energie. Allein mich morgens aus dem Bett zu quälen, ging beinahe über meine Kräfte. Quasi über Nacht waren alle meine Hoffnungen und Zukunftsträume, etwa eines Tages mit Paul eine Familie zu haben, wie eine Seifenblase zerplatzt.
Was nun?
Was sollte ich tun?
Vor Kummer wie betäubt, fällte ich eine radikale Entscheidung, obwohl alle mir davon abrieten. Mach keine übereilten Schritte, warte das erste Jahr ab, mahnten meine Eltern, mein Bruder, meine Freundinnen. Ich hörte nicht auf sie, kündigte Knall auf Fall meinen Job, erwarb ein Bed & Breakfast und nannte es Rose Harbor Inn. Rose stand natürlich für meinen Mann. Und Harbor sollte der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die kleine Pension für mich zu einem schützenden Hafen werden möge, in dem meine Seele Heilung finden konnte. Glücklicherweise ist es tatsächlich so gekommen – sogar nicht allein für mich, sondern auch für meine Gäste.
Es war, als läge ein Zauber auf diesem Haus oder was immer es sein mochte.
Nur selten habe ich anderen Menschen anvertraut, was ich in der ersten Nacht nach meinem Einzug hier erlebte. Ich fürchtete nämlich, sie könnten mir raten, ernstlich über eine Therapie nachzudenken. Selbst später fragte ich mich manchmal, ob ich das alles wirklich erlebt habe oder ob meine überreizte Psyche mir damals einen Streich spielte.
Ich hatte gedöst, mich also in einem Übergangszustand zwischen Wachen und Schlafen befunden, als ich in einer solch traumähnlichen Phase mit einem Mal Paul sah. So real, dass ich aus Angst, er könnte wieder verschwinden, nicht zu atmen wagte. Mir war, als müsste ich nur eine Hand ausstrecken, um ihn zu berühren, aber das wagte ich nicht.
Dennoch spürte ich seine Liebe, und dann begann er auch noch zu mir zu sprechen. Nicht dass seine Worte laut im Raum zu hören gewesen wären, das nicht. Nein, sie erklangen irgendwie in meinem Inneren, in meinem Herzen.
Ich weiß, es fällt schwer, das zu glauben, doch genauso habe ich es erlebt. Paul versicherte mir, dass ich in diesem Haus Heilung finden würde und dass dies ebenfalls für alle gelte, die eine Zeit lang hier wohnen würden. Ob nun Realität oder Traum, ich klammerte mich an dieses Versprechen. In meiner abgrundtiefen Verzweiflung wollte ich einfach, dass es sich so verhalten hatte. Dass Paul da gewesen war und mir den Glauben an die heilende Wirkung dieses Hauses einpflanzte.
Ich brauchte so dringend Hoffnung und einen Grund zum Weitermachen.
An eines aber hatte ich niemals gedacht: dass zu meinem Heilungsprozess eine neue Liebe gehören könnte. Das schien mir undenkbar, völlig aus der Welt. Verstandes- wie gefühlsmäßig. Paul gefunden zu haben, war Wunder genug gewesen, dachte ich und rechnete folglich nicht damit, erneut so ein Glück zu haben. Insofern war die Erkenntnis, ein zweites Mal verliebt zu sein, eine fast noch größere Überraschung als beim ersten Mal.
Allerdings hing bei meiner Beziehung zu Mark Taylor der Himmel zunächst ganz und gar nicht voller Geigen.
Anfangs zog ich mich in Cedar Cove weitgehend zurück, suchte keine Kontakte in meiner neuen Heimat. Meine Gäste reichten mir. Und mein Hund Rover, den ich aus dem Tierheim holte. Ansonsten beschäftigte ich mich mit Stricken, erweiterte meine bis dahin eher mangelhaften Kochkünste und entdeckte meine Liebe zur Gartenarbeit. Lauter Dinge, die in meinem früheren Leben nie für mich in Betracht gekommen wären.
Die einzige menschliche Konstante während meiner ersten drei Jahre war Mark Taylor.
Ein ewig mürrischer, verschlossener und manchmal sehr grober Allroundhandwerker und dazu ein überaus geheimnisvoller Mann. Doch im Laufe der Zeit wurde er zu einem Freund, wenngleich wir dauernd stritten und ich mich ständig über seine elende Geheimniskrämerei ärgerte. Vermutlich klingt das alles andere als logisch, aber so ist es nun mal gelaufen.
Mehr und mehr gewöhnten wir uns aneinander.
Mark war eigentlich täglich bei mir anzutreffen, weil er eine Vielzahl von Dingen für mich erledigte, ob das nun ein Schild mit dem Namen der Pension war, ein Gartenpavillon oder Umbauten in den Zimmern. Er konnte und machte einfach alles. Und nach einer Weile freundeten wir uns trotz unserer Reibereien an, die eigentlich sowieso nicht ernst gemeint, sondern eher wie das Salz in der Suppe waren. Jedenfalls langweilten wir uns nie miteinander.
Außerdem war es ein Geben und Nehmen. Ich brauchte ihn immer wieder, und er kam bereitwillig, wenn ich ihm dafür Plätzchen backte. Ganz warm, also frisch aus dem Ofen mussten sie sein. Dafür tat er fast alles.
Mark war es auch, der mich nach Pauls Tod zum ersten Mal wieder zum Lachen brachte. Er war gerade mit Malerarbeiten beschäftigt und trat, als er von der Leiter stieg, versehentlich in einen großen Farbeimer. Ich fand das urkomisch und lachte, bis mir die Tränen über die Wangen rannen. Marks Belustigung hielt sich dagegen in Grenzen.
Die Jahre gingen ins Land, und Marks Anwesenheit wurde zur Selbstverständlichkeit. Regelmäßig war er ein paar Stunden täglich in der Nähe, werkelte in Haus oder Garten herum, während ich für sein leibliches Wohl sorgte. Selbst wenn er anderswo arbeitete, kam er unweigerlich auf einen Kaffee und ein paar Plätzchen bei mir vorbei.
Wir saßen dann auf der Veranda und tauschten uns über die Ereignisse des Tages aus. Manchmal schwiegen wir auch einfach. Im Grunde brauchten wir keine Worte, um uns zu verständigen. Irgendwelche Anzeichen für eine beginnende Romanze gab es dennoch lange nicht; ich sah ihn als Freund, nicht mehr.
Für die Möglichkeit, dass seine Gefühle anders gelagert sein könnten, war ich vollkommen blind.
Als er mir dann gestand, dass er sich in mich verliebt habe, traf es mich völlig unvorbereitet. Es war ein regelrechter Schock, mit dem ich nicht umzugehen wusste. Erst recht nicht, als mir klar wurde, dass Mark mittlerweile für mich ebenfalls mehr als ein Freund war. Ich hatte es bis dahin einfach verdrängt und die schleichende Veränderung meiner Gefühle für ihn ignoriert.
Das hier war so ganz anders als mit Paul: kein Aha-Erlebnis, kein Blitz, der einen aus heiterem Himmel traf.
Kaum hatte ich schließlich akzeptiert, dass mein Herz für Marks Liebe offen und empfänglich war, versetzte er mir völlig unerwartet einen Tiefschlag. Um ein anderes Bild zu bemühen: Auf seine Liebeserklärung folgte eine kalte Dusche. Er werde Cedar Cove verlassen und aller Voraussicht nach nicht zurückkehren, teilte er mir mit. Und das, obwohl er mich angeblich liebte.
Ich verstand die Welt nicht mehr.
Was sollte das Ganze, fragte ich mich, denn es ergab keinen Sinn. Nicht den geringsten. Und überhaupt: Wer machte so etwas? Und warum, um Himmels willen?
Und dann war er weg. Wirklich weg. Haus verkauft, Habseligkeiten verschenkt. Alles war schlicht und ergreifend weg. Als hätte es in Cedar Cove niemals einen Mark Taylor gegeben.
Kurz darauf erfuhr ich den Grund für seinen überstürzten Aufbruch. Irgendwann in seiner Vergangenheit war Mark beim Militär gewesen, als Berufssoldat wie Paul, war im Irakkrieg zum Einsatz gekommen und hatte dort Dinge erlebt, die sein Leben veränderten. Am meisten quälte ihn, dass er einen irakischen Freund samt Familie zurücklassen musste, der jetzt als ehemaliger Informant der Amerikaner um sein Leben fürchten musste. Mark hatte versprochen, ihn mitzunehmen – seine Vorgesetzten erlaubten es nicht. Aus einem unerfindlichen Grund sollte der Abzug der Einheit unter strengster Geheimhaltung in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vonstattengehen.
Obwohl ihm die Hände gebunden gewesen waren, machte Mark sich Vorwürfe, betrachtete sich als Feigling, weil er nicht alles Menschenmögliche versucht hat. Seit seiner Rückkehr in die Staaten hatte Mark jeden Tag mit seinem Gewissen zu kämpfen gehabt. Und dann lernte er mich kennen, die Witwe eines Kriegshelden, wie er das sah. Um mich ohne Skrupel lieben zu können, gab es in seinen Augen nur eine Möglichkeit. Er musste zurück in den Irak und Ibrahim mit Familie aus dem Land herausholen.
Das glaubte er sich und mir schuldig zu sein.
Dabei war ihm durchaus bewusst, dass er immense Gefahren für sein eigenes Leben auf sich nahm. Ja, er rechnete sich sogar lediglich geringe Chancen aus, diese Rettungsaktion heil zu überstehen. Trotzdem wollte er es versuchen.
Um sich wieder ins Gesicht sehen zu können – und um sich meiner würdig zu erweisen, wie er das sah.
Wenn Mark sich allerdings einbildete, mir damit einen Gefallen zu tun, irrte er sich. Mir reichte ein Held, der gestorben war. Irgendwie ahnte er das womöglich, fürchtete offenbar, ich könnte ihm dieses riskante Unterfangen ausreden, und unterließ es deshalb, mich über seine Beweggründe aufzuklären. Die erfuhr ich später in seinem Auftrag von Bob Beldon, einem väterlichen Freund. Natürlich hätte ich alles in meiner Macht Stehende getan, ihn von diesem Vorhaben abzubringen.
Ich wünschte ihn mir in Cedar Cove, sonst nirgendwo.
Ohnehin war ich bereits ausgerastet, als er mir ohne Angabe irgendwelcher Gründe mitteilte, er wolle weggehen. In meiner Verbitterung warf ich ihm sogar an den Kopf, dass ich in dem Fall nicht auf ihn warten werde. Was er allerdings gar nicht verlangt hatte. Wie auch immer: Ich beschloss, mich nicht länger zu verkriechen, vielmehr mit Freundinnen auszugehen und auch Dates mit Männern nicht auszuschlagen. Bloß begegnete mir niemand, der mir wie Paul und Mark das Gefühl gegeben hätte, lebendig zu sein.
Dennoch begann ich mehr und mehr, mir ein neues Leben aufzubauen.
Mark war inzwischen seit fast neun Monaten fort, und ich hatte nur einmal von ihm gehört. Ein einziges Mal. Und zwar mitten in der Nacht, als mich ein Telefonanruf aus dem Tiefschlaf riss. Er sei im Irak und habe Ibrahim gefunden, ließ er mich wissen. Die Verbindung war schlecht, und ich bekam lediglich einen Teil von dem mit, was er sonst so erzählte. Aber wenigstens hörte ich seine Stimme, wenngleich mit Unterbrechungen. Soweit ich es mir zusammenreimen konnte, war er dabei, mit Ibrahim, seiner Frau und ihren beiden Kindern das Land zu verlassen. Wie und wo genau, blieb mir ein Rätsel – darüber schwieg er sich aus.
Worum es ihm jedoch mit seinem Anruf in erster Linie ging, das bekam ich sehr genau mit. Mark bat mich um meine Hilfe. Sofern es ihm gelang, Ibrahim und seine Familie aus dem Irak herauszuschaffen, wollte er sicher sein, dass ich mich in den Staaten um sie kümmerte. Er sagte es nicht ausdrücklich, oder es ging durch die ständigen Störungen unter – diese Rückversicherung war für den Fall gedacht, dass er nicht lebend aus dem Land herauskam.
Obwohl mir ganz übel wurde bei dem Gedanken, versprach ich Mark, alles zu tun, was in meiner Macht stand, damit diese Familie hier Fuß fassen konnte. Was hätte ich anderes sagen sollen? Seitdem hatte ich nichts mehr von ihm gehört.
Null, nicht ein einziges Wort.
Kein Brief. Kein Anruf. Kein Kontakt irgendwelcher Art.
Für mich ein Grund zur Besorgnis. Mehr oder weniger ging ich bereits davon aus, dass Mark ebenso wie Paul für mich verloren war. Immerhin waren Wochen vergangen – eigentlich hätte er es längst geschafft haben müssen, so es denn überhaupt zu schaffen war.
Mittlerweile stand ein neuer Sommer vor der Tür. Ich hatte mich in die Komfortzone des Verdrängens zurückgezogen und zwang mich dazu, nicht an Mark zu denken – versuchte es besser gesagt, denn es funktionierte nicht wirklich. Was mir aber gelang, war, alle anderen daran zu hindern, über Mark zu reden. Vor allem meine Mutter, die ständig am Telefon beteuerte, dass sie immer noch für ihn und das Gelingen dieses Unternehmens bete.
Ich hingegen dachte, es sei leichter, mir keine großen Hoffnungen zu machen, sondern mich vorsorglich mit dem Gedanken abzufinden, dass er nicht mehr lebte. Krass, ich weiß, und trotzdem vielleicht verständlich, wenn man bedenkt, dass Pauls sterbliche Überreste ein ganzes Jahr lang nicht geborgen werden konnten und ich mich jeden einzelnen Tag, jede einzelne Minute wider besseres Wissen an die Hoffnung geklammert hatte, mein Mann habe irgendwie überlebt. Nun weigerte ich mich, das ein zweites Mal zu tun. Um meiner eigenen Psyche willen musste ich loslassen.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Zum Glück war die Pension an den Sommerwochenenden dank der idyllischen Lage am Puget Sound praktisch immer ausgebucht, sodass ich ziemlich viel um die Ohren hatte. Unter der Woche allerdings gab es oftmals viel Leerstand, weshalb ich mich darauf eingelassen hatte, ein Zimmer auf unbegrenzte Zeit zu vermieten.
An eine junge Lehrerin namens Emily Gaffney.
Die junge Frau hatte in Cedar Cove eine Stelle angenommen und würde in den nächsten Tagen eintreffen. Sie wollte die Zeit bis zum Schulanfang nutzen, um sich eine dauerhafte Bleibe zu suchen. Ihr schwebte ein Haus vor, doch eine solche Entscheidung durfte man nicht übers Knie brechen. Aus diesem Grund hatte sie sich mit mir in Verbindung gesetzt und ein für uns beide akzeptables Arrangement getroffen: Sie logierte bei mir zwar als Dauergast, aber das Mietverhältnis konnte von beiden Seiten wöchentlich beendet werden.
Einsam, wie ich war, freute ich mich auf Emily.
Mit ihr wäre es auch unter der Woche weniger eintönig. Rover war ein treuer Gefährte – menschliche Gesellschaft indes konnte er mir nicht ersetzen. Nach wie vor hatte ich mich noch nicht an das Leben ohne Mark gewöhnt. An manchen Tagen kam es mir vor, als würde sich ein riesiger Abgrund vor mir auftun und mich mit Haut und Haaren verschlingen.
Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es Zeit für meinen nachmittäglichen Fitnesskurs war. Ich habe seit jeher gern Sport getrieben. Nicht wegen der körperlichen Betätigung als solcher, das nicht. Die hasste ich eher. Was mich reizte, war der Kick, das berauschende Gefühl, etwas Tolles vollbracht zu haben. Es gab mir gleichermaßen psychisch wie physisch enormen Auftrieb.
»Ich gehe jetzt«, sagte ich zu Rover, mit dem ich mangels anderer Gesellschaft bisweilen wie mit einem Menschen zu reden pflegte. Ich trug meine engen Trainingshosen, ein ärmelloses Top und ein schwarz-weiß gepunktetes Stirnband.
Mein Hund würdigte mich keines Blickes, denn er betrachtete es eigentlich als sein natürliches Recht, mich überallhin zu begleiten. Dass das im Fitnessstudio nicht möglich war, verstand er nicht. Wie sollte er auch. Ostentativ drehte er den Kopf zur Seite.
»Pass hier schön auf«, brummte ich, zog die Tür hinter mir zu und schloss sie ab.
Ich war mit Dana verabredet, einer Immobilienmaklerin etwa in meinem Alter, verheiratet, zwei Kinder. Wir hatten uns kurz vor der Geschichte mit Mark kennengelernt, und sie war für mich zu meiner wichtigsten moralischen Stütze geworden. Jetzt stand sie wartend bei den Trimmrädern. Sie hatte sich das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, hob die Arme, rollte die Schultern und machte sich startklar. Ich für meinen Teil blinzelte die verdammten Räder mit den schmalen Sätteln wie immer missmutig an und hätte am liebsten wie immer kehrtgemacht.
»Hattest du einen schönen Tag?«, fragte Dana.
»Es gab schon bessere.«
Ich wiederholte nicht, was sie ohnehin wusste – dass meine Gedanken ständig um Mark kreisten. Am Abend zuvor war ich mit einem Typen namens Ralph ins Kino gegangen. Er war nett, geschieden, aber zwischen uns funkte es einfach nicht. Nicht einmal ein Flammenwerfer hätte geholfen. Ich dachte, auszugehen würde mir guttun, doch in Wahrheit kam ich regelmäßig deprimiert und durcheinander nach Hause. Mag sein, dass ich nicht wusste, wonach ich suchte. Ich wusste nur, dass ich es bei Ralph niemals finden würde – genauso wenig wie bei den vorhergehenden Kandidaten.
Dana musterte mich prüfend, rang offenbar mit sich, ob sie etwas sagen sollte oder nicht. Und da ich meinerseits eine weitere Diskussion nicht wünschte, weder über Ralph noch über Mark, stieg ich aufs Rad, legte die Unterarme auf den Lenker und sagte: »Also dann los, oder?«
»Klar«, gab Dana zurück.
Und in diesem Ton verlief der Rest der Trainingsstunde.
Wie gehabt sah ich eigentlich keinen Sinn darin, meinen Körper derart auszupowern, und strampelte mich trotzdem ab. Hinterher war ich dann froh, die Anstrengung auf mich genommen zu haben. Es war eine echte Hassliebe, die mich mit diesem Training verband.
Seufzend wischte ich mir mit einem Handtuch den Schweiß vom Gesicht. »Sind wir bereits in Paris?«, erkundigte ich mich.
Als Anreiz für die Plackerei hatten Dana und ich während der letzten sechs Monate begonnen, unsere zurückgelegten Meilen zusammenzuzählen und im Geiste bis nach Europa zu radeln. Genauer gesagt nach Paris. Dana, von Natur aus athletisch gebaut, war mir einiges voraus und würde vermutlich vor mir das Ziel erreichen. Egal, ich zog es sowieso vor, in der imaginären französischen Landschaft herumzutrödeln, frisch gebackenes Brot mit Käse zu probieren und mir dazu eine schöne Flasche Rotwein schmecken zu lassen.
»Wir sind fast da«, versicherte Dana, aber ich glaubte ihr kein Wort. Sie versuchte bloß, mich bei der Stange zu halten.
»Bis Mittwoch dann«, sagte ich auf dem Weg zur Tür.
»Mittwoch«, rief sie mir hinterher. »Oder früher.«
Wann immer sie eine freie Minute hatte, was allerdings nicht oft vorkam, schaute Dana nämlich auf einen Tee und ein Plauderstündchen bei mir vorbei und half mir so über manch einsame Stunde hinweg.
Auf dem Weg zum Haus blieb ich am Briefkasten stehen und öffnete ihn. Er enthielt ein paar Werbesendungen, eine Kochzeitschrift und natürlich eine Anzahl Rechnungen. Ich warf die Post in der Küche achtlos auf den Tresen und ging erst mal unter die Dusche.
Rover schien das nicht zu passen. Er legte den Kopf schief und starrte mich erwartungsvoll an.
»Du hattest deinen täglichen Spaziergang schon«, erinnerte ich ihn, bezweifelte jedoch, dass ihm das reichte.
Ich verwöhnte dieses Tier wirklich nach Strich und Faden, und bisweilen schien er die Rollen umzukehren. Weshalb ich ihm immer mal wieder ins Gedächtnis rufen musste, wer hier das Sagen hatte. Leider war ich selbst in dieser Hinsicht nicht allzu erfolgreich.
Nachdem ich mich unter der Dusche erfrischt hatte, beschloss ich, mich ein Weilchen auf die Veranda zu setzen und die Nachmittagssonne zu genießen. Wir hatten einen herrlichen Frühling gehabt mit für den pazifischen Nordwesten ungewöhnlich warmem und sonnigem Wetter. Ich schenkte mir ein Glas Eistee ein, zog die Kochzeitschrift aus dem Poststapel und machte es mir in einem der weißen Korbsessel bequem, ließ dabei träumerisch den Blick über die Bucht schweifen. In der Marina tanzten Boote aller Größen auf der Wasseroberfläche. Die Gipfel der Olympic-Mountains-Bergkette hoben sich vor einem strahlend blauen Himmel ab. Ein Blick, der nicht allein meine Gäste, sondern auch mich immer wieder aufs Neue verzauberte.
Als ich das Heft mit den Rezepten aufschlug, passierte es.
Eine Postkarte mit einer ausländischen Briefmarke rutschte zwischen den Seiten hervor.
Keine x-beliebige Karte.
Obwohl er sie nicht unterschrieben hatte, wusste ich sofort, dass sie von Mark war.
Genieße die Zeit im Jeddah Beach Swim Reef.
Schlechte Verbindung. Kein ANDC.
Verlorener Koffer okay, meiner dagegen stark beschädigt.
Ist auf dem Weg nach Hause.
Liebe dich.
2
Mark
Ich habe mich nie für den strahlenden, muskelbepackten Helden gehalten, der in Romanen vorkommt – dazu war ich immer viel zu hager und zu groß. In der Highschool nannte man mich deshalb Bohnenstange. Zwar legte ich in meinen Zwanzigern ein bisschen zu, blieb aber trotzdem eher schlank. Soweit ich das selbst beurteilen kann, bin ich nicht attraktiv. Nicht dass ich je großen Wert auf mein Äußeres gelegt hätte – ich habe es immer hingenommen. Und was andere über mich dachten, hat mich wirklich immer einen feuchten Kehricht interessiert.
Zumindest bis ich Jo Marie kennenlernte.
Plötzlich legte ich, ohne es zu wollen, großen Wert darauf, was sie von mir hielt, was sie über mich dachte. Das ging sogar so weit, dass ich Kopf und Kragen riskierte, um mich ihrer würdig zu erweisen. Und nur darum steckte ich jetzt in diesem vom IS besetzten irakischen Gebiet nahe der syrischen Grenze fest.
Die Hitze hier war so drückend, dass sie einem die Kraft aus dem Körper saugte wie Luft aus einem Ballon. Jeden Tag kletterte die Temperatur um die Mittagszeit auf ungefähr sechsundvierzig Grad. Und als wäre die sengende Sonne nicht genug gewesen, musste ich mich zusätzlich in allerlei Kleidungsschichten hüllen. Nach fast einem Jahr im Irak sah ich mehr wie ein Iraker aus, als Saddam Hussein es je getan hatte.
Meine Aufgabe hatte in erster Linie darin bestanden, meinen Freund und früheren Informanten Ibrahim zu finden und ihn, seine Frau Shatha und die zwei Kinder aus dem Land zu schaffen, nachdem mir das beim Abzug meiner Einheit nicht gelungen war. Eigentlich sollte ich mit meinen Freunden längst wieder sicheren Boden erreicht haben, doch leider war das nicht der Fall. Zunächst war es schwierig gewesen, Ibrahim, der sich bei Verwandten im Nordirak versteckt hielt, überhaupt ausfindig zu machen, und auch danach lief nichts nach Plan.
Wie so oft in meinem Leben.
Seit vier Monaten hingen wir in einem von der Terrormiliz kontrollierten Gebiet fest, in dem ein Menschenleben nichts mehr galt. Natürlich hatte ich das alles gewusst, als ich mich entschloss, in den Irak zurückzukehren, und deshalb meine Chancen, diesen Einsatz zu überleben, nicht gerade hoch eingeschätzt. Da müsste schon ein Wunder geschehen, hatte ich gedacht.
Und ohne Shathas medizinische Kenntnisse läge ich vermutlich inzwischen sechs Fuß unter der Erde. Das passierte schnell, wenn einen eine Kugel erwischt hatte. Es kostete mich fast drei Monate, so weit zu Kräften zu kommen, um an eine Weiterreise zu denken – unser Ziel war die Grenze nach Saudi-Arabien.
Während dieses Zwangsaufenthalts hatte ich reichlich Gelegenheit gehabt, jene Ereignisse Revue passieren zu lassen, mit denen das ganze Unglück angefangen hatte. Da ich fließend Farsi und Arabisch sprach, wurde ich damals zur Informationsbeschaffung eingesetzt, und Ibrahim war mein wichtigster Mitarbeiter. Dann begann der überstürzte Truppenabzug meiner Einheit, über den kein Sterbenswörtchen nach außen dringen durfte.
Innerhalb weniger Stunden wurde das gesamte Gelände geräumt, und es war fast so, als wären wir überhaupt nie dort gewesen. Ich konnte Ibrahim weder informieren, dass ich das Land verließ, noch ihm in irgendeiner Weise helfen. Obwohl ich ihm das einmal vorbeugend versprochen hatte. Niemand befand es für nötig, unsere irakischen Mitarbeiter über die veränderte Situation und die damit verbundenen Gefahren in Kenntnis zu setzen.
Mit anderen Worten, unser abrupter Aufbruch ließ insbesondere unsere Informanten vollkommen verwundbar und schutzlos zurück. Vergeblich versuchte ich meinem Einheitsführer zu erklären, dass es gewissermaßen einem Todesurteil gleichkomme, wenn wir sie nicht mitnahmen. Er hatte anderslautende Befehle – dass Ibrahim und seinesgleichen als Kollaborateure fortan in Lebensgefahr schwebten, interessierte die Army nicht.
Ich redete gegen eine Wand.
Diese Erfahrung nahm mich endgültig gegen das Militär ein. Sowie meine Dienstzeit abgelaufen war, lehnte ich eine Wiederverpflichtung ab. Eine Entscheidung, die niemand erwartet hatte. Insbesondere nicht von einem wie mir, denn ich entstammte einer Militärdynastie, in der man seit jeher viel darauf hielt, dem Vaterland in unbedingter Treue zu dienen. Befehle wurden da nicht angezweifelt. Mein Großvater marschierte im Zweiten Weltkrieg an der Seite des legendären Generals Patton, der maßgeblichen Anteil daran hatte, das westliche Europa von der nationalsozialistischen Besetzung zu befreien, und mein Vater, der ebenfalls die militärische Karriereleiter erklomm, hatte als Offizier am Vietnamkrieg teilgenommen. Beiden waren Tapferkeitsmedaillen verliehen worden.
Und ich, der die Familientradition fortsetzen sollte, quittierte den Dienst.
In einem Anfall rechtschaffenen Zorns und Bitterkeit kehrte ich dem den Rücken, was ich bis dahin für meine Zukunft gehalten hatte, und ließ mich in Cedar Cove nieder, wo ich dank meines handwerklichen Geschicks zum Hansdampf in allen Gassen avancierte. Zum Glück war ich nicht auf ein gesichertes Einkommen angewiesen, denn von meinen verstorbenen Eltern hatte ich genug geerbt, um bei sorgfältiger Planung bis an mein Lebensende damit auszukommen.
Trotzdem gestaltete sich mein neues Leben schwierig.
Ich war immer ein Einzelgänger gewesen und hatte lediglich einen wirklichen Freund gehabt: Ibrahim. Und ausgerechnet ihn überließ ich einem ungewissen Schicksal. Ich wusste schließlich, was dort unten mit Kollaborateuren passierte – erst wurden sie gefoltert, um ihnen Informationen zu entlocken, dann ermordet. Einschließlich der Familien.
Wie sollte ich mir da noch ins Gesicht sehen können?
Nicht lange nachdem ich mich in Cedar Cove niedergelassen hatte, lernte ich Jo Marie kennen. Eine Kriegerwitwe, deren Mann wie ein Held in Afghanistan gestorben war und damit das genaue Gegenteil von mir darstellte. Bis dahin war ich noch nie richtig verliebt gewesen und hatte folglich auch nie erlebt, was die Liebe zu einer Frau in einem Mann anrichten konnte.
Mir kam es vor, als wäre sie zu einem lebenden, atmenden Teil von mir selbst geworden, als hätte sie sich in meinem Kopf und, schlimmer noch, in meinem Herzen eingenistet. Mich von ihr zu trennen war das Schwerste, was ich je tun musste – und das Schmerzhafteste, was ich je erlebt habe.
Und der Gedanke an sie war es, der mich überhaupt am Leben hielt.
Nachdem ich angeschossen worden war und das Fieber in mir tobte, dachte ich nur daran, zu ihr zurückzukehren. Angeblich, so Shatha, führte ich im Delirium lange Gespräche mit Jo Marie – und in der Tat meinte ich mich zu erinnern, ihre Stimme gehört zu haben, die mich beschwor, am Leben zu bleiben, nicht aufzugeben, wieder nach Hause zu kommen. Und allein ihretwegen war ich trotz Schmerzen und Schwäche bereit, diese gefährliche Reise fortzusetzen.
Als ich Jo Marie erstmals begegnete, war Paul kein Jahr tot und sie nach wie vor in abgrundtiefer Trauer versunken. In den ersten Monaten half ich ihr mit vielerlei Dingen, die in der Pension repariert, umgebaut oder neu gestaltet werden mussten. Und so kam es, dass ich nach und nach immer mehr Zeit mit ihr verbrachte. Ich fand sie klug und witzig, zugleich jedoch sehr eigensinnig, schrecklich eigensinnig. Aber gerade deshalb liebte ich es, sie zu provozieren und herauszufordern. Und vermutlich half ihr das sogar, den Panzer ihrer Trauer ein kleines Stück zu durchbrechen und sich wieder lebendig zu fühlen.
Sobald mir klar wurde, dass ich mich in sie verliebt hatte, wusste ich nicht so recht, wie ich mit diesen neuen Empfindungen umgehen sollte. Schließlich passierte es mir ja zum ersten Mal. Und da ein ungeschickter, liebeskranker Trottel das Letzte war, was Jo Marie brauchte, behielt ich meine Gefühle erst mal für mich, liebte sie aus der Ferne und gab mir alle Mühe, mir nichts anmerken zu lassen.
Fast zwei Jahre wartete ich darauf, dass sie über ihren Verlust hinwegkam und der Schutzwall, den sie um sich errichtet hatte, einzustürzen begann. Bis dahin war ich bereits zu einem Teil ihres Alltagslebens geworden. Alle Arbeiten für sie beziehungsweise für die Pension genossen bei mir absolute Priorität, weil ich Zeit mit ihr verbringen wollte. Und sie dachte, ich käme bloß wegen ihrer selbst gebackenen Plätzchen!
Nicht dass ich ihre Backkünste nicht schätzte, doch mir ging es nicht um Erdnussbutterplätzchen.
Es ging einzig und allein um sie selbst, um Jo Marie.
Ich vermag nicht mehr genau zu sagen, wann ich mich endgültig zu dem verspäteten Versuch entschloss, Ibrahim und seine Familie zu suchen und sie hoffentlich noch zu retten. Es hat immer in mir gebrodelt, und mein Gewissen quälte mich. Und solange ich die Sache nicht in Ordnung gebracht hatte, verdiente ich eine Frau wie Jo Marie nicht. So sah ich das.
»Sadiq.« Ibrahim flüsterte mir das Wort für Freund auf Arabisch zu. »Bist du wach?«
Ich blickte zu ihm auf und blinzelte. Es kostete mich Mühe zu lächeln.
»Trink«, drängte er, schob seinen Arm unter meinen Nacken und hob meinen Kopf so weit an, dass er mir eine Flasche an die Lippen halten konnte.
Wie oft hatte ich Ibrahim beschworen, mich zurückzulassen und sich mit seiner Familie zu dem Treffpunkt zu begeben, der mir von der Army genannt worden war. Drei Termine hatten wir bereits wegen meiner Verletzung verpasst, und dennoch weigerte sich Ibrahim, mich im Stich zu lassen. Er erwog nicht einmal, ohne mich weiterzuziehen. So war er eben. Ein Freund. Ein Bruder.
Niemals würde er Gleiches mit Gleichem vergelten.
»Zeit zum Aufbruch?«, fragte ich und betete im Stillen, genug Kraft aufbringen zu können, um überhaupt einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Wir bewegten uns hauptsächlich nachts im Schutz der Dunkelheit, mal mit Autos, mal mit Fuhrwerken, mal zu Fuß. Sowie wir zu einer größeren Stadt kamen, trennten wir uns. Shatha ging mit den beiden Kindern voraus, während Ibrahim mit mir zurückblieb. Vorsicht war das oberste Gebot. Überall lauerten Gefahren, und wir konnten und durften niemandem trauen. Deshalb war es weitaus sicherer, zwei Gruppen zu bilden.
Lange an einem Ort zu verweilen erhöhte ebenfalls das Risiko, aber das größte Risiko von allen war das geringe Tempo, in dem wir vorankamen – und das wiederum lag allein an mir. Wenn wir so weitermachten, würden wir unseren Treffpunkt frühestens in zwei Wochen erreichen. Unter normalen Umständen hätten wir die Strecke in weniger als einem Viertel der Zeit hinter uns gebracht.
»Schlaf lieber noch ein wenig«, meinte Ibrahim, als ich mich mühsam aufrichtete.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, wir müssen weiter.«
»Du bist zu schwach.«
In der Tat war es erschreckend, welche Anstrengung mich schon das Aufsetzen kostete. Alles begann sich um mich zu drehen, und ein scharfer Schmerz schoss mir in die Seite, wo die Kugel mich getroffen hatte. Ich schnappte nach Luft, fiel auf mein Lager zurück und atmete keuchend.
»Ruh dich aus, mein Freund«, wiederholte Ibrahim sanft. »Wir ziehen morgen weiter.«
Der sechsjährige Amin gesellte sich zu seinem Vater und musterte mich besorgt. Ibrahim hatte seinem Sohn einen Namen gegeben, der im weitesten Sinne übersetzt ehrenhaft bedeutet. Es war als Referenz an mich gedacht. An den Freund, den Ibrahim für einen Ehrenmann hielt.
Wie beschämend.
»Bist du okay, Scout?«, fragte ich ihn auf Arabisch. Ich nannte ihn Scout, weil er über die gespenstische Fähigkeit verfügte, das zu sehen, was Ibrahim und mir oft entging.
»Ich okay. Du okay?«, gab der Junge auf Englisch zurück, was ihm einen warnenden Blick seines Vaters eintrug.
Um ihn zu beruhigen, drückte ich seine kleine Hand. Dabei ging es mir ganz und gar nicht gut – eher hatte ich das Gefühl, stündlich schwächer zu werden. Trotzdem mussten wir weiter, sonst würde auch unsere letzte Chance vertan sein, und alles wäre verloren.
Wir waren zu nah am Ziel, um jetzt aufzugeben.
Entschlossen sah ich Ibrahim an. »Nein, wir gehen weiter. Wir müssen weiter, denn uns bleibt keine andere Wahl.«
»Du musst erst gesund werden.«
»Keine Zeit.«
Ibrahim seufzte stumm. Er wusste genau, wie sehr die Zeit drängte.
»Entweder brechen wir auf, oder du lässt mich hier«, beharrte ich, streckte einen Arm aus und packte seine Hand. »Wir haben keine andere Wahl«, wiederholte ich.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis Ibrahim schließlich nickte. »Okay, wir machen uns wieder auf den Weg«, stimmte er zu.
Amin sprang auf und flitzte davon, um seiner kleinen Schwester und seiner Mutter Bescheid zu geben.
3
Emily
Ich persönlich hielt Liebe inzwischen für ein völlig überbewertetes Gefühl. Vielleicht weil meine bisherigen Beziehungen kein gutes Ende genommen hatten. Jetzt wollte ich einen neuen Anfang machen, und das hieß: neuer Job, neue Umgebung, neue Wohnung. Ich gab mein Apartment in Seattle auf, um mir in Cedar Cove etwas Neues zu suchen, aber zunächst einmal würde ich im Rose Harbor Inn wohnen.
Als ich in die Auffahrt einbog, fielen mir sogleich die altmodische Eleganz und anmutige Schönheit des Hauses ins Auge. Keine Ahnung, wann es erbaut worden sein mochte. Schätzungsweise plus/minus um die Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert. Bestechend fand ich die Veranda, die um das gesamte Haus verlief und auf der ich gemütliche Sitzmöbel aus Korb entdeckte sowie große Pflanzkübel mit roten Geranien. Auf Anhieb überkam mich ein Gefühl von Trost und Frieden wie schon lange Zeit nicht mehr. Ich hatte es bereits gespürt, als ich die Fotos im Internet betrachtete.
Zu diesem Zeitpunkt lag so einiges hinter mir, und ich stand vor der Frage, in welche Richtung ich mein Lebensschiff jetzt lenken sollte. Eines jedenfalls stand für mich fest: Mit der Liebe war ich fertig und würde auch nicht mehr danach suchen, weil es mir einfach nicht bestimmt zu sein schien.
Als junges Mädchen hatte ich mir meine Zukunft im Geist immer so ausgemalt, wie es in Liebesromanen nachzulesen ist. Idylle pur und nichts als eitel Freude und Sonnenschein. Ich glaubte damals fest daran, meinem Traumprinzen zu begegnen, ihn zu heiraten und mit ihm viele bezaubernde Kinder zu bekommen. Und alle zusammen würden wir in einem schönen Haus mit Garten leben, ganz traditionell und glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer Tage.
Für viele klang das altmodisch – wie ein Rückfall in die Steinzeit, wie ein Verrat an der Emanzipation, aber ich sehnte mich lange Zeit genau danach. Deshalb verfolgte ich auch keine ehrgeizigen Berufspläne. Bis ich meinen Traummann fand, so dachte ich, würde ich vollauf damit zufrieden sein, Grundschulkinder zu unterrichten – danach wollte ich schließlich nichts als Ehefrau und Mutter sein.
Leider hatte ich nicht das Zeug zur Märchenprinzessin.
Nach zwei gelösten Verlobungen dämmerte mir, dass meine Zukunftsplanungen einiger Korrekturen bedurften. Den Mann schminkte ich mir erst mal ab, die Kinder nicht. Wer sagte denn, dass es nicht anders ging. In meinem Fall bedeutete das Adoption.
Jedenfalls beschloss ich, mein Leben komplett umzukrempeln.
Da war es ein Glücksfall, dass ich auf ein Stellenangebot in Cedar Cove auf der anderen Seite des Puget Sound stieß. Die kleine Stadt lag weit genug entfernt, damit ich unabhängig war, und zugleich nah genug, um meine Familie in Seattle regelmäßig besuchen zu können.
Ironischerweise war ich im letzten Sommer mit meinem damaligen Verlobten erstmals in der idyllischen Kleinstadt gewesen, weil James dort ein Klassentreffen besuchte. Mir hatte es dort auf Anhieb gefallen. Wir waren durch die Straßen des Ortes und über den Bauernmarkt geschlendert, hatten uns die Marina und die Strandpromenade angesehen, und ich hatte mich sogleich angesprochen gefühlt von der beschaulichen Atmosphäre des Städtchens und der Wärme und Freundlichkeit seiner Bewohner.
Kurz darauf lösten wir die Verlobung, und als ich wenig später das Stellenangebot entdeckte, folgte ich einer Laune und bewarb mich. Es war ein Schuss ins Blaue gewesen, denn ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, genommen zu werden. Umso begeisterter war ich, als mir der Job wirklich angeboten wurde.
Manchmal fragte ich mich seinerzeit, ob ich unbewusst durch diesen Umzug eine Verbindung zu James halten wollte, der immerhin aus Cedar Cove stammte. Der Gedanke machte mir eine Zeit lang zu schaffen, doch inzwischen bin ich sicher, dass es sich nicht so verhielt. Auch wenn ich James wirklich geliebt hatte – sogar genug, um die Verlobung zu lösen und ihn für eine andere freizugeben.
Vielleicht hätten wir ansonsten sogar geheiratet, aber wären wir glücklich geworden? Vermutlich nicht, denn der nagende Zweifel wäre immer geblieben – dieser Zweifel, der gesät worden war, als er auf dem Klassentreffen seine erste große Liebe Katie wiedergetroffen hatte.
Von vorn zu beginnen und Seattle zu verlassen fühlte sich also total richtig an, zumal ich hinsichtlich des neuen Jobs zugleich eine ganz neue Zielstrebigkeit spürte. Früher war der Beruf ja für mich lediglich ein Übergangsstadium bis zur Ankunft des Traumprinzen gewesen, aber das hatte sich schlagartig geändert, seit ich meine Zukunft nicht länger als Wolkenkuckucksheim betrachtete.
Ich war wirklich bereit, offen nach vorne zu schauen.
Meine Eltern hingegen brachte mein Entschluss ziemlich aus der Fassung. Sie waren es gewohnt, mich in ihrer Nähe zu wissen. Zudem hatte meine Mutter, im Gegensatz zu mir, es nicht aufgegeben, für mich doch noch den passenden Mann zu finden. Sie stellte mich praktisch jedem unverheirateten Typen vor, den sie von der Straße zerren konnte. Es war allmählich schon regelrecht peinlich geworden. Dass ich Ehe und Familie abgehakt hatte, ignorierte sie einfach. Es war und blieb eben ihr Traum, mir die Hochzeit des Jahrhunderts auszurichten.
Nach wie vor in Gedanken versunken, stieg ich aus dem Auto, wuchtete meinen schweren Koffer aus dem Kofferraum und begann ihn zum Haus zu schleppen. Ich wollte mich so schnell wie möglich auf die Suche nach einem Haus machen. Allerdings fürchtete ich, dass es nicht so einfach sein würde, das Richtige zu finden. Generell nicht, aber bei mir kam hinzu, dass ich ziemlich wählerisch war. Und bei einer so weittragenden Entscheidung wie dem Kauf eines Hauses war das wohl kaum falsch. Immerhin suchte ich etwas, wo ich eventuell für den Rest meiner Tage zufrieden leben konnte – wie lange das auch immer sein mochte.
Die Eingangstür der Pension wurde geöffnet, und eine Frau, ein paar Jahre älter als ich, trat heraus und beobachtete mich. Ich hielt sie für einen Gast, wurde jedoch sogleich eines Besseren belehrt.
»Sie müssen Emily Gaffney sein«, begrüßte sie mich lächelnd. »Ich bin Jo Marie Rose. Willkommen.«
Das also war meine künftige Vermieterin. Nach unserem Gespräch am Telefon hatte ich sie für älter gehalten.
»Sie sind Jo Marie?«, fragte ich unsinnigerweise zurück.
»Ja.« Sie lächelte, als würde sie sich über meine Überraschung amüsieren. Dann deutete sie auf den kurzhaarigen Hund an ihrer Seite. »Und das ist Rover.«
Der Mischling setzte sich auf die Hinterbeine und musterte mich mit schief gelegtem Kopf, als würde er mich einzuschätzen versuchen. Anscheinend bestand ich den Test, denn sein Schwanz klopfte in einer Geste der Akzeptanz und der Begrüßung auf das Holz der Veranda.
»Ihr Zimmer ist fertig. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich Sie im zweiten Stock einquartiert habe«, meinte Jo Marie und bat mich herein.
Ich blieb stehen und schaute mich erst mal um. Die Halle war kleiner, als ich es bei einem Haus dieser Größe vermutet hätte, und wurde von einer breiten Treppe beherrscht, die nach oben führte. Direkt zu meiner Linken lag ein Speise- oder Frühstücksraum, in dem ungefähr zwanzig Leute Platz fanden. Außerdem gab es ein geräumiges Zimmer mit einem Kamin, das wohl ebenfalls den Gästen offen stand. Aus allen Fenstern sah man die Bucht mit der Marina und im Hintergrund die Berge. »Zweiter Stock ist optimal«, versicherte ich Jo Marie. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auf dieses Arrangement eingegangen sind.«
»Kein Problem. Sie können so lange bleiben, wie es nötig ist«, erwiderte meine Wirtin und ging voraus zu dem großzügigen Küchenbereich.
Dort holte sie einen Krug Eistee aus dem Kühlschrank, goss jedem von uns ein Glas ein und schlug vor, dass wir nach draußen auf die Veranda gingen. Es kam mir vor, als würde ich eine Freundin besuchen.
»Der Nachmittag ist so schön«, sagte sie, als wir es uns bequem machten. »Lassen Sie uns eine Weile hier sitzen und uns unterhalten und uns besser kennenlernen. Hatten Sie eine gute Fahrt? Der Verkehr auf der Brücke kann manchmal nervtötend sein.«
»Ich hatte überhaupt keine Probleme«, entgegnete ich und hielt mein Gesicht in die kühle Brise, die vom Wasser heraufwehte.
Die letzten Tage mit Packen und Wohnungsübergabe waren anstrengend gewesen, und ich musste sogar dem Drang widerstehen, die Augen zu schließen.
»Diese Pension ist ein ganz besonderer Ort«, hörte ich Jo Marie sagen.
»Ja, es ist wirklich schön hier«, stimmte ich zu, »und die Aussicht ist geradezu spektakulär.«
»Das ist sie in der Tat.« Jo Marie nickte und trank von ihrem Tee. »Aber das ist noch längst nicht alles.«
»Wie meinen Sie das?«
Sie sah mich so sanft und verständnisvoll an, als wüsste sie mehr über mich als das, was ich ihr erzählt hatte.
»Es ist schwer zu erklären«, begann sie und schien dann zu zögern. »Mit dem Haus hat es eine besondere Bewandtnis, die weit über eine tolle Lage hinausgeht …«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Nun, das Rose Harbor Inn ist gewissermaßen ein Ort der Heilung.«
»Wie bitte?«, hakte ich irritiert nach. »Sind Sie eine Art Privatsanatorium, beziehungsweise sehe ich etwa aus, als bedürfte ich irgendwelcher Heilanwendungen?«, fragte ich leicht ironisch.
»Um Gottes willen nein. Das wollte ich damit nicht andeuten. Es ist nur etwas in Ihren Augen – ein Ausdruck, der mich an eine Zeit erinnert, die für mich sehr schwierig war.«
»Oh.«
»Damals war mein Mann erst ein paar Monate tot, und ich erstickte fast an meinem Kummer.«
»Bei mir ist niemand gestorben«, gab ich rasch zurück und ließ es ziemlich definitiv klingen nach dem Motto: Keine weiteren Fragen bitte.
Ich wollte nicht unhöflich sein, doch wir hatten uns gerade erst kennengelernt, und ich war nicht bereit, mit einer praktisch Fremden Vertraulichkeiten auszutauschen. Überhaupt legte ich Wert auf meine Privatsphäre, und Geheimnisse oder unbewältigte Probleme preiszugeben, die ich mit mir herumtrug, das war schon gar nicht meine Sache.
»Ich möchte hier ein Haus kaufen«, wechselte ich das Thema.
»Ja, das sagten Sie bereits am Telefon.«
Jo Marie musste gemerkt haben, dass ich über nichts Persönliches sprechen wollte, und akzeptierte meinen abrupten Themenwechsel.
»Das ist eine nette Gegend hier«, meinte ich. »Hübscher als andere Viertel, dazu nah am Ortskern und an der Marina. Und vor allem der Schule.«
»Von hier aus kann man alles zu Fuß erreichen – unter anderem etliche Restaurants, was für meine Gäste ideal ist«, erwiderte Jo Marie. »Der einzige Nachteil, wenn Sie so wollen, ist der steile Hügel. Er macht den Rückweg aus der Stadt ziemlich beschwerlich, aber man gewöhnt sich daran. Wenn ich allerdings schwere Taschen vom Markt heraufzuschleppen habe, sehe ich das nicht so locker.«
Entspannt lächelte ich. »Wissen Sie vielleicht zufällig in der näheren Umgebung von Häusern, die zum Verkauf stehen?«
»Leider nein, doch vielleicht kann meine Freundin Dana – sie ist Maklerin – Ihnen weiterhelfen. Wonach genau suchen Sie denn?«
Ich beschrieb ihr das Haus, das ich mir im Geiste ausgemalt hatte. Geräumig und zugleich gemütlich. Hell und freundlich. Umgeben von einem Garten mit einem weißen Zaun.
»Wenn ich etwas fände, das diesem Bild annähernd entspricht, wäre ich überglücklich.«
»Das klingt wie …« Jo Marie schüttelte den Kopf, zögerte dann. »Ihre Beschreibung trifft ziemlich genau auf ein Haus zu, das drei Straßen von hier entfernt liegt. Es ist ein älteres Gebäude und wird gerade renoviert. Näheres weiß ich nicht, auch nichts über den Besitzer.«
»Haben Sie die Adresse?«
»Es liegt in der Bethel Street, die Hausnummer weiß ich nicht, aber Sie können es gar nicht verfehlen – den genauen Weg beschreibe ich Ihnen noch.«
Ich nahm mir vor, es mir bei meiner morgendlichen Joggingrunde anzuschauen.
Anschließend unterhielten wir uns ein paar Minuten darüber, wie sich mein Aufenthalt als Dauergast gestalten sollte. Wir würden abwechselnd am Abend kochen und uns die Kosten für die Lebensmittel teilen. Zum Frühstück brauchte ich nichts außer meinem Proteindrink nach dem Morgenjogging, und zum Lunch aß ich grundsätzlich bloß ein Sandwich oder einen Salat, mal zu Hause, mal auswärts. Blieb also als einzige gemeinsame Mahlzeit das Dinner. Ach ja, und ich bot an, ihr an den Wochenenden gelegentlich zur Hand zu gehen.
Jo Marie war flexibel und umgänglich, und bestimmt würden wir gut miteinander klarkommen. Es war fast so, als wäre ich wieder auf dem College und müsste mich mit einer Mitbewohnerin arrangieren.
Nachdem wir unser Gespräch beendet hatten, zeigte sie mir das Zimmer, das sie für mich reserviert hatte. Es war entzückend. Sie nannte es das Lavendelzimmer, denn die Wände waren in diesem Farbton gestrichen, und ein Fries mit weißen und lavendelblauen Blumen bildete den Abschluss. Die weiße Tagesdecke auf dem riesigen Bett war zudem mit Kissen übersät, die alle Schattierungen von Lavendel wiedergaben. Zum Garten hin gab es einen hübschen Balkon, auf dem weiße Korbmöbel standen. Ich war rundum zufrieden.
Bis auf eine kleine Störung schlief ich gut. Ungefähr um drei Uhr hörte ich Geräusche im Garten. Ich öffnete die Balkontür, trat ins Freie, um nachzuschauen, was los war, und meinte, einen Mann und einen Hund zu sehen. Wie merkwürdig war das denn? Genaueres konnte ich nicht erkennen, außer dass es sich um einen großen Hund handelte, womöglich um einen Schäferhund. Vielleicht sollte ich Jo Marie von meiner Beobachtung erzählen, überlegte ich, und kroch wieder ins Bett.
Als um sechs der Wecker klingelte, war die Sonne schon aufgegangen, und der Tag versprach wunderschön zu werden. Die App auf meinem Smartphone versprach fünfundzwanzig Grad. Perfekt, einfach perfekt, und für Juni hier oben im Nordwesten ein unverhofftes Geschenk.
Ich setzte mich im Bett auf, griff nach meinem Tagebuch und begann zu schreiben. Danach las ich eine Weile, bevor ich meinen Schlafanzug mit Shorts und ärmellosem Top vertauschte und nach unten ging.
Auf der Veranda absolvierte ich ein paar Dehnübungen und lief dann los, versuchte mein Tempo zunehmend zu steigern. Irgendwelche Medaillen würde ich nie gewinnen, aber das spielte keine Rolle. Laufen war gut für die Gesundheit und die Figur, und vor allem machte es mir Spaß. Wenn du regelmäßig Sport treiben willst, dann tu etwas, was dir Freude bereitet – dieser Rat eines Fitnesstrainers auf dem College hatte mir eingeleuchtet und sich, zumindest für mich, bewahrheitet.
Meist lief ich querfeldein, doch heute wollte ich mir zunächst das Haus ansehen, von dem Jo Marie gesprochen hatte. Es handelte sich um ein zweistöckiges Gebäude, das aus den Fünfzigern oder Sechzigern stammen mochte und aussah, als wäre lange nichts mehr daran gemacht worden. Der Verandaboden schien teilweise gebrochen zu sein, an den Hauswänden begann der Putz zu bröckeln, und der Garten war mit Unkraut überwuchert. Aber trotz dieser Schönheitsfehler fühlte ich mich von dem Haus magisch angezogen. Vielleicht weil ich mir ebenfalls vernachlässigt, nicht beachtet und ausrangiert vorkam. Außerdem spürte ich, dass dieses Haus früher einmal geliebt worden war und dass seine ursprüngliche Schönheit sich bestimmt wiederherstellen ließ.
Jemand hatte diese Aufgabe bereits in Angriff genommen, wie mir das an der Vorderseite aufgestapelte Holz sowie die Sägeböcke und allerlei andere Werkzeuge verrieten. Nach beendeter Renovierung würde das Haus genau so aussehen, wie ich es mir ausgemalt hatte. Ich hatte mein neues Heim gefunden. Vielleicht ein wenig zu groß für den Moment, für meine Zukunftspläne hingegen genau richtig.
Bloß war weit und breit kein Schild zu sehen, dass es zum Verkauf angeboten wurde.
Ich würde fragen müssen – irgendwer in einem so kleinen Ort wie Cedar Cove wusste sicher Bescheid. Jedenfalls schien es unbewohnt zu sein, und so beschloss ich, den riesigen Obstgarten zu erkunden, in dem ungefähr fünfzig Bäume standen und durch den sich ein zugewachsener Weg schlängelte, dem ich jetzt folgte. An etlichen Bäumen hingen bereits knospende Früchte, die Bilder von Gläsern mit Apfelbutter, Pflaumengelee und eingemachten Birnen heraufbeschworen.
Als ich den Obstgarten zur Hälfte durchquert hatte, hörte ich hinter mir ein lautes Knurren. Mein Herz begann augenblicklich panisch zu rasen. Vorsichtig drehte ich mich um und entdeckte einen großen Schäferhund, der keinen Meter von mir entfernt drohend die Zähne fletschte. Eindeutig ein Wachhund, der bei der geringsten Provokation angreifen würde. Vermutlich war er sogar abgerichtet.
»Hallo, mein Junge«, sagte ich leise, während ich tausend Ängste ausstand, der Hund könnte mir bei der ersten abrupten Bewegung ein Stück aus dem Bein herausbeißen. Ein Besitzer, der mir hätte zu Hilfe eilen können, war weit und breit nicht in Sicht.
Also versuchte ich es weiter im Guten.
»Hör zu, ich bin ganz harmlos«, murmelte ich mit gedämpfter Stimme, damit er nicht auf die Idee kam, mir an die Kehle zu gehen. »Bist du auch harmlos? Du siehst aus, als könntest du ein freundlicher Hund sein.«
Ich hasste es, dass meine Stimme zitterte. Manche Tiere witterten Angst, und ich wusste nicht, ob es mir wirklich gelang, das zu überspielen.
Schwer zu erklären, was als Nächstes passierte.
Irgendwie schien der Hund zu spüren, dass von mir keine Bedrohung ausging, hielt meinem Blick stand und tat dann etwas vollkommen Unerwartetes. Er wedelte mit dem Schwanz.
Abgrundtiefe Erleichterung durchströmte mich, und ich merkte, wie ich mich entspannte. Mutig geworden, ließ ich mich auf ein Knie nieder und streckte den Arm aus, um behutsam seinen Kopf zu streicheln. Er trug ein Halsband mit einer silbernen Marke, auf der sein Name eingraviert war. Elvis.
»Du bist also ein Love me tender-Hund, wie?«, scherzte ich und tätschelte ihn erneut. »Schade, dass du mir nichts über dieses Haus und die Leute sagen kannst, die hier wohnen«, fügte ich seufzend hinzu und erhob mich wieder.
Half nichts. Ich würde selbst Nachforschungen anstellen müssen, dachte ich und setzte mit diesem Vorsatz meine Laufrunde fort.
Jo Marie war in der Küche beschäftigt, als ich zurückkam.
»Haben Sie ausgiebig trainiert?«, erkundigte sie sich und schob ein Blech mit Plätzchen in den Ofen.
»Allerdings.« Ich nahm eine Flasche kaltes Wasser aus dem Kühlschrank, öffnete sie und trank einen großen Schluck. »Ich war bei dem Haus, das Sie gestern erwähnt haben.«
»Und was meinen Sie?«
»Es hat mir sehr gefallen. Leider war niemand da, der mir hätte verraten können, ob es überhaupt zum Verkauf steht. Ich versuche es morgen noch mal, heute Nachmittag muss ich zu einer Besprechung mit dem Schuldirektor.«
»Dana, die Immobilienmaklerin, von der ich gesprochen habe, wohnt ganz in der Nähe. Ich treffe sie später im Fitnessstudio und werde sie fragen, wenn Sie möchten.«
»Bitte tun Sie das.«
Ich ließ Jo Marie allein und joggte die Stufen hoch, um zu duschen. Noch war ich keine vierundzwanzig Stunden in Cedar Cove und fühlte mich bereits wie zu Hause.
4
Jo Marie
Emily wohnte erst seit einer knappen Woche bei mir, und trotzdem hatte sich schon eine gewisse Alltagsroutine entwickelt. Wir standen ungefähr zur selben Zeit auf, und während ich das Frühstück für meine Gäste vorbereitete, drehte sie ihre morgendliche Runde. Meist kam sie zurück, wenn ich die Tische abräumte, und mixte sich dann in der Küche ihren Proteindrink. Ich bewunderte ihre gesunden Essgewohnheiten uneingeschränkt – ich selbst brachte so viel Konsequenz nämlich nicht auf.
Über das Haus, an dem Emily so viel lag, wussten wir nach wie vor nichts. Erstaunlicherweise hatte selbst Dana nicht weiterhelfen können, wollte sich aber erkundigen. Da Emilys Besessenheit mich neugierig gemacht hatte, beschloss ich, mir das Objekt beim nächsten Spaziergang mit Rover selbst einmal anzuschauen, vermochte ihre Begeisterung jedoch nicht zu teilen. Ich fand es einfach ziemlich heruntergekommen.
Ich wollte mich gerade zum Gehen wenden, als ein Schäferhund zum Zaun geschossen kam und wild knurrte und bellte. Natürlich kläffte Rover erbost zurück. Es schien ihn zu kränken, so schäbig behandelt zu werden, und ich konnte es ihm nicht verdenken. Zum Glück hatten wir nicht versucht, das Grundstück zu betreten.
Seit Emily bei mir wohnte, liebte ich besonders die Abende. Wir wechselten uns mit der Zubereitung des Dinners ab, und ich genoss es, auch mal bekocht zu werden, zumal meine Mitbewohnerin sich als ausgezeichnete Köchin entpuppte. Sie verwendete nur frische Zutaten und lehnte industriell verarbeitete Lebensmittel kategorisch ab. Was ich eigentlich ebenfalls tat, bloß nicht mit solcher Absolutheit. Manchmal war es eben praktischer, schnell eine Tiefkühlmahlzeit in die Mikrowelle zu stecken. Besonders wenn man bloß für sich alleine kochte.
Nach dem Essen saßen wir meist auf der Veranda, blickten über die Bucht hinweg und hingen schweigend unseren Gedanken nach. Wie immer kreisten meine fast ausschließlich um Mark. Meine heldenhaften Versuche, ihn mir aus dem Kopf zu schlagen, waren endgültig seit dem Eintreffen dieser Postkarte gescheitert. Das Datum war Wochen alt gewesen, und die Nachricht hatte ziemlich kryptisch geklungen. Deshalb rätselte ich unentwegt, was er mir mitteilen wollte. Dass einer von ihnen verletzt war? Oder was sollte das sonst mit dem beschädigten Koffer, der sich auf dem Rücktransport befand?
»Wenn ich nur wüsste, wo Mark ist.«
»Mark?« Emily drehte sich zu mir um und musterte mich neugierig. »Wer ist Mark?«
Ich hatte nicht gemerkt, dass ich laut gesprochen hatte.
»Sorry …« Es war mir peinlich, so aus heiterem Himmel mit seinem Namen herauszuplatzen. »Ein Freund«, erwiderte ich und empfand im selben Moment das Bedürfnis, mich zu korrigieren. »Na ja, eigentlich ist er mehr als ein Freund.«
»Er ist nicht hier?«
»Nein, derzeit befindet er sich im Irak«, antwortete ich ohne nähere Erklärung.
»Ein Soldat also?«
»Das war er früher. Er ist zurückgegangen, um einen Freund zu suchen, einen Iraker, der als Informant für die Army gearbeitet hat. Marks Einheit wurde abgezogen und …« Ich hielt inne, als mir klar wurde, dass ich viel mehr Informationen preisgab, als nötig war. »Entschuldige, ich wollte das nicht alles bei dir abladen.« Inzwischen waren wir vom Sie zum Du gewechselt.
»Nein, bitte, ich würde gerne hören, was passiert ist.«
Also erzählte ich ihr die Geschichte, beschränkte mich allerdings auf die wesentlichen Fakten.
»Liebst du ihn?«, erkundigte sie sich.
Emily hatte eindeutig kein Problem damit, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Es verblüffte mich, dass eine Frau, die mich kaum kannte, so mühelos meine Gefühle zu deuten vermochte.
»Ja, mir liegt viel an ihm – sehr, sehr viel. Er ist seit fast einem Jahr fort. Ein Jahr«, wiederholte ich mit brechender Stimme.
Das längste Jahr meines Lebens. So lange hatte selbst die Zeit der Ungewissheit über Pauls Schicksal nicht gedauert.
»Ich weiß nicht einmal, ob Mark überhaupt noch am Leben ist«, fuhr ich fort. »Kurz bevor du gekommen bist, erhielt ich eine Postkarte, die erst keinen Sinn ergab und bei längerem Nachdenken dann doch. Trotzdem weiß ich nicht, was ich denken soll.«
»Was stand auf der Karte?«
Ich wiederholte es wortwörtlich – die wenigen kurzen Zeilen hatte ich mir eingeprägt.
»Verlorener Koffer okay, meiner dagegen stark beschädigt. Ist auf dem Weg nach Hause«, wiederholte Emily und nippte an ihrem Kaffee, wobei sie den Becher mit beiden Händen festhielt. »In seiner Handschrift?«
»Ja, ich denke schon. Allerdings war sie ziemlich krakelig, als hätte er sie geschrieben, während sie in einem Wagen über eine holperige Straße fuhren.«
»Oder weil er schwach war«, murmelte Emily und sah mich eindringlich an.
»Oder weil er schwach war«, echote ich und schloss deprimiert die Augen. Ich war davon ausgegangen, dass sich das beschädigte Gepäck auf Ibrahim und Shatha bezog, nicht auf Mark selbst. Wie hatte ich so blind sein können? »Mark ist gemeint«, flüsterte ich jetzt. »Er ist derjenige, der verletzt ist.«
Mit einem Mal kam es mir vor, als würde ein Betonblock auf meine Brust gepresst, der mich zu zerquetschen drohte.
»Es ist lediglich ein Verdacht, mehr nicht. Vielleicht war es auch so, wie du vermutet hast«, versuchte Emily mich zu beruhigen, die meine Angst zu spüren schien.