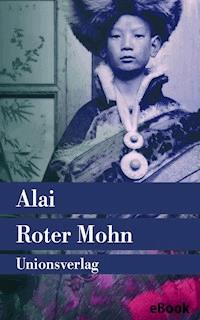
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder weiß, dass der zweite Sohn des Fürsten Maichi ein Idiot ist. Als Thronfolger wird er nie zum Zug kommen. Umso unvoreingenommener beobachtet er seine Umgebung: die Festung des Fürsten im äußersten Osten Tibets, die in kleinliche Streitereien verwickelten Lamas, die Intrigen um schöne Frauen, die Fehden mit benachbarten Herrschern und die wechselnden Allianzen mit den Chinesen. In das entlegene Hochland dringt die Moderne lediglich als fernes Echo. Einzig der Idiot erkennt, dass sich das Ende einer Ära abzeichnet. Zunächst von vielen chinesischen Verlagen wegen der heiklen politischen Thematik abgelehnt, wurde Roter Mohn ein Bestseller und 2000 mit dem wichtigsten chinesischen Literaturpreis, dem Mao-Dun-Preis, ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Jeder weiß, dass der zweite Sohn des Fürsten Maichi ein Idiot ist. Als Thronfolger wird er nie zum Zug kommen. Umso unvoreingenommener beobachtet er seine Umgebung. In das entlegene Hochland Tibets dringt die Moderne lediglich als fernes Echo. Einzig der Idiot erkennt, dass sich das Ende einer Ära abzeichnet.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Alai (*1959) begann Anfang der 1980er-Jahre, Gedichte und Erzählungen zu veröffentlichen. Sein erster Roman Roter Mohn wurde ein sensationeller Erfolg.
Zur Webseite von Alai.
Karin Hasselblatt (*1963) studierte Chinesisch und Japanisch an den Universitäten in Berlin und Bonn. U. a. übersetzte sie Werke von Yiao Hong, Wan Anyi, Mo Yan und Wei Hui. Sie arbeitet als freie Übersetzerin und Lektorin.
Zur Webseite von Karin Hasselblatt.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Alai
Roter Mohn
Roman
Aus dem Chinesischen von Karin Hasselblatt
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel Chen’ai luoding bei Renming wenxue chubanshe (Literaturverlag des Volkes) in Peking.
Die Übersetzung aus dem Chinesischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: Chen’ai luoding (1998)
© by Alai 1998
Die Übersetzungsrechte wurden durch die Sandra Dijkstra Literary Agency vermittelt.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Harvard College Library
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30178-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 21:57h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ROTER MOHN
Erstes Kapitel1 — Wilde Singdrosseln2 — »Sharü«3 — Sangye Dolma4 — Der EhrengastZweites Kapitel5 — Blumen im Herzen6 — Töten7 — Die Erde schwanktDrittes Kapitel8 — Weißer Traum9 — Krankheiten10 — Die neue Gelugpa-Sekte11 — SilberViertes Kapitel12 — Gäste13 — Frauen14 — Köpfe15 — Das verlorene Medikament16 — Ohrenblüte17 — Der MohnblütenkriegFünftes Kapitel18 — Die Zunge19 — Bücher20 — Was habe ich zu fürchten?21 — Der Intelligente und der Idiot22 — Die englische DameSechstes Kapitel23 — Forts24 — Weizen25 — Fürstinnen26 — DolmaSiebtes Kapitel27 — Schicksal und Liebe28 — Verlobung29 — Es geht los30 — Neue UntertanenAchtes Kapitel31 — Grenzmarkt32 — Nachrichten aus dem Süden33 — Familienfehde34 — HeimkehrNeuntes Kapitel35 — Wunder36 — Der Fürst dankt ab37 — Ich schweigeZehntes Kapitel38 — Der Mörder39 — Richtung Norden40 — Ein weit gereister Gast41 — Schnell und langsamElftes Kapitel42 — Über die Zukunft43 — Sie werden alt44 — Die Fürsten45 — SyphilisZwölftes Kapitel46 — Farbige Menschen47 — Toiletten48 — Kanonendonner49 — Festung im StaubDankWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Alai
Über Karin Hasselblatt
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Alai
Zum Thema China
Zum Thema Tibet
Zum Thema Asien
Zum Thema Berge
Erstes Kapitel
1
Wilde Singdrosseln
Es war ein schneebedeckter Morgen. Ich lag im Bett und lauschte dem Singen wilder Drosseln vor dem Fenster, während Mutter sich in einer kupfernen Schale wusch. Sie tauchte ihre hellen, schlanken Hände in die warme Kuhmilch und atmete tief durch, als strengte es sie an, sich die Haut zu verschönern. Dann schnippte sie mit den Fingern gegen den Rand der Schüssel, sodass die Milch sich kräuselte und das Echo im Raum widerhallte. Anschließend rief sie nach Sangye Dolma.
Die Dienerin Sangye Dolma trat mit einer weiteren Kupferschüssel ein. Sie stellte die Schale mit Milch auf den Boden. »Komm her, Dordor«, rief Mutter weich. Es knarrte und knackte, als sich ein kleiner Hund unter dem Schrank hervorwand, einen Purzelbaum schlug und seiner Herrin zuwedelte, bevor er den Kopf in die Milchschale steckte. Die Frau des Fürsten liebte das Geräusch, mit dem jemand von dem bisschen Liebe fast erstickte, das sie spendete. Sie lauschte dem atemlosen Schlecken des kleinen Hundes und wusch sich dabei die Hände in klarem Wasser. Zugleich bat sie die Dienerin Dolma nachzusehen, ob ihr Sohn bereits aufgewacht sei. Da ich gestern Fieber hatte, war meine Mutter die Nacht über in meinem Zimmer geblieben. Ich sagte: »Ama, ich bin wach.«
Sie kam an mein Bett und legte mir ihre feuchte Hand auf die Stirn: »Das Fieber ist gesunken.«
Dann trat sie zur Seite, um ihre sauberen Hände zu betrachten, auf denen gleichwohl die Spuren des Alters nicht zu übersehen waren. Das tat sie jedes Mal, wenn sie sich gewaschen und gekämmt hatte. Nun, da ihre Morgentoilette beendet war, untersuchte sie wiederum ihre Hände nach Zeichen, die die Jahre darauf hinterlassen hatten, und wartete zugleich darauf, dass die Dienerin das Wasser draußen auskippte. Immer war es ein Warten voller Angst und Unruhe. Bei dem berstenden Geräusch, mit dem das Wasser aus der Schüssel über vier Stockwerke auf den Steinfußboden unten klatschte, verkrampfte ihr Körper regelrecht. Es klang schaurig wie das Geräusch zersplitternder Knochen.
Heute jedoch verschluckte tiefer Schnee das Geräusch. Dennoch schrak Mutter zusammen, als hätte es ertönen müssen. Ich hörte den schönen Mund der Dienerin Dolma murmeln: Und wieder ist nicht die Herrin selbst in die Tiefe gestürzt.
»Wie bitte?«, fragte ich.
»Was sagt das kleine Trampeltier?«, fragte Mutter.
Ich antwortete: »Sie sagt, sie habe Magenschmerzen.«
»Wirklich?«, fragte Mutter Dolma.
Ich antwortete an ihrer Stelle: »Es geht schon wieder.«
Mutter öffnete eine Zinndose, nahm mit einem ihrer grazilen Finger Fett heraus und strich es sich auf das Handgelenk, dann cremte sie mit einem Finger der anderen Hand den Rücken der ersten Hand ein. Im Nu breitete sich ein beißender Geruch im Zimmer aus. Diese Hautcreme war aus Murmeltieröl, der Bauchspeicheldrüse von Schweinen und einem geheimnisvollen, im Tempel geweihten indischen Duftstoff gemischt. Die Frau des Fürsten, meine Mutter, kann eine ausgesucht angewiderte Miene aufsetzen. »Das Zeug stinkt entsetzlich«, meinte sie säuerlich.
Sangye Dolma reichte ihr mit beiden Händen ein feines Kästchen, in dem sich der Jadereif für den linken Arm der Frau des Fürsten befand und der elfenbeinerne für den rechten Arm. Mutter legte beide an und drehte sie an ihren Handgelenken. »Ich habe schon wieder abgenommen.«
»Ja«, erwiderte die Dienerin.
Mutter fragte: »Kannst du außer diesem Wort noch etwas sagen?«
»Ja, Herrin.«
Ich erwartete, dass die Frau des Fürsten ihr eine Ohrfeige geben würde, doch das tat sie nicht. Dennoch lief die Wange der Dienerin aus Angst rot an.
Die Frau des Fürsten ging hinunter, um zu frühstücken. Dolma blieb neben meinem Bett stehen, lauschte auf die Schritte, die sich auf der Treppe entfernten, kniff mich unter der Bettdecke und fragte: »Wann habe ich etwas von Bauchschmerzen gesagt? Wann soll ich Bauchschmerzen gehabt haben?«
Ich sagte: »Du hattest keine Bauchschmerzen, aber du hast vor, das Wasser beim nächsten Mal noch wütender auszuschütten.«
Der Satz verfehlte seine Wirkung nicht. Ich reckte meinen Hals, und sie küsste mich. Dann sagte sie: »Wage nicht, der Herrin davon zu erzählen.« Ich streckte meine Hände aus und spürte ihre Brüste wie zwei scheue, kleine Kaninchen. Durch meinen Körper – oder war es mein Kopf? – ging ein Beben. Dolma befreite sich aus meinen Händen und wiederholte: »Wage nicht, der Herrin davon zu erzählen.«
An diesem Morgen spürte ich zum ersten Mal die freudige Erregung, mit der der Körper einer Frau mich erfüllte. Sangye Dolma schimpfte: »Idiot!«
Ich rieb mir die verklebten Augen und fragte: »Also wirklich, wer ist hier ein Idiot … Idiot?«
»Vollidiot!«
Sie half mir nicht beim Ankleiden, sondern ließ mich mit einem roten Fleck am Arm wie vom Picken eines Vogels sitzen und ging fort. Der Schmerz war neu und aufregend.
Wie blendend der Schnee vor dem Fenster leuchtete! Draußen rannten die Bälger der Leibeigenen herum und jagten den Drosseln hinterher. Ich lag immer noch im Bett zwischen Bärenfellen und Seide und hörte unsere Dienerin über den langen Flur gehen – es schien, als wolle sie sich tatsächlich nicht mehr um mich kümmern. Also stieß ich mit einem Fuß die Decke zur Seite und begann laut zu rufen.
Im Territorium des Fürsten Maichi weiß jeder, dass der Sohn seiner zweiten Ehefrau ein Idiot ist. Dieser Idiot bin ich.
Außer meiner leiblichen Mutter mochten mich alle so, wie ich war. Als intelligenter Junge, wer weiß, wäre ich vielleicht längst ins Jenseits eingegangen, statt hier zu sitzen und bei einer Tasse Tee meinen Gedanken nachzuhängen. Die erste Frau des Fürsten ist an einer Krankheit gestorben. Meine Mutter war von einem Fell- und Medizinhändler gekauft und dem Fürsten geschenkt worden. Der Fürst zeugte mich in ziemlich besoffenem Zustand, sodass ich wohl oder übel als fröhlicher Idiot durchs Leben gehe.
Dennoch gibt es im Umkreis von hunderten von Kilometern niemanden, der mich nicht kennt, was allein daran liegt, dass ich der Sohn des Fürsten bin. Wenn Sie mir nicht glauben, dann spielen Sie doch mal einen Knecht oder den Sohn einfacher Leute und sehen Sie, ob man Sie kennt oder nicht.
Ich bin ein Idiot.
Mein Vater war ein Fürst, der im Auftrag des Kaisers über zehntausende von Menschen regierte.
Darum brach ich in lautes Geheule aus, als die Dienerin nicht kam, um mich anzukleiden.
Wenn die Dienerschaft sich verspätete, musste ich nur ein Bein ausstrecken, um die Seidendecke wie Wasser zu Boden fließen zu lassen. Die chinesischen Seidenstoffe, die von weit jenseits der Berge kommen, sind unglaublich geschmeidig und weich. Seit meiner Kindheit habe ich nie begriffen, warum das Land der Chinesen nicht nur die Quelle der von uns so dringend benötigten Dinge wie Seide, Tee und Salz ist, sondern auch die Quelle der Macht unserer Stammesfürsten. Manche sagten, es liege am Klima. Darauf antwortete ich: »Ach, das Wetter?« Aber ich glaube, das ist bestimmt nicht der einzige Grund. Denn wenn es so wäre, warum hat das Wetter dann mich nicht verändert? Soweit ich weiß, gibt es überall Wetter. Es gibt Nebel und Wind, und wenn der Wind warm wird, verwandelt sich Schnee in Regen. Bei kaltem Wind verwandelt sich Regen wiederum in Schnee. Wetter verwandelt alle Dinge, doch wenn du diesen Wandel beobachtest und dabei zwinkerst, verwandelt sich im selben Augenblick alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Andererseits kann niemand niemals zwinkern! Es ist wie beim Darbringen von Opfern. Wenn die Gottheiten, in Rauchschwaden eingehüllt, ihre leuchtend roten Lippen in den goldenen Gesichtern öffnen wollen, um zu lachen oder zu weinen, wird vor dem Tempel mit Sicherheit lautes Trommelschlagen ertönen und dich vor Schreck am ganzen Körper erzittern lassen. Im selben Moment werden die Gottheiten ihre Miene ändern und wieder so ausdruckslos und ernst blicken wie ehedem.
An jenem Morgen schneite es, der erste Schnee in diesem Frühjahr. Nur Frühjahrsschnee fällt so schwer und feucht, dass er nicht sofort wieder vom Wind fortgeblasen wird, nur Frühjahrsschnee bedeckt die Erde so weit und breit, dass er das Licht der ganzen Welt auf sich zu sammeln scheint.
Der Schneeglanz der ganzen Welt sammelte sich auf der Seidendecke meines Bettes. Ich hatte große Angst, dass die Seide zusammen mit dem Licht sich verflüchtigen könnte, und die Trauer eines schweren Abschieds stieg plötzlich in mir hoch. Die Lichtstrahlen stachen mir wie eine Ahle mitten ins Herz, sodass ich laut zu weinen anfing und meine Amme Dechen Motso von draußen hereingestolpert kam. Sie war überhaupt noch nicht alt, tat aber gerne so, als wäre sie es. Sie wurde meine Amme, weil ihr erstes Kind kurz nach der Geburt gestorben war. Ich war damals drei Monate alt, und meine Mutter wartete ungeduldig auf ein Anzeichen in meinem Gesicht, mit dem ich zeigte, dass ich wusste, wer und wo ich war.
Mit einem Monat hatte ich beschlossen, nicht zu lachen. Als ich zwei Monate alt war, schaffte es niemand, mir durch Zurufen und Ansprechen eine Reaktion zu entlocken, und sei es in den Augen.
Mein Vater, der Fürst, befahl seinem Sohn in seinem üblichen Befehlston: »Los, lachen!« Als er keine Reaktion sah, schlug er einen weicheren Ton an und sagte ernst: »Lächle einmal, lächle, hörst du?« In diesem Augenblick sah er wirklich lächerlich aus, und als ich den Mund verzog, tropfte Speichel herunter. Meine Mutter wandte sich weinend ab, als sie sich daran erinnerte, dass mein Vater in der Nacht meiner Empfängnis genauso ausgesehen hatte. Von diesem Augenblick an hatte sie keine Milch mehr. Sie sagte: »Lassen wir das Kind einfach verhungern.«
Nicht sonderlich betroffen, schickte mein Vater den Verwalter mit zehn Silbermünzen und einer Packung Tee zu Dechen Motso, deren Sohn gerade gestorben war. Von dem Geld sollte sie den Mönchen etwas spenden, damit sie eine Zeremonie für das tote Kind vollzögen. Der Verwalter führte den Befehl aus, ging am Morgen fort und brachte am Nachmittag die Amme mit zurück. Als die Hunde am Tor wie verrückt bellten und tobten, sagte der Verwalter zu ihr: »Hilf ihnen, deinen Duft zu erkennen.«
Die Amme holte ein Brot hervor, brach es in Stücke und spuckte auf jedes Teil, bevor sie es den Hunden zuwarf. Sie hörten sofort auf zu bellen und sprangen in die Luft, um das Brot im Flug aufzufangen. Anschließend kamen sie zur Amme gelaufen, hoben ihren Rock mit der Schnauze hoch und rochen an ihren Füßen und Beinen, um sich zu vergewissern, dass der Geruch derselbe war wie der auf dem Brot. Dann erst begannen sie, mit den Schwänzen zu wedeln. Während die Hunde das Brot kauten, führte der Verwalter die Amme zum Tor hinein.
Der Fürst war sehr zufrieden. Zwar stand der Amme die Trauer noch ins Gesicht geschrieben, doch hatte sie so viel Milch, dass sie ihre Kleider durchfeuchtete.
In diesem Augenblick begann ich herzzerreißend zu weinen. Die Frau des Fürsten hatte keine Milch mehr und versuchte immer noch, mit ihren leeren Brüsten dem idiotischen Sohn den Mund zu stopfen. Mein Vater stampfte mit seinem Stock hörbar auf den Boden und sagte: »Weine nicht, nun hast du eine Amme.« Als hätte ich verstanden, hörte ich auf zu weinen. Die Amme nahm mich aus den Armen meiner Mutter entgegen, und ich fand ihre vollen Brüste auf Anhieb. Ihre Milch sprudelte wie aus einer Quelle, warm und süß. Ich schmeckte einen Hauch von Schmerz sowie den Duft wilder Blumen und Gräser weiter Ebenen. Die Milch meiner Mutter dagegen war wie ein Bündel farbenfroher Gedanken, die mein kleines Hirn zum Bersten füllten.
Mein Magen war bald bis zum Rand gefüllt, und als Ausdruck meiner Zufriedenheit entleerte ich meine Blase in den Armen der Amme. Als ich ihre Brust freigab, wandte sie den Kopf zur Seite und weinte. Es war noch nicht lange her, dass die Lamas für ihren kleinen Sohn die Totengebete gelesen, ihn in Rinderfelle gelegt und am Grunde eines tiefen Sees bestattet hatten. »Was für ein Unglück!«, sagte Mutter.
Die Amme antwortete: »Herrin, verzeiht mir dieses eine Mal, ich konnte nicht an mich halten.« Mutter befahl ihr, sich selbst zu ohrfeigen.
Inzwischen war ich dreizehn. In all diesen Jahren hatten meine Amme und die anderen Bediensteten tiefen Einblick in die Geheimnisse der Fürstenfamilie gewonnen und waren längst nicht mehr so gehorsam wie früher. Auch meine Amme hielt mich für blöd und sagte oft in meiner Gegenwart: »Herren, ha! Diener, ha!« Damit stopfte sie sich etwas, das sie gerade zur Hand hatte, in den Mund – etwas Deckenfüllung aus Schafwolle oder die Seidenfäden eines Kleidungsstücks – und spuckte es mit viel Speichel gegen die Wand. Seit ein, zwei Jahren schaffte sie jedoch keinen so hohen Bogen mehr. Darum spielt sie jetzt einfach eine alte Frau. Als ich nun laut zu schreien und zu weinen anfing, kam sie hastig herbeigehumpelt: »Bitte, Junger Herr, lassen Sie das nicht die Herrin hören.«
Dabei weinte ich, weil es mir Spaß machte. »Junger Herr, es schneit!«, sagte die Amme. Was hat der Schnee mit mir zu tun? Aber ich hörte auf zu weinen. Vom Bett aus wirkte das kleine Fenster wie ein Bilderrahmen um den atemberaubend blauen Himmel. Als sie mich hochhob, um mir den Schnee zu zeigen, der schwer auf das Geäst der Bäume drückte, wollte ich wieder anfangen zu weinen.
»Schau, auch die Drosseln kommen aus den Bergen«, sagte die Amme eilig.
»Wirklich?«
»Ja, sie kommen. Hör nur, sie rufen euch Kinder zum Spiel.« Daraufhin ließ ich mich brav anziehen.
Himmel, nun bin ich endlich bei den Drosseln angelangt – du meine Güte, sehen Sie nur den Schweiß auf meiner Stirn. In unserer Gegend hier gibt es nur Wilddrosseln, und wenn es bedeckt ist, weiß niemand, wo sie stecken. Sobald es aber aufklart, kommen sie geflogen und lassen ihren hellen, wohlklingenden Gesang hören. Singdrosseln können nicht gut fliegen, sie gleiten mehr von den Höhen herunter, und in sehr tief gelegenen Gegenden sieht man sie selten. Doch sobald es schneit, ändert sich das, dann finden sie in den Höhen, in denen sie leben, nichts mehr zu fressen und müssen in von Menschen bewohnte Gegenden herunterkommen.
Der Schnee zwingt sie, die Berge zu verlassen.
Als ich mit Mutter beim Frühstück saß, kamen ununterbrochen Leute mit einem Anliegen herein. Als Erster fragte der hinkende Verwalter, ob der Junge Herr nicht lieber warme Stiefel anziehen solle, um im Schnee zu spielen, und wenn der Herr im Haus sei, plädiere er dafür, dass ich die Schuhe wechselte. Mutter antwortete: »Verschwinde, du Krüppel, häng dir die Stiefel um den Hals und verschwinde!« Der Verwalter ging hinaus, ohne sich jedoch die Stiefel um den Hals zu hängen und ohne zu »verschwinden«.
Einen Augenblick später kam er zurückgehumpelt und berichtete, dass die Leprakranke, die man aus der Festung in die Berge gejagt hatte, im Schnee nichts mehr zu essen gefunden und sich an den Abstieg gemacht habe.
Mutter fragte hastig: »Wo ist sie jetzt?«
»Sie ist auf halbem Weg in eine Wildschweinfalle getappt.«
»Kommt sie da wieder heraus?«
»Auf keinen Fall, sie ruft jetzt laut um Hilfe.«
»Dann begrabt sie eben!«
»Lebend?«
»Das ist mir egal. Jedenfalls darf eine Leprakranke auf keinen Fall unser Dorf betreten.«
Danach ging es ans Almosenspenden für den Tempel und ans Verteilen von Saatgut an die Leute, die unser Land bestellten. Im Messingbecken brannte ein Holzkohlenfeuer, und ich war nach kurzer Zeit schweißüberströmt.
Nachdem sie die offiziellen Angelegenheiten erledigt hatte, verschwand normalerweise der müde, erschöpfte Ausdruck vom Gesicht meiner Mutter. Sie schien von innen zu leuchten, als sei ein Licht in ihr entzündet worden. Ich starrte so gebannt in ihr strahlendes Gesicht, dass ich ihre Frage nicht hörte. Das machte sie wütend, und sie wiederholte mit lauter Stimme: »Was, sagtest du, willst du?«
»Die Drosseln rufen nach mir«, antwortete ich.
Da verlor die Frau des Fürsten die Nerven und stampfte wütend hinaus. Ich schlürfte langsam meinen Tee und nahm dabei ganz die Haltung eines wahren Aristokraten ein. Bei der zweiten Tasse Tee hörte ich aus der Heiligen Halle in der oberen Etage Glocken und Trommeln und wusste, dass die Frau des Fürsten für den Lebensunterhalt der Mönche sorgte. Wäre ich kein Idiot, hätte ich meine Mutter nicht ausgerechnet jetzt so enttäuscht. In den letzten Tagen kostete sie die Rechte des Fürsten so richtig aus. Vater war mit meinem älteren Bruder in die Provinzhauptstadt gegangen, um den Nachbarfürsten Wangpo anzuklagen. Mein Vater hatte kürzlich geträumt, dieser habe einen Korallenstein an sich genommen, der aus meines Vaters Ring gefallen war. Ein Lama sagte, das sei kein guter Traum. Und richtig, kurz darauf betrog uns ein Führer an der Grenze, indem er mit zehn seiner Diener auf das Gebiet von Fürst Wangpo überlief. Als mein Vater Leute mit kostbaren Geschenken hinüberschickte, wurde ihnen die Auslösung der Diener verweigert. Die nächste Delegation führte Goldgeschenke mit sich und bot an, nur den Kopf des Verräters zurückzukaufen und die übrigen Leute sowie das Land dem Fürsten Wangpo zu schenken. Das Gold wurde zurückgeschickt. Dazu kam die Nachricht, wenn Fürst Wangpo einen seiner verdienstvollen Männer umbrächte, würden seine Untergebenen genauso in alle Richtungen davonlaufen wie die von Fürst Maichi.
Nun sah Fürst Maichi keinen anderen Ausweg mehr. Einer Truhe mit Einlegarbeiten aus Silber und Perlen entnahm er ein offizielles, hohes Siegel aus der Qing-Dynastie sowie eine Landkarte und ging damit zur Militärregierung der Provinz Sichuan, die unter der Kontrolle der Republik China stand. Er wollte sich beschweren.
Die Familie Maichi bestand außer mir und meiner Mutter, außer meinem Vater und meinem älteren Halbbruder, der von einer anderen Frau war, noch aus meiner älteren Halbschwester und einem Onkel, der Kaufmann war. Diese beiden lebten in Indien, und später ging meine Schwester in das noch viel weiter entfernte England. Es hieß, das sei ein riesiges Land, und alle sagten, die Sonne gehe dort niemals unter. Ich fragte Vater, ob in großen Ländern immer Tag sei?
Vater lachte: »Kleiner Dummkopf.«
Nun waren sie fortgegangen, und ich war sehr einsam. Deshalb sagte ich: »Die Singdrosseln.«
Damit ging ich die Treppe hinunter. Unten angekommen wurde ich sogleich von den Kindern der Dienerschaft umringt. Vater und Mutter sagten oft zu mir: »Schau, sie sind deine Haustiere.« Ich hatte meinen Fuß kaum auf die Steinplatten im kleinen Innenhof gesetzt, da kamen meine zukünftigen Haustiere schon angelaufen. Sie trugen weder Stiefel noch Lederkleidung und schienen dennoch nicht mehr zu frieren als ich. Sie warteten auf meine Befehle. »Wir gehen Drosseln jagen«, entschied ich.
Ihre Gesichter begannen rot zu glühen.
Ich schwenkte die Arme, stieß einen Schrei aus und rannte mit einer Horde Jungtiere im Gefolge zum Tor hinaus. Damit schreckten wir die Wachhunde auf, die wild zu bellen anfingen und so die freudig erwartungsvolle Stimmung des Morgens noch verstärkten. Was für ein Schnee! Das Land war strahlend weiß und schier unendlich weit. Meine Diener fielen in den aufgeregten Lärm ein. Sie traten den Schnee mit nackten Füßen von sich und sammelten die Taschen voll kalt überfrorener Steine. Die Drosseln reckten ihre dunkelgelben Schwänze hoch in die Luft und hüpften hin und her, um am Fuß der Mauer, wo weniger Schnee lag, etwas zu fressen zu finden.
»Los!«, brüllte ich.
Meine kleinen Diener und ich begannen, hinter den Vögeln herzurennen. Da sie nicht in der Lage sind, besonders hoch zu fliegen, suchten sie hastig Zuflucht im Obstgarten beim Fluss. Wir schlitterten und stolperten durch den knöcheltiefen Schnee den Hügel hinunter. Die Vögel wurden einer nach dem anderen von den Steinen erschlagen. Ihre Körper krümmten sich, und die Köpfe hingen schlaff im tiefen Schnee. Die das Glück hatten, zu überleben, retteten ihren Kopf auf Kosten des Schwanzes und hockten zwischen Steinen und Baumwurzeln, bevor sie uns dann doch in die Hände fielen.
Das waren die Kämpfe, die ich in meiner Kindheit anführte, erfolgreich und vollkommen.
Ich schickte einige meiner Diener nach Hause, um Feuer zu holen, andere ließ ich auf Apfel- und Birnbäume klettern, von denen sie trockene Zweige und Äste abbrachen, während der Mutigste von allen sogar in die Küche ging, um Salz zu stehlen. Die übrigen schließlich blieben zurück, um Schnee zu fegen, denn wir brauchten einen freien Platz, um Feuer darauf zu machen und uns mit einem Dutzend Kumpels darum zu versammeln. Sonam Tserang, der Salzdieb, war so etwas wie meine rechte Hand. Er war am schnellsten und kam als Erster zurück. Ich nahm das Salz entgegen und wies ihn an, den anderen zu helfen. Noch außer Atem fegte er mit dem Fuß den Schnee zur Seite und war dabei immer noch viel schneller als die anderen. Deshalb ließ ich es ihm auch durchgehen, als er mir eine Ladung Schnee ins Gesicht trat. Selbst Diener haben manchmal das Recht auf bevorzugte Behandlung. Für einen Herrscher ist das so etwas wie ein ehernes Gesetz, eine nützliche Wahrheit. Aus diesem Grund duldete ich ein solches Verhalten mangelnder Unterordnung und musste kichern, als mir der kalte Schnee den Nacken hinunterglitt.
Bald loderte das Feuer. Wir rupften den Drosseln die Federn aus. Sonam Tserang tötete sie dazu nicht erst, sondern rupfte die erbärmlich zappelnden und kreischenden Vögel bei lebendigem Leib, sodass man eine Gänsehaut bekam – nur er gab sich unberührt. Bald stieg vom Feuer der beruhigende Geruch von geröstetem Vogelfleisch auf. Nicht lange, und jeder von uns hatte vier oder mehr Drosseln im Bauch.
2
»Sharü«
Zur gleichen Zeit ließ die Frau des Fürsten, meine Mutter, im ganzen Haus nach mir suchen.
Wäre mein Vater zu Hause gewesen, er hätte mich nicht an solchen Spielen gehindert. Doch in diesen Tagen war Mutter für alles zuständig. Die Diener fanden mich schließlich im Obstgarten. Die Sonne stand hoch am Himmel, sodass der Schnee blendete und man die Augen kaum aufbekam. Ich knabberte an den kleinen Vogelknochen, und meine Hände waren voller Blut. Mit den Kindern der Leibeigenen, deren Gesichter und Hände ebenfalls blutbeschmiert waren, kehrte ich nach Hause zurück, wo die Hunde uns wegen des starken Blutgeruchs besonders lautstark begrüßten. Im Haus angekommen sah ich meine Mutter auf dem oberen Treppenabsatz stehen und mit ernster Miene auf uns herniedersehen. Die kleinen Diener begannen heftig zu zittern. Ich wurde hinaufgebracht, um neben dem Kohlenbecken meine feuchte Kleidung zu trocknen.
Im Hof hörte ich eine Lederpeitsche durch die Luft sausen. Es klang ein bisschen wie das Niederstürzen eines Falken, der seine Beute ergreift. In diesem Augenblick hasste ich meine Mutter, hasste die Frau des Fürsten Maichi. Als habe sie Zahnschmerzen, hielt sie sich die Wange und sagte: »Du hast nicht die Knochen eines Unwürdigen im Leib.«
»Knochen«, das ist bei uns hier kein gewöhnliches Wort, genauso wie der Begriff »Wurzel«.
Das Wort »Wurzel« ist bei uns kurz und knapp: »Nyi.«
Das Wort für »Knochen« dagegen hat einen stolzen Klang: »Sharü.«
Die Welt besteht aus Wasser, Feuer, Wind und Luft. Menschen dagegen sind aus Knochen gemacht oder aus Wurzeln.
Ich hörte meiner Mutter zu, sog die Wärme der frisch angezogenen Kleidung auf und dachte über das Problem der Knochen nach, ohne allerdings zu einem Ergebnis zu kommen – stattdessen spürte ich die Drosseln in meinem Bauch ihre Flügel ausbreiten, hörte die Peitsche auf die Rücken meiner zukünftigen Haustiere niederknallen. Jugendliche Tränen begannen meine Wangen hinunterzulaufen. Die Frau des Fürsten meinte, ihr Sohn zeige Reue, strich mir über den Kopf und sagte: »Denke immer daran, mein Sohn, du kannst auf ihnen reiten wie auf Pferden, kannst sie schlagen wie Hunde, nur darfst du sie nicht als Menschen ansehen.« Sie hielt sich für sehr klug, aber ich denke, selbst kluge Menschen sind manchmal strohdumm. Ich mag zwar ein Idiot sein, doch bin ich anderen zuweilen überlegen. Deshalb konnte ich nicht anders und lachte, noch Tränen in den Augen, laut auf.
Ich hörte den Verwalter, die Amme und die Dienerin fragen: »Was hat der Junge Herr?« Doch ich sah sie nicht. Erst dachte ich, ich hätte die Augen geschlossen. Doch sie waren weit geöffnet, und so schrie ich laut: »Meine Augen sind weg!«
Damit wollte ich sagen, dass ich nichts mehr sehe.
Der Sohn des Fürsten hatte rot geschwollene Augen, und der kleinste Lichtstrahl schmerzte wie das Stechen von Stahlnadeln.
Der auf Heilkunst spezialisierte Lama der Monpa-Nationalität sagte, ich sei vom grellen Licht im Schnee geblendet worden. Er verbrannte einen Wacholderzweig und etwas Medizin und räucherte mich so stark mit Qualm ein, dass man meinen konnte, er wolle für die Drosseln Rache üben. Dann hängte er ehrfürchtig ein Bild vom Buddha der Medizin neben mein Bett. Im Nu wurde ich, der ich eben noch laut geschrien und getobt hatte, vollkommen ruhig.
Als ich aufwachte, brachte mir der Monpa-Lama eine Schale sauberes Wasser. Er schloss das Fenster, ließ mich die Augen weit öffnen und in die Schale sehen.
Ich sah Lichter funkeln wie von Sternen am nächtlichen Himmel. Das Licht ging von Luftblasen aus, die im Wasser nach oben stiegen. Dann sah ich auf dem Grund der Schale dicke Gerstenkörner liegen. Sie waren es, die die glitzernden Luftblasen ausspuckten. Im Nu fühlten meine Augen sich viel kühler an.
Der Monpa-Lama verneigte sich, um dem Buddha der Medizin zu danken. Dann packte er seine Sachen, um in der Heiligen Halle Gebete für mich zu lesen.
Ich nickte kurz ein, wurde aber vom Geräusch mehrerer Kotaus an der Tür wieder geweckt. Die Mutter von Sonam Tserang lag vor der Herrin auf den Knien und flehte um Gnade für ihren unwürdigen Sohn.
Meine Mutter fragte mich: »Siehst du das?«
»Ja.«
»Siehst du es wirklich?«
»Ich sehe es wirklich.«
Nach dieser Bestätigung befahl die Frau des Fürsten: »Bringt den kleinen Bastard hinunter und gebt ihm zwanzig Peitschenhiebe!« Seine Mutter dankte der meinen und ging hinunter. Wie sie so heulte, dachte man, der Sommer sei gekommen und Bienen summten zwischen den Blumen im Kreis herum.
Ach, da ich im Augenblick ans Bett gefesselt bin, lassen Sie mich weiter von den Knochen erzählen. In der Gegend, aus der unsere Religion kommt, sprach man von Knochen als »Kasten«. Sakyamuni kam aus einer besonders noblen Kaste in Indien – das Land der weißen Gewänder. In dem Land, in dem wir die Macht besitzen, China – das Land der schwarzen Gewänder –, werden »Knochen« mit Türschwellen in Verbindung gebracht. Dieses schwer zu übersetzende Wort meint wahrscheinlich die Höhe der Türschwellen. Wenn dem wirklich so wäre, müsste an der Tür zum Hause des Fürsten eine besonders hohe Schwelle angebracht sein. Meine Mutter kommt aus einer armen Familie. Nachdem sie in die Familie Maichi eingeheiratet hatte, achtete sie sehr auf diese Dinge. Sie wollte das Gehirn des Idioten immer bis zum Rand damit voll stopfen.
Einmal fragte ich sie: »Könnten wir bei so hohen Türschwellen nicht von den Wolken her ein- und ausgehen?
Sie lachte bitter.
»Dann wären wir keine Fürsten, sondern Unsterbliche.« So sprach ihr Sohn, der Idiot, zu ihr. Sie lachte enttäuscht, nur damit ich mich schuldig fühlte, weil aus mir nie etwas werden würde.
Die Festung von Fürst Maichi war in der Tat ein hoher Bau. Mit sieben Stockwerken und einem Dach, dazu einem Kellerverlies, ragte es mehr als sechzig Meter hoch. Die vielen Zimmer und zahllosen Türen waren durch Treppen und Flure miteinander verbunden, so verschachtelt und kompliziert wie der Lauf des Lebens und das menschliche Herz. Das Gebäude stand in einer bergigen Gegend hoch über zwei Flüssen, die dort unten zusammenflossen, sodass man einen guten Blick auf einige dutzend Ansiedlungen an den Ufern hatte.
Die Menschen, die dort wohnten, nannte man »Kaba«. Alle Bewohner gehörten zu demselben »Knochen« oder »Sharü«. Sie bestellten ihre Felder und arbeiteten auf dem Anwesen des Fürsten, wenn er sie brauchte, und sie erfüllten Botendienste zwischen mehr als zweitausend Familien in über dreihundert Ansiedlungen in einem Umkreis von hundertachtzig Kilometern in westöstlicher Richtung und mehr als zweihundert Kilometern in nordsüdlicher Richtung von der Festung aus. Ein Sprichwort der »Kaba« sagt: Wenn dein Hinterteil in Flammen steht, liegt es an der Feder auf dem Brief des Fürsten. Sobald der Gong auf dem Dach des Fürsten erklang zum Zeichen, dass ein Brief fortgebracht werden müsse, musste sich jemand aufs Pferd setzen, selbst wenn seine Mutter gerade im Sterben lag.
In den Bergen und Tälern links und rechts des Flusslaufes sah man eine Ansiedlung neben der anderen. Die Bewohner lebten von Ackerbau und Viehzucht. Ihnen standen Führer unterschiedlicher Ränge vor. Die Führer verwalteten die Ansiedlungen, und die Fürstenfamilie wiederum kontrollierte die Führer. Die Menschen, die von den Führern regiert wurden, waren das einfache Volk. Sie machten den größten Teil der Bevölkerung aus und gehörten alle dem gleichen »Knochen« an. Menschen aus dieser Klasse konnten aufsteigen und ihrem eigenen »Knochen« durch adliges Blut mehr Gewicht verleihen. Sehr viel wahrscheinlicher war aber der Niedergang, und wenn das geschah, war es fast unmöglich, wieder auf die Beine zu kommen. Denn der Fürst zog es vor, möglichst viele freie Bürger zu unfreien Sklaven werden zu lassen. Sklaven waren Haustiere, die man nach Belieben kaufen, verkaufen und zur Arbeit antreiben konnte. Und es ist leicht, freie Menschen in Leibeigene zu verwandeln – man braucht nur Gesetze zu erlassen, gegen die jedermann leicht verstößt, das ist alles. Das ist noch sicherer als die Fallen, die erfahrene Jäger aufstellen.
So auch die Mutter von Sonam Tserang. Sie war die Tochter einfacher Leute und damit selbst eine Frau aus dem Volk. Der Fürst konnte nur über einen Führer Arbeit und Tribut von ihr einfordern. Aber sie bekam ein uneheliches Kind, verstieß damit gegen ein Gesetz und verurteilte so ihren Sohn und sich selbst zu einem Leben als rechtlose Leibeigene.
Ein Gelehrter sagte einmal, der Fürst habe keine Gesetze. Es stimmt, wir hatten kein geschriebenes Gesetz, aber wir hielten uns an Vorschriften, die uns in Fleisch und Blut übergegangen waren. Sie waren wirkungsvoller als so manches Gesetz, das heute niedergeschrieben wird. Ich frage: »Ist das tatsächlich so?« Eine Stimme aus der fernen Vergangenheit antwortet dröhnend: »So ist es, so ist es.«
Jedenfalls waren unsere damaligen Gesetze geeignet, Menschen von Freien zu Leibeigenen werden zu lassen, nicht umgekehrt. Die Künstler, die diese Gesetze schufen, waren Leute mit schweren, adeligen »Knochen«. »Knochen« teilen die Menschen in oben und unten.
Der Fürst.
Unter dem Fürsten die Führer.
Die Führer verwalten das einfache Volk.
Danach kommen die »Kaba« (Boten, keine Kuriere). Zum Schluss die Familienleibeigenen. Und dann gibt es noch Menschen, die ihre Position beliebig verändern können. Dazu zählen Mönche und Priester, Kunsthandwerker, Magier, gute Unterhaltungskünstler. Diese Leute lässt der Fürst gewähren, solange sie ihm nicht das Gefühl geben, nicht zu wissen, was er mit ihnen tun soll.
Ein Lama sagte einmal zu mir: »Die Tibeter, die in ihren von schneebedeckten Bergen umschlossenen Gebieten leben, können angesichts des Bösen Schwarz und Weiß ebenso wenig unterscheiden wie die stillen Chinesen; und wenn sie nichts zu lachen haben, wirken sie dennoch fröhlich wie die Inder.«
China heißt in unserer Sprache »Gyanag«. Das bedeutet so viel wie »Reich der schwarzen Gewänder«.
Indien heißt »Gyagar«. Das bedeutet »Reich der weißen Gewänder«.
Der Maichi-Fürst bestrafte den Lama später, weil er sich um Fragen Gedanken machte, über die niemand tiefer nachdenken sollte. Ihm wurde die Zunge abgeschnitten, und er starb aus Qual darüber, nicht sprechen zu können. Ich denke darüber so: Die Zeit vor Sakyamuni war die der Propheten, seitdem aber brauchen wir nicht mehr so viel nachzudenken. Wenn Sie sich für einen besonderen Menschen halten, aber nicht als Adeliger geboren wurden, dann werden Sie Lama und zeichnen den Leuten Bilder von ihrer Zukunft. Wenn Sie das Gefühl haben, über das Jetzt und das menschliche Leben etwas zu sagen zu haben, dann tun Sie es schnell. Denn wenn Sie keine Zunge mehr haben, können Sie überhaupt nichts mehr sagen. Sehen Sie doch all die verrotteten Zungen, die einmal etwas sagen wollten.
Einfache Leute haben zuweilen etwas zu sagen, warten aber bis kurz vor ihrem Tod damit. Dies wären geeignete letzte Worte:
– Reich mir etwas Honigwein.
– Bitte leg mir einen kleinen Jadestein in den Mund.
– Es wird gleich Tag.
– Ama, sie sind da.
– Ich finde meinen Fuß nicht.
– Himmel, Himmel.
– Geister, Geister!
und so weiter.
3
Sangye Dolma
Meine Erinnerung setzt an jenem verschneiten Morgen ein, als ich dreizehn Jahre alt war. Der erste Frühjahrsschnee machte mich regelrecht blind. Meine geschwollenen Augen kühlten angenehm ab, als ich die Peitsche auf den Körper von Sonam Tserang niedersausen hörte. Mutter wies die Amme an: »Pass gut auf den Jungen Herrn auf.«
Die schöne Dienerin Dolma wollte gleich hinter meiner Mutter zur Tür hinausgehen. Ich riss mir das Handtuch von den Augen und schrie laut: »Ich will Dolma!«
Ich hatte zwar überhaupt nicht nach Mutter gefragt, doch sie antwortete: »In Ordnung, wir gehen nicht, sondern bleiben hier bei dir.« Wie sollte mein kleines Gehirn verstehen, was wirklich vor sich ging? Ich hielt die warme, weiche Hand von Dolma ganz fest und war im nächsten Augenblick eingeschlafen.
Als ich erwachte, war es Abend. Von der Brücke unterhalb unseres Dorfes drang der lang gezogene, verzweifelte Ruf einer Frau herüber. Die Seele eines Kindes war an diesem Ort verschwunden, an dem die Geister ein- und ausgehen, und die Mutter lockte sie zurück nach Hause. Ich aber sagte zu Dolma, die am Kopfende meines Bettes lehnte: »Dolma, ich will dich, Dolma.« Sie kicherte. Dann kniff sie mich und glitt zu mir unter die Bettdecke.
Es gibt ein Lied, das so geht:
Ein gefallenes Mädchen –
Gleite wie Wasser in meine Arme.
Welch ein Fisch im Wasser –
Schwimm in die Träume des Menschen.
Erschrecke sie nicht,
Den gefallenen Mönch und das schöne Mädchen!
In den Entstehungsmythen unserer Welt sagt eine Gottheit, die irgendwo wohnt: »Ha!«, und sofort ist da die Leere. Der Gott sagt zur Leere wiederum: »Ha!« Und schon sind da Wasser, Feuer und Staub. Beim nächsten geheimnisvollen »Ha!« bläst der Wind, sodass die Welt sich in der Leere dreht. An diesem Tag umfasste ich die Brüste von Sangye Dolma mit beiden Händen und rief ebenfalls aufgeregt: »Ha!«
Dolma brummte vor sich hin: »Mm … mmh … mmh …«
Eine Welt aus Wasser und Feuer, aus Licht und Staub begann sich wirbelnd zu drehen. In jenem Jahr war ich dreizehn, Dolma achtzehn Jahre alt.
Die achtzehnjährige Sangye Dolma legte mich auf sich. In meinem dreizehnjährigen Körper begann es wie Feuer zu brennen.
Sie sagte: »Geh hinein, geh hinein.« Als habe ihr Körper eine Tür. Und tatsächlich spürte ich das dringende Verlangen, irgendwo einzudringen.
Sie sagte: »Idiot. Du Idiot.« Dann umfasste sie mich dort unten und zeigte mir den Weg.
Ich Dreizehnjähriger schrie laut auf und explodierte. Die Welt hörte auf zu existieren.
Am nächsten Morgen schwollen meine Augen, die eigentlich schon geheilt waren, wieder so stark an, dass ich sie nicht öffnen konnte. Dolma wurde rot und flüsterte meiner Mutter etwas ins Ohr. Die Frau des Fürsten sah mich an, musste lachen und gab der schönen Dienerin eine Ohrfeige.
Wiederum kam der Monpa-Lama. Mutter sagte: »Der Herr wird bald zurück sein – nun seht, was ihr mit den Augen des Jungen Herrn gemacht habt.«
»Hat der Junge Herr etwas Unsauberes gesehen?«, fragte der Lama.
Die Frau des Fürsten erwiderte: »Geister? Einige traurige Geister, die Ihr nicht ausgetrieben habt, sind sicher noch da.«
Der Lama schüttelte den Kopf: »Unten hat eine Hündin Junge bekommen, hat der Junge Herr sie sich angesehen?«
Also wurde ich wieder mit dem Qualm verbrannter Wacholderzweige behandelt. Außerdem verabreichte der Lama mir Kräutermedizin in Pulverform. Kurz darauf musste ich pinkeln. Der Lama sagte, es werde wehtun. Und so kam es, dass ich an der Stelle, an der ich mich am Abend zuvor so wohl gefühlt hatte, nun Schmerzen verspürte wie von unzähligen Nadeln.
Der Lama sagte: »Dann stimmt es also, ich habe mich nicht geirrt, der Junge Herr ist erwachsen geworden.«
Als ich mit der Amme allein war, fragte sie: »Was hat das verruchte kleine Weibsstück mit dir gemacht?«
Ich bedeckte meine geschwollenen Augen mit den Händen und lachte. Voll Bitterkeit sagte meine Amme: »Ach, du Idiot, ich hatte gehofft, dass das Leben weniger demütigend sein würde, wenn du erst mal groß bist, und dann tanzt du mir mit so einem Weib auf der Nase herum.« Sie ließ die Feuerzange scheppernd ins Kohlebecken fallen. Ich ignorierte sie – wie gut das Leben es doch mit dem Sohn des Fürsten meinte, man brauchte nur wie ein Gott »Ha!« zu rufen, und schon begann die Welt sich zu drehen. Dann lehrte das Abführmittel des Lama meine Gedärme singen.
Mit weinerlicher Stimme sagte die Amme zum Lama: »Was haben Sie mit dem Magen des Jungen Herrn gemacht?«
Der Lama starrte sie ernst an und ging. Ich musste lachen, und in diesem Augenblick spritzte flüssiger Kot unten aus mir heraus. An diesem Vormittag kam ich von der Bettschüssel nicht herunter. Mutter wollte den Lama zur Rechenschaft ziehen, aber der war fort und machte anderswo Krankenbesuche. Wir kamen zwar für Kost und Logis auf, doch er verdiente sich gern noch etwas hinzu. Am Nachmittag waren meine Augen und mein Magen wieder in Ordnung. Da lobten und priesen alle die Künste des Lama.
Es war ein sonniger Nachmittag. Rasendes Hufgetrappel wurde laut und ließ alle aufhorchen. Die Sonnenstrahlen wirkten wie die straff gespannten Saiten eines Bogens. Mein Vater, Fürst Maichi, der seine Beschwerde bei der Provinzregierung vorgetragen hatte, kehrte aus dem Gebiet der Chinesen zurück.
Er und seine Begleiter hatten knapp zehn Kilometer entfernt ihre Zelte für die Nacht aufgeschlagen und schickten nun einen schnellen, berittenen Boten mit folgender Nachricht hierher: Der Fürst habe einen hohen Beamten der Militärregierung mitgebracht, der morgen mit großen Ehren empfangen werden solle.
Kurz darauf waren einige schnelle Pferde aus unserem Anwesen unterwegs zu nahe gelegenen Festungen. Mutter und ich standen auf einem Balkon unseres Arkadenhauses und blickten den aufwirbelnden Staubwolken nach, die die rasenden Pferde auf den weiten Ebenen hinterließen. Die Arkaden liefen über drei Stockwerke, und man blickte von hier aus Richtung Südosten ins Tal. Die anderen drei Seiten des Gebäudes hatten sieben Stockwerke, und hinten war ein Wachturm angebaut, der auf eine breite Straße wies, die von den Bergen herunterkam. Da der Frühling nahte, gab der Boden aus festgestampftem Lehm unter dem Balkon allmählich nach. Das oberste der drei Stockwerke war das der Familienwache, und von dort aus konnte man Angriffe von vorn besonders gut abwehren. In den zwei Stockwerken darunter wohnten die Hausdiener. Das Flusstal öffnete sich nach Südosten. Von dorther würden Vater und mein großer Bruder morgen zurückkommen. An jenem Tag bot sich mir das gleiche Bild wie sonst: Die Berge schienen immer höher zu werden, bis die Sonne dahinter verschwand. Ein Fluss sprudelte aus den Bergen Richtung Osten und grub ein immer breiteres Bett in das Tal. Wie eine Redensart sagt: Der Kaiser der Han-Chinesen regiert in der Morgensonne, der Dalai-Lama unter der des Nachmittags.
Wir befanden uns in der Mittagssonne ein kleines Stück Richtung Osten. Die Stelle hat eine bestimmte Bedeutung. Sie entschied darüber, dass wir mit dem Kaiser der Chinesen im Osten mehr zu tun hatten als mit unserem eigenen religiösen Führer, dem Dalai-Lama. Die geografischen Gegebenheiten entschieden über unsere politischen Beziehungen.
Wissen Sie, der Grund dafür, dass wir uns so lange halten konnten, liegt darin, dass wir uns über unsere Position immer klar waren. Unser erklärter Feind dagegen, Fürst Wangpo, machte Pilgerreisen nach Lhasa. Als kluge Gefolgsleute ihm rieten, sich auch bei den Chinesen zu zeigen, fragte er zurück: »Wer ist größer, Wangpo oder China?« Und vergaß darüber, dass seine Insignien ebenfalls von Vorfahren aus Peking hergebracht worden waren. Tatsächlich heißt es in einigen Büchern, dass wir schwarzhaarigen Tibeter an einem Wollseil in diese erhabene, hoch gelegene und außergewöhnliche Gegend heruntergekommen sind. Insofern hatte Fürst Wangpo jeden Grund zu der Annahme, dass auch Insignien, Geld und Waffen auf einem blauen Lichtstrahl vom Himmel herunterkommen können.
Mutter sagte: »Die Leute, die mit Fürst Wangpo umzugehen verstehen, sind auf dem Weg, wir werden ihnen morgen entgegengehen. Sie kommen aus meiner Heimat. Himmel, ob ich noch Chinesisch mit ihnen reden kann? Himmel, oh Himmel. Hör mir zu, Sohn, mal sehen, ob es noch geht.«
Ich tippte mir an die Stirn. »Woher soll ich denn wissen, ob das, was du sprichst, Chinesisch ist?«
Aber sie hatte schon angefangen, draufloszuplappern. »Göttin der Barmherzigkeit«, rief sie erleichtert aus, »ich habe es nicht vergessen, ich habe es nicht vergessen.« Sie weinte. An diesem Tag packte sie meinen Kopf wieder fest mit beiden Händen, schüttelte ihn und sagte: »Ich werde dir Chinesisch beibringen, Himmel, so groß schon, warum nur habe ich nicht daran gedacht, dir Chinesisch beizubringen?«
Ich hatte jedoch überhaupt kein Interesse daran. Wieder enttäuschte ich sie in einem Augenblick größter Aufregung. »Schau, ich sehe den gelben Schirm des Lama kommen«, sagte ich wie ein Idiot.
Wir unterhielten zwei Gruppen buddhistischer Mönche. Die einen in der Heiligen Halle in unserer Festung, die anderen im Mondron-Ling-Kloster auf der anderen Seite des Flusses. Jeeka Rinpoche hatte gerade von der großen Zeremonie morgen gehört und eilte herbei. Als er und sein Gefolge über die Holzbrücke kamen, griff plötzlich eine Windbö in den gelben Schirm und riss den Novizen, der ihn trug, in den seichten Fluss. Als er sich aufgerappelt hatte und tropfnass wieder auf der Brücke stand, kicherte die Frau des Fürsten. Hören Sie nur, wie jung ihr Lachen klingt! Als die Prozession den langen Weg über die Steintreppen emporstieg, befahl Mutter, das Tor zu schließen.
Die Beziehungen zwischen dem Fürsten und dem Kloster waren seit einiger Zeit nicht besonders gut. Der Auslöser war, dass Jeeka Rinpoche nach dem Tod meines Großvaters eine Hitze im Kopf spürte und sagte, nur mein Onkel sei der Richtige, um die Nachfolge des Fürsten anzutreten. Doch am Ende wurde mein Vater, nicht mein Onkel Fürst Maichi. Seither war es still um das Kloster geworden. Mein Vater führte das Amt des Fürsten ordnungsgemäß weiter, er ließ später die Heilige Halle in der Festung erweitern und lud Mönche von anderswoher ein, um nichts mehr mit dem Kloster zu tun zu haben.
Mutter stand inmitten ihrer Leute auf dem Balkon der Festung und sah nach Osten, dem herrschaftlichen Pomp entgegen.
Da schlug der Rinpoche den Kupferring im Maul des Löwen am Tor an. Der humpelnde Verwalter wollte nach unten rufen, damit jemand das Tor öffne. Doch Mutter hielt ihn zurück. Sie fragte mich: »Sollen wir öffnen?«
»Lass sie ein bisschen warten. Wenn sie Geld wollen, sollen sie nicht so drängeln«, antwortete ich.
Der Verwalter, meine Dienerin und alle anderen Hausangestellten lachten. Nur die Amme nicht. Ich weiß, dass für sie Mönche und Gottheiten im Tempel dasselbe waren.
Dolma sagte: »Der Junge Herr ist sehr klug.« Mutter warf ihr einen scharfen Blick zu, worauf die Dienerin verstummte.
»Wie kann man einen Rinpoche so behandeln!«, schimpfte Mutter, raffte ihren langen, gefältelten Rock zusammen und ging huldvoll die Treppe hinunter, um dem Rinpoche selbst die Tür zu öffnen.
Er grüßte höflich. Die Frau des Fürsten erwiderte den Gruß nicht, sondern sagte weich: »Ich sah, wie der Schirm des Rinpoche in den Fluss geweht wurde.«
»Amitabha-Buddha, Herrin, meine Fähigkeiten sind noch unvollkommen.«
Im Flusstal kam Wind auf, der hörbar durch die Luft pfiff.
Mutter bat den Rinpoche nicht herein, sondern sagte: »Es wird stürmisch, kommen Sie morgen mit den Musikern Ihres Klosters, um hier unsere Gäste zu begrüßen.«
Jeeka Rinpoche bekam vor Aufregung kein Wort mehr heraus, er verbeugte sich wieder und wieder vor der Frau des Fürsten. Streng genommen war das gegen die Ordnung. Denn sobald er sein gelbes Gewand und die purpurne Robe trug, war er nicht mehr er selbst, sondern der Vertreter aller Gottheiten und Buddhas auf der Erde – aber das hatte er vollkommen vergessen.
Am nächsten Morgen stand ich mit den zwei Signalschüssen vom Wachtturm auf und zog mich selbst an. Die Amme eilte mit dem Nachttopf herbei, doch ich bekam nichts aus mir heraus. Ich war gestern schon alles losgeworden.
In der Heiligen Halle ertönten Gongs, und über der Festung stieg Qualm von Räucherstäbchen auf. Im Hof und auf dem Platz vor der Festung stand alles voller schweißnasser Pferde. Die Führer waren mit ihren Leuten und Pferden aus allen Richtungen herbeigeeilt. Als Mutter und ich von oben herunterkamen, brach die Menge gerade auf. Mutter ritt auf einem Schimmel inmitten einer Menge rotbrauner Pferde. Sie trug einen handbreiten Silbergürtel um die Taille, mehrere Perlenketten um den Hals, und das frisch geflochtene Haar glänzte auf ihrem Kopf. Ich schlug auf mein Pferd ein, um sie einzuholen. Mutter lachte. Mein Rotfuchs war breit und stark und hatte einen kräftigen Galopp. Als ich zu Mutter aufgeschlossen hatte, jubelten die Leute den beiden prächtigen Pferden zu. In strahlendem Sonnenschein ritt ich neben meiner Mutter die Straße entlang und hörte die Rufe. Ich vermutete, sie wolle bestimmt nicht mit so einem Idioten zusammen sein. Aber nein, sie ritt neben ihrem Sohn her, winkte der jubelnden Menge zu, in der Hand eine Peitsche mit roten Troddeln. In diesem Augenblick ging mein Herz über vor grenzenloser Liebe zu ihr.
Ich galoppierte weit voraus und stellte mir vor, dass alle normalen Kinder sagen: »Ich liebe dich, Ama.« Ich aber sagte, als Mutter zu mir aufschloss: »Sieh nur, Ama, ein Vogel.«
Mutter antwortete: »Idiot, das ist ein Falke.« Mit ihrer freien Hand formte sie eine Kralle wie die des Falken: »So kommt er heruntergeschossen und greift sich Kaninchen oder eine Ziege.«
»Sie können auch tote Fische aus dem Fluss ergreifen.«
»Oder sie stürzen sich auf eine Giftschlange und töten sie.«
Ich wusste, wenn sie von einer Giftschlange sprach, meinte sie den Führer, der uns verraten hatte, ganz zu schweigen von Fürst Wangpo, der sich zu unserem Feind erklärt hatte. Dann wurde Mutter von den Führern nach vorn eskortiert. Ich hielt mein Pferd an und blieb am Straßenrand stehen. Sangye Dolma ging in prächtigen Kleidern zwischen anderen Bediensteten. Heute waren zwar alle Dienerinnen und Diener herausgeputzt, doch weder ihre Kleidung noch ihre Gesichter strahlten. Ich empfand es als Demütigung für Dolma, mit diesen Menschen zusammen zu sein.
In ihren Augen lag ebenfalls Trauer. Als sie auf mich zukam, gab ich ihr die Zügel in die Hand. Damit schafften ein groß gewachsenes Pferd und ein leicht beschränkter, aber hochgeborener Mann eine Distanz zwischen ihr und den anderen Menschen, die nichts als die Hoffnung auf das nächste Leben hatten. Meine Mutter und ihr Ehrfurcht gebietendes Gefolge waren hinter der nächsten Bergkuppe verschwunden. Ein weites, sonnenbeschienenes Feld breitete sich vor uns aus, oberhalb an den Hängen goldene Wälder, unten funkelte das Wasser im Fluss. Um die Festungen herum stand grüne Wintergerste. An jeder einzelnen, an der wir vorüberkamen, schlossen sich uns mehr Menschen an, und diese immer größere Truppe folgte mir nach, denn niemand wagte, den Herrn zu überholen. Wenn ich mich umdrehte, zogen Männer grüßend den Hut, und schöne Mädchen strahlten mich an. Oh, wie wundervoll, ein Fürst zu sein, Herr über ein winziges Stück Land. Wäre ich nicht ein Unfall meines Vaters nach zu viel Alkoholgenuss, ich würde in einem Moment wie diesem an so etwas wie Vatermord denken. Doch ich sagte nur: »Lass uns anhalten, Dolma, ich habe Durst.«
Dolma drehte sich um und sagte den Leuten hinter uns Bescheid. Sofort rannten einige Männer los, Staub wirbelte um ihre Füße, sie knieten vor meinem Pferd nieder und nestelten verschiedene Flaschen mit Alkohol aus ihrem Gepäck. Dolma schob die mit den unsauberen Flaschen zur Seite. Die Zurückgewiesenen waren so unglücklich, als sei ein lieber Mensch gestorben. Ich löschte meinen Durst aus einer Flasche, die wie ein kleiner Vogel geformt war. Dann wischte ich mir den Mund ab und fragte: »Wer bist du?«
»Ich bin der Silberschmied Chödak«, erwiderte der Mann mit einer Verbeugung aus der schmalen Taille.
»Bist du ein guter Silberschmied?«
»Ich bin kein guter Silberschmied«, antwortete der Mann ruhig. Ich wusste, dass ich ihm eigentlich etwas zum Dank hätte geben müssen, doch sagte ich nur kühl: »Es ist gut, du kannst gehen.«
Dolma sagte: »Du musst dich erkenntlich zeigen, Herr.«
»Wenn er dich weniger angesehen hätte«, erwiderte ich.
Ich wusste, wie verletzbar ein Herrscher war. Ich fand meine gute Laune erst wieder, als Dolma mich kniff. Ich sah zu ihr hinüber, und sie blickte mutig zurück, sodass ich in die Tiefe ihrer Augen stolperte und nicht mehr herauskam.
Lassen Sie mich ein Lied singen:
Ah, sieh nur nach oben,
welch herrlicher Anblick,
dort steht eine Pagode des Sieges.
Ah, sieh nur hinüber,
welch herrlicher Anblick,
dort steht ein tapferer junger Mann mit einem Gewehr.
Ah, sieh nur hinunter,
welch herrlicher Anblick,
dort steht ein schönes junges Mädchen in Samt und Seide.
Ich hob den Kopf, und Dolma fiel ein. Sie sang herzergreifend, melodisch und wohlklingend. Doch hatte ich nicht das Gefühl, dass es um mich ging. Der junge Mann war nicht ich. Dann hätte sie, die Dienerin, der Gunst wegen, die sie mir erwiesen hatte, Samt und Seide tragen müssen. Das Lied war zu Ende. Ich sagte: »Sing es noch einmal.« Sie dachte, es mache mir Freude, und begann von vorn. Ich ließ sie noch einmal singen. Sie sang. Ich hieß sie abermals singen. Diesmal war es nicht so gut. Ich sagte: »Noch einmal.« Tränen liefen ihr die Wangen hinunter. An diesem Tag, ich sagte es bereits, begriff ich, wie gut es ist, ein Herrscher zu sein. Auch begriff ich, wie verletzbar ein Herrscher ist. Ihre Tränen wirkten wie Balsam auf den Schmerz in meiner Seele.
4
Der Ehrengast
Fünf Kilometer von der Festung entfernt schlugen wir die Zelte auf, um unsere Gäste zu begrüßen. Die Männer sollten ihre Reit- und Schießkünste vorführen. Die Lamas der Festung und des Tempels führten Trommelmusik und Maskentänze vor, ein Wettbewerb, auf den sie all ihre Kräfte verwendeten. Um ehrlich zu sein, wir lieben diese Konkurrenz unter den Lamas, denn sonst wären sie allzu unantastbar. Ohne diese Konkurrenz würden sie ständig erzählen, der Buddha sage dies, der Buddha sage jenes, und selbst der Fürst könnte nichts dagegen tun. Aber sobald es Probleme zwischen ihnen gab, kamen sie gelaufen und boten an, für die Familie des Fürsten Gebete zu sprechen. Sie garantierten, dass ihre Gebete wirkungsvoller seien als die der anderen.
Ein ganzes Lamm war gerade im Kochtopf verschwunden, der Tee entfaltete sein Aroma, und in der Ölpfanne entstand ohrenförmiges Gebäck, als wir auf dem Bergrücken eine, zwei, schließlich drei Rauchsäulen emporsteigen sahen, das Zeichen für die Ankunft der Ehrengäste. Innerhalb und außerhalb der Zelte wurden Teppiche ausgebreitet. Auf niedrigen Tischen vor den Teppichen wurden Köstlichkeiten arrangiert, auch die Nudeln, die eben fertig geworden waren. Hören Sie die »Ohren« zischeln?
Einige Hornsignale, eine dicke Staubwolke, schon war unser Reitertrupp davongeprescht. Danach folgte eine Gruppe einfacher Leute mit Katag-Schals aus Seide, darunter einige hervorragende Sänger.
Den Schluss bildeten Mönche, die Seemuscheln und ihre oboenartigen Gyalings in den Händen hielten.
Auf dem Weg hierher würden Vater und der Ehrengast von diesen drei Gruppen begrüßt werden. Wir hörten die Salutschüsse der Reitervorhut. Danach erklangen die Gesänge der gewöhnlichen Leute. Als das ferne Dröhnen der Seemuscheln und das Singen der Gyalings ertönte, konnten wir die Gäste bereits sehen.
Fürst Maichi hielt sein Pferd an, damit alle seinen freudigen Stolz sehen konnten. Doch der Provinzbeamte neben ihm strahlte bei weitem nicht die Würde aus, die wir von ihm erwartet hatten. Es war ein schmaler Mann, der nun seinen Hut abnahm und der Menge zuwinkte. Das unzivilisierte Volk fiel im gelben Gras donnernd auf die Knie. Ein Teppich wurde bis zu den Pferden hin ausgerollt, und zwei Diener knieten sich auf alle viere, um als Absteigehilfe zu dienen. Einer von ihnen war mein persönlicher Knecht Sonam Tserang.
Der knochige Chinese setzte seinen Hut wieder auf, rückte die schwarzrandige Brille zurecht und stieg über den Rücken Sonam Tserangs vom Pferd. Er winkte einige dutzend schmucke Soldaten heran, und als der Fürst zu seiner Frau hinüberging, wurden beide mit militärischen Ehren gegrüßt. Anschließend überreichte Sonderbotschafter Huang Chumin der Frau des Fürsten Geschenke aus Seide, Brokat, Jade und Gold. Die Frau des Fürsten bot ihm eine Schale Wein an und reichte ihm einen gelben Katag. Nun gaben junge Mädchen den chinesischen Soldaten ebenfalls Wein und Katags. Die Lamas begannen zu trommeln und auf ihren Gyalings zu spielen.
Als der Sondergesandte Huang im Zelt Platz genommen hatte, bat mein Vater, mit der Tanzvorführung zu beginnen. »Warten Sie, der Sondergesandte hat noch nicht gedichtet«, sagte der Übersetzer. Da war dieser hochgeborene Chinese also Poet. Bei uns werden Dichter nicht mit einer solch wichtigen Aufgabe betraut. Als ich seine halb geschlossenen Augen gesehen hatte, hielt ich ihn zunächst für trunken von all den Speisen, Getränken und der Schönheit der jungen Mädchen.
Der Sondergesandte Huang saß einen Moment ruhig da, dann öffnete er die Augen und sagte, das Gedicht sei fertig. Voller Begeisterung folgte er der Darbietung der Mädchen, begann während des langatmigen Maskentanzes der Lamas zu gähnen und wurde daraufhin von seinen Soldaten zum Rauchen hinausgeführt. Das sagten sie tatsächlich, dass der Sondergesandte zur Aufmunterung rauchen müsse. Die Begeisterung der Lamas ließ augenblicklich nach, ihre Schritte wurden langsamer. Dabei war es eine sehr seltene Gelegenheit, dass der Rinpoche des Klosters Mondron-Ling winkte und ein gesticktes Porträt von Sakyamuni auf die Tanzfläche getragen wurde. Mit einem leisen Rascheln verneigten alle Anwesenden sich bis zur Erde, und die Lamas fanden zu ihren Tanzschritten zurück.
Der Fürst sagte zu seiner Frau: »Der Rinpoche legt sich ganz schön ins Zeug.«
Mutter antwortete: »Ja, und es wäre besser gewesen, hätte er das damals schon getan, statt sich für deinen Bruder einzusetzen.«
Vater lachte: »Leider haben nur wenige das begriffen.«
»Und wenn doch, war es zu spät.«
Jeeka Rinpoche, eine kristallgeschliffene Brille auf der Nase, kam zur Begrüßung herüber. Er blickte missmutig. Vater nahm seine weiche, breite Hand und sagte: »Wir werden zu Fürst Wangpo gehen, um mit ihm abzurechnen, und du musst für uns die Schriften lesen, damit wir auf der ganzen Linie erfolgreich sind.« Das Gesicht von Jeeka Rinpoche, der so viele Jahre geschnitten worden war, begann zu strahlen.
Vater fuhr fort: »Morgen werde ich dir Almosen schicken lassen.«
Der Rinpoche legte die Hände vor der Brust zusammen und zog sich zurück.
Im Zelt hatte der Sondergesandte Huang seine Soldaten gegen unsere Mädchen eingetauscht, und seine Augen leuchteten wie die eines nachtaktiven Tieres.
Der letzte Programmpunkt des Tages war ein Fototermin.
Als wir uns um den Sondergesandten gruppiert und hingesetzt hatten, fiel mir auf, dass mein Bruder nicht dabei war. Er eskortierte weiter hinten den Transport der eingekauften Waffen: Gewehre, Maschinenpistolen und Munition.





























