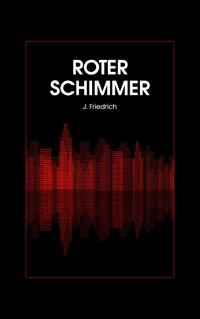
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bist du bereit für die Zukunft? 2078. Felix, ein junger Mann aus der Unterschicht, möchte es in seiner Heimatstadt Olympolis zu etwas bringen. Doch das ist gar nicht so einfach. Als er eines Tages in seinem Keller alte Bücher entdeckt, findet er heraus, dass er einen berühmten Urgroßvater hat. Nun steht seinem Aufstieg zum „Oberbürger“ nichts mehr im Weg. „Opa Freddy“ war ein Vordenker der Megastädte, die nach den katastrophalen Auswirkungen der „Dunkelzeit“ in ganz Deutschland entstanden und für politische Stabilität sorgten. Je mehr Felix als Oberbürger vorankommt, desto klarer wird ihm, dass er mit den starren und autoritären Verhältnissen alles andere als einverstanden ist. Im Zwiespalt zwischen Widerspruch und Anpassung begehrt er auf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
J. Friedrich
ROTER SCHIMMER
ERSTER TEIL
Am späten Nachmittag des 1. März 2078 begab sich Felix in den innersten Bezirk von Olympolis, dorthin, wo sich die luxuriösesten Einkaufszentren befanden. Er wusste, nur hier würde er das finden, was er suchte: einen silbernen Stift, den man althergebracht Füllfederhalter nannte.
Felix legte Wert darauf, ab und an dieses Viertel zu besuchen. Er nahm immer denselben Weg. Dennoch war es für ihn jedes Mal ein Ereignis, wenn sich hinter dem letzten Häuserblock der bereits ansehnlichen, aber immer noch eng bebauten Zufahrtsstraße ein weiter Platz öffnete, der von Fassaden aus Stahl, Glas und Beton gesäumt war, in denen sich die Sonnenstrahlen verfingen. Ab da bewegte sich Felix anders. Er gab sich alle Mühe, unter den hier flanierenden Oberbürgern nicht als das aufzufallen, was er war: ein Unterbürger, für den die Dinge, die der gehobenen Kundschaft in den Auslagen zahlreicher Geschäfte angeboten wurden, zumeist unerschwinglich waren. Wenn Felix die wundersamen Einkaufstempel durchwanderte, wurde er still, ja sprachlos. Wonach sollte er auch fragen, mit wem sprechen, da er hier doch nichts kaufen würde? Es konnte geschehen, dass er staunend vor einem der Schaufenster stehen blieb. Manchmal überkam ihn ohne Anlass das Gefühl, jemand beobachte ihn dabei. Sein Magen krampfte sich dann zusammen und vor Nervosität wurde ihm übel.
Heute ging Felix seinen Weg mit schnellem Schritt. Nichts, schon gar nicht die eigene Unsicherheit, durfte ihn aufhalten. Er ließ die schöne, mit sorgfältig gestutzten Bäumchen bepflanzte Grünfläche in der Platzmitte hinter sich, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Zielgerichtet steuerte er ein Geschäft für die höchsten Ansprüche an. Er wusste, in dessen gläsernen Vitrinen würde das von ihm begehrte Schreibgerät zu finden sein. Als er aber durch die sich vor ihm sanft öffnende Tür des Ladens trat, fehlte es ihm an Orientierung. Unschlüssig suchte er die Regale ab. Schweiß perlte ihm auf der Stirn, als er einen Schritt rückwärts machte und dabei versehentlich eine Kundin anstieß.
„Kann ich Ihnen behilflich sein?“ Noch bevor sich Felix bei der Frau entschuldigen konnte, sprach ihn ein Angestellter von der Seite, jedoch sehr höflich, an.
„Ich möchte einen Füllfederhalter erwerben.“ Diesen Satz hatte Felix x-mal im Kopf durchgespielt und wieder und wieder abgewandelt, bis ihm die Formulierung kurz und prägnant genug erschien. „Erwerben“ hatte er besonders betont.
Auf Felix’ Verlangen hin breitete der Verkäufer sogleich die vorrätigen Muster aus, die er aus einer der vielen Schubladen in dem Schrank aus Nussbaumholz, der die ganze Wand bedeckte, holte. „Bei allem, was Sie hier sehen, handelt es sich um Replikate von Modellen aus dem letzten Jahrhundert. Jedes einzelne wird in unserer hauseigenen Manufaktur gefertigt.“ Während der Verkäufer mit seinen Erklärungen fortfuhr, achtete Felix empfindlich auf jede Geste des Mannes, auf jeglichen Anflug von Überheblichkeit, die anzeigte, dass er Felix als Unterbürger entlarvt hatte. Doch der Verkäufer gab ihm dafür keinen Anlass. Er zeigte Felix zunächst, wie man die Patronen in den Stift einsetzte. Wie er sodann den Füllfederhalter vorführte, die Feder von ihm mit Schwung über eine weiße Papierfläche gezogen wurde, wo sie mit einem leisen Kratzen ein paar herrlich sattblaue Spuren hinterließ, erschien ein glückliches Lächeln auf Felix’ Gesicht.
Der heutige Aufenthalt im Luxusviertel verlief anders als für gewöhnlich: Felix würde ein Stückchen Luxus von hier mit nach Hause nehmen, wenn auch ein winziges.
Felix war sich sicher, er hatte an diesem Nachmittag einen guten Kauf getätigt. Vor gut drei Wochen, genauer am Morgen seines fünfundzwanzigsten Geburtstages, hatte er sich dazu entschlossen, ein Tagebuch zu beginnen. Er war früh aufgewacht und hatte eine ganze Weile im Bett über sich und sein Leben sinniert. Wenig Erquickliches war darunter gewesen, der Einfall mit dem Tagebuch erschien ihm da wie eine Erleuchtung. Er hatte sich daraus einen morgendlichen Entschluss gemacht, der ihm genug Schwung gab, einen voraussichtlich öden Tag zu überstehen.
Felix war zu dem Schluss gekommen, wenn er ab jetzt aufzeichnete, was er jeden Tag erlebte und wie er darüber dachte, dann würde er seinen Lebensfluss immer vor Augen haben und könnte sich täglich fragen: „Was hast du heute gut gemacht, was ist falsch gelaufen?“ In seinem Bett die Decke anstarrend hatte er sich ausgemalt, wie er bald im Geschriebenen einen roten Faden entdecken würde, der ihm half, das Richtige zu tun. Ja, er war in diesen ersten Stunden seines fünfundzwanzigsten Geburtstages vollkommen davon überzeugt, so ein Tagebuch würde ihm dabei helfen, endlich das zu schaffen, was ihm seit Jahren am meisten umtrieb: in der Hierarchie der Bürgerklassen die entscheidende Stufe nach oben zu gelangen. Wenn schon an diesem Geburtstag keinerlei Wünsche für ihn in Erfüllung gehen würden, das sollte doch ein guter Plan sein!
Später saß er mit seinem besten Freund Michal im Wohnzimmer, um auf das neue Lebensjahr zu trinken. Ab der zweiten Flasche des billigen, aber hochprozentigen Getränks, das Felix für diesen Anlass besorgt hatte, stellte sich die richtige Stimmung ein, um Michal in sein Vorhaben einzuweihen. Die Meinung seines besten Freundes war ihm wichtig.
„Ich werde ein Tagebuch schreiben, so, wie es die Menschen früher getan haben: mit einem Stift auf echtem Papier. Ohne alle Technik“, erklärte er Michal. Felix sah die großen Fragezeichen in Michals Augen. Davon angestachelt holte er weiter aus. „Ich habe das Gefühl, mein Leben gleitet mir durch die Finger. Ich komme nicht voran. Es ist jeden Tag der gleiche Mist, der mir durch den Kopf geht. Mir fehlt ein roter Faden. Doch damit ist jetzt Schluss.“
Felix war klar, das Festhalten des täglich Erlebten, um es dann irgendwann später noch einmal zur Hand zu nehmen, würde so ziemlich jeder, den er kannte, als vollkommen nutzlos und zeitraubend ansehen. So auch Michal, aber vielleicht konnte Felix von ihm immerhin ein Quäntchen Verständnis bekommen?
„Ich hinke der Zeit hinterher, weißt du. Falls es so weitergeht, bin ich bald völlig abgehängt!“
Doch alles, was Felix sagte, schien bei Michal wenig Eindruck zu hinterlassen.
„O ja. Die Zeit, die Zeit. Die vergeht viel zu schnell. Der Urknall ist nun auch schon wieder vier Milliarden Jahre her“, seufzte Michal mit gespielter Resignation.
„Vierzehn Milliarden!“, knurrte Felix. „Und die Erde ist keine Scheibe!“
„Na du Schlaumeier. Aber nimm doch lieber gleich alles auf. So viel Schreiberei ist völlig unnötig!“
„Das ist doch nicht der Punkt!“ Michals Ignoranz brachte Felix in Rage. Enttäuscht seufzte er auf. Warum verstand auch sein bester Freund ihn nicht?
„Lass gut sein, ist alles ein bisschen viel für mich“, warf Michal ein.
Felix musste sich eingestehen, Michal hatte damit recht. Er langte zu der Kiste mit dem Flaschenvorrat, um ihr Gespräch mit einem neuen Getränk in anderes Fahrwasser zu leiten.
Dienstag, 1. März 2078
Im Abschlusszeugnis meiner Schule steht, dass ich zwar so rede, wie es mein niederer Bürgerstatus erwarten lasse, meine Aufsätze aber erstaunlich sinnreich seien und ich darin oft wunderbare Sätze bilden würde. Abgesehen davon, dass ich zu jener Zeit erst seit Kurzem diesem „niederen Bürgerstatus“ angehörte, werde ich mich bemühen, in meinem Tagebuch viele schöne, gut geformte Sätze aufzuschreiben.
Ein dickes Heft mit grünem Einband und mit vielen leeren Seiten habe ich ja schon länger. Das ist nun wirklich alt, muss noch von meinem Urgroßvater stammen. Der hatte hier im Haus eine ganze Menge alter Sachen hinterlassen, als er vor vielen Jahren, ich war noch ein Kind, auszog. Das meiste davon ist längst in den Müll gewandert. Nur das Büchlein, das hat die Jahre unbeachtet in einer Kiste unter meinem Bett überdauert. Mir geriet es ein paar Tage nach meinem Geburtstag zufällig in die Hände. Als ich es aufschlug, sah ich, dass seine Seiten über die Jahre fleckig-gelb geworden waren. Na ja, im Schlafzimmer ist es eben immer ein wenig feucht. Das Heft sah nicht nur alt, sondern schon schäbig aus. Dennoch war ich mir sofort sicher, genau dieses Heft würde mir als Tagebuch dienen.
Für die meisten ist alt und schäbig sowieso das Gleiche. Ich finde das nicht. Im Gegenteil, ich will immer viel über die alte Zeit erfahren. Wie die Leute hier früher lebten, möchte ich wissen. Wie die Stadt vor hundert oder mehr Jahren aussah, das interessiert mich. Aber das ist schwierig. Alles Geschehen in dieser Stadt, bevor sie den neuen Namen Olympolis bekam, gilt als unwichtig. Ich glaube beinahe, selbst die Oberbürger sind noch in ihren noblen Replikate-Firlefanz verliebt, aber das war es dann auch schon mit dem Interesse am Alten.
Ich habe oft darüber nachgedacht, warum die Vergangenheit, selbst die eigene, für die meisten von uns so bedeutungslos scheint. Nur das Jetzt zählt. Wie es die Oberbürger damit halten, weiß ich allerdings nicht. Die meisten Hauptbürger könnten zumindest etwas über ihrer Familiengeschichte sagen. Aber dann gibt es die vielen anderen, die Normalbürger, wie ich einer bin, und ganz unten die Masse der Hilfsbürger. Viele von uns sind irgendwann neu hierhergekommen. Oder sie sind die Kinder von solchen, die irgendwo in der Welt entwurzelt wurden, um hier in der Megastadt eine neue Heimat zu finden. Da nimmt man wenig mit von früher.
Alle, die ich kenne, haben genug mit dem Jetzt zu tun. Erinnerungen sind da nur hinderlich, die Gegenwart ist ausreichend schwierig. Ich kenne niemanden, der sich die Mühe machen würde, das zu bedauern. Wahrscheinlich ist es unserer Regierung sogar ganz recht, wenn über unserer Vergangenheit ein Schleier liegt und die Masse der Leute kein Interesse hat, ihn auch nur ein bisschen anzuheben. Dazu passt etwas, das meine Großmutter vor vielen Jahre sagte und das mir komischerweise Wort für Wort in Erinnerung geblieben ist: „Die vergangene Zeit wird bei uns gerne in einen tiefen Brunnen versenkt, wo sie die einen nicht bemerken und die anderen nicht stört.“ Das war noch zu der Zeit, als wir hier zusammen wohnten. Ich konnte mit ihren blumigen Sprüchen oft nicht viel anfangen, aber ich mochte sie und ihre Weisheiten vermittelten mir Geborgenheit. Das war damals, in meiner Kindheit, bevor sie mich so unsagbar enttäuschte.
Für jemanden, der wie ich nur ein einfacher Normalbürger ist, habe ich eine sehr gute Schule besucht. Aber selbst dort wurde uns wenig über Geschichte gelehrt. Die letzten tausend Jahre hatte man in vier, fünf Abschnitte eingeteilt und über jeden Abschnitt wurde nur wenige Schulstunden lang gesprochen. Soviel wir auch in anderen Fächern lernten, unsere Geschichtskenntnisse waren schlecht. Das meiste wurde uns noch über die Zeit seit Entstehung der Megastädte erzählt, also die letzten vierzig Jahre. Davor gab es ziemlich viel Chaos und auch Krieg. „Dunkle Zeit“, „finstere Zeit“ oder „Zeit der Zerstörung“ nannten wir die Jahre in der Schule, ohne viel darüber zu erfahren. Vielleicht waren diese Zeiten einfach zu düster, als dass man sich heute noch daran erinnern möchte. Die Zeit nach der Schule war so schwierig für mich, dass ich kaum Gelegenheit hatte, mein historisches Wissen zu verbessern. Es wäre eigentlich eine gute Sache, daran etwas zu ändern.
Felix hatte unversehens gut zwei Seiten seines Tagebuchs gefüllt. Nun besah er sich stolz sein kleines Werk. Die tintenblaue Handschrift auf den gelblichen Seiten sah wirklich sehr gut aus! Das Fleckige auf dem Papier stört jetzt gar nicht mehr. Dennoch haderte Felix mit sich. Die rechte Hand schmerzte von der ungewohnten Übung. Hatte er sich denn nicht gut vorbereitet, die letzten Tage mit einem uralten Bleistiftstummel das Schreiben regelrecht trainiert? Hatte er nicht eine Schule besucht, wo man noch Wert darauf legte, dass die Schüler eine ordentliche Handschrift entwickelten?
Es hatte nichts genützt, die Schulzeit lag schon eine Weile zurück und viele der dort gelernten Fähigkeiten waren ihm abhandengekommen. So auch das Schreiben von Hand.
Da war noch eine Menge in seinem Kopf, was er am liebsten gleich zu Papier gebracht hätte, aber Felix entschied, unter Schmerzen würde er kaum ein befriedigendes Ergebnis erzielen. Er blickte auf die hölzerne Treppe, die in den oberen Teil des Hauses führte. Mit nach hinten gelegtem Kopf lugte er die Treppe hinauf. „Man könnte da mal fegen“, dachte er sich. Sogleich verwarf er die Idee. „Zu unwichtig!“ Schließlich nutzte Felix keines der Zimmer in der ersten Etage regelmäßig. Ob da Staub auf den Dielen lag oder nicht, war also ziemlich egal.
Seine Gedanken gingen in die entgegengesetzte Richtung: „Keller aufräumen!“ Gut die Hälfte des Hauses war unterkellert. Seit Felix denken konnte, wurde der Keller zum Abstellen aller möglichen, meist überflüssigen Dinge genutzt. Felix hatte es über die Jahre nicht anderes gehalten. Im letzten Jahr hatte er sich aber fest vorgenommen, die Räume gründlich auszumisten. Allein, er hatte sich bislang nicht dazu überwinden können. Jetzt aber war die Gelegenheit günstig. Entschlossen wandte er sich Richtung Kellertür. „Mal richtig Ordnung da unten reinbringen“, erschien ihm auf einmal als eine wahrhaft sinnige Angelegenheit.
Nachdem er die Tür geöffnet hatte, starrte er in den nach unten führenden Gang wie in einen dunklen Schlund. Eigentlich musste hier doch gleich die Beleuchtung angehen! Unbehagen stieg in Felix hoch. Zum Glück ging ihm schnell auf, dass die Steuerung des Lichts im Keller, anders als im Rest des Hauses, nicht über den Cubus verlief. Statt also die Kellertür wieder zuzuwerfen, taste er ein wenig an der Wand zu seiner linken und siehe da, ein alter Lichtschalter fand sich direkt neben der Tür. Unten angelangt tat sich ein niedriger, fensterloser Raum auf, der mit einem Sammelsurium an Gegenständen zugestellt war. Felix roch Staub und altes Mauerwerk. Verdrießlich blickte er auf die sich vor ihm auftürmende Aufgabe. Wie weit führte denn dieser Keller nach hinten? Felix erkannte ganz vorne eine Palette mit Protein-Shakes, die, vor zwei Jahren billig erworben, sich bald als unappetitliche Mixtur entpuppten und sodann in den Keller verfrachtet von ihm vergessen worden waren. Immerhin konnte er sich angewidert an den Geschmack erinnern. Er arbeitete sich Stück für Stück durch das ganze alte Gerümpel. Bald bemerkte er, dass die körperliche Anstrengung ihm guttat. Jetzt hielt ihn nichts mehr auf, auch nicht die Spinnweben. Als er schließlich auf ein paar Kleinmöbel stieß, zögerte Felix einen Moment. Nachdenklich strich er den Staub von einer hölzernen Tischplatte. Die Dinge stammten womöglich noch von der Großmutter. Aber das war kein Grund, schwach zu werden, entschied er schnell. Er schaffte die sperrigen Sachen die Treppe hoch nach draußen und ächzte unter der Last während des kurzen Weges bis zum Müllcontainer an der nächsten Straßenecke. Dieser nahm alles auf, vom Protein-Shake bis zum Bücherregal, und zermalmte es anstandslos.
Nach drei Stunden schwerer Arbeit ließ sich Felix mit schmerzenden Muskeln ganz vorsichtig auf der untersten Kellerstufe nieder. Er war geschafft, das schweißnasse Hemd klebte auf seiner Haut. Nun war wieder gut Platz. Zufrieden ging sein Blick durch den ganzen, jetzt wieder unverstellten Keller. Ein zweiter, kleinerer Raum war auch wieder frei zugänglich. Dort befanden sich zwar noch ein paar leere Regale, aber Felix entschied, dass sie zum Inventar zählten, das hier unten verbleiben durfte.
Erst als er sich erhob und etwas tiefer in den zweiten Raum hineinging, entdeckte er in einer Nische den riesigen Holzschrank. Felix konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, ihn jemals zuvor gesehen zu haben. Er war viel zu erschöpft, um sich auch noch darum zu kümmern. „Der ist für nächstes Mal“, klärte er mit sich selbst die Lage. Er wollte zurück nach oben, zurück zum Tagebuch, das weiter beschrieben werden wollte. Einzig weil er sah, dass eine der drei Schranktüren ein Stück offenstand, ging er hin, um sie zu schließen. Doch die Tür widersetzte sich. Irgendetwas sperrte von innen. Widerwillig schaute er genauer hin. Felix konnte sich nicht erklären, warum ihm beim Öffnen der Schranktür das Herz pochte. Dahinter fand sich jedenfalls eine Fülle an Papierkram: Im untersten Fach sauber abgelegt in ein paar schweren Ordnern, alle in Reihe und Glied aufgestellt und akkurat, aber ziemlich unleserlich von Hand beschriftet. Er schlug einen Ordner auf, überflog das eine oder andere Papier aus dem Sammelsurium aus schmalen Heftern und gehefteten Blätterstapeln in den restlichen Fächern. Dabei fand er neben bedruckten Blättern seitenweise handgeschriebene Notizen. Eine der mit solchen Papieren gefüllten Kisten stand ein wenig über den Rand des Schrankbodens hinaus. Deshalb also schloss die Tür nicht.
Felix stieß den Atem aus. Alles roch ein wenig muffig und war ohne Zweifel alt. Das wenige, was er flüchtig las, interessierte ihn nicht, er konnte sich auch keinen Reim darauf machen. Doch das Papier verströmte eine Aura des Vergangenen, Einzigartigen. Mit frisch entfachter Neugierde begann Felix, den Schrank zu untersuchen. Die anderen beiden Schranktüren ließen sich problemlos flügelförmig öffnen. Dahinter offenbarten sich weitere Dinge aus einer unbestimmten Vergangenheit. Angesichts des Durcheinanders aus alten Ordnern, schmalen Schachteln und ein paar flacher, silbriger Kästen aus Kunststoff überkam Felix das prickelnde Gefühl des Entdeckers. Vergessen war die Müdigkeit. Die silbrigen Kästen erkannte er als Technik. Sie erinnerten ihn an die alten Konsolen, die in seiner Kindheit die Großmutter genutzt hatte. Allerdings waren diese Teile hier aufklappbar und ziemlich wuchtig. Gehörte diese Hinterlassenschaft seiner Familie oder sogar einem Vorbesitzer des Hauses? Der Gedanke an seine Familie versetzte ihm den üblichen Stich, den er sich sogleich verbat. Er entdeckte Zettel, die an den Deckeln der Geräte klebten. Darauf waren säuberlich Jahresangaben vermerkt. Als ältestes Datum fand Felix „Laptop 2024-2026“, das jüngste Gerät war mit „2030/31“ beschriftet. Felix drückte ein paar Tasten, es passierte nichts. Doch dieser Misserfolg konnte ihn nicht abschrecken. Er ließ die Technik stehen und machte sich eifrig daran, den restlichen Schrankinhalt zu erforschen. Auf dem Boden, zunächst durch lose Blätter verdeckt, befanden sich zwei hölzerne Kisten. Eine, länglich und schlank, war versiegelt. Felix meinte, ein merkwürdiger, aromatischer Geruch, der den sonstigen Kellergeruch überdeckte, würde ihr entsteigen. Es war dieser Eindruck, der Felix zögern ließ, das Siegel zu brechen. Stattdessen widmete er sich erst einmal dem anderen Kasten, der schwer und edel mit Stoff bezogen war und ohnehin einen imposanteren Eindruck auf ihn machte. Felix fasste sich ein Herz und klappte den hölzernen Deckel hoch. Ein Ausruf der Verblüffung entfuhr ihm, als er im Inneren fünf aneinander gereihte, dicke Buchrücken erblickte. Vorsichtig klaubte er einen der schweren, in Leder gefassten Bände heraus. Aufgeregt schlug er das Buch auf und blätterte an verschiedenen Stellen. Dabei verlor sich seine Begeisterung mehr und mehr. Etwas Politisches zu den Megastädten, stellte er enttäuscht fest und klappte das Buch wieder zu. Für einen Moment noch wog Felix den Band unschlüssig in der Hand. Dann kapitulierte er vor der Herausforderung, die ihm die unzähligen, zu komplizierten Sätzen zusammengefügten Wörter darin bereiten würden. „Wer liest denn Texte mit mehr als sechs, sieben Sätzen?“, schoss es ihm wie zur Entschuldigung durch den Kopf. Plötzlich hatte er es sehr eilig, alles wieder in den Schrank zu packen. Er achtete lediglich darauf, dass die Schranktüren nun richtig schlossen, damit kein Makel auf der schönen neuen Kellerordnung lag. Während Felix schließlich erschöpft die Kellertür hinter sich schloss, war es für ihn bereits eine ausgemachte Sache, den Rest des Abends im Vergnügungszentrum ein paar Blöcke stadtauswärts zu verbringen. Sicher traf er da wenigstens ein paar Bekannte aus der Clique. Er musste sich dringend erholen.
Dienstag, 2. März 2078
Nachdem ich mich gestern im Keller verausgabt hatte, musste ich den Rest des Abends einfach etwas anderes machen. Ich warf etwas gegen die Müdigkeit ein und machte mich auf ins Vergnügungszentrum. Dort angekommen überredeten mich Michal und ein paar andere, noch in die Holobar eines nördlichen Vergnügungszentrums umzuziehen. Wir blieben dann bis tief in die Nacht. Die Holobars im Norden sind eindeutig die besten. Erstaunlich, welche Möglichkeiten dort angeboten werden. Einfach mit der Datenbrille kann man für wenig Geld eines der angebotenen Netzwerke betreten. Egal, ob du in die Rolle eines Kämpfers schlüpfst, der ganz Olympolis rettet, ob du als Wissenschaftler auf geniale Erfindungen stößt oder einfach als Star angehimmelt wirst, es gibt tausende von Spielwelten, in die man sich begeben kann. Auch der unbedeutendste Hilfsbürger kann hier zum Gewinner werden.
Aber die Holobars haben ja noch mehr zu bieten. Man zahlt noch etwas dazu und bekommt dafür einen „Liquidus“. Das ist ein flüssiges Gebräu, welches mittels eines kleinen Geräts direkt ins Blut verabreicht wird. So ein Liquidus ist schon ein gefährliches Zeug. Nicht nur die chemischen Substanzen gehen direkt ins Gehirn, auch die Nanotechnik-Partikel. Dort öffnen sie gezielt Hirnbereiche für die Programme aus den Netzwerken. Oder die Programme sitzen selbst auf den Nanoparts, oder beides. Jedenfalls macht man, vollgepumpt mit dem Liquidus und im Netzwerk gefangen, den Schritt hinein in eine „Wünsch dir was“-Realität mit einem „Ich“ jenseits der eigenen Haut. „Erschaffe dich neu in deiner Erlebniswelt“ nennt das die Werbung. Mehr noch, mit zueinander passenden „Liquidus“-Cocktails können Bekannte oder Freunde ihre Welten miteinander teilen. Das ist das Größte, sagt zumindest die Werbung.
Als ich vor ein paar Monaten neugierig einen Blick durch eine unverschlossene Tür im Vergnügungszentrum werfen konnte, sah ich einen Haufen dröger Gestalten mit Datenbrillen einfach nur regungslos im Halbdunkel dastehen. Sie waren in Reihen aufgestellt. Jeder hatte dicke Kabelstränge an sich, die in den Boden führten. Zwischen den Reihen war genug Platz, so dass ein Holobar-Angestellter sich hin und her bewegen konnte, um den Zustand des einen oder anderen Kunden zu prüfen. Einer von ihnen, ganz in meiner Nähe, drehte plötzlich den Kopf in meine Richtung. In seinem ausdruckslosen, erstarrten Gesicht sah ich nichts, keine Verwunderung, keine Freude, keinen Ärger, einfach gar nichts. Wäre dieser Anblick nicht schon verstörend genug gewesen, bewegte diese Gestalt plötzlich noch ein Bein. So, als wolle sie einen Schritt direkt auf mich zu machen. Ich wich entsetzt zurück, konnte einen Aufschrei nicht verhindern, so dass man auf mich aufmerksam wurde. Barsch wurde mir die Tür vor der Nase zugeworfen. Ich schwor mir nach diesem Erlebnis, dass ich kein neu geschaffenes Ich bräuchte. Also mache ich nicht mit, egal, was die anderen deswegen von mir halten. Ich habe auch gehört, dass so mancher sich schon tagelang in den Holobars verloren hat. Der Körper ist dann irgendwann soweit runter, dass der Geist zwangsweise zurückgeholt werden muss.
Die Glücksgefühle sollen ja die ersten Male kolossal sein, wurde mir gesagt. Aber je länger man dabei ist, desto mehr lässt der Kick nach. Irgendwann erinnert man sich nur noch lückenhaft an die durchgespielten Welten. Das wiederum reizt die Leute zum Weitermachen, denn sie versuchen nun mit jedem neuen Spiel, den schwindenden Glückstraum zurückzuholen. Manch einer schafft es nicht mehr, zwischen der Erlebniswelt und dem wirklichen Leben zu unterscheiden. Ich befürchte, die eine oder andere Gestalt, die da in der Holobar an den Kabeln hing, war nicht mehr weit davon entfernt.
Eine Welt, die man sich so machen kann, wie es einem gefällt, einmal jemand zu sein, den alle bewundern, ein Held, oder einfach nur in Luxus zu schwelgen, das ist schon toll. Für viele von uns Unterbürgern ist das die einzige und gerade noch erschwingliche Möglichkeit, sich aus dem tristen Alltag einmal zu verabschieden. Aber auch wenn ich den einen oder anderen Glückskick gebrauchen könnte, so schäbig geht es mir nicht, dass ich mich auf diese Weise ruinieren möchte.
Heute früh schälte ich mich mit schwerem Kopf aus dem Bett. Aber es half ja nichts, ich musste pünktlich auf der Arbeit erscheinen. Mein Job als Hilfscontroller im Transportwesen ist für mich ein notwendiges Übel. Mein Sektor gehört zum zentralen Betrieb am Wasser. Er wickelt den Warenverkehr aus und nach Olympolis ab. Deswegen ist er eher klein, denn die Megastadt versorgt sich ja mit dem meisten selbst. Im Prinzip überwache ich ein Netzwerk, dass jedem Container einen Stellplatz zuweist, bevor er voll automatisch entladen wird. Ich mache das, was Controller treiben: Die Arbeit der intelligenten Netzwerke beaufsichtigen. Fast immer bestätige ich das, was mir das Netzwerk vorschlägt. Wie es bestimmt zigtausend andere Controller in Olympolis auch tun. Tag für Tag, Woche für Woche die ewig gleichen Abläufe. Es ist jedoch ein sauberer, erträglicher Job. Ich habe es damit besser getroffen als manch anderer.
Über meinem Arbeitsplatz, in einem sauberen, klimatisierten Büro, sitzt mein Chef und schaut seinerseits darauf, was ich und die Typen aus den benachbarten Sektoren anstellen. Ich bin mir sicher, auch seine Netzwerkkonsole erledigt für ihn das Wesentliche. Wahrscheinlich geht das so weiter bis ganz nach oben.
Auf unserem Betriebshof gibt es ständig ein paar ältere Hilfsbürger. Das sind magere Typen, die schon über die Zeit des Schuftens hinaus sind. Aber sie müssen hier bei uns arbeiten, damit sie einigermaßen ehrlich durchkommen. Nach einer Weile müssen sie sich die nächste Arbeit suchen. Für ihresgleichen sind dreckige oder schwere Arbeiten die einzig möglichen Beschäftigungen, die ihnen die Stadt bietet.
Es ist schon richtig, für alle gelten die gleichen Gesetze, egal, ob Ober-, Haupt-, Normal- oder Hilfsbürger. Aber in der Anwendung und in der Auslegung, da gibt es gewaltige Unterschiede. Man sagt, für die Hilfsbürger gibt es Extragerichte. Schnell landen sie schon wegen kleiner Vergehen vor so einem Gericht. Da wird dann auch bei schlechter Beweislage hart geurteilt. Das alles weiß ich von Michal. Die meisten meiner Freunde sind Hilfsbürger und leben vorschriftsmäßig, versuchen es zumindest. Viele Hilfsbürger bekommen angesichts ihres harten Lebens irgendwann eine Schwäche für Liquidus und Holobars. Und für Gewalt. Kleinigkeiten genügen dann schon, damit sie aus der Haut fahren. Michal, beispielsweise, mein bester Freund ist irgendwo dazwischen. Ich habe ihn schon erlebt, wie er sich mit leuchtenden Augen in eine Prügelei geworfen hat. Aber meist ist er vernünftig, ein großzügiger und gutmütiger Typ.
„Wir treffen uns in zwei Stunden. Sei ja pünktlich!“ Mit dieser so knappen wie eindeutigen Aufforderung meldete sich Michal bei mir. Dummerweise hatte ich gestern Nacht im Spielrausch zugestimmt, heute da weiterzumachen, wo wir ein Ende gefunden hatten. Typisch für Michal, mich mit gespielter Strenge daran zu erinnern, denn er weiß, ich werde zögern, die Verabredung einzuhalten.
„Mal sehen“, war meine ebenso knappe, wie ausweichende Antwort für ihn.
Donnerstag, 4. März 2078
Nach Dienstschluss konnte ich mich gestern nur noch müde auf dem Sofa ausstrecken. Mir fehlte jeglicher Elan, an Tagebuch-Schreiben war nicht zu denken. Selbst Michal, der mich schon wieder kontaktierte, blockte ich ab. Gleichzeitig ärgerte ich mich: Unten im Keller warten fünf alte Bücher auf mich, aber ich muss mich von Arbeit und Spielrausch erholen.
Heute geht es mir ein wenig besser, so dass ich Stift und Buch zur Hand genommen habe. Dieser Bücherkeller gehört zu meinem Haus. Das Haus, in dem ich lebe, seit ich denken kann, ist mein Eigentum! Es ist recht geräumig, aber alt, über der Tür steht die Jahreszahl 1930 in Stein. Dennoch ist es gut in Schuss und nah am Zentrum.
Keiner, den ich kenne, besitzt ein Haus. Ich denke, das bisschen Besondere an mir hängt mit meiner Familie zusammen, meiner Großmutter, ihrem Vater und ihrer Tochter, die formal meine Mutter ist. Über meine Familie spreche ich nicht gerne, aber es ist etwas anderes, darüber zu schreiben. Denke ich an mich als kleinen Jungen zurück, würde ich fast meinen, meine Kindheit war unbeschwert. Jedenfalls lebten wir in guten Verhältnissen. Ich meine, mein Urgroßvater war vermögend. Ich habe nicht viele Erinnerungen an ihn, aber ich weiß, dass ich ihn Opa Freddy nannte.
Als ich älter war, zog der Urgroßvater zwar in einen Vorort, aber sonst änderte sich für mich nichts. Ich hatte ein paar Freunde, wenn auch wenige, und besuchte die Schule, wo mir das Lernen leicht fiel. Meine Mutter soll früher eine sehr schlanke und hübsche Frau gewesen sein. Ich habe sie eher als mager in Erinnerung, ja knochig und dürr. Und dürr war auch ihre Liebe zu ihrem Sohn. Sie verhielt sich mir gegenüber kalt und reserviert. Keine Ahnung, warum sie so war. Dass ich dennoch überwiegend gute Erinnerungen an meine frühen Jahre habe, ist meiner Großmutter zu verdanken. Gern verbrachte ich die Zeit in ihrer Nähe. Ohne sie wäre es eine schwierige, ja trostlose Kindheit für mich gewesen.
Ein paar Jahre später, 2066 muss es gewesen sein, starb der Urgroßvater. Meine Mutter wollte unbedingt weg aus der Stadt. Ich nicht, wir stritten heftig darüber. „Ich will mein Leben leben, was du machst, ist mir egal!“, schleuderte sie mir entgegen. Ich war immerhin schon dreizehn oder vierzehn Jahre alt und erwartete nicht mehr viel von ihr. Mutters Liebling war ich nie gewesen, das war mir bewusst. Aber nun reagierte sie einfach auf alles, was ich tat, nur noch gereizt. Betrat ich das Zimmer, ging sie mit verkniffenem Gesicht hinaus.
Die Großmutter hat eigentlich immer zu mir gehalten. Aber sie war noch ganz in der Trauer um ihren Vater gefangen. Zuhause wurde es für mich von Monat zu Monat unerträglicher. Die Großmutter erkrankte, ich wusste nicht recht woran, sah nur, wie es nicht besser wurde.
Das ging ein knappes Jahr so, dann ist sie wirklich weggegangen, meine Mutter. Sie zog nach Hamburg. Und sie brachte meine Großmutter dazu, sie zu begleiten. Das empfand ich als Verrat, also ging ich nicht mit. Ich fühlte mich stark genug und wollte nur Abstand zu meiner Mutter. Auch auf die Großmutter war ich nunmehr schlecht zu sprechen. Dass mich jemand bedrängt hätte mitzukommen, daran kann ich mich nicht erinnern.
Mit dem alten Schmidt von nebenan, einem pensionierten Bankangestellten, vereinbarten sie, dass er ein Auge auf mich haben sollte. Plötzlich war ich frei und konnte tun und lassen, was ich wollte! Aber ich war erst vierzehn. Es ging mir nicht gut, ich fühlte mich alleine. Der alte Schmidt bemerkte das wohl. Es gelang ihm, mich zu überreden, bei ihm einzuziehen. Vielleicht wollte er sich auch das Haus unter den Nagel reißen. In seiner kleinen Wohnung im Nachbarhaus teilte er für mich ein Zimmerchen ab. Doch ich ertrug die Nähe zu diesem Mann nicht, es ekelte mich schon vor seinem Geruch. Durch die dünnen Wände hörte ich des Nachts sein Schnarchen - und dann die Geräusche, die er im Bad machte. Drei Tage blieb ich, dann ging ich wieder zurück. Er klingelte ein paar Tage lang an meiner Haustür, versuchte mich zu überreden und drohte, als er damit nicht weiterkam. Ich war kräftig und großgewachsen für mein Alter. Ein paar deutliche Worte von mir, die er mir vielleicht nicht zugetraut hatte, brachten ihn zur Ruhe.
Ich vermisste meine Großmutter. Gleichzeitig war ich bitter enttäuscht von ihr. Da war eine unheimliche Wut in meinem Bauch. Sie fraß sich unversöhnlich und eisenhart in mir fest. Nichts mehr daran war kindlich. So mies es mir auch ging, die Wut hielt mich davon ab, den beiden nach Hamburg zu folgen. Und ich war stolz, den alten Schmidt verscheucht zu haben. Von nun an war ich auf mich gestellt und wollte nur noch allein sein!
Ein gutes Jahr darauf folgte der entscheidende Einschnitt. Mich traf ein Schlag ins Gesicht, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Mit dem sechzehnten Geburtstag wird man bei uns geschäftsfähig und in einen Bürgerrang eingestuft. Dafür ist die Herkunft, also die ortsansässigen Angehörigen, entscheidend. Doch meine Familie war nicht nur nicht ortsansässig, sondern glänzte in den entscheidenden Augenblicken des Verfahrens durch absolute Untätigkeit. Die behördliche Prozedur überforderte mich kolossal. Ich war ja noch ein halbes Kind. Der alte Schmidt, von dem meine Mutter und Großmutter vielleicht meinten, er würde mir helfen, war schon Monate zuvor weggezogen. Nach meinem Auszug hatten wir nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Ich musste fürchten, dass mein gesellschaftlicher Status endgültig futsch war. In der Tat gehörte ich ab sofort zur Unterschicht und alles davor war ohne Bedeutung. Die meisten meiner Schulfreunde kannten mich nicht mehr, wahrscheinlich hatten es die Eltern ihnen so gesagt. Die Schule konnte ich zwar noch mit Erfolg zu Ende bringen, bis zum Schluss blieb ich ein passabler Schüler. Aber danach endete mein Bildungsweg. Ich fühlte mich in diesen Monaten mehr denn je einsam und verlassen. Mehr noch, ich wütete gegen die ganze Welt. Immerhin verfügte ich als Normalbürger noch über einige Rechte, so dass mir mit sechzehn automatisch das Haus überschrieben wurde. Das ließ mich neue Kraft schöpfen.
Ich suchte mir eine einfache Arbeit im Lager einer Fabrik. Mit dem ersten selbstverdienten Geld in der Hand wuchs meine Selbstachtung. Ich stieg nach ein paar Monaten sogar auf, da ich einfach mehr konnte, als man mir, dem Ungelernten, zutraute. Langsam kämpfte ich mich aus der schlimmsten Krise heraus, kam besser zurecht. Um mich herum war jetzt ein anderer Typ Mensch, Leute aus der Unterschicht, und mit der Zeit gewöhnte ich mich daran. Mit Anfang zwanzig bemühte ich mich um einen besseren Job, aber jede meiner Bewerbungen schlug fehl. „Leider sind Sie sind nicht würdig genug für diese Anstellung“, schrieb man mir, noch mit einem Anflug von Verbindlichkeit, in einer der Ablehnungen. Mehr als einmal wurde mir beim Vorstellungsgespräch ganz unverhohlen ins Gesicht gesagt, einem Menschen meiner Stellung fehle es an der nötigen Persönlichkeit. Von der Qualifikation ganz zu schweigen.
Schließlich, ich erwartete es kaum noch, durfte ich im Hafen einen erkrankten Hilfscontroller ersetzen. Als dieser einige Wochen später nicht auf seinen Platz zurückkehrte, bot mir mein Chef die Stelle dauerhaft an.
Ja, ich habe mich in meinem Leben einigermaßen eingerichtet. Ich habe ein paar Freunde gefunden. Sie stempeln mich nicht als abgehoben ab, auch wenn ich anders rede, anders wohne als sie. Ich habe mich damit abgefunden, dass sie öfter über mich lächeln. Ich gebe mich eben nicht nur den Verlockungen der Vergnügungszentren hin. Nun, ihr Lachen ist meist nicht böse gemeint, und wenn doch, weiß ich mich inzwischen zu wehren.
Vernarbte Enttäuschungen trage ich mit mir herum. Viel zu häufig sind die Gelegenheiten, die mich daran erinnern. Vielleicht würde mir meine Unzufriedenheit nicht immer wieder aufs Neue aufstoßen, hätte ich nicht in Kindesjahren bessere Zeiten erlebt. Auch wenn ich damals noch ein kleiner Junge war, davon ist etwas in mir zurückgeblieben, eine Art Sehnsucht. Ich weiß längst, als Normalbürger wird sich nichts für mich ändern. Keine Chancen, kein Aufstieg. So gärt in mir seit einiger Zeit nur eine Frage: Kann ich es zum Hauptbürger schaffen? Aber die Kluft, die ich dafür überwinden muss, ist gewaltig. Ich brauche dringend einen guten Einfall, wie ich es angehe.
Mein Chef ist ein ziemlich langweiliger Hauptbürger. Ich sollte besser „bieder“ schreiben, das ist ein elegantes, wenn auch altmodisches Wort. Aber er setzt sich mit seinen Leuten an einen Tisch. Selbst mit den Hilfsbürgern. Wie wäre es damit: Ich überwinde mich und gehe demnächst zu ihm, halb dienstlich, halb privat. Er wird bestimmt verstehen, dass ich etwas aus mir machen möchte. Vielleicht hilft er mir, meine Sache voranzutreiben. Schließlich hat er mir auch die Arbeit als Hilfscontroller besorgt.
Freitag, 5. März 2078
Zum Freitag hatte sich die Arbeit in meinem Sektor wieder gestapelt. Als Ausgleich für den Stress hielt ich auf dem Heimweg an einem besseren Imbiss an, um ein Schnitzel mit Gemüse zu kaufen. Dazu noch ein Stück Käse. Alle ein, zwei Wochen gönne ich mir solche natürlichen, aber teuren Lebensmittel. Die übrige Zeit bin ich wie jedermann auf das erschwinglichere Angebot angewiesen. Meist wähle ich das, was es in allen erdenklichen Farben gibt: mit Vitaminen angereicherte Mixturen. Nährstoffmäßig sind sie genau ausbalanciert, ansonsten rein synthetisch und leicht sämig. Viel besser sind die Pasten auch nicht. Nur hat man mal eine andere Konsistenz zwischen den Zähnen. Wenn ich mir ab und an ein gebackenes Brot leiste, kann ich die dick geschnittenen Scheiben ganz gut mit diesen Pasten beschmieren.
Nur wenig teurer sind die nachgemachten Sachen, die so ähnlich schmecken sollen, wie ihre natürlichen Vorbilder. „Käse-gleich“ oder „Hühnchen-gleich“. Auch „Brot-gleich“ gibt es und noch vieles mehr. Die meisten Kunden werden das „gleich“ im Namen als „sofort“ verstehen, also nicht im Sinne von „ähnlich“. Und das ist wohl auch von den Herstellern gewollt. Der Geschmack jedenfalls gleicht ganz und gar nicht den Originalen. Gut bekömmlich, ja gesund, sind diese Sachen angeblich dennoch.
So gut wie alles, was wir essen, wird in den Außenbezirken erzeugt. Dort befinden sich große Fabriken, in denen das Essen für die Massen produziert wird. Das Rohmaterial dafür kommt aus hunderten hochhaushoher Landwirtschaftstürme. In deren Erdgeschossen stehen Biomasse erzeugende Inkubatoren. In den Etagen darüber sollen sich auch Tierställe und Turbogärten mit optimiertem Kunstlicht befinden. Von hier kommt der stetige Nachschub an Grundstoffen für die Inkubatoren.
Ganz weit draußen, schon an den Grenzen, da wohnen die Bauern, deren Tiere auf Graswiesen weiden. Dort wachsen Getreide, Obst und Gemüse im Freien. Die Bauern produzieren die teuren, natürlichen Lebensmittel. Der Großteil der Menschen ist jedoch auf das Fabrikessen angewiesen und scheint ganz zufrieden damit zu sein. Ich bin auch hier wieder eine Ausnahme. Das lässt sich leicht erklären: Ich sehne mich einfach nach dem guten Essen meiner Kindheit zurück. Jenes Essen, das ich mir heute nur noch selten leisten kann. Meine Großmutter hatte immer fürsorglich darauf geachtet, dass bei uns zuhause etwas Vernünftiges auf den Tisch kam.
Der schmale Weg entlang des Flusses war weder der schnellste noch der kürzeste, um zu Felix´ Arbeitsstätte zu gelangen. Dennoch hatte er sich dafür entschieden. Felix kannte und schätzte diesen vergessenen, unbebauten Streifen Natur am Fluss. Hier entkam er dem städtischen Lärm und der Enge. Felix hoffte, die Stille hier würde ihn im Kopf klarer und ruhiger machen.
Die Hoffnung, sein Abteilungsleiter würde ihm behilflich sein, zum Hauptbürger aufzusteigen, hatte sich am Wochenende in seinem Kopf wie eine unumstößliche Wahrheit festgesetzt. Darum kostete es ihn am Montagmorgen kaum Überwindung, seine Idee ohne weiteres Grübeln anzugehen: Noch von zu Hause hatte er den Mann via Konsole um ein Gespräch gebeten. Felix hatte erwartet, erst nach Tagen eine Antwort zu erhalten, aber bereits wenige Minuten später kam die Bestätigung für einen Termin am nächsten Tag. Das war heute. Felix hatte keine klare Vorstellung, wie er ein solches Gespräch angehen könnte. Wie würde sein Chef reagieren?
Vor zwei Tagen hatte es geschneit. Es war ein fantastisches, seltenes Ereignis in der Megastadt. Mit wem man auch darüber sprach, alle waren entzückt davon. Von den verschneiten Wiesen des Uferstreifens waren inzwischen nur noch schmutzig-weiße, nässende Schollen übrig geblieben. Der sonst knüppelharte, erdige Weg hatte sich in eine Strecke voller Pfützen verwandelt. Stellenweise war es auf dem durchnässten Untergrund rutschig, dann setzte Felix seine Schritte besonders vorsichtig. Er hatte genügend Zeit eingeplant. Um nichts in der Welt wollte er stürzen und seine gute Hose beschmutzen.
Felix nahm die kurzfristige Terminvergabe als ein gutes Zeichen für das, was ihn erwartete. Ansonsten fiel ihm auch in dieser kleinen, menschenleeren Oase inmitten der Megastadt wenig Hilfreiches für die bevorstehende Unterredung ein. Er passierte ein paar abseitig im kniehohen, welken Gras stehende Häuserreste – vergessene Überbleibsel von etwas, das nicht mehr erkennbar war. Wie kompliziert die Dinge auch sein mögen, irgendwann bleibt so oder so kaum etwas übrig, dachte sich Felix beim Anblick offener Dächer und verfallener Fassaden. Er entschied, gegenüber seinem Chef auf Spontaneität zu setzten.
Nach einer halben Stunde bog Felix auf den asphaltierten Weg ein, der ihn zum Hintereingang des Betriebshofes führte. Von hier musste er nur noch wenige Meter bis zum separaten Aufgang gehen, der ihn in das Büro des Abteilungsleiters führte. Thiel residierte ganz oben in einer Art kleinem Turm, der die restlichen Gebäude ein Stück überragte. Sein auf allen vier Seiten großzügig verglastes Büro bot so einen Rundumblick über alle Sektoren, für die er verantwortlich war, bis hin zu den Hafenbecken des Betriebes.
Felix hatte keinen Zugang zum Fahrstuhl, so dass er die Treppe nutzen musste. An der Eintrittschranke wies er sich aus, erhielt Zutritt und konnte das Büro seines Vorgesetzten betreten.
„Guten Tag, Herr Thiel“, presste er, vom Treppensteigen kurzatmig geworden, hervor.
„Herr Scholz, da sind Sie ja. Ganz pünktlich, wie immer“, begrüßte ihn Thiel. Er kam dabei nicht nur auf Felix zu, sondern nahm auch die Datenbrille ab. Sie für eine Unterhaltung abzulegen, war ein Akt der Höflichkeit. Felix hatte daher die seine längst von der Nase genestelt.
„Bitte“, lud ihn Thiel zum Setzen ein, „was genau führt Sie denn nun zu mir?“ Die kleinen, rötlich unterlaufenen Augen mit den angeschwollenen Tränensäcken darunter, die ohne Datenbrille zum Vorschein kamen, ruhten freundlich und fragend auf Felix.
Felix gefiel, dass sein Chef ohne Vorrede zur Sache kam. Also sprach er seinerseits ganz gerade heraus an, worum es ihm ging. „Ich suche nach einem Weg, mich für den Rang eines Hauptbürgers zu registrieren, weiß aber nicht so recht wie. Ein besserer Job würde doch sicher hilfreich sein. Sie haben mir da ja schon einmal geholfen. Es soll doch für Normalbürger Programme zur Qualifizierung geben.“ Felix unterbrach sich für einen Moment. Sein Vorgesetzter machte allerdings keinerlei Anstalten, auf die eilig vorgebrachten Sätze einzugehen. Also holte Felix seinen Trumpf hervor, einen Geistesblitz, der ihm erst auf den letzten Metern des Weges gekommen war: „Wissen Sie, ich bin im richtigen Alter, eine Familie zu gründen. Aber meine jetzigen Lebensumstände sind dafür nicht ausreichend.“ Felix war stolz auf seinen Einfall, denn Familienplanung galt unter Hauptbürgern als eine wichtige Angelegenheit.
„Sie sind mir schon lange aufgefallen“, antwortete ihm Thiel jovial. „Darum habe ich Ihnen ja auch zu Ihrer Stelle verholfen.“
„Ach ja?“, rief Felix gedehnt und freudig aus. Thiels Antwort befeuerte seine Erwartungen. Hatte er seinem Chef ausreichend für die damalige Vermittlung gedankt? „Vielen Dank für ihre Hilfe damals. Das war wirklich wichtig für mich.“
Thiel winkte ein wenig ungehalten ab. „Ja, aber so, wie Sie sich das vorstellen, wird das nichts. Das können Sie vergessen!“ Sein Chef hatte seine freundliche Tonlage höchstens um eine Nuance verändert. Dennoch war das, was er sagte, wie eine schallende Ohrfeige für Felix.
„Aber wieso denn nicht?“
Thiel erhob sich, er schien dem Ganzen plötzlich überdrüssig zu sein „Ihnen fehlt der lange Atem und das Stehvermögen. Vor allem brauchen Sie Ellenbogen, um das durchzuziehen. Sie sind aber nicht der Ellenbogentyp.“
Thiel schaute ernst und ein wenig vorwurfsvoll auf Felix herab. Felix erwiderte den Blick der roten Äuglein, die ihm auf einmal hässlich und bösartig erschienen. Er hoffte, Thiel würde seine Datenbrille wieder aufsetzen und ihm ein Zeichen geben, gehen zu dürfen. Denn das wollte Felix in diesem Moment, einfach nur weg. Die Enttäuschung erwischte ihn eiskalt.
„Das wissen Sie doch selbst“, schloss Thiel. „Nein“, wollte Felix ihm entgegenschleudern, ihm mit deutlichen Worten sagen, wie falsch er lag. Aber Felix beherrschte sich, so wie er sich seit Jahren zu beherrschen wusste, wenn er aus der olympolischen Hierarchie Demütigungen erfuhr.
Endlich griff Thiel zu seiner Datenbrille. „Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, Scholz. Spannen Sie mal für den Rest des Tages aus. Gehen Sie nach Hause.“ Sein Chef nahm wieder an seinem Schreibtisch Platz und widmete sich einer der Konsolen.
Felix war schon fast draußen, da rief ihm Thiel nach: „Sie sind doch ansonsten ganz patent, mit guten Manieren, ein hübscher Bursche. Suchen Sie sich eine nette Hauptbürgerin, heiraten Sie. Das ist der richtige Weg für Sie. Ihr Antrag zum Hauptbürger ist dann nur noch eine Formsache. Aber das wissen Sie ja, oder?“
Felix verließ den Glaskasten, ohne etwas darauf zu erwidern. Auf dem Weg nach unten machte er sich deswegen Vorwürfe, verbat sich diese sogleich brüsk. Nur kurz schaute er an seinem Arbeitsplatz vorbei, um mittels Konsole sich nicht nur für heute, sondern auch die nächsten zwei Tage freizustellen. Das Netzwerk war mit seinem Urlaubsantrag sogleich einverstanden. Er flüchtete von diesem Ort und hastete den Kopf schüttelnd an zwei Kollegen vorbei, die ihm auf dem Hof etwas zuriefen, dass er nicht verstand. Er verließ den Betrieb über den Hintereingang, um wieder von dem verwilderten Stück Grün geschluckt zu werden. Dort wollte sich Felix ein wenig von der Niederlage erholen, die ihm sein Chef soeben bereitet hatte. Nach ein paar hundert Metern verließ er den Weg, patschte über Schneematsch bis direkt ans Ufer des Flusses. Der war fast überall in der Stadt nur ein gerader, langweiliger Strich in der Landschaft. Sein Wasser schwappte brav ans befestigte Ufer. Felix hockte sich unter zwei große Weidenbäume, deren Zweige bis ins Wasser fielen und von der Strömung etwas mitgezogen wurden. Ihm gefiel die Vorstellung, wie das träge Wasser des Flusses ein paar Hundert Kilometer weiter in tosenden Nordseewellen aufging. Schwere Gedanken wurden ihm im Angesicht des Wassers meist leichter. Heute gelang das nicht. Wieder und wieder ging er Thiels Absage im Kopf durch. Neu waren Fetzen einer zornigen Gegenrede, die er dazu erfand. Felix steigerte sich in eine wahre gedankliche Tobsucht hinein, die ganz auf seinen Vorgesetzten abzielte. Seine Kiefer pressten sich aufeinander. Das zornige Gewitter in seinem Hirn strömte hinunter in die rechte Hand. Die Hand, mit der er wie besessen über Brustbein und Schulter rieb. Der ganze Körper war unter Wut angespannt. Sein Atem ging heftig. In seinem Kopf lief der Film ab, in dem er Thiel arg beschimpfte: Phrasen wie „Sie elender Bastard“ und „Keine Ellenbogen? Wollen sie lieber meine Fäuste zu spüren bekommen?“ kamen darin vor. Und tatsächlich wurde Thiel am Ende kleinlaut und wich vor Felix zurück!
Das Ganze dauerte nicht mal zwei Minuten, dann war es vorüber, alles aus ihm raus. Felix stand mit leerem Kopf auf matschigem Grund. Missmutig bemerkte er Dreckspritzer, nicht nur an seinen Schuhen, sondern auch am Hosensaum. Früher waren solche Anfälle häufig gewesen, und noch viel heftiger. So schlimm, dass ihm manchmal noch Stunden danach ein kaltes, schmerzhaftes Ziehen im Bauch blieb. Felix verdross seine Unfähigkeit, Wut an einem realen Gegenüber auszulassen. Es waren immer einsame Ausbrüche gewesen, die er nur mit sich selbst abmachte. So hatte er sich allerdings auch viel Ärger erspart.
Felix stakste zum Weg zurück. „Wozu?“, knurrte er, als ihm aufging, dass er dabei noch immer stoisch bemüht war, seine Sachen nicht zu verschmutzen.
Dienstag, 9. März 2078
Als ich zu Hause ankam, war ich noch immer von dem unerfreulichen Gespräch mit dem Chef angeknackst. Ich machte die Tür hinter mir zu, aß etwas, egal was, um wenigstens den Magen halbwegs zu füllen. Ich wollte nichts und niemanden sehen oder hören. Dennoch, ich fühlte mich nicht ganz verzweifelt. Thiel hatte immerhin eine gewisse Anteilnahme gezeigt, indem er mir so großzügig freigab. Ich denke, er fand seinen Ratschlag mit der Heirat genial, er wollte mir damit wirklich helfen.
Doch Frauen und ich, das ist eine spezielle Sache. Es ist nicht schwer, jemanden kennenzulernen. Das passiert leicht, wenn man wie ich in den Vergnügungszentren unterwegs ist. Aber dort gelten eigene Regeln. Das Zügellose, der Rausch, den man dort findet, all das schwingt auch in der Beziehung mit. Außerhalb geht das dann nicht weiter. Wollen die meisten auch gar nicht. Nach einer kurzen, intensiven Zeit ist einfach Schluss. Draußen, im wahren Leben, stelle ich mich, was Frauen betrifft, nicht sonderlich geschickt an. Ich kann einfach nicht deuten, was sie von mir wollen. Dennoch, eine Einsicht entwickelte sich in mir und half, das Erlebte schneller zu verdauen. Mein Chef hatte wohl nicht ganz unrecht, warum konnte es mit mir und einer netten Hauptbürgerin nicht klappen? Vielleicht sollte ich dieser Fährte nachgehen.
Felix war nicht recht bei der Sache, als er am frühen Nachmittag in den Keller ging und versuchte, die alten, konsolenartigen Geräte namens Laptops in Gang zu bekommen. Das, was er für einen Bildschirm hielt, blieb schwarz und stumm.
Lieber öffnete er wahllos ein paar Ordner und suchte darin nach gedruckten Texten, in denen er querlas. Doch schon nach wenigen Minuten verlor er jegliches Interesse daran. Felix widmete sich lieber den beiden Holzkisten und wuchtete die Kiste mit der Bücherlast Richtung Treppe. Dort auf den Stufen konnte er es sich bequem machen, um den Inhalt zu inspizieren. Das Äußere der dunkelroten, leicht geriffelten Lederbände fand er spannend, den Titel „Theorie und Praxis der Urbanregionen auf deutschem Boden“ eher nicht. Das Ganze in fünf Bänden. Wie sperrig und fade! Auf dem Einband gab es noch zwei weitere Zeilen: „Von Doktor Friedhelm Axt“ und „Herausgeber und Autor“. Axt? Friedhelm? Der Anflug einer Erkenntnis durchlief Felix, als er den Namen las. Plötzlich erinnerte er sich an eine Halskette seiner Großmutter mit einem Anhänger in Form einer kleinen, goldenen Axt. Als kleiner Junge fand er diese Halskette faszinierend. „Du bist die Oma mit der Axt“, rief er ihr gerne zu, weil sie dann lachte. Und sie antwortete ihm: „Recht hast du. Das ist ja auch mein Name.“
Axt war der Nachname seiner Großmutter. „Und der deines Urgroßvaters“, hatte die Großmutter manchmal noch hinzugesetzt. „Opa Freddy“, murmelte Felix vor sich hin. Ihr Nachname, seit den Kindheitsjahren aus dem Sinn. Felix saß nun kerzengerade vor der Kiste. Die Gedanken rotierten auf einmal wie von selbst in seinem Hirn: „Freddy ist gleich Friedhelm? Könnte dieser Friedhelm Axt mein Urgroßvater sein? Dann hat mein Urgroßvater diese dicken Bücher hier verfasst? Dann wäre er ein Experte gewesen.“ So ratterte es in seinem Schädel. Und dann fiel Felix noch etwas anderes ein: „Friedhelm Axt, das war doch ein bekannter Name. Ja, Felix hatte einst darüber etwas in der Schule gelernt, das war der Name des Retters von Olympolis. Ein Name, vergessen, wie so vieles aus der Schulzeit.
Felix versuchte sich zu erinnern, aus welchem Schlamassel dieser Friedhelm Axt der Stadt wohl geholfen hatte. Er schüttelte den Kopf, denn die Namensgleichheit dieses Helden aus der Dunkelzeit mit seiner Großmutter war ihm selbst in der Schulzeit niemals aufgegangen und Großmutter hatte eine öffentliche Rolle ihres Vaters nie erwähnt. „Ich habe mich seit der Geschichte mit ihrer Goldkette wahrscheinlich nicht mehr groß um ihren Namen geschert“, dachte er sich. Felix trug den Nachnamen seines ihm unbekannten Vaters, so hatte es seine Mutter nach der Geburt gewollt.
Noch ganz angefüllt mit der freudigen Aufregung über das, was er sich soeben zurecht kombiniert hatte, versuchte Felix ein Bild des Urgroßvaters heraufzubeschwören. Keine Erinnerung an Opa Freddy gab Anlass, ihn als Helden zu sehen. Ein neuer Gedanke drängte sich dazwischen, der brutal alle anderen Vorstellungen durchkreuzte: Was, wenn der Urgroßvater diese Bücher einfach nur hier im Schrank gehortet hatte? Es könnte eine rein zufällige Gleichheit des Namens geben, der Grund für die Anschaffung gewesen war. Felix wurde bei diesem Gedanken unwohl. Hektisch schlug er den ersten Band auf. Auf einer der ersten Seiten fand sich eine Fotografie des Dr. Friedhelm Axt nebst Tochter und darunter ein kurzer Text, mit dem er sein Werk eben dieser Tochter widmete. Den Mann auf dem Foto hätte Felix nie und nimmer erkannt. Das Bild der Frau, ihr Name und die Kette um ihren Hals passten jedoch eindeutig zur Großmutter. Mit dem Wohlgefühl der erlösenden Gewissheit griff Felix nun beherzt in die Kiste. Er entschied sich für den ersten Band, dazu griff er noch wahllos zwei weitere Bände heraus. Mit diesem Fang wollte er sich so schnell wie möglich befassen, aber lieber im Sessel seines Wohnzimmers, der bequemer war als die Kellertreppe. Außerdem konnte ihm oben der Cubus helfen, den Text zu verstehen. Felix hielt nichts mehr hier unten. Er hastete mit den drei Büchern im Arm die Treppe hoch. Oben angekommen stürzte er sich zunächst in seinen Sessel mit den reichlich abgegriffenen Armlehnen und dann kopfüber in die Seiten. Er hatte keinerlei Vorbehalte mehr gegen die langen Texte.
Zunächst las Felix nur die Überschriften in den Inhaltsverzeichnissen der einzelnen Kapitel, dazu hier und da ein bisschen in den Einführungen zu den Kapiteln. Begriffe wie „Politische Ordnung“, „Mikroökonomische Betrachtungsweise“ oder „Wirtschaftsstruktur“ kamen ihm öfter unter. Ziemlich schnell fand Felix heraus, dass das Buch Aufsätze verschiedener Autoren beinhaltete. Die ältesten Beiträge stammten aus den frühen dreißiger Jahren, die jüngsten wurden 2049 verfasst. Der Urgroßvater stand nur für einen Teil der Aufsätze, ansonsten hatte er sich auf Einführungen zu den Texten anderer beschränkt. Im Kern drehte sich alles um das Funktionieren der Megastädte, die hier Urbanregionen genannt wurden.
Staunend las Felix über den Anlass der Veröffentlichung des Buchs. Er wusste noch aus der Schulzeit, dass 2049 sechzehn Megastädte auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschlands nach Jahren der Konfrontation feierlich einen Bundesvertrag verabschiedet hatten.
Felix stellte sich den Menschen hinter diesem Buchwerk vor. Eine Autorität, eine Persönlichkeit, ein Professor, aber sein Urgroßvater? Warum hatte man nie über dessen herausragende Rolle gesprochen? Warum dieses Totschweigen in der eigenen Familie, so dass Felix bis heute nichts von dessen Berühmtheit geahnt hatte? Es gab für ihn keinerlei Verbindungslinien zwischen dem berühmten Buchautor und seinem Urgroßvater, an den er sich nur vage erinnern konnte. Ärgerlich klappte Felix das Buch zu und blickte mit zusammengekniffenen Augen aus dem Fenster. Die Abenddämmerung schlich sich bereits über Straße und Gehwege vor seinem Haus. Vereinzelte Laternen kämpften vergeblich gegen die Vorboten der Dunkelheit. Aus den großen Fenster von „Kemals Universalshop“ schräg gegenüber ergoss sich ein derart verführerisches Licht, dass ein paar Passanten wie die Fliegen angelockt wurden. Es dauerte eine Weile, bis Felix wieder dazu bereit war, die Nase in den Band zu stecken. Hier suchte er nach Spuren des Menschen und stieß auf Ansichten zu Geschehnissen und Entwicklungen, die noch vor der Dunkelzeit lagen. Felix las:
„Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts hatte sich der Ost-West-Konflikt erledigt. Die Geschichte, sagte man, war an ihrem Ende angelangt. Der Westen hatte obsiegt. Es erschien jedermann offensichtlich: Die Kulturen dieser Welt würden über kurz oder lang das westlich-liberale Leitbild annehmen. Ein vielstimmiges Ja zu einem Lebensgefühl aus Freiheit, Mobilität, stetiger Veränderung, technologischem Fortschritt und auch Konsum breitete sich in allen Ecken der Welt aus. Es war das enthusiastische Lebensgefühl des Westens. Eine freiheitliche, weltumspannende Gemeinschaft sollte daraus entstehen.
Aber taugte dieses Lebensgefühl, um eine solche Gemeinschaft zusammenzuhalten? Und war nicht schon erkennbar, in welche Richtung sich bald alles verdichten würde: ein Streben nach Vorherrschaft statt nach Gemeinschaft?
Eine neue Dimension der Märkte tat sich wie von selbst auf. „Mehr Handel zum Wohle aller“ wurde den Menschen versprochen. Auf den wachsenden, zusammenfließenden Märkten konnten nur immer größer werdende Unternehmen bestehen. Fusionen und Aufkäufe waren die Folge, multinationale Konzerne gaben den Takt der Wirtschaft an. Als klug geltende Köpfe dieser Zeit nannten diese Entwicklung „Globalisierung“.





























