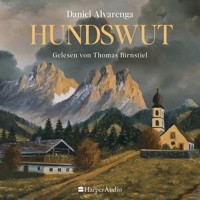11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Seit Wochen fiebert Felix dem Wochenende mit Ben und Laura in der Waldhütte entgegen und ist nicht begeistert, dass seine Freunde ungebeten weitere Gäste mitbringen. Die Stimmung ist spürbar angespannt. Als ein alter Mann vor der Tür steht und die Gruppe auffordert, bis zum Abend eine Person auszuwählen, die es verdient, weiterzuleben, während alle anderen sterben, gerät die Gruppendynamik aus den Fugen und offenbart, wer sich am Ende selbst der Nächste ist.
Während sich die Situation im Wald immer weiter zuspitzt, beginnt Felix‘ Vater sich um seinen Sohn zu sorgen. Sie haben kein besonders inniges Verhältnis zueinander, doch Felix‘ plötzliches Verschwinden bewegt ihn dazu, sich mit dessen Leben auseinanderzusetzen. Dabei eröffnet sich ihm ein Bild, das ihn zutiefst beunruhigt.
Schonungslos schreibt »Hundswut«-Autor Daniel Alvarenga über menschliche Abgründe und die Grenzen der Moral
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Seit Wochen fiebert Felix dem Wochenende mit Ben und Laura in der Waldhütte entgegen und ist nicht begeistert, dass seine Freunde ungebeten weitere Gäste mitbringen. Die Stimmung ist spürbar angespannt. Als ein alter Mann vor der Tür steht und die Gruppe auffordert, bis zum Abend eine Person auszuwählen, die es verdient, weiterzuleben, während alle anderen sterben, gerät die Gruppendynamik aus den Fugen und offenbart, wer sich am Ende selbst der Nächste ist.
Während sich die Situation im Wald immer weiter zuspitzt, beginnt Felix‘ Vater sich um seinen Sohn zu sorgen. Sie haben kein besonders inniges Verhältnis zueinander, doch Felix‘ plötzliches Verschwinden bewegt ihn dazu, sich mit dessen Leben auseinanderzusetzen. Dabei eröffnet sich ihm ein Bild, das ihn zutiefst beunruhigt.
Zum Autor
Daniel Alvarenga wurde 1986 in Berlin geboren, wuchs aber in Bayern auf, wo er auch heute noch mit seiner Familie lebt.
Seine Leidenschaft fürs Schreiben hat er schon zu Schulzeiten entdeckt, diese hat sich bis zu seinem Debütroman Hundswut aber vor allem auf das Verfassen und Verfilmen von Drehbüchern konzentriert.
Daniel Alvarenga
Ruf Der Leere
Roman
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Coverggestaltung von wilhelm typo grafisch, Zürich
Coverabbildung von Everett Collection / maradon 333 / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783749909124
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte des Urhebers und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für Mone.Für immer.
Präludium
I think I saw you late at night
Weaving shadows into light
Trying to mend the fractures
Left by words you couldn’t fight
And I think you shouldn’t linger near this place
There are whispers in the halls
Twisted faces in the walls
And they’re watching every move you trace
Prolog
FELIX
20:34
»Also ich denke, die allgemeinen Regeln der Höflichkeit gebieten, dass Sie uns zumindest sagen, wer Sie sind.«
Felix war einigermaßen stolz auf sich, dass er sich seine Coolness bewahrt hatte. Er warf einen verstohlenen Blick zu Elena, die immer noch so aussah, als würde sie jeden Moment kotzen. Den anderen ging es offenbar nicht viel besser. Insgesamt war die Stimmung am Arsch, seit seine Schwester diesen alten Mann hereingebracht hatte und der sich benahm, als würde die Hütte ihm gehören.
Auch jetzt benahm der Alte sich keineswegs wie ein Gast oder, was noch viel passender gewesen wäre, wie der Störfaktor, der er war. Vielmehr lehnte er sich gemütlich auf seinem Stuhl zurück und grinste Felix an, bevor er antwortete.
»Ich denke, die Antwort wird dir nicht gefallen.«
»Das Risiko gehe ich ein.«
Felix lächelte immer noch, aber seine Stimme war kalt geworden. Er ließ den alten Mann nicht aus den Augen, und langsam nervte ihn die Situation. Seine Belustigung, die er bis eben verspürt hatte und die bis zu einem gewissen Maß wohl auch dem Alkohol geschuldet war, war verflogen. Er war weit davon entfernt, so ein Nervenbündel zu sein wie Elena, erbärmlich war das, trotzdem wollte auch er, dass der alte Mann verschwand. Es war sein Wochenende, seine Party, seine Hütte, und der Alte hatte hier nichts zu suchen.
Allein, dass er ihn so vehement duzte. Natürlich hätte er problemlos sein Großvater, bei näherer Betrachtung vielleicht sogar sein Urgroßvater sein können, trotzdem war auch Felix kein Kind mehr. Er konnte erwarten, dass man ihm mit einem Mindestmaß an Respekt begegnete. Da waren sie wieder, die allgemeinen Regeln der Höflichkeit.
Kurz überlegte er, nun seinerseits zum Du überzugehen, verwarf den Gedanken aber schnell wieder. Es gab kaum eine so effektive Methode, seine Verachtung auszudrücken, wie ausgesuchte Höflichkeit. Das war eines der wenigen Dinge, die er von seinem Vater gelernt hatte.
Diesmal ließ der Eindringling seinen Blick über jeden Einzelnen streifen, der am Tisch saß, sah jedem von ihnen kurz lächelnd in die Augen, bevor er sprach. Es war klar, dass seine Antwort an sie alle gerichtet war.
»Wenn es so ist, verzeiht mir bitte die Theatralik.«
Er hielt inne. Oho, eine effektvolle Pause. Felix war gelinde beeindruckt. Hier hatte er jemanden vor sich, der wusste, wie man eine Rede hielt. Interessiert zog er die Augenbrauen hoch, gespannt, was nun folgen sollte.
»Ich bin der Tod.«
1
FELIX
07:59
Seine innere Uhr funktionierte so zuverlässig wie nervtötend. Eine Minute bevor der Wecker klingelte, wachte Felix auf. Er stellte ihn aus, was bedeutete, dass er ein paar Mal auf seinem Smartphone herumdrückte. Schöne neue Welt.
Noch ein bisschen rumdrücken, diesmal auf den Schalter neben seinem Bett. Die Jalousien öffneten sich und erlaubten dem Sonnenlicht, die letzte Erinnerung an den Schlaf schmerzhaft aus seinen Augen zu verjagen. Klospülung, Dusche, elektrische Zahnbürste, Amouage, Airbuds, dazwischen immer wieder das Handy – das Leben war ein Drücken von Knöpfen, und dann starb man.
Von diesen positiven Gedanken beseelt verließ er sein Badezimmer und ging ins Erdgeschoss. Wie immer roch er Jenny, bevor er sie sah. Während er selbst sein Parfum von Amouage – seine Wahl war vor Jahren auf Reflection gefallen, und er hatte bisher keinen Grund gesehen, diese Wahl zu überdenken – recht sparsam einsetzte, zwei Sprühstöße auf das Handgelenk, verreiben, Hals, Kragen und Haare, weil der Duft sich dort am längsten hielt, schien Jenny darin zu baden.
Er fragte sich, ob sein Vater inzwischen dazu übergegangen war, die leeren Flakons einfach mit irgendeiner billigeren Plörre wieder aufzufüllen. Er bezweifelte, dass Jenny es bemerken würde, seiner Meinung nach ging es ihr hauptsächlich darum, dass die Fläschchen pink waren. Und teuer natürlich.
Er lebte ein scheiß Klischee. Die Mutter früh gestorben, die neue Frau des Vaters kaum älter als er selbst, objektiv betrachtet wohl atemberaubend schön und dumm wie zwei Meter Feldweg, dabei aber immer noch intelligent genug, die Zuneigung seines Vaters auszunutzen. Wäre sein Leben ein Märchenbuch, er würde wohl die Nächte damit zubringen, Linsen zu sortieren.
Er hasste sie, obwohl sie ihm eigentlich nie etwas getan hatte. Keines der hoch melodramatischen Traumata aus diversen Teenie-Romanen traf auf ihn zu. Sie hatte ihm weder die Liebe seines Vaters geraubt, denn die hatte es schon vorher nicht gegeben, noch trauerte er seiner Mutter so sehr nach, dass er ihre Nachfolgerin aus Prinzip hassen müsste. Sie war bei der Geburt seiner Schwester gestorben, und da war Felix gerade einmal fünf Jahre alt gewesen. Das war fast zwanzig Jahre her, und die meisten Erinnerungen, die er an sie hatte, entstammten alten Fotoalben. Seine Mutter sah nett aus, und er hätte sie gerne richtig kennengelernt oder würde sich gerne daran erinnern, sie gekannt zu haben, aber letztlich hatte er keine besondere emotionale Bindung zu ihr. Ob es Elena anders ging? Schuldgefühle vielleicht? Wenn die Mutter bei der eigenen Geburt starb, musste das ja was mit einem machen. Erklären würde das zumindest einiges.
Dass sein Vater nicht für immer allein bleiben würde, war klar, und dass er sich eine extrem attraktive – und fast dreißig Jahre jüngere – Frau suchen würde, konnte Felix auf einer gewissen Ebene absolut nachvollziehen. Wozu war man schließlich reich?
Da es also keinen Grund gab, den ein Therapeut auf frühkindliche Verluste zurückführen konnte, vermutete Felix, dass er Jenny ganz einfach persönlich und vollkommen ohne Hintergedanken scheiße fand. Allein der Name. Sie hieß nicht etwa Jennifer und fand Jenny cooler, nein, in ihrem Ausweis stand tatsächlich Jenny. Jenny Uhlig. Sag mir, dass du aus dem Osten kommst, ohne mir zu sagen, dass du aus dem Osten kommst. Verzeihung, seit einem guten Jahr hieß sie natürlich Jenny Riedhof. Ob es das besser machte, wusste Felix nicht.
Sie hatte ihm sogar erzählt, warum sie so hieß, damals, am Anfang, als er noch wirklich versucht hatte, mit ihr zu sprechen. Ihre Mutter hatte sie Jenny genannt, weil das so wunderbar international klang. International, wichtig, aber gleichzeitig nicht zu bedrohlich, mit der richtigen Betonung sogar süß. Mit der Wahl des Namens hatte ihre Mutter ihre Zukunft bis ins Detail geplant. Raus aus Karl-Marx-Stadt, ab in die große weite Welt. Paris, New York, Saint Tropez. Internationale Top-Managerin, Führungselite, Reichtum. Wenn sie schließlich das Eckbüro im sechsundvierzigsten Stock hätte, würden ihre Untergebenen sie ehrfürchtig Jen nennen.
Das mit dem Reichtum hatte ja letztlich ganz gut geklappt, das mit der internationalen Karriere eher weniger. Immerhin gute 300 Kilometer Luftlinie hatte sie geschafft, bis zu einem exklusiven Herrenausstatter in der Münchner Innenstadt, und dort war sie schließlich seinem Vater begegnet. Irgendwo zwischen der Auswahl des teuersten Oberstoffs für den Dreiteiler und der Abnahme der Schrittlänge mussten die beiden sich nähergekommen sein.
Dass Felix über den Schritt und in logischer Konsequenz über das Sexualleben seines Vaters nachdenken konnte, ohne dass ihm schlecht wurde, sagte wahrscheinlich auch einiges über ihn aus. Er drückte einen weiteren Knopf seines Lebens, diesmal den des Kaffeevollautomaten, als das Gegenstück des eben erwähnten Sexuallebens auf ihn zukam und mit ihm sprach.
Die Kopfhörer in seinen Ohren bemerkte sie entweder nicht oder ignorierte sie. Nicht dass er gerade Musik damit hören würde. Er trug die Dinger aus reiner Selbstverteidigung, denn er hatte festgestellt, dass die kleinen weißen Knöpfe zumindest einen Teil der Menschen, denen er begegnete, davon abhielten, ihm ein Gespräch aufzudrängen. Airbuds, dazu ein leerer Blick, gerne kombiniert mit einer Sonnenbrille und einem energischen Schritt, der völlig klarmachte, dass man ein wichtiges Zeil zu erreichen hatte, und zwar in viel zu kurzer Zeit, so ließen sich die sozialen Interaktionen auf ein Minimum reduzieren. Er verstand ohnehin nicht, warum offenbar so viele Menschen den Wunsch verspürten, mit ihm zu sprechen. Er hielt sich selbst für nicht besonders sympathisch und gab sich große Mühe, beim Rest der Menschheit denselben Eindruck zu erwecken.
Jenny gehörte zu den Menschen, die sich davon nicht im Geringsten abschrecken ließen. Sie redete eigentlich rund um die Uhr, und Felix hatte längst gelernt, sie vollständig auszublenden, ob mit Kopfhörern oder ohne. Sie war für ihn ein Hintergrundgeräusch geworden, ein atmosphärisches Fiepen, das das Gehirn irgendwann nicht mehr wahrnahm. Die Klimaanlage hörte man ja auch nur an den ersten paar warmen Tagen.
Inhaltlich verpasste er ohnehin nichts, der Ablauf war auch da immer derselbe. Sie trug ihm diverse Wünsche vor, die meistens mit Beteiligung an Haushalt und/oder Freizeitgestaltung, emotionaler Anteilnahme an der eigenen Person oder der Hilfe mit diversen technischen Geräten von der Mikrowelle bis zur Alarmanlage zu tun hatten, und er ignorierte sie. Abends teilte sein Vater ihm dieselben Anliegen, angewiesen von seiner Ehefrau, deutlich energischer mit, diesmal hörte Felix aufmerksam zu, nickte ergeben und gelobte Besserung, nur um tags darauf erneut darauf zu scheißen.
Die wenigen Stunden täglich, die sein Vater, Herr Professor Thomas Riedhof, zwischen Labor, Golfplatz, E-Bike-Trails und Oberpollinger zu Hause verbrachte, waren für weitreichende Konsequenzen nicht ausreichend, und das Generve seiner Stiefmutter – was für ein wunderbar altmodischer Ausdruck, er nahm sich fest vor, das Wort wieder groß zu machen – musste er eben aushalten.
Natürlich, er könnte auch endgültig in seine Wohnung in der Stadt ziehen, und in absehbarer Zeit würde er das wohl auch tun müssen, aber im Moment überstiegen die Vorteile die Nachteile noch erheblich. Andererseits kam Ben heute zurück. Wer weiß, vielleicht sollten sie zusammenziehen? Die lässigste Wohngemeinschaft seit der Kommune 1, die Keimzelle eines Imperiums? München war nett, aber es gab so viel mehr. Berlin, Hamburg, Frankfurt? Oder warum nicht gleich New York? Sydney? Peking?
Ihm stand die Welt offen, und das, obwohl er nicht mal Jenny hieß.
Er trank, noch immer vollkommen unbeeindruckt von Jennys Gesprächsversuch, seinen noch heißen Espresso mit einem Schluck, stellte die Tasse auf den Tresen und drehte sich um, nur um fast in seinen Vater hineinzulaufen, der bedrohlich nah hinter ihm stand.
Felix zuckte unwillkürlich einen Schritt zurück und stieß gegen die Küchenfront. Dabei hatte er eigentlich nicht den geringsten Grund, sich zu fürchten. Sein Vater war nie die Herzlichkeit in Person gewesen, er neigte einfach nicht zu übermäßigen Gefühlsbekundungen, seien sie positiv oder negativ. Er war Wissenschaftler durch und durch. Gute Leistungen wurden wohlwollend, aber objektiv zur Kenntnis genommen, Fehlverhalten ebenso kritisch, aber nie mit Gebrüll oder gar körperlicher Gewalt beanstandet. Sein Abitur mit einem Schnitt von 1,0 zählte zu Ersterem, die diversen Umwege innerhalb seines Studiums definitiv zu Letzterem, wobei Felix’ aktueller Vorstoß in Richtung Medizin seinen Vater wieder versöhnt hatte. Bestraft im klassischen Sinne war er noch nie worden. Dazu fehlten seinem Vater die Konsequenz und vermutlich auch das Interesse.
Allerdings hatte sein Vater sich verändert, seit Jenny in ihr aller Leben getreten war. Zählte das schon als Midlife-Crisis? Musste Felix damit rechnen, dass demnächst eine Harley in der Doppelgarage stehen würde und sein Vater statt Armani ein Slayer-Shirt tragen würde?
Felix, den der Gedanke an seinen Vater mit einem Haarschnitt, der nicht zweiwöchentlich akkurat gestutzt wurde, tatsächlich amüsierte, unterdrückte erfolgreich ein Grinsen, während er sich die Kopfhörer aus den Ohren klaubte und seinen Vater aufmerksam anschaute.
Der wartete mit der stoischen Geduld eines Oberlehrers ab, bis dies erledigt war und er die ungeteilte Aufmerksamkeit seines Sohnes genoss, bis er zu sprechen anfing.
»Keine Uni heute?«
So kannte er seinen Vater. Keine Floskeln, kein »Guten Morgen«, kein »Warum trägst du im Haus Kopfhörer und ignorierst deine Stiefmutter?« – wirklich, ein großartiges Wort. Direkte, harte Fakten, kein Gelaber.
»Heute ist Freitag«, gab Felix zurück, wohl wissend, dass seinem Vater die Bedeutung dieses speziellen Freitags nicht bewusst sein würde.
»Und freitags hat die Universität geschlossen?«, antwortete sein Vater auch direkt erwartungsgemäß mit jenem süffisanten Unterton, der Lehrern, Geistlichen und Familienvätern vorbehalten war.
»Ich hol heute Ben vom Flughafen.«
»Ben«, nickte sein Vater. Als Kind war Felix überzeugt gewesen, sein Vater wüsste schlicht und einfach alles, später war er dahintergekommen, dass er einfach nur extrem gut darin war zu verschleiern, wenn dem nicht so war. Und so war es bis heute schwierig zu wissen, ob sein Vater zu einem Thema gerade nichts beitragen konnte oder schlicht keine Lust darauf hatte.
Zumindest Ben sollte er in den letzten zwanzig Jahren aber bemerkt haben, immerhin war er der beste Freund seines Sohnes und ging in ihrem Haus ein und aus. Dass er das seit genau sechs Monaten nicht mehr getan hatte, lag daran, dass er für ein Auslandssemester in Australien gewesen war. Ebendieses war jetzt zu Ende und Bens Rückkehr der Grund für Felix, an einem Freitag um 8 Uhr morgens aufzustehen. Denn natürlich ging er niemals freitags zur Uni, er war ja kein Masochist.
Bens Rückkehr war außerdem der Grund für die Wochenendpläne. Der Grund oder der Vorwand, je nachdem, wie man es betrachten wollte.
Felix sah seinen Vater an, ob da noch etwas kommen würde, und war gerade zu dem Schluss gekommen, dass ihr Gespräch wohl zu Ende war, als dieser kurz durchatmete und zu einer Rede ansetzte, die Felix schon nach dem ersten Satz befürchten ließ, er würde bei seiner weiteren Tagesplanung wohl ein bisschen improvisieren müssen.
»Felix, wir müssen uns über deine Zukunftsperspektiven unterhalten.«
»Jetzt?«, gab Felix zurück.
»Passt’s grad nicht?«, fragte sein Vater und sah sich im Raum um, als suche er nach dem, was sein Sohn wohl gerade Besseres zu tun haben könnte.
»Eigentlich hab ich …«
»Ich habe mit Elena gesprochen, und nach dem, was sie mir erzählt hat, hab ich mit János gesprochen. Und was der mir erzählt hat, macht mir, gelinde gesagt, ein wenig Sorgen.«
Felix spürte, wie sein Schädelinnendruck langsam, aber konsequent anstieg. Noch ein paar Momente, und es würde in seinen Ohren rauschen, und wenn er sprechen würde, würde er seine Stimme von innen und außen gleichzeitig hören. Nichts hasste er mehr als dieses Gefühl. Was genau hatte seine Schwester seinem Vater bitte erzählt? Was konnte sie überhaupt wissen? Worum es ging, war klar, denn János, wie sein Vater ihn jovial nannte, war Professor János Szabó und nicht nur einer der Golffreunde seines Vaters, sondern vor allem auch Felix’ Professor in Medizinethik.
Felix sammelte sich innerlich, konzentrierte sich aufs Hier und Jetzt und versuchte, logisch zu denken. Was konnte sein Vater wissen?
Dazu musste er zuerst überlegen, was konnte Elena und was konnte Szabó wissen? Seine Schwester – nicht viel. Sie hatte gerade erst ihr Abi gemacht, wenn sie überhaupt schon mal an der Uni gewesen war, dann im Zuge einer dieser lächerlichen Erstie-Führungen. Szabó – theoretisch alles. Zumindest wenn Laura mit ihm gesprochen hatte. Das allerdings hielt Felix für recht unwahrscheinlich. Dass Szabó sich schließlich ausgerechnet seinem Vater anvertraut haben sollte, zwar auch, undenkbar war es jedoch nicht.
Er sah kurz zu seinem Vater, und damit verflog die naive Hoffnung, es könnte sich bei diesem Satz lediglich um eine Feststellung gehandelt haben, um ein rhetorisches Mittel, um den eigenen Unmut auszudrücken. Nein, sein Vater wollte ein Gespräch führen, er wollte es jetzt tun, und es würde kein angenehmes Gespräch werden. Das ging nicht. Normalerweise scheute Felix die Konfrontation nicht, auch nicht die mit seinem Vater, aber in diesem Fall war das Eis deutlich zu dünn. Er musste sich darauf vorbereiten, musste herausfinden, was sein Vater wusste, sonst konnten ernsthafte Konsequenzen auf ihn zukommen. Und die konnte er heute nicht gebrauchen. Dieses Wochenende war wichtig. Wie wichtig, wusste nur er.
Also wählte er die Taktik, die er bei dem Besten gelernt hatte und die immer funktionierte. Er setzte sein charmantestes Lächeln auf, ging den noch fehlenden halben Schritt auf seinen Vater zu und klopfte ihm kumpelhaft auf den Oberarm.
»Du, Papa, ich find auch, da sollten wir uns dringend drüber unterhalten, aber grad ist’s echt nicht ideal. Ben kommt in …« – strategischer Blick zur Armbanduhr – »… nicht mal einer Stunde an, und du weißt, wie der Verkehr zum Flughafen ist. Sorry! Reden wir morgen, hm?«
Bei den letzten Worten musste er die Laustärke leicht erhöhen, denn er war bereits aus der Küche getreten und halb den Flur heruntergelaufen. Mit einem entschuldigenden Grinsen drehte er sich um, schlüpfte in seine Sneaker und griff nach dem Rucksack, der schon seit gestern Abend neben diesen stand. Er war zufrieden. Der Schüler hatte den Lehrer mit dessen eigenen Waffen geschlagen.
»Felix.«
Felix zuckte zusammen. Nur ein Wort, nicht laut, nicht einmal besonders scharf. Das hatte sein Vater noch nie nötig gehabt. Autorität besaß man entweder oder nicht, und einem Thomas Riedhof war sie in die Wiege gelegt. Felix sah seine Felle davonschwimmen. Trotzdem versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen, als er sich mit gespielt fragendem Blick umdrehte.
»Das besprechen wir noch.«
Felix nickte, als könnte er den Abgrund hinter diesem kurzen Satz nicht sehen, grüßte lässig und verschwand durch die Tür in die Garage.
Der Schüler hatte den Lehrer geschlagen? Lächerlich. Vier Worte, und sein Vater hatte mehr erreicht als schwächere Menschen mit einer Stunde Gebrüll, Drohungen und Flüchen schaffen würden. Dieser Mann konnte mit einem kurzen Satz Leben verändern. Oder vernichten. DAS war Macht. Felix war aufrichtig beeindruckt.
Garagentor, STARTENGINE, die beiden letzten Knöpfe, die er heute innerhalb der Mauern dieses Hauses drücken würde. Als es schon bald darauf hinter ihm immer kleiner wurde, verblasste im gleichen Maße auch die Drohung, die in der Luft lag. Das Gespräch mit seinem Vater würde kein Spaß werden, vor allem wenn er in absehbarer Zeit herausfinden würde, dass sein Sohn nicht nur den Schlüssel zur Hütte dabeihatte, das würde er wahrscheinlich gar nicht bemerken, sondern auch seinen nagelneuen Cayenne. Es war nicht so, dass Felix dieses Schlachtschiff besonders mochte. Er selbst bevorzugte klein, schnell und vor allem leise, aber für sein eigenes Auto hatte er einfach zu viel Zeug dabei. Außerdem war nicht ganz klar, wie das Wetter in den Bergen werden würde, da schadete Allrad bestimmt nicht.
Natürlich, er hätte auch fragen können, aber dann hätte er seinem Vater die Gelegenheit gegeben abzulehnen. So war es eben ein weiterer Punkt auf der Liste dessen, was ihn bei seiner Rückkehr erwartete, eine Liste, die Felix anlegen und direkt darauf vollständig aus seinen Gedanken verbannen konnte.
Jetzt konzentrierte sich Felix ausschließlich auf das Wochenende. Und das würde legendär werden.
2
FELIX
10:23
Er hasste nichts so wie den Straßenverkehr in und um die Stadt. Eine Stunde und siebzehn Minuten für verdammte 53 Kilometer Strecke, es war ein Witz. Dass er selbst Teil des Problems war, zumal mit so einer Eigentumswohnung auf Rädern, drauf geschissen, was sollte er denn machen? Einen Hubschrauber hatte er eben nicht. Sich über die anderen Verkehrsteilnehmer aufzuregen, brachte aber auch nicht viel. Das stresste nur ihn selbst, die anderen würden nicht plötzlich lernen, wie man Auto fuhr, nur weil er sie anschrie.
Felix blendete sämtliche Idioten um ihn herum aus und konzentrierte sich auf die Musik, das half eigentlich immer. Als hätte er es beim Einsteigen schon geahnt, passte die Playlist wie die Faust aufs Auge. Neunziger-Mainstream-Grunge, Soundgarden, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, viel Nirvana natürlich. Packte er nicht immer, aber grad war’s perfekt. I’m the man in the box buried in my shit.
Felix musste grinsen. Er vermutete, Jerry Cantrell hatte beim Schreiben des Songs nicht unbedingt zähfließenden Verkehr im Hinterkopf gehabt, aber das tat der Sache ja keinen Abbruch.
10:23, Bens Flieger war vor mehr als zehn Minuten gelandet. Natürlich, wenn man sich einmal wünschte, dass die Scheißkisten zu spät kamen, waren sie pünktlich. Felix machte sich keine Sorgen, dass Ben hilflos wie ein Welpe, mit eingezogenem Kopf und weinend durch das Flughafengebäude stolpern würde, trotzdem hatte er sich ihr Wiedersehen anders vorgestellt. Sein bester Freund war ein halbes Jahr am anderen Ende der Welt gewesen, eigentlich hätte Felix für seine Rückkehr eine Parade organisieren müssen.
Mit quietschenden Reifen blieb Felix direkt vor Terminal 1 stehen. Jetzt war es immerhin wirklich von Vorteil, dass er mit einem Porsche Cayenne S vorgefahren war. Für den war es zwar genauso verboten, hier zu parken, außer er wäre zufällig gelb und hätte ein Schild auf dem Dach, aber bei dieser Karre wunderte es niemanden, wenn man sich einen Dreck um die Regeln kümmerte.
Die wenigen unter den vorbeieilenden Pendlern und suchend herumstolpernden Urlaubern, die ihn überhaupt bemerkten, bedachten ihn mit der Mischung aus Neid und Verachtung, die er seit frühester Kindheit kannte und die ihm schon fast genauso lange egal war. Nicht sein Auto, nicht sein Geld, nicht sein Problem. Felix bildete sich nichts auf seinen Reichtum ein, immerhin hatte er nicht das Geringste dafür getan. Er schämte sich aber auch nicht dafür, sondern nutzte völlig emotionslos die Vorteile, die er ihm brachte, denn er hatte bisher nicht die geringste Ambition, selbst Geld zu verdienen. Er war vierundzwanzig, für Ambitionen fühlte er sich im Moment noch deutlich zu jung. Jetzt wurde erst mal gelebt.
Und das konnte er, ohne Nebenjobs in Hipstercafés, als studentische Hilfskraft oder mit einem Studienkredit im Nacken, eben ein bisschen leichter als andere. Was nicht bedeutete, dass er generell faul wäre. Wenn ihn etwas interessierte, konnte er mehr Energie dafür aufbringen als sein gesamter Freundeskreis zusammen. Das Problem war nur, dass es recht wenig gab, was ihn besonders lange interessierte. Und sobald er sich langweilte, zog er weiter.
Felix öffnete die Tür und stieß gegen die Wand aus heißer Luft, die ihm sofort entgegenschlug, als er den schützenden Kokon des vollklimatisierten Fahrzeuginnenraums verließ. In irgendeinem drittklassigen Magazin, vermutlich im Wartezimmer irgendeines Facharztes, denn wo sonst blätterte man als vernunftbegabter Mensch freiwillig in solchen Heftchen, hatte irgendein Autor behauptet, Flughäfen würden nach Freiheit riechen. Felix roch von der Sonne aufgeweichten Asphalt, von billigem Deo erfolglos übertünchten Langstreckenflugschweiß – und das, obwohl er draußen und mindestens fünf Meter vom nächsten Urlauber entfernt stand – und irgendeinen chemisch-öligen Geruch, bei dem es sich vermutlich um Kerosin handelte. Wenn so die Freiheit roch, dann bitte lieber eingesperrt sein.
Während Felix darüber nachdachte, um wie viele Prozentpunkte es die Wirkung seines Auftrittes schmälern würde, wenn er im gekühlten und luftgefilterten Auto warten und die Drehtür über den Seitenspiegel im Auge behalten würde, drückte sich ein neuer Schwung Urlauber durch ebendiese. Nachdem der dickliche Mittsechziger mit Rollkoffer, der, von der mitteleuropäischen Vormittagssonne offenbar überrascht, endlich seine Sonnenbrille, Modell zwielichtiger Strandhändler, aufgesetzt hatte und zwei Schritte weitergegangen war und damit den Ausgang nicht mehr wie ein Korken verstopfte, ergossen sich die Reisenden zähflüssig auf die Straße.
Gleich einer der ersten weckte in Felix eine leise Hoffnung, es könnte sich bei den Herausströmenden bereits um die Passagiere von Bens Flieger handeln, denn der junge Mann sah aus wie das lebende Klischee eines Australiers. Kinnlange blonde Locken, braun gebrannt, blaue Augen, Shorts und nicht etwa ein spießig-europäischer Koffer, nein, ein lässig über eine Schulter getragener Rucksack war offenbar völlig ausreichend für alles, was man als cooler Surferdude für eine Reise ans andere Ende der Welt brauchte. Noch ein Billabong-Shirt in LSD-Farben, und das Bild wäre perfekt gewesen. Na, viel Spaß in Germany, dachte Felix sich. Ob der Eisbach mit Bondi Beach mithalten konnte? Er bezweifelte es. Immerhin würde der junge Mann nicht viele Nächte allein verbringen. Blond und Achttagebart kam bei den örtlichen Studentenmädels ganz gut an, das wusste Felix aus Erfahrung.
Doch der Surfer blieb die Ausnahme. Es folgten ein geschniegelter Anzugtyp, eine gestresste Familie mit übermüdeten Kindern im Paw-Patrol-Einheitslook, noch ein geschniegelter Anzugtyp, alle so deutsch, wie man nur sein konnte. So langsam verlor Felix den Glauben daran, dass er doch noch im genau richtigen Moment angekommen war, da erblickte er endlich ein bekanntes Gesicht.
Zwischen schwarzen Locken, einem schwarzen Bart und hinter einer schwarzen Hornbrille leuchteten zwei strahlende, suchende Augen und, als die Augen Felix entdeckt hatten, zwei Reihen ebenso strahlender Zähne hervor, als Ben über das ganze Gesicht zu grinsen begann.
»Kollege! Endlich!«
Felix grinste ebenfalls, breitete die Arme aus und erweckte erfolgreich den Eindruck, als würde er schon seit Stunden hier auf ihn warten. Seine Freude dagegen musste er nicht spielen. Erst jetzt wurde ihm wirklich bewusst, wie sehr er seinen besten Freund vermisst hatte.
»Ja Mann!«, rief Ben, stürmte auf Felix zu und ließ sich in die Arme schließen. Felix atmete erleichtert tief durch und stellte fest, dass Ben genauso stank wie jeder andere, der aus dem Flughafengebäude kam. Doch bei ihm war das irgendwie okay. Trotzdem nahm er Bens Ausdünstungen zum Anlass, die Umarmung mit den obligatorischen zwei maskulinen Schlägen auf den Rücken des anderen zu lösen, und blickte ihn an.
»Und?«
»Geiles Land!«, antwortete Ben. »Ich sag’s dir: Geiles. Land.«
Felix grinste wieder. Er hatte die Antwort gekannt, bevor er die Frage gestellt hatte. Ben sah blendend aus.
Die beiden kannten sich seit dem Kindergarten, damals hatten sie die ersten zwei Wochen damit verbracht, sich zu prügeln oder sich mit steinharten Klumpen, die man fabrizieren konnte, indem man Klopapier mit der stinkenden Kindergartenflüssigseife und Wasser vermischte, fest zusammendrückte und dann über Nacht in seinem Garderobenfach versteckte, zu bewerfen. Dann hatte Ben Felix eines Tages unaufgefordert beim Malen mitgeteilt, dass man Braun bekam, wenn man Rot und Grün mischte. Das war ein wertvoller Tipp, denn Felix war gerade dabei, einen Hund auszumalen, und es gab für die zweiundzwanzig Kindergartenkinder in der Entengruppe exakt drei braune Buntstifte, die entsprechend begehrt waren. Felix blieb zwar skeptisch, denn nach seinem Empfinden müsste die Mischung eigentlich Lila oder so ergeben, entschloss sich dann aber, es doch auszuprobieren. Der Hund wurde tatsächlich braun, und Felix und Ben waren von da an unzertrennlich.
Die beiden waren bald weithin bekannt. Felix, der als Kind so blond gewesen war, dass seine Haare fast weiß gewesen waren, und dessen Haut nicht erheblich dunkler war, und neben ihm Ben, Kind einer bayerischen Mutter und eines iranischen Diplomaten, den es irgendwie nach München verschlagen hatte, damals zwar nachvollziehbarerweise noch ohne Bart und Brille, aber schon mit denselben dichten schwarzen Locken. Und nur äußerst selten bekam man den einen ohne den anderen zu sehen.
Felix kam nicht umhin, sich zu fragen, ob diese ganze Sache mit Laura auch passiert wäre, wenn Ben nicht in Australien gewesen wäre, als er plötzlich aus dem Augenwinkel sah, dass der seltsame Surfertyp immer noch unschlüssig neben Ben und ihm herumstand.
Was war denn los? Dachte der Kerl, er wäre ein Taxi? Oder wollte er ihn nach dem Weg fragen? Er überlegte gerade, ob er ihn ansprechen sollte, da folgte Ben seinem Blick und kam ihm zuvor.
»Oh man, sorry!«, sagte Ben zu dem Australier, und noch bevor Felix Zeit hatte, richtig verwirrt zu sein, drehte sein Freund sich wieder zu ihm um.
»Felix, das ist Bill, aus Australien!« Er deutete auf den Surfertypen, der daraufhin die Sonnenbrille abnahm, ihn freundlich angrinste und damit, wie Felix nicht ohne eine Portion Neid anerkennen musste, seine Attraktivität augenblicklich verdoppelte. Während Felix, einigermaßen überrumpelt, automatisch zurücklächelte, sprach Ben schon weiter.
»Der hat jetzt auch Semesterferien, und weil wir uns im letzten halben Jahr ganz gut angefreundet haben, hat er dann superspontan beschlossen, dass er einfach ein paar Wochen mitkommt, meinen Kontinent sehen, meine Leute kennenlernen, so Sachen.«
Ben stockte, als wäre ihm das Wichtigste, das, was Felix seit Wochen plante und worauf er sich seit Tagen freute, gerade erst wieder eingefallen.
»Apropos: Hütte steht?«
Felix’ Gehirn schaltete augenblicklich in den Zeitlupenmodus. Seine nächsten Worte, die nächsten Sekunden waren entscheidend. Nicht nur, was die Gestaltung des Wochenendes betraf. Felix wusste, dass es um viel mehr ging. Ohne dass sein Lächeln einen Riss bekommen oder Ben und sein Anhängsel auch nur bemerken würden, dass er nachdachte, ging Felix die Fakten durch.
Ben war wieder da – supergeil. Natürlich stand die Sache mit der Hütte. Die Getränke, das Essen und alles andere hatte er schon gestern persönlich hingebracht, sauber war sie auch, der Weg war begeh- und befahrbar, was wirklich keine Selbstverständlichkeit war, es waren Matratzen, Decken und genug Holz für ein gewaltiges Lagerfeuer da, und den Schlüssel hatte er in seiner rechten Hosentasche. Ergo – auch geil.
Ben hatte, ohne das abzusprechen oder auch nur zu erwähnen, irgendeinen Typen mitgebracht, das war schon deutlich weniger geil. Zumal dieser Kerl problemlos den Brad Pitt der späten Neunziger doubeln könnte. Felix glaubte zwar nicht, dass sein Plan an der Attraktivität eines anderen Typen scheitern würde, wenn das der Fall war, hätte er sowieso verkackt, aber er mochte es einfach generell nicht, wenn er seine Pläne kurzfristig ändern musste. Aber was war die Alternative? Ben sagen, dass der Wochenendtrip, von dem er ihm schon vor Tagen erzählt hatte, jetzt doch nicht stattfand, ihn nach Hause fahren und ihn dann meiden, bis Bill wieder im Flieger saß? Eher nicht. Also, weiterlächeln, nichts anmerken lassen, improvisieren.
»Hütte steht«, sagte er also vollkommen selbstverständlich und verfehlte damit die erwünschte Wirkung nicht.
»Yeah, stark! Coole Sache!«, rief Ben, und wieder leuchteten seine weißen Zahnreihen aus seinem von der australischen Sonne dunkelbraun gebrannten Gesicht hervor. »Wer ist am Start?«, wollte er wissen.
»Siehst du, wenn wir da sind«, antwortete Felix, der nicht im Traum daran dachte, jetzt schon die Karten auf den Tisch zu legen. Während er schon wieder ums Auto herum zur Fahrertür ging, freute er sich, dass er damit zumindest eine kleine Rache bekam. Wenn Ben ihn vor vollendete Tatsachen stellen konnte, konnte er das erst recht.
»Geht übrigens direkt los.«
Ben reagierte wie erwartet, stand hilflos herum und starrte Felix an. Der Surfertyp – Felix musste sich daran gewöhnen, ihn Bill zu nennen – stand ebenfalls verwirrt da, wobei Felix nicht wusste, ob der überhaupt etwas von ihrem Gespräch mitbekommen hatte. Er würde herausfinden müssen, wie viel der Typ verstand, ob er überhaupt Deutsch sprach und all diese Kleinigkeiten. Na ja, dafür war ja jetzt genug Zeit.
»Direkt … jetzt?«, fragte Ben überrumpelt. »Aber ich bin doch grad erst angekommen. Und ich hab ja auch meinen ganzen Scheiß hier.«
Dabei deutete er auf seinen Rucksack, als wäre Felix begriffsstutzig.
»Passt doch«, gab Felix unbeeindruckt zurück. »Dann hast du gleich Klamotten. Wird ja wohl noch was Sauberes drin sein, oder?«
»Und was ist mit Bill?«
Ach, jetzt auf einmal kam ihm der Gedanke? Was war mit Bill? Was hätte Ben sich denn alternativ überlegt? Einen kurzen Umweg über Bens Zuhause fahren, seinen Eltern einen vermutlich völlig fremden Australier vor die Tür stellen und versprechen, sich nach dem Wochenende wieder um ihn zu kümmern? Oder wollte er Bill am Flughafen zurücklassen? Irgendwas war mit Ben nicht in Ordnung, denn Felix kannte ihn zu gut, um ihn für so dämlich zu halten. Felix beschloss, es auf den Jetlag zu schieben.
Er tat kurz so, als müsste er darüber nachdenken, dann antwortete er gönnerhaft:
»Kann mit.«
»Kann mit … okay …«, wiederholte Ben, scheinbar immer noch überfordert, dann wandte er sich an seinen Begleiter.
»Ah Bill, mind if …«
»What? No, sure! Warum nicht?«, gab der erstaunlich schnell zurück.
Damit war das wohl auch geklärt. Er verstand scheinbar alles, und er sprach auch Deutsch, wenn auch mit einem ziemlich breiten Akzent, der unter der weiblichen Einwohnerschaft Deutschlands wohl für reihenweise nasse Schlüpfer sorgen würde.
Und außerdem war er ein deutlich schlechterer Schauspieler als sein Freund Ben. So spontan, wie die beiden ihn glauben machen wollten, war diese Entscheidung ganz offensichtlich nicht getroffen worden. Das würde er weiter beobachten.
Doch für den Moment drückte er nur den Knopf am Schlüsselbund, der den Kofferraum öffnete, und stieg ein.
»Kommt ihr dann?«, fragte er laut, mit einer Genervtheit, die er nicht zu spielen brauchte.
Um die beiden zu etwas Eile anzutreiben, ließ er bereits den Motor an, was, wie er zugeben musste, mit dem Auto seines Vaters bedeutend eindrucksvoller klang als mit seinem eigenen.
Als die beiden eingestiegen waren, fuhr er mit quietschenden Reifen los, womit er nun vermutlich auch die letzten Besucher des Flughafens davon überzeugt hatte, genau das arrogante Arschloch zu sein, das sie in so einem Auto vermuteten.
3
LAURA
April
Mit bis zum Hals klopfendem Herzen und kurz vorm Kreislaufzusammenbruch ließ Laura sich auf den Klappsitz fallen und verstaute ihre Tasche hinter ihren Beinen, um möglichst wenig Raum in dem viel zu engen Durchgang zu blockieren. Nicht dass das wirklich nötig gewesen wäre, denn die restlichen Plätze waren sowieso alle besetzt. Sie wunderte sich, dass sie überhaupt noch einen gefunden hatte.
Dabei hatte sie wirklich ALLES dafür getan, um pünktlich zu ihrer ersten Vorlesung zu kommen. Sie hatte rechtzeitig nachgesehen, wo sie stattfand, war schon letzte Woche an der Uni gewesen, um auch zu wissen, wo der Hörsaal genau war, und nicht wie ein offensichtlicher Erstie hilflos über die Gänge zu irren. Sie war rechtzeitig aufgestanden, war rechtzeitig fertig gewaschen und angezogen gewesen, war rechtzeitig losgegangen – und hatte dann den Fehler gemacht, sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verlassen. Minute für Minute war ihr sorgsam eingeplanter Puffer dahingeschmolzen, und letztlich war sie in der höchstmöglichen Geschwindigkeit, die noch nicht allgemein als Rennen galt, über den Campus gehetzt.
Sie kannte Uni-Vorlesungen bis jetzt ausschließlich aus Filmen und war sich absolut sicher, dass sie in einen totenstillen Saal hineinplatzen würde, ein strenger Professor sie mit hochgezogener Augenbraue begrüßen und sie vor versammelter Mannschaft und selbstverständlich bei ihrem vollen Namen bloßstellen würde. Stattdessen war sie stolze drei Minuten vor Vorlesungsbeginn angekommen, die Lautstärke glich der in einem Bierzelt, und das Pult war leer. Das Leben war also offensichtlich kein College-Film.
Jetzt, da sie endlich saß, erlaubte sie sich zum ersten Mal seit Stunden durchzuatmen. Und als hätte ihr Körper dieses Kommando gebraucht, aktivierte er auch sämtliche anderen grundlegenden Funktionen wieder. Ihre Beine fingen an zu zittern, als wäre sie gerade einen Halbmarathon gelaufen, und sie spürte, wie Schweiß aus jeder möglichen Pore kam und ihr Top an ihr klebte. Für eine Sekunde machte sie sich Gedanken darüber, ob sie anfangen würde zu stinken, schob den Gedanken aber schnell beiseite. Sie war nicht hier, um gut zu riechen, sondern um etwas zu lernen.
Es war ein furchtbares Klischee, und sie würde es auch vor niemandem zugeben, aber sie hatte seit Jahren auf diesen Moment hingearbeitet. Sie hatte sich in der Schule den Arsch aufgerissen, sobald sie beschlossen hatte, dass das Medizinstudium ihr Weg sein sollte. Sie war nicht dumm und hatte schon immer gute Noten gehabt, aber ab da war ihr einziges Ziel absolute Perfektion. Unter einem Schnitt von 1,0 brauchte man es sowieso nicht zu versuchen, das wusste jeder. Sie hatte es schließlich geschafft, mit achthundertsechsundneunzig Punkten. Nicht perfekt, aber gut genug. Nebenbei hatte sie jeden Cent gespart, hatte in den Ferien in Cafés und im Kino gejobbt, Babys und Hunde gesittet und ihr Privatleben komplett auf Eis gelegt, um den finanziellen Puffer zu erlangen, sich zumindest im ersten Semester komplett auf ihr Studium konzentrieren zu können.
München war unfassbar teuer, und auch wenn es ihrer Familie wirklich nicht schlecht ging, lag es weit abseits der Möglichkeiten ihrer Eltern, das Studentenleben ihrer Tochter zu finanzieren.
Und jetzt saß sie hier, in ihrer allerersten Vorlesung. Sie hätte sich für die späteren Geschichten für ihre Enkel zwar einen glanzvolleren Kurs vorstellen können, Medizinethik war für sie doch eher Pflicht als Leidenschaft, aber immerhin war ihr Professor, ein Ungar namens János Szabó, offenbar eine Koryphäe, Verfasser zahlloser Bücher und nach übereinstimmender Meinung derer, die zu so etwas eine Meinung hatten, der Beste auf seinem Gebiet. Also vielleicht doch etwas für die Enkel.
Als hätte der lobende Gedanke an seinen Namen ihn herbeigerufen, öffnete sich just in diesem Moment die Tür, und ein sympathisch wirkender Mann, den Laura auf Mitte fünfzig schätzte, kam herein. Laura wusste nicht, wie sie sich einen Professor für Medizinethik vorgestellt hatte, aber so vermutlich nicht. Szabó trug schwarze Jeans, ein schlichtes weißes Hemd, hatte zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes graues Haar, einen grauen Kinnbart und so eine kleine runde John-Lennon-Brille, die diejenigen, denen sie stand, immer sofort um achtzig Prozent netter aussehen ließ, bei den meisten Menschen aber einfach nur dämlich aussah. Szabó hatte das Glück, zu der ersten Gruppe zu gehören.
Er stellte seine Tasche ab und drückte einen Knopf an seinem Pult. Daraufhin leuchteten sowohl eine rechteckige Fläche vor ihm als auch die Wand hinter ihm, die, wie Laura jetzt erkannte, aus einer elektronischen Tafel bestand, auf, und auch die letzten Gespräche im Saal verstummten. In Großbuchstaben und in einer für einen Mediziner erstaunlich lesbaren Handschrift schrieb er das Wort ETHIK auf sein Pult und damit an die Wand und wandte seinen Blick zum ersten Mal seinem Publikum zu.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche einen schönen guten Morgen«, sagte Szabó mit einer ruhigen, tiefen Stimme, die perfekt zu seinem Aussehen passte. »Es freut mich sehr, dass sich doch ein paar Leute«, er deutete mit einer lockeren Handbewegung in Richtung der Anwesenden und erntete vereinzelte Lacher aus den vollbesetzten Reihen, »hier eingefunden haben, um ein Thema zu behandeln, das traditionell der Hälfte der Studenten zu abstrakt und der anderen zu trocken ist. Dass dieser Kurs zum Pflichtprogramm für Erstsemester gehört, trägt vermutlich zu seiner Beliebtheit bei.«
Wieder kicherten einige Studenten, Laura gehörte nicht zu ihnen. Diese ganze Eröffnung klang für sie doch ziemlich auswendig gelernt, und unter der Fassade der kumpelhaften Lockerheit glaubte sie, eine gehörige Portion Arroganz auszumachen.
»Der zweiten Hälfte werde ich vermutlich auch im Verlauf meines Kurses das Thema nicht schmackhaft machen können, zumindest bei dem ersten Problem kann ich aber versuchen, direkt Abhilfe zu schaffen.« Er deutete, ohne sich umzudrehen, auf das Wort hinter ihm, was ihn einerseits sehr souverän wirken ließ, Lauras Theorie der perfekt einstudierten Eröffnungsrede aber nur bekräftigte.
»Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist Ethik?«
Er hob die Augenbrauen und sah zu seinen Zuhörern, um zu unterstreichen, dass seine Frage nicht rhetorisch gemeint war, sondern er tatsächlich auf eine Antwort wartete. Natürlich hob kein einziger der über achthundert Anwesenden die Hand. Niemand wollte derjenige sein, der sich als Erster mit einer falschen Antwort blamierte.
Szabó wartete noch einige Sekunden, dann breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus, das seine freundliche Fassade für einen Moment bröckeln ließ, denn selbstverständlich war er sich dieser Tatsache ebenfalls bewusst.
»Die Antwort laut Lehrbuch lautet, dass Ethik die Theorie der Moral ist, und damit sind Sie exakt genauso weit wie zuvor, denn das führt uns unvermeidlich zu der nächsten Frage: Was ist Moral?«
Diesmal machte er sich nicht die Mühe, eine Antwort aus dem Kreis der Zuhörer abzuwarten, sondern sprach bereits weiter, während er das Wort MORAL ebenfalls in Großbuchstaben unter das Wort ETHIK schrieb.
»Tatsächlich bin ich geneigt, dem Lehrbuch in diesem Fall zu widersprechen, denn Ethik und Moral unterscheiden sich meiner unbedeutenden Meinung nach massiv. Die Moral ist die Zwillingsschwester der Religion, denn sie umfasst immer eine Form von Gruppendenken, und genau das macht sie so gefährlich. Weil sie nichts anderes zulässt, weil sie sich selbst als das einzig Wahre, das einzig Richtige definiert.«
Ein Knopfdruck änderte die Farbe seines digitalen Stiftes, und mit einer schwungvollen Handbewegung zog er einen roten Strich über MORAL.
»Die Ethik dagegen stellt eine im weitesten Sinne auf sich selbst bezogene, nun, vielleicht nicht unbedingt Handlungsanweisung, aber doch zumindest eine Art Richtschnur für das eigene Handeln dar.«
Szabó ließ seinen Blick durch das Auditorium schweifen, als suchte er nach Zustimmung für seine Einschätzung. Laura wusste nicht, ob er sie bekam, doch er wirkte zufrieden, als er, jetzt wieder in sachlicherem Ton, fortfuhr.
»Davon abgesehen, ist der Begriff der Moral reichlich abgegriffen, durch Religion und Esoterik verwässert und hat insgesamt einen mehr romantischen als wissenschaftlichen Klang, weswegen ich den Begriff der Ethik bevorzuge und in meinen Vorlesungen exklusiv verwenden werde.«
Mit diesen Worten malte er einen Kreis um das Wort ETHIK und drückte daraufhin einen weiteren Knopf auf seinem Pult, woraufhin beide Worte von der Wand verschwanden und eine Präsentation startete, die seine weiteren Erläuterungen untermalte.
»In diesem Kurs befassen wir uns mit der Medizinethik, also mit angewandter Ethik, in Abgrenzung zur rein theoretischen oder philosophischen Behandlung des Themas. An diesen Herangehensweisen ist nichts Verwerfliches, da bitte ich Sie, mich nicht misszuverstehen, jedoch werden Sie sich im Rahmen Ihres späteren Berufslebens mit sehr konkreten Situationen konfrontiert sehen, die ethische Entscheidungen erforderlich machen.«
Laura kam nicht umhin, Szabós Professionalität zu bewundern. Er drehte sich kein einziges Mal um, soweit sie sehen konnte, liefen die Folien seiner Präsentation nicht sichtbar auf sein Pult, und er schien sie auch nicht manuell zu steuern. Trotzdem war das, was er sagte, perfekt synchron zu Text und Bild hinter ihm an der Wand, und er schaffte es trotzdem, den Vortrag locker und improvisiert klingen zu lassen. Sie ermahnte sich, nicht abzuschweifen, und konzentrierte sich wieder auf das, was ihr Professor sagte.
»Die meisten der hier Anwesenden werden den Beruf der Ärztin beziehungsweise des Arztes anstreben, weswegen folgerichtig der Bereich der Arztethik für Sie der konkreteste sein wird. Die Medizinethik geht jedoch weit über diesen hinaus und befasst sich auch mit Problematiken, die Ihnen begegnen werden, sollten Sie sich für eine Laufbahn in der Forschung, der Pflege oder« – hier stahl sich wieder ein perfekt getimtes Lächeln auf seine Lippen, und er blickte kurz zu seinem Publikum – »in der Ausbildung entscheiden.«
»Die Majorität Ihrer ethischen Entscheidungen«, fuhr er fort, »wird Ihnen durch die recht strikte Gesetzeslage hierzulande abgenommen, doch auch im Rahmen geltenden Rechts werden Sie gelegentlich nicht umhinkommen, selbstständig zu denken.«
Wieder wurden vereinzelte Lacher laut, die jetzt jedoch mit einem erstaunlich scharfen Blick Szabós quittiert wurden und entsprechend schnell wieder verstummten.
»Der Begriff der ›Halbgötter in Weiß‹ ist falsch, veraltet und völlig zu Recht aus der Mode geraten, und Ihre Arbeitsrealität wird bedeutend unromantischer aussehen. Nichtsdestotrotz werden Sie, je nach Ihrer angestrebten Fachrichtung, öfter, als Ihnen lieb ist, über Leben und Tod entscheiden müssen. Diese Entscheidung kann weder ich noch sonst jemand Ihnen abnehmen, ein fundiertes Wissen über Ethik und – hier passt ausnahmsweise auch der andere Begriff wieder – Moral wird es Ihnen aber leichter machen, Ihre Entscheidungen vor anderen, primär aber vor Ihnen selbst zu rechtfertigen und Sie – an dieser Stelle bitte ich, die Drastik meiner Worte zu entschuldigen – nachts ruhig schlafen zu lassen.«
Laura verdrehte in Gedanken die Augen. Nicht, dass es nicht stimmte, was Szabó sagte, aber seine Theatralik ging ihr gehörig auf den Geist.
Natürlich hatte sie sich zur Vorbereitung auf ihr Studium auch mit den Durchfallquoten beschäftigt und erstaunt festgestellt, dass sie, obwohl das Gebiet der Medizin sicher nicht zu den einfachen Studiengängen gehörte, verschwindend gering waren. Nur zwei von tausend abgelegten Abschlussprüfungen wurden nicht bestanden. Auch die Durchfallquote im Physikum war verhältnismäßig gering, und der Anteil der Studienabbrecher war geringer als in jedem anderen Fach. Diese ganze elitäre Drohgebärde, die Leute wie Szabó noch immer aufbauten, war also reichlich überholt.
Jeder, der es bis in diesen Hörsaal geschafft hatte, wusste genau, was er hier wollte, und würde sich nicht von dem Gedanken abschrecken lassen, womöglich irgendwann mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Menschen mit derartigen Bedenken sollten in die Wirtschaft gehen, wo ihre Entscheidungen nur ein paar fiktive Zahlen auf ein paar fiktiven Konten beeinflussten und keine Menschenleben.
Ein gelegentlicher Blick zur Tafel reichte Laura, um Szabós Ausführungen über künstliche Befruchtungen, Schwangerschaftsabbrüche, Sterbehilfe und Gentechnik folgen zu können, und so erlaubte sie sich, ihre Kommilitonen in Augenschein zu nehmen.
Wie bei einem übervoll besetzten Hörsaal nicht anders zu erwarten, war hier jede Version eines Studierenden zu beobachten, die man sich ausmalen konnte. Während einige fleißig mitschrieben, was Laura nicht nur aufgrund des Einführungscharakters der Vorlesung für übertrieben hielt, sondern auch weil die Präsentation, die noch immer exakt synchron zu Szabós Worten über die Wand lief, bereits wenige Minuten nach Ende der Veranstaltung in ihren Postfächern landen würde, schienen sich andere überhaupt nicht für das zu interessieren, was vorne vor sich ging.
Besonders negativ fiel ihr ein blonder Typ auf, der allen Ernstes die Frechheit besaß, eine Sonnenbrille zu tragen. Laura schüttelte den Kopf und fragte sich, ob der Kerl verkatert oder einfach extrem unhöflich war, dann wurde sie hellhörig, als sie das Wort »Seminar« hörte.
»… und auch in Bezug auf dieses Begleitseminar möchte ich mich für die zahlreichen Bewerbungen bedanken«, sagte Szabó gerade, während die Wand hinter ihm wieder dunkel wurde. Die Vorlesung neigte sich also offenbar ihrem Ende zu.
»Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre habe ich mich entschlossen, die Teilnehmerzahl des Seminars auf zehn zu beschränken.«
Ein Raunen ging durch den Saal und auch Lauras Augen wurden größer. Zehn Teilnehmer? Aus achthunderteinundsiebzig Studienbeginnern? Natürlich war klar, dass es reine Glückssache war, es in ein Seminar zu schaffen, vollkommen egal in welchem Fach.
Man hatte sich im Vorfeld anmelden müssen, und auch wenn das nirgends klar kommuniziert wurde, war doch jedem mit gesundem Menschenverstand klar, dass es bei der Masse an Studierenden eher eine Bewerbung als eine Anmeldung war. Trotzdem hatte Laura zumindest mit dreißig Plätzen gerechnet, was noch immer eine Gruppengröße war, in der man effektiv arbeiten konnte. Zehn war eine Frechheit.
»Die Termine und benötigten Unterlagen erhalten Sie digital, zum Abgleich der Daten melden Sie sich bitte im Anschluss bei mir …«
Szabó kramte kurz in seiner Tasche und holte dann eine Liste hervor, die tatsächlich, soweit Laura das von ihrem Platz aus erkennen konnte, handschriftlich verfasst war. Hatte Szabó sich seine Top Ten tatsächlich selbst ausgesucht? Da war es wieder, das elitäre Machtgehabe.
Laura holte ihre Tasche zwischen ihren Beinen hervor und stellte sie auf ihren Schoß. Der Weg zur nächsten Vorlesung war weit und die Zeit relativ knapp, sie wollte unter den Ersten sein, die den Hörsaal verließen. Innerlich hatte sie die Vorlesung bereits abgehakt. Hier gab es bloß nichtssagende Allgemeinplätze, die wirklich interessanten Themen würden im Seminar behandelt werden, und dieser Zirkel war offensichtlich nur Personen mit ausreichend Vitamin B zugänglich. Es würde sie wundern, wenn es über die quotennotwendige Vorzeigestudentin, die dabei war, damit man sich in Zeiten von mainstreamtauglichem Feminismus nichts nachsagen lassen musste, noch eine weitere weibliche Person ins Seminar schaffen würde.
Genervt saß Laura auf der Kante ihres Sitzes und wartete nur noch auf die obligatorische Verabschiedung, als sie plötzlich ihren Namen hörte.
Sie riss die Augen auf, aber es war unmöglich, dass sie sich verhört hatte. Szabó hatte ihren Namen genannt.
Sie war dabei.
4
FELIX
12:41
Ganz ehrlich, wollten ihn heute eigentlich alle verarschen?
Er hatte gute zwei Stunden Autobahn hinter sich, in denen er mehr über die Oper von Sydney, das Outback, Kängurus, Schnabeltiere, das Great Barrier Reef, Boatpeople, Jaffles und Lamingtons erfahren hatte, als er jemals wissen wollte – und nichts darüber, warum Ben nicht alleine zurückgekehrt war.
Nicht dass es ihn nicht interessierte, Ben war sein bester Freund, und Felix wollte absolut ALLES über sein Auslandssemester erfahren, aber gerade hatte er einfach keinen Kopf dafür. Je näher er der Hütte, beziehungsweise ihrem Treffpunkt am Parkplatz, kam, desto weniger konnte er vor sich selbst verbergen, dass sich all seine Gedanken um Laura drehten.
Ein entsprechend großer Stein war ihm vom Herzen gefallen, als sie auf besagten Parkplatz zufuhren und er Lauras Auto, irgendeine kleine blaue asiatische Schüssel, die rein baureihentechnisch keinerlei Wiedererkennungswert besaß, die er aber trotzdem überall auf den ersten Blick entdecken würde, tatsächlich dort stehen sah. Doch das Glücksgefühl, das sich sofort in ihm breitmachte, erhielt schon Sekunden später einen heftigen Dämpfer, als er sein Auto vor einer dieser typischen festverschraubten Autobahnrastplatz-Bank-Tisch-Kombinationen abstellte, von denen selbst hier im vorletzten Eck des Nationalparks eine ganze Reihe aufgestellt worden war.
Denn auf der Bank saß zwar wirklich Laura – und das war etwas, wovon er bis zum Schluss nicht komplett überzeugt gewesen war –, außer ihr saßen dort jedoch noch zwei andere Personen, die absolut nichts hier zu suchen hatten.
Eine davon war ein etwas mitgenommen aussehendes blondes Mädchen, vermutlich etwa in Lauras Alter, das Shorts und ein kurzes Top trug und sich an einer Flasche Bier festhielt. Felix hatte keine Ahnung, wer sie war, ihre Anwesenheit störte ihn nicht besonders. Sie kam ihm irgendwie bekannt vor, er kam aber nicht darauf, woher. Felix vermutete, dass sie eine Freundin oder Mitbewohnerin von Laura war und dass die sie spontan eingeladen hatte. Das schien ja mittlerweile zum guten Ton zu gehören. Aber wer wäre er, sich gegen die Gesellschaft einer hübschen jungen Frau auszusprechen? Vielleicht würde sie ja den Australier beschäftigen.
Das Problem und der Grund dafür, dass Felix mehr als einen Augenblick lang ernsthaft mit dem Gedanken spielte, einfach das Gaspedal wieder durchzudrücken und nur eine Staubwolke zurückzulassen, saß Laura gegenüber.
Dort, herausgeputzt in dem, was sich ein Vierzehnjähriger anziehen würde, nachdem er The Wolf of Wall Street gesehen hatte, mit einer Aviator auf der Nase, den Blick auf sein – selbstverständlich – brandneues iPhone gesenkt und allen Ernstes, als wäre der Rest seines Besserverdiener-Hipsterlooks nicht schon armselig genug, ein Zigarillo im vom geölten Barbershop-Vollbart umhegten Mundwinkel, saß Fabian, Lauras Anscheinend-immer-noch-Boyfriend.
Was zur Hölle wollte dieser Wichser hier? Nicht nur dass er den Altersdurchschnitt am Tisch vermutlich verdoppelte und alles mit diesem dunkelbraunen Ding in der Fresse vollstank, Felix war eigentlich fest davon überzeugt gewesen, dass sich das zwischen ihm und Laura endgültig erledigt hatte. Zumindest hatte Felix alles, was ihm möglich war, dafür getan.
Aufregen brachte nichts. Felix schaltete den Motor ab, setzte sein selbstbewusstestes Lächeln auf und ging auf die drei zu.
Er hatte es einmal geschafft, er würde es wieder schaffen.
Außerdem lag die Hütte verdammt weit oben.
Und manchmal stürzten Menschen von Klippen.
5
LAURA
12:42
Respekt, das dürfte ein neuer Rekord sein.
Felix war noch nicht mal aus dem Auto gestiegen, und Laura wollte einfach nur weg. Wie konnte man es denn schaffen, dass allein die Art, auf einen Parkplatz zu fahren, einen schon als Arschloch outete? Der Parkplatz war wirklich nicht klein und fast leer. Sie selbst hatte ganz am Rand geparkt, fast bei der Ausfahrt zur Hauptstraße und damit weit entfernt von dem Weg, der schließlich in den Nationalpark führte.