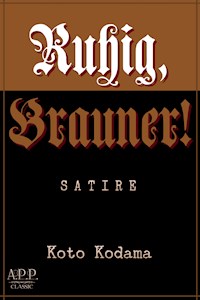
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: A.P.P. Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit soll man nie ändern – doch genau an dieses Gebot will Jesus Christus sich an jenem Tag im Jahr 1930, als er Adolf Hitler in dessen Stammlokal, dem Schelling-Salon in München aufsucht, nicht halten. Den Holocaust, arisches Gedankengut, ja mithin den gesamten 2. Weltkrieg schon im Vorfeld zu verhindern – eine wahrhaft göttliche Mission. Folgen Sie dem Gottessohn und dem unheilvollsten Diktator aller Zeiten in eine amüsante Plauderei über ›Gott und alle Welt‹, zu der auch die Damen Maria Magdalena, Angelika Raubal und Eva Braun so einiges beizutragen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Table of Contents
DAS BUCH
VORWORT
Kapitel 1: Der Thronfolger
Kapitel 2: Der Schelling-Salon
Kapitel 3: So unergründlich tief
Kapitel 4: Heilige oder Hure?
Kapitel 5: Unerwarteter Besuch
Kapitel 6: Der Klerus
Kapitel 7: Die Selbstentzündung
Kapitel 8: Ein Gespräch unter Frauen
Kapitel 9: Der Mann mit dem verchromten Colt
Kapitel 10: Ein Telefonat der besonderen Art
Kapitel 11: Mit Pauken und Trompeten
Kapitel 12: Die Gottesprobe
Kapitel 13: Sand im Getriebe
Kapitel 14: Angelika macht einen Ausflug
Kapitel 15: Wenn der Vater mit dem Sohne
Über den Autor:
Leseprobe aus DOPPELOPFER
Das Buch
PRÄLUDIUM
TEIL 1
Die Stunde null
1
2
Ruhig, Brauner!
Deutsche Erstausgabe August 2019
©Koto Kodama
[Registration Number TXu 1-985-147]
United States Copyright Office
www.kotokodama.de
Alle Rechte vorbehalten!
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Erschienen im:
A.P.P.-Verlag
Niederlassung Deutschland
Peter Neuhäußer
Gemeindegässle 05
89150 Laichingen
Presseanfragen: [email protected]
Mobi: 978-3-96115-505-7
E-Pub: 978-3-96115-506-4
Print: 978-3-96115-507-1
Dieser Roman wurde unter Berücksichtigung der neuen deutschen Rechtschreibung verfasst, lektoriert und korrigiert. Es handelt sich um eine fiktive Geschichte. Orte, Events, Markennamen und Organisationen werden in einem fiktiven Zusammenhang verwendet. Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Markennamen und Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer.
DAS BUCH
Die Vergangenheit soll man nie ändern – doch genau an dieses Gebot will Jesus Christus sich an jenem Tag im Jahr 1930, als er Adolf Hitler in dessen Stammlokal, dem Schelling-Salon in München aufsucht, nicht halten. Den Holocaust, arisches Gedankengut, ja mithin den gesamten 2. Weltkrieg schon im Vorfeld zu verhindern – eine wahrhaft göttliche Mission.
Folgen Sie dem Gottessohn und dem unheilvollsten Diktator aller Zeiten in eine amüsante Plauderei über ›Gott und alle Welt‹, zu der auch die Damen Maria Magdalena, Angelika Raubal und Eva Braun so einiges beizutragen haben.
VORWORT
Wie jeder weiß, sah Hitler in Richard Wagner »die größte Prophetengestalt, die das deutsche Volk besessen« habe. So eine von Hitlers Wagner-Euphorien zu jener Zeit.
Der Begriff »Ruhig, Brauner!« kommt also in Wagners »Walküre« vor. Es handelt sich hierbei um das Gesamtwerk »Der Ring des Nibelungen«. Der Ring des Nibelungen ist eine Tetralogie, ein »Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend«. Die Walküre ist nach dem Vorspiel (»Das Rheingold«) der erste Tag.
Dritter Akt: Auf dem Gipfel eines Felsengebirges. Rechts begrenzt ein Tannenwald die Szene. Links der Eingang einer Felsenhöhle, die einen natürlichen Saal bildet: darüber steigt der Fels zu seiner höchsten Spitze auf. Nach hinten ist die Aussicht gänzlich frei; höhere und niedere Felssteine bilden den Rand vor dem Abhange, der – wie anzunehmen ist – nach dem Hintergrund zu steil hinabführt. Einzelne Wolkenzüge jagen, wie vom Sturm getrieben, am Felsensaume vorbei.
Vorspiel und erste Szene:
Gerhilde, Ortlinde, Waltraute und Schwertleite, später Helmwige, Siegrune, Grimgerde, Roßweiße, Brünnhilde, Sieglinde (Gerhilde, Ortlinde, Waltraute und Schwertleite haben sich auf der Felsspitze, an und über der Höhle, gelagert, sie sind in voller Waffenrüstung.)
GERHILDE
(zuhöchst gelagert und dem Hintergrunde zurufend, wo ein starkes Gewölk herzieht) Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha! Helmwige! Hier! Hierher mit dem Ross!
HELMWIGES STIMME
(im Hintergrunde)
Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!
(In dem Gewölk bricht Blitzesglanz aus; eine Walküre zu Ross wird in ihm sichtbar: über ihrem Sattel hängt ein erschlagener Krieger.
Die Erscheinung zieht, immer näher, am Felsensaume von links nach rechts vorbei)
GERHILDE, WALTRAUTE UND SCHWERTLEITE
(der Ankommenden entgegenrufend)
Heiaha! Heiaha!
(Die Wolke mit der Erscheinung ist rechts hinter dem Tann verschwunden)
ORTLINDE (in den Tann hineinrufend)
Zu Ortlindes Stute stell deinen Hengst:
mit meiner Grauen grast gern dein Brauner!
WALTRAUTE
(hineinrufend)
Wer hängt dir im Sattel?
HELMWIGE
(aus dem Tann auftretend)
Sintolt, der Hegeling!
SCHWERTLEITE
Führ‹ deinen Brauen fort von der Grauen:
Ortlindes Mähre trägt Wittig, den Irming!
GERHILDE
(ist etwas näher herabgestiegen)
Als Feinde nur sah ich Sintolt und Wittig!
ORTLINDE
(springt auf)
Heiaha! Die Stute stößt mir der Hengst!
(Sie läuft in den Tann) (Schwertleite, Gerhilde und Helmwige lachen laut auf)
GERHILDE
Der Recken Zwist entzweit noch die Rosse!
HELMWIGE
(in den Tann zurückrufend)
Ruhig, Brauner!
Brich nicht den Frieden!
»Was für ein Glück für die Regierenden,
dass die Menschen nicht denken!»
Adolf Hitler
Kapitel 1: Der Thronfolger
Dort wo alles begann, in der Hauptstadt der Bewegung und der Hauptstadt der Deutschen Kunst: München, Anfang der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts. Dunkle braune Wolken ziehen über den Horizont von Bayern, die sich später über ganz Europa, bis kurz vor Moskau erstrecken werden.
Vorausgegangen war dieser misslichen politischen Situation der Ausbruch des ersten Weltkrieges, denn am 28. Juni 1914 besuchte der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz-Ferdinand mit seiner Ehefrau Sophie die bosnische Stadt Sarajevo. Die Stadt und Bosnien waren damals unter österreichisch-ungarischer Herrschaft, nach der Annexion von 1908. Diese Annexion wurde von vielen in Bosnien und auch Serbien als Besatzungsherrschaft empfunden.
Das Paar fuhr bei seinem Besuch Sarajevos im offenen Wagen, aufgrund schwerer Blähungen der Herzogin. Sie hatte zuvor eine Analspülung, wegen einer akuten Verstopfung im Enddarmbereich. Klistiere und Einläufe können auch eine Methode des Alkoholkonsums sein, doch in ihrem Fall wurde das einfache Klistier für sexuelle Praktiken der Klinikerotik, Klysmaphilie, zur Vorbereitung auf Analverkehr verwendet. Neugier, Experimentierfreude und Ironie waren die Ingredienzien, die beide in den Bann zogen und die das gemeinsame Vorhaben von der ersten Minute an beflügelt hatten. Und so fuhren sie weiter mit dem offenen Wagen und einer Eskorte in die Stadt. Am Morgen wurde ein Bombenanschlag auf sie verübt, dabei wurden zwei der Begleiter und mehrere Schaulustige verletzt. Die Fahrt wurde dennoch fortgesetzt und der Besuch im Rathaus absolviert.
Da die Inflatio der Dame auch danach nicht abrissen, fuhren sie weiter im offenen Wagen. Offensichtlich nahmen weder der Thronfolger und seine Frau noch die Eskorte die Gefahr wirklich ernst. Und so kam es zu einem zweiten, tödlichen Anschlag. Franz-Ferdinand und seine Ehefrau starben im offenen Wagen durch Pistolenkugeln.
Nach dem Anschlag hegte die österreichisch-ungarische Führung unter Kaiser Franz Joseph bald den Verdacht, der serbische Staat stecke hinter dem Mord des Thronfolgers und seiner Frau.
»Ich war ja eh allerweil freundlich. Ich lass mich nur net gern von so einem Bettbrunzer wie den Alexander I. Karađorđević am Schmäh halten. Es gibt jede Menge Tschuschen, da fährt die Eisenbahn drüber. Alles, was kein Wiener ist, ist praktisch ein Tschusch. Was glauben die denn überhaupt’s, mit wem sie reden? Bei mir reißen s‹ mit so einer Goschn ka Leiberl«, sagte der Kaiser auf Wienerisch, und somit drohte ein Krieg, den Österreich-Ungarn dann genau einen Monat nach den Morden am 28. Juli 1914 Serbien auch erklärte.
Dabei hatte es die volle Unterstützung des deutschen Kaisers Wilhelm II. Die beiden Mittelmächte hielten fest zusammen. Auf der Seite Serbiens aber stand der russische Zar Nikolaus. Seine Truppen machten sich ebenfalls bereit für einen Krieg. Die Französische Republik wiederum war mit Russland verbündet – das Bündnis, zu dem auch Großbritannien gehört, nannte sich Entente – und machte sich gleichermaßen bereit. Am 1. August erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg, dann am 3. August Frankreich.
Am 11. November 1918 endete für das Deutsche Kaiserreich der Erste Weltkrieg. Die Bilanz der Katastrophe waren etwa 8,5 Millionen Tote und mehr als 21 Millionen Verwundete. Als Ergebnis des Waffenstillstandes und des 1919 folgenden Versailler Friedensvertrages, der Deutschland die alleinige Kriegsschuld zuschrieb, besetzten Alliierte die linksrheinischen Gebiete. Deutschland musste etwa 14 Prozent seiner Fläche abtreten, schwere Waffen und die Hochseeflotte ausliefern sowie hohe Reparationszahlungen leisten. Später entstand die Dolchstoßlegende der im Felde unbesiegten Armee. Der verlorene erste Weltkrieg wurde von der NSDAP und seinem Führer Adolf Hitler später als Legitimation für ihr Handeln benutzt. Dabei wurden die Unterzeichner des Waffenstillstandsvertrages als »Novemberverbrecher« von Adolf Hitler diffamiert.
»Das sind eh nur irgendwelche Vertreter oder Hirnhappler von Politikern. Was die da machen, ist ein aufglegter Schas«, kommentierte Hitler. Die weiteren Maßnahmen führten zum sogenannten Hitlerputsch, dabei versuchte Adolf Hitler, Erich Ludendorff und weitere Putschisten am 8. und 9. November 1923 in der bayerischen Landeshauptstadt München die Regierungsmacht an sich zu reißen, um dann mit ihren Unterstützern einen Marsch auf Berlin zu machen, wie es damals Mussolini 1922 auf Rom getan hatte. In Berlin sollte dann die Republik beseitigt werden und eine nationale Diktatur gegen Juden und Marxisten errichtet werden.
Doch der Putsch scheiterte kläglich, und Hitler stand ab Frühjahr 1924 unter Hochverratsanklage vor dem Volksgericht in München. Hitler konnte sich im Laufe des nun folgenden »Hitler-Prozesses« aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten vom Angeklagten zum Ankläger hochstilisieren. Dabei deutete er unter anderem das Ereignis und Gedenken der Kriegsniederlage zum »eigentlichen Hochverrat« um und instrumentalisierte es in seinem Sinn als »Aufruf zum Putsch und Auflehnung gegen die Landesverräter«. Obwohl Hitlers Versuch, die Macht im Staat zu erobern, kläglich gescheitert war, sollte sich der Novemberputsch für ihn und die NSDAP später bezahlt machen. Sein Bekanntheitsgrad war dadurch enorm gestiegen und ihm wurde durch den nachfolgenden Prozess erhöhte mediale Aufmerksamkeit zuteil, die er auch nutzte, um sich als wahren Revolutionär und treuen, aber verratenen Patrioten zu präsentieren. Zudem ließ sich der Putsch später mythologisch verklären.
Nach seiner Verurteilung wegen des gescheiterten Putsches vom 9. November 1923 wurde Adolf Hitler zur Verbüßung seiner Strafe in die Gefangenenanstalt Landsberg am Lech eingewiesen. Die Festungshaft, die er am 1. April 1924 antrat, gestaltete sich für ihn sehr moderat: Er war in einem separaten Gefängnistrakt untergebracht, konnte zahlreiche Besucher empfangen, davon über zweihundert Verehrerinnen. Aber ein Mann »von guter Selbstzucht und Beherrschung«, wie Otto Leybold, der Leiter der Strafanstalt, ihn bezeichnete, lehnte dies uneigennützig und höflich ab. Und somit konnte er den ersten Band von ›Mein Kampf‹ verfassen. Am 20. Dezember 1924 wurde Hitler auf Fürsprache von Leybold auf Bewährung entlassen.
Als es am »Schwarzen Donnerstag«, dem 24. Oktober 1929, zu massiven Kursverlusten an der New Yorker Börse kam, lagen die Nerven der Börsianer blank.
»Siehst du, was passiert Jerry? Siehst du, was passiert, wenn man Aktien zu einem immer höheren Wert handelt, Jerry? Siehst du! Genau das passiert, wenn man versucht, einfache Aktienanleger in den Arsch zu ficken, Jerry!«, sagte einer der Spekulanten zu seinem Arbeitskollegen auf dem Börsenparkett. Der einleitende Kurssturz von der New Yorker Börse hatte in Deutschland besonders gravierende Auswirkungen.
Die amerikanischen Kapitalanleger hatten zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Weimarer Republik auf der Grundlage des Dawes-Plans wesentlich beigetragen.
Die Verantwortlichen für die Kreditvergabe nach Deutschland hatten sich in Schüchternheit und Zurückhaltung gegenseitig übertroffen, da die FED im Börsenboom von 1928, der dem Krach vorausging, die Zinsen deutlich angehoben hatte.
Der à la criée-Handel oder auch Zurufhandel, ist eine Form des Börsenhandels, womit sich die Händler die Preise der Aktien oder Warrants zurufen und mit Handzeichen zu verstehen geben, dass sie mit dem Kauf oder Verkauf zu diesem Preis einverstanden sind. Durch ein unglückliches Handzeichen eines Händlers, der eigentlich einen Freund auf dem Parkett grüßte, löste dieser damit eine Kettenreaktion aus, und seitdem war Auslandskapital kaum noch zu erhalten. So wurde eine Abwärtsspirale in Europa in Gang gesetzt, in der eine massiv rückläufige Produktion zu Massenentlassungen führte und sinkende Massenkaufkraft den Absatz weiter einbrechen ließ. Die Investitionstätigkeit kam praktisch zum Erliegen. Zugleich wurde die anschwellende Massenarbeitslosigkeit in Deutschland zur wachsenden Belastung und finanziellen Überforderung des sozialen Sicherungssystems, das eben erst um die Arbeitslosenversicherung erweitert worden war. Jeweils bezogen auf den Monat Januar stieg die Anzahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten Arbeitslosen von 1929 auf 2,85 Millionen und 1930 auf über 3,2 Millionen.
Kapitel 2: Der Schelling-Salon
In den von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Großstädten begegnete man auf den Straßen Dauerarbeitslosen mit Schildern, auf denen stand: »Suche Arbeit um jeden Preis«. Der einfache Briefzusteller Josef Mösenbichler war ein arbeitsloser Postbote in München, der seine Anstellung durch eine Verkettung unglücklicher Umstände verlor. Der Grund für seine absurde Entlassung war ein gewisser Leutnant namens Franz Kettler. Kettler hatte den sogenannten »Völkischer Beobachter« abonniert, und wartete, wie jeden Mittwoch, auf die korrekte Zustellung des Postbeamten Josef Mösenbichler. Vor ein paar Monaten war der Herr Leutnant verreist, und die Post stapelte sich in Kettlers Briefkasten. Als er zurückkehrte, bemerkte der Leutnant, dass sein im wahrsten Sinne des Wortes Völkischer Beobachter nach Scheiße roch. In der Zeitung war ein riesiger Haufen brauner Scheiße eingewickelt, die ihm auf seine frischpolierten Stiefel fiel, als er die Zeitung aus dem Briefkasten nahm. »Wer tut denn so etwas?, rief Kettler lauthals durch den Flur. Er zögerte nicht lange und hegte ungehaltene Vorwürfe gegen den ahnungslosen Postboten Josef Mösenbichler, der sich zuvor schon einmal negativ über diese Zeitung geäußert hatte, und legte prompt Beschwerde gegen ihn ein.
Nun musste sich Josef vor dem Postmeister Gerhardt Hofer rechtfertigen und traf folgende Aussage, nachdem man ihn gefragt hatte, was es mit dem »Völkischer Beobachter« auf sich hätte.
»Auf gut Deutsch … Scheiße!«, antwortete Josef Mösenbichler, und so kam es, wie es kommen musste. Er verlor seine Anstellung bei der Post, durfte aber seine Pensionsansprüche behalten.
»Tja«, sagte Josef zu seiner Frau, als er ihr diese traurige Nachricht überbrachte: »Ein Leutnant steht allemal über einem Professor oder einfachen Postbeamten. Er verkörpert Eleganz, Ehre, Schneid und Ritterlichkeit, da habe ich als einfacher Briefzusteller überhaupt’s keine Chance.« Und so stolzierte Josef Mösenbichler mit einem Schild um seinen Hals die Straße entlang, bis er an der Ecke Schellingstraße, direkt vor dem sogenannten Schelling-Salon im Münchener Bezirk Maxvorstadt stand. Dort verweilte er einen Augenblick und starrte auf das neubarocke, reich verzierte Eckgebäude mit eingebautem Turm. Der damalige Wirt des Schellinghofes, Silvester Mehr, hatte das Gebäude schon im Jahre 1872 errichtet. Herr Mehr, der von 1904 bis 1911 auch Präsident der Gastwirte-Innung in Bayern war, nutzte den Salon zunächst als eine Gartenwirtschaft. 1911 wurde er von dem Sohn übernommen und im Stile eines Wiener Café-Restaurants eingerichtet.
Zahlreich war dieses Wiener Café-Restaurant in jener Zeit besucht, hier stieß die Welt der Handwerker und kleinen Angestellten mit derjenigen der Lebenskünstler und verkrachten Existenzen zusammen. Aufgrund der hereinbrechenden Ereignisse in Wirtschaft und Politik, welche alles Bestehende über den Haufen geworfen hatten, und der neuen Zustände, welche so wenig zu den alten Gewohnheiten passen wollten, diente dieses Café nun der kleineren Bürgerschaft. Bei einem dunklen Bier oder einem Kaffee konnte man über die Ereignisse des gewerblichen oder politischen Lebens nach Herzenslust räsonieren.
Das elegante Kaffeehaus verfügte darüber hinaus über einige Leseecken, einen Zeitungsstand und mehrere Billardtische. An der Wand waren dunkle, ja schon fast schwarze, mit kleineren Rillen verzierte Holzvertäfelungen angebracht. Die etwa ein Meter fünfzig hohen Wandvertäfelungen durchzogen den ganzen Raum.
An manchen Stellen wurden sie mit großen Trennwänden, die im oberen Teil etwa vierzig Zentimeter geschmiedeten Eisenverzierungen im Landhausstil und dem unteren Teil, der aus demselben Holz wie die Wandvertäfelung war, unterbrochen. Diese Trennwände bildeten einen abgeteilten, sichtgeschützten Bereich in dem Lokal, oder wie viele sagten Chambre séparée oder auch nur Séparée. Innerhalb dieser Séparées standen dunkle und schwere Tische, die mit vier oder mehr Stühlen ausgestattet waren. Vom Boden bis zur Decke erstreckten sich vereinzelt vier große Säulen, die vom sogenannten Säulenschaft sowie oben drauf, am Kapitell, mit einem sich wiederholenden, abstrakten und abstrahierten Muster verziert waren. Sie hatten den Anschein, die schwere, langgezogene Decke hoch über den Besuchern zu stützen. Im hinteren Bereich, parallel zu den reich verzierten Säulen, standen einige Billardtische.
Im April 1930, ich glaube es war ein Donnerstag, kam es zu einem merkwürdigen Ereignis im Schelling-Salon. Es war noch früh am Abend, und bis auf ein paar alte Damen, die gemütlich Kaffee schlürften und Kuchen aßen und einem besetzten Stammtisch der Schützenbruderschaft, war noch nicht viel los.
Ein großer schwerer Eichentisch, an dem die Schützen saßen, befand sich inmitten des Schelling-Salons, und jeder, der zur Tür hereintrat, konnte ihre mit Orden und Schützenemblemen behangenen Uniformen und Trachten sehen.
Der Stammtisch traf sich zweimal pro Woche, an einem Donnerstag und Sonntag. »Wobei der Donnerstag immer der schönere der beiden Tage ist, da es schon mal vorkommt, dass die Ehefrauen nach dem Sonntagsgottesdienst ihre Herren in den Salon begleiten, und dann ist es nicht mehr so schön und lustig«, sagte Joseph Steyrer, einer der älteren Schützenbrüder. Joseph war ein um drei Ecken verwandter Vetter von Hans Steyrer, der als sogenannter Kraftmensch in Bayern bekannt geworden war. Als Sohn eines Metzgermeisters und Gastwirts erlernte er das Schlachterhandwerk bei seinem Vater. Schon als Lehrling konnte er ohne Hilfe jedes Kalb und jedes Ochsenviertel auf den Haken heben. Als dann 1879 der Zirkus Herzog den stärksten Bayern gesucht und diese Aktion bayernweit plakatiert hatte, gewann Hans Steyrer alle Wettbewerbe, und seitdem wurde er »der bayrische Herkules« genannt. Rosemarie, die Frau von Joseph, stammte aus einer leicht verblödeten, christlich-sozialen Familie und war eine entfernte Nichte vom »Perterbauer«, der 1922 groß in den Schlagzeilen gestanden hatte. Denn am Hof Gruber in Hinterkaifeck, in der oberbayerischen Einöde zwischen den Dörfern Gröbern und Laag, waren 1922 alle sechs Bewohner eines Bauernhofs brutal mit einer Hacke erschlagen worden. Der »Perterbauer«, auch Schlittenbauer genannt, galt als tüchtig und hilfsbereit. Eine Respektsperson.
Dies änderte sich, nachdem er mit zwei anderen Bauern die sechs Leichen gefunden hatte, vier Tage nach der Tat, am 4. April. Schlittenbauer wurde schnell verdächtigt, weil er eine Liebesaffäre mit der getöteten Viktoria hatte – und diese wiederum von ihrem Vater missbraucht worden war. Hinterkaifeck galt somit als Synonym für ungelöste Meuchelmorde. Doch zu ihrem Glück hatte sie schon lange Zeit vor den Meuchelmorden, um genau zu sein fünfzehn Jahre zuvor, Hinterkaifeck verlassen.
Und das kam so: Bei einem Volksfest in Laag lernte sie den damaligen Schützenbruder Joseph Steyrer kennen, wo er einst zu ihr sagte: »Es ist gerade 1906, bitte halte mir den Daumen, Rosemarie. Ich will jetzt auf der Stelle Schützenkönig werden, du Hur.« Sie sympathisierte mit dem Schützenbruder, und ein Jahr darauf heirateten die beiden. Joseph brachte seine frisch angetraute Gemahlin auf seinen Hof, der in der Nähe von München lag.
Die Schützenbruderschaften waren schon im frühen neunzehnten Jahrhundert in den Wirren der napoleonischen Kriege entstanden, und einige der alten Schützengilden existierten bis heute fort. In ihnen fand auch der Wandel vom Brauchtum zur Sportart statt, indem durch das Schießen auf die konzentrische Zielscheibe Zufallsschüsse minimiert und das exakte Messen eingeführt wurden.
Die alten Herren, die diese Tradition weiter pflegten, redeten über ihren nächsten Auftritt, der schon in ein paar Monaten stattfinden sollte.
Es war der Trachtenumzug für die ebenfalls traditionelle Münchner Wies´n. »Auf dem Oktoberfest in diesem Jahr sind auf der Festwiese jede Menge Hühner-, Fisch- und Wurstbratereien vertreten; weiter sind vorhanden: die Molkereikosthalle, Kaffeebuden, Süßigkeitsstände, Schießbuden, Tobogane, Flieger, Schiffsschaukeln, Krinolinen, Karussells, Wurfbuden und Schaustellungen aller Art. Karl Gabriel soll sogar eine Riesenpolarschau mit einem Lappendorf geplant haben. Außerdem bringt er eine Völkerschau der ›Lippen-Negerinnen‹ mit, die ihre Lippen künstlich verunstalten und zu abnormen Gebilden ausweiten können. Der Bierpreis beträgt wie im Vorjahre 1 RM pro Liter«, sagte einer der Herren und legte die alljährliche Wies’n Programmzeitung beiseite. Die Stimmung war ausgelassen fröhlich, und eine gewisse Freude auf das bevorstehende Oktoberfest machte sich breit.
»Ich weiß, meine Herren«, sagte Joseph Steyrer. »Es sind jetzt noch insgesamt sechs Monate bis dahin, aber was meinst, wie schnell die vorbei san‹?
»Ja genau«, stimmten ihm die anderen lautstark zu und tranken von ihrem dunklen Bier.
An jenem Abend saß noch jemand etwas abseits, in einem seitlichen gelegenen Séparée des Salons. Ein finster dreinblickender Mann, der einen fleckenlosen kohlrabenschwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit einer nachtfarbenen Krawatte und rußfarbenen Schuhe trug. Er hatte einen breitflächigen, gewöhnlichen Mund, und unter seiner breit ausladenden, etwas eingedrückten Nase trug er einen Oberlippenbart, der exakt, ja fast schon quadratisch rasiert war. Sein schwarzes Deckhaar war adrett auf der rechten Seite gescheitelt. Die nach außen geschlagene linke obere Vorderkante seines Sakkos war mit einem etwa vierundzwanzig Millimeter großen runden Parteiabzeichen der NSDAP mit goldenen Eichenkranz verziert.
Er war ebenfalls Stammgast und saß immer in einem Séparée direkt am Fenster. Von dort aus konnte man den ganzen Schelling-Salon überblicken und auf die Straße sehen. Dieser Herr im fleckenlosen dunklen Anzug war kein anderer als Adolf Hitler, ein aus Österreich stammender staatenloser Gefreiter, der im ersten Weltkrieg in der ersten Kompanie des Bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 16 als Ordonnanz und Meldegänger gedient hatte. Der zugegebenermaßen auch am 9. November 1923 in der bayerischen Landeshauptstadt München die Regierungsmacht mit einem Putsch an sich hatte reißen wollen. Und für diese Tat ins Gefängnis gekommen und dennoch wegen angeblich guter Führung nach weniger als neun Monaten Haft in der Festung Landsberg am 20. Dezember 1924 entlassen worden war. Ob die vorweihnachtliche Sentimentalität eine wesentliche Rolle bei dieser, wie sich später herausstellen sollte, naiven Entlassung gespielt hatte, ist nicht bekannt. Der Entlassene hatte in seiner Haftzeit ein Manifest an Grausamkeiten, antisemitischen und rassistischen Ideologien des Nationalsozialismus verfasst, was bei der späteren Veröffentlichung damals große Wellen geschlagen hatte. Denn es war ein grausamer Plan, den Hitler niedergeschrieben hatte und den er auch verfolgte. Er wollte die deutsche Schmach, wie der verlorene Erste Weltkrieg bezeichnet wurde, beenden und das deutsche Volk zu Selbstbewusstsein und Stolz zurückführen. Eben dieser Mann, der, um seine Absichten zu verschleiern, die Wörter »Sonderbehandlung« und »Endlösung« gebrauchte, jedoch damit »töten« und »ausrotten« meinte, saß nun gemütlich an seinem Stammtisch. In seinen Händen hielt er einen Brief von Wilhelm Frick, dem Innenminister von Thüringen sowie Minister für Volksbildung und durchlas aufmerksam dessen Inhalt. In diesem Brief stand folgendes:
Sehr geehrter Herr Adolf Hitler,
der ›einfachste‹ Weg zur Erlangung einer deutschen Landesangehörigkeit verliefe über eine Beamtung, da diese gemäß § 14 Abs. 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 automatisch die Einbürgerung zur Folge hätte.
Hiermit bieten wir Ihnen eine Stelle als Gandarmeriekommissar in Hildburghausen an. Ich werde Ihnen die Ernennungsurkunde gegen eine persönliche Bestätigung aushändigen.
Hochachtungsvoll ergebenst,
Wilhelm Frick
Hitler nickte inspiriert, nachdem er den Brief gelesen hatte.
Seine äußere Erscheinung mochte auf den ersten Blick alltäglich und durchschnittlich wirken. Doch der Wirt des Salons, der auf den klangvollen Namen Ignaz hörte, konnte ihn nicht leiden. Hitler war für ihn ein notorischer Zechpreller in seiner Gastwirtschaft, denn obwohl Hitler Geld besaß, ließ er des Öfteren seine Zeche anschreiben, um sie später oder auch gar nicht zu begleichen. Außerdem passte dem Wirt nicht, dass Herr Hitler zu später Stunde anfing, lautstark zu politisieren.
»Das verstört nur die Gäste«, so der Wirt. Seine Frau hingegen mochte Hitler sehr, irgendwie bewunderte sie diesen kleinen, stattlichen Mann. Schließlich war er ein bekannter Schriftsteller, und so duldete der Wirt die Anwesenheit des Stammgastes nur ungern in seinem Wiener Café Restaurant.
Hitler faltete den Brief wieder zusammen, steckte ihn mit einer überlegenden Bewegung zurück in den Umschlag und anschließend in die linke Brusttasche seines Sakkos. Plötzlich sprang ihm ein Gedanke durch den Kopf, er saß da wie paralysiert, völlig in sich gekehrt, den Blick starr nach vorn gerichtet, seine Lippen bewegten sich nicht.
Ein Abend wie immer, dachte er. Ich sitze in einem heruntergekommenen Wirtshaus mit einem noch mehr heruntergekommenen Wirt. Heute habe ich endlich den Schneid, das zu tun, was ich hätte vor langer Zeit tun sollen. Niemand bemerkt, was ich in der Tasche habe. Eine kleine Überraschung für alle. Obwohl ich mich lange vorbereitet habe, frage ich mich, ob ich es wage – aber ja – verdammt noch mal, ja!
Als der Wirt mit den Getränken, die er an den Tisch der Schützenbrüder bringen wollte, an Hitler mit unziemlicher Eile vorbeilief und ihn dort so bewegungslos sitzen sah, fragte er im Vorbeigehen: »Alles in Ordnung bei Ihnen, Herr Hitler?«
Hitler wurde aus seinen Gedanken gerissen, erschrak und antwortete schnell: »Alles bestens, und bei Ihnen?«
Aber der Wirt hatte es nicht gehört, er war schon quer durch den Salon gelaufen und erreichte soeben den Tisch der Schützenbrüder.
Solch förmliche Floskeln kannte Hitler nur zu gut, er ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und verfiel nach dem kurzen Intermezzo wieder in seine Gedanken zurück.
Ich werde es Ihnen heimzahlen, dachte er weiter. Tag für Tag sind sie zu weit gegangen. Immerzu haben sie mich herausgefordert, heute werden sie es bereuen. Wenn Geli kommt, werden sie es erfahren. Oh ja, wenn sie kommt, wissen es alle.
Kaum war der Gedanke zu Ende gedacht, erschien vor ihm eine Person im Séparée. Sein Antlitz strahlte wie die Sonne, und seine Kleider waren so weiß wie das Licht. Auch der Hintergrund leuchtete so hell, dass Hitler im ersten Moment geblendet war. Als sich seine Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten, sah er einen Mann in einem strahlend weißen Gewand, wie sie auf Erden kein Bleicher hätte machen können, und einer roten Toga, die von der rechten oberen Schulter nach links unten verlief.
Der Mann trat einen Schritt näher an den Tisch heran, und nun sah Hitler zu seiner Verwunderung im Hintergrund eine weitere Person. Es war eine Frau. Der Mann, der vor ihm stand, hatte schulterlanges braunes Haar, er trug einen Vollbart, hatte Sandalen an den Füßen und eine Dornenkrone auf dem Kopf. Aus ihm ragte eine große Nase mit gewaltigen Nasenlöchern hervor, und unter den buschigen Brauen leuchteten zwei braune Augen.
Zu Anfang glaubte Hitler, der Mann sei Kommunist oder ein Bolschewiki, wegen der roten Toga, im nächsten Moment, dass er ihm etwas verkaufen wollte. Dann trat die junge Frau an den Tisch heran. Sie war wie aus einem Märchen von Tausendundeiner Nacht. Bildhübsch, ein mediterraner Typ. Sie hatte hellbraune Haut, braune Augen, schulterlanges, leicht welliges, dunkles Haar und hohe Wangenknochen. Ihre Nase war gewöhnlich, nicht zu groß und nicht zu klein. Sie trug ein langes Kleid, das so dunkelrot wie ihre prallen vollen Lippen war. Ihre hellbraune Haut schimmerte durch das Licht, das Hitler blendete, erst jetzt konnte er zum ersten Mal sehen, dass sich die ebenso dunklen Höfe ihrer Brustwarzen zusammengezogen und sich leicht aufgerichtet hatten.
Das Kleid schien fast durchsichtig zu sein.
Der Mann mit dem Vollbart sagte: »Ist hier noch etwas frei?«, an den Tisch herantretend.
Finster blickte Hitler zur Tür, den Kopf zur Seite neigend, dabei sah er einige freie Tische. Er streifte leicht mit der rechten Hand über seinen akkuraten Schnurrbart und blickte nachdenklich in das Gesicht des bärtigen Mannes.
Hitler hielt einen Augenblick inne, bevor er antwortete: »Ja, aber ich erwarte noch meine Begleitung. Sie müsste jeden Augenblick kommen«, dies mit gepresstem Ton und gerunzelter Stirn. Er war sich ziemlich sicher, dass ihm nicht gefallen würde, was jetzt kam.
Der Mann stellte sich und seine Gefährtin vor. »Hallo, mein Name ist Jesus Christus und das ist meine Begleitung Maria Magdalena.«
Hitler mutmaßte, dass die Sachlage etwas komplexer sein könnte, trotzdem grüßte er, mit kühler Höflichkeit verneigend, vornehm zurück.
»Hallo, ich bin Adolf. Adolf Hitler«, sagte er mit scharfen, verwitterten Zügen und beobachtendem Blick auf die beiden Gestalten.
»Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Hitler«, entgegnete ihm Maria Magdalena mit einem Lächeln und reichte ihm im selben Augenblick ihre zarte, weiche kleine Hand entgegen.
Der charmant wirkende Österreicher war von ihrer Schönheit so begeistert und geblendet, dass er die Hand entgegen nahm, obwohl er den dunklen Hauttyp eher meidete als sich mit ihm zu unterhalten, geschweige denn, ihm die Hand zu reichen.
»Ganz meinerseits«, antwortete er und hatte ebenfalls ein kleines Lächeln auf seinen Lippen. »Eine reizende Person, ihr Fräulein Maria«, fügte er mit schweifendem Blick über die durchschimmerten dunklen Höfe ihrer Brustwarzen hinzu.
In dieser Zeit setzten sich Maria und Jesus an den Tisch. Maria Magdalena saß gegenüber von Hitler, indes rechts von ihr nahm Jesus Platz.
»Danke!«, erwiderte Jesus, während er sich den Stuhl zurechtrückte. »Und wie heißt Ihre Begleitung, die gleich kommen wird?«, fragte er neugierig.
Mit stolzgeschwellter Brust antwortete Hitler: »Angelika Raubal, aber alle sagen Geli zu ihr.« Ein kleines Schmunzeln zeichnete sich auf seinem Gesicht ab, als er den Spitznamen »Geli« sagte. Für Hitler stand in jenem Augenblick fest, dass ohne den Besitz von Angelika sein Leben keinen Sinn mehr hätte. Und der kurze Gedanke daran, dass Angelika mal die Frau an Hitlers Seite werden würde, gefiel ihm.
Die zaghafte Unterhaltung wurde von dem Wirt unterbrochen, der forsch an den Tisch herantrat, die neuen Gäste begrüßte und nach ihren Getränkewünschen fragte.
»Wos deaf ›s sei, fia de Herrschofdn?«, fragte Ignaz, den Blick auf den bärtigen Mann gerichtet.
Ignaz war von beeindruckender großer und kräftiger Statur. Er hatte dunkles, fast schwarzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Die maskulinen Züge in seinem Gesicht und die auffälligen Augenbrauen wirkten im ersten Moment ein wenig verwildert. Er trug ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine schwarze Hose und eine passende Weste, die nur eine Nuance heller, dafür mit feinen, kleinen springenden Hirschen und silbernen Ornamenten bestickt war. In der rechten Hand hielt er ein Serviertablett und über dem linken Unterarm lag ein Kellnertuch.
Er wirkte gelangweilt und sah den neuen Gästen an, dass sie weder ein Drei-Gänge-Menü noch ein paar Wiener bestellen würden. Er hatte die Erscheinung schon beim Platznehmen erfasst, ohne genau hinzusehen.
Hitler, der nicht auf den Getränkewunsch von Maria Magdalena und ihrem Begleiter warten wollte, rief dem Wirt zu »Ich nehme noch ein Helles« und überreichte ihm ganz unerwartet seinen leeren Bierkrug.
Als sogenannter Stammgast hatte jeder von ihnen seinen eigenen Krug im Schelling-Salon. Der von Hitler war ein klassischer Bierkrug aus Steingut ohne Deckel mit großzügigem Henkel und Füllmarkierung. Vorn zierte ihn ein in Blau gefasstes königlich bayerisches Wappen.
In den Zügen des Wirtes zeigte sich eine leichte Verlegenheit. Er nahm den Krug entgegen, stelle ihn auf sein Serviertablett und wiederholte die Bestellung von Herrn Hitler. »Ein Helles, der Herr. Und die Dame?«, fuhr er fort, dabei blickte er zu Maria Magdalena.
Die Dame zögerte einen Augenblick, doch kurz darauf äußerte sie ihren Getränkewunsch. »Ich hätte gerne einen Rotwein«, sagte sie und blickte zu dem Wirt auf.
Just in dem Moment, als Ignaz die Bestellung wiederholen wollte, wurde er von Jesus unterbrochen. »Wir nehmen einen Krug voll Wasser und zwei Gläser, mein Sohn«, sagte er aufblickend und zupfte beunruhigt an seinem Pharisäerbart.
Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr von einer Heiterkeit in Ignaz‹ Gesicht zu erkennen. Er blickte mit scharfem und durchdringendem Blick in die braunen Augen von Jesus, als wollte er in ihnen lesen, gleichwohl aber wussten beide, dass bei einem Krug voll Wasser nichts zu verdienen war.
Die Bestellung machte den Wirt erst richtig sauer, sodass dies auch zum Ausdruck mit folgenden bayerischen Worten kam: »Ah, Wossa? Na bitte, do werd I reich. Aba kannst jo nix dafia, dass du a Depp bisd«, sagte er kopfschüttelnd und wandte sich ab. Wutentbrannt verließ er den Tisch und ging seiner absurden Bestellung nach.
Nachdem der Wirt blitzartig verschwunden war, widmete sich Jesus wieder Hitler »Sagen Sie mal, Herr Hitler, was verschlägt Sie eigentlich nach München?«
Diese Frage überraschte und verstörte Hitler zugleich, schließlich war der Name »Hitler«, nach dem Erscheinen seiner zweiteiligen Buch-Reihe »Mein Kampf«, der erstmals am 18. Juli 1925, der zweite am 11. Dezember 1926 veröffentlicht wurde und als Bestseller in der bayerischen Landeshauptstadt München galt, für jedermann ein Begriff. Zudem war Adolf Hitler seit 1921 Parteivorsitzender der NSDAP, in der Hauptstadt der Bewegung.
»Das ist eine komische Frage«, erwiderte Hitler. »Aber ich werde Sie Ihnen gerne beantworten«, setzte er fort. »Ich bin hier, um politische Karriere zu machen. Ich werde das Deutsche Volk an die Spitze der Welt bringen«, fügte er energisch hinzu.
Dann scheitelte er sein Haar, das bei dem Ausdruck »Das Deutsche Volk« von seiner hohen Stirn etwas in sein Gesicht gerutscht war, langsam beiseite.
Seine grimmige Miene ist ein gewisser Fortschritt. Anscheinend ist er doch fähig, zumindest irgendetwas ernst zu nehmen, dachte Jesus.
Maria nahm seine Antwort mit leichtem Wohlwollen auf, strich sich ebenfalls die leicht gewellten, dunklen Haare aus ihrem Gesicht und sagte: »Das ist aber eine große Herausforderung.«
»Ja, da gebe ich Ihnen recht, Fräulein«, antwortete er unbeholfen. »Aber sagen Sie«, fuhr er mit hochgezogenen Augenbrauen und fragenden Blick auf Jesus fort, »kenne ich Sie nicht von irgendwoher?«
Anscheinend war Hitler etwas in Verlegenheit geraten, denn irgendwie waren ihm die beiden unheimlich geworden. Er versuchte von sich abzulenken und blickte lange mit schmalen Augen in das Gesicht von Jesus. Dort sah er aber nur einen zufriedenen, sanften, ja fast schon gelassenen Gesichtsausdruck.
Jesus lächelte fein, als er das hörte. »Oh, das mag sein«, erwiderte er nach einigen Minuten des Schweigens. »Es kommen viele Menschen auf mich zu und fragen mich genau das Gleiche. Wahrscheinlich habe ich so ein Allerweltsgesicht«, setzte er fort und fasste sich dabei an seine Dornenkrone.
Bei dem Versuch, die Krone etwas zurechtzurücken, bohrten sich ein paar Spitze Dornen durch die Haut seiner Stirn und ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen war zu sehen. Ein besonders dicker Blutstropfen bahnte sich seinen Weg aus der Wunde. Hitler beobachtete das Schauspiel, verfolgte mit seinem Blick den dunkelroten Blutstropfen, sah, wie er langsam aus der Wunde trat und in einer tiefen Stirnfalte von Jesus verschwand. Einen kurzen Augenblick passierte nichts, dann floss der Blutstropfen weiter, machte einen kleinen Bogen über der Augenbraue und fiel zu Boden.
Der düstere und melancholische Anblick des Blutes von Jesus versetzte Hitler in eine Art Trance. Er war völlig verwirrt und fragte sich, ob er dabei war, den Verstand zu verlieren. Es waren die schrecklichen Szenen und Bilder des Ersten Weltkrieges in seinem Kopf, die ihn immer wieder einholten. Die Sturmangriffe, das Gemetzel zwischen den Gräben, die vielen verwundeten und toten Kameraden – all jene erschütternden Kriegsszenen kamen plötzlich wieder hervor. Wie bei so vielen Soldaten war auch Hitler innerlich zerstört, ein Verlorener, dessen Seele der Krieg zerfetzt hatte.
Solch kleine Reminiszenzen konnten ihn ganz wehmütig stimmen.
Gemütsarm brachte Ignaz die Getränke an den Tisch und servierte sie seelenlos. Zuerst bekam Hitler sein Bier, in der Hoffnung, dass er später seine Rechnung begleichen würde.
»So, des Helle, fia den Herrn. Und da Gruag Wossa, fia des Gschwerl«, sagte er aufgeregt und stellte den Krug mit den beiden Gläsern lieblos mitten auf den Tisch.
»Danke, vergelt’s Gott! Das sagt man doch so in Bayern, nicht wahr?«, fragte Jesus mit einem ironisch, spöttischen Klang in seiner Stimme.
Ein leichtes Räuspern entfloh seiner Kehle, als er sich langsam vor Jesus aufbaute und weiter im bayerischen Tone zu ihm sagte: »Wissn Sie wos? Wenn I den jemois seng soiad, den HERRN, dann haue I eahm east oamoi in de Goschn. Und won er frogt wieso? Dann gleich no a.«
Der Mann mit der außergewöhnlichen Bartfliege, für den die bayerische Sprache kein Hindernis darstellte, blickte im selben Augenblick zu Ignaz auf und sagte: »Na, na, na, jetzt is ›s aba guad. Do ham’s an Kreiza und ›etz vaschwindn Sie.«
Mit einer unpassenden, chevaleresken Geste warf Hitler eine Münze quer über den Tisch, sodass Ignaz sie mit einer schnellen und flinken Handbewegung stoppen musste, bevor sie das Tischende erreichte und zu Boden fiel. Er nahm die Münze an sich und ließ sie in seiner Westentasche verschwinden. Dann griff er nach seinem Serviertablett und verließ zähneknirschend den Tisch.
Hitler machte eine abwehrende Handbewegung und wandte sich wieder Jesus zu.
»Ich bin mir bewusst, dass es vermutlich verstörende Neuigkeiten für Sie sind, aber ich muss mich für ihn entschuldigen, in der heutigen Zeit ist es für jeden schwer. Es gibt genug arbeitsloses Gesindel, Herumtreiberoder Schmarotzer in den Großstädten. Außerdem hat er riesige emotionale Probleme und deshalb reagierte er so«, sagte er beschwichtigend.
Jesus blickte mit unverändertem Ausdruck und fast neugieriger Aufmerksamkeit dem Wirt hinterher und sagte: »Ich glaube, er ist ein guter Mensch, aber die Krankheit seiner Frau setzt ihm zu.«





























