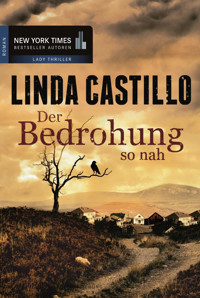9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Tag des Gerichts ist gekommen Auf einem Feld werden die Knochen des vor achtzehn Jahren verschwundenen Amisch-Bischofs Ananias Stoltzfus gefunden. Neben ihm liegt die Waffe von Jonas Bowman, mit der der umstrittene Geistliche gerichtet wurde. Die Polizei in Pennsylvania glaubt, in Bowman den Täter gefunden zu haben, aber die Ältesten der amischen Gemeinde können nicht an Jonas' Schuld glauben und bitten Polizeichefin Kate Burkholder um Hilfe. Kate kennt Jonas von früher und der Fall weckt lange begrabene Erinnerungen in ihr, denn die beiden verbindet eine persönliche Vergangenheit. Ist Jonas wirklich der rachsüchtige Mörder, für den er gehalten wird? Jetzt ist Kate die einzige, die den Mann vor der Todesstrafe bewahren kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Linda Castillo
Saat der Sünde
Thriller
Über dieses Buch
Auf einem Feld in Belleville, Pennsylvania, werden die Überreste des vor achtzehn Jahren verschwundenen Bischofs Ananias Stoltzfus gefunden. Ein Verlust, der damals die gesamte Amisch-Gemeinde des umstrittenen Geistlichen in Aufruhr versetzt hatte. Widerstandslos lässt sich Jonas Bowman von der Polizei abführen, obwohl er beteuert, den Mord nicht begangen zu haben. Da es Jonas’ eigene Waffe ist, mit der der Tote gerichtet wurde, betrachtet die Polizei in Belleville den Fall als abgeschlossen. Die Ältesten der Amisch-Gemeinde bitten Kate Burkholder in Painters Mill, Ohio, um Hilfe, da sie nicht an Jonas’ Schuld glauben. Jetzt ist Kate seine einzige Hoffnung, der Todesstrafe zu entkommen. Doch Jonas und Kate verbinden nicht nur gemeinsame Kindertage, sondern auch eine persönliche Vergangenheit …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Bestseller, die immer auch auf der SPIEGEL-ONLINE-Bestenliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Helga Augustin hat in Frankfurt am Main Neue Philologie studiert. Von 1986 - 1991 studierte sie an der City University of New York und schloss ihr Studium mit einem Magister in Liberal Studies, Schwerpunkt Translations, ab. Die Übersetzerin lebt seit 1991 in Frankfurt am Main.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Dank
Dieses Buch widme ich meinen Freunden in Ohio, Denise Campbell Johnson und Mark O. mit Dank für den fröhlichen Lunch im Amisch Country, bei dem der Funke einer Idee zu einem lodernden Feuer entfacht wurde.
EIN MENSCH SIEHT, WAS VOR AUGEN IST;
DER HERR ABER SIEHT DAS HERZ.
1. Samuel 16,7
Prolog
Er hatte immer gewusst, dass dieser Augenblick kommen würde. Der Tag des Jüngsten Gerichts. Die große Abrechnung. Das Urteil, das schon sein ganzes Erwachsenenleben wie ein Damoklesschwert über ihm hing. Viele Jahre hatte er seine Schuld abgestritten. Jede wache Minute hatte er versucht zu beweisen, nicht getan zu haben, was man ihm vorwarf, und Wiedergutmachung geleistet. Denn er hatte es getan. Beinahe war es ihm gelungen, sich selbst zu überzeugen, dass nichts davon geschehen war. Er hatte sich seine eigene Wahrheit geschaffen, und an der hielt er fest mit der Verzweiflung eines Mannes, der wusste, dass sein Leben davon abhing.
Doch während er die Dummköpfe – und vielleicht auch das eigene Gewissen – hinters Licht führen konnte, ließ sich das Schicksal nicht täuschen. Das Untier, das in seinem Inneren lauerte und vor dem er so lange weggerannt war, hatte ihn schließlich eingeholt.
Warum er dem Treffen zugestimmt hatte, war ihm nicht klar. Irgendein innerer Zwang. Wohl auch Neugier. Oder aber die irrsinnige Vorstellung, die Wahrheit zu sagen mache ihn frei. Doch was wusste ein Meisterlügner schon von Wahrheit? Vielleicht war das Bedürfnis, es zu Ende zu bringen, ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen, ebenso einfältig, wie zuzugeben, dass er verdiente, was immer auch passieren würde.
Komm zur Windmühle. Um Mitternacht. Komm allein.
Es war die dritte Nachricht dieser Art in zwei Wochen. Gewöhnliche Menschen würden solche Aufforderungen ignorieren oder in den Müll werfen, Unschuldige würden sie der Polizei übergeben. Aber er war kein gewöhnlicher Mensch, sosehr er es auch glauben wollte. Und ganz bestimmt war er nicht unschuldig. Nein, dachte er düster, das nicht. Er musste mit dem Problem umgehen, sich ihm stellen und es endgültig aus der Welt schaffen. Die Dinge wieder in Ordnung bringen, falls das irgendwie möglich war. Und es dann ein für alle Mal ad acta legen.
Doch wie konnte jemand davon wissen? Wie konnte jemand in seiner Vergangenheit das entdecken, was er so akribisch verborgen gehalten hatte? Aber die eigentliche Frage, die ihn seit der ersten Nachricht am meisten ängstigte und jede Nacht wachhielt, war: Wie konnte sich jemand an etwas erinnern, das er selbst so gut wie vergessen hatte?
Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du getan hast. Ich kenne deine Geheimnisse. Alle.
Seit Tagen wurde er von diesen Worten gepeinigt. Er hatte weder gegessen noch geschlafen und war keinen Moment lang zur Ruhe gekommen. Verzweifelt wollte er glauben, die Bedeutung, die Absicht der Nachrichten falsch interpretiert zu haben; dass der Grund für die mysteriösen Worte ein belangloser Vorfall oder aber ein banaler Ausruf gewesen war, mit dem er jemanden in der Gemeinde provoziert hatte. Konnte es sein, dass er etwas in sie hineinlas, was gar nicht gemeint war?
Ich weiß, wer du bist.
Nein, dachte er, als er am südlichen Rand des Waldes entlanglief, diese Worte waren nicht falsch zu verstehen. Aber richtig oder falsch oder etwas dazwischen, er musste der Sache auf den Grund gehen – sie beenden, bevor die Situation außer Kontrolle geriet –, und das ging nur auf eine einzige Weise.
Der Wind rüttelte an den Blättern der Bäume, schnitt eiskalt durch Jacke und Kleider. Die alte Farm lag ziemlich weit weg, und er war froh, den Spazierstock mitgenommen zu haben. Auch eine Laterne hatte er dabei, aber die brauchte er nicht. Der Dreiviertelmond bot mehr als genug Licht, um dem teils überwucherten Feldweg zu folgen.
Als der Weg eine Biegung machte, durchquerte er den Graben und ging auf der anderen Seite weiter bis zum Stacheldrahtzaun. Dort hängte er den Gehstock an den obersten Strang, testete dessen Festigkeit, trat auf den untersten Strang und schwang das Bein oben drüber. Sein Knie protestierte, als er auf der anderen Seite aufkam, ebenso der Fuß – das Los eines Mannes, der zu alt geworden war.
Er ging weiter, und nach zwei Minuten tauchten in der Ferne die Umrisse der baufälligen Scheune und der Windmühle auf. Die metallenen Flügel, vom stürmischen Wind angetrieben, jaulten wie Todesfeen. Normalerweise liebte er dieses Geräusch, doch heute Nacht ließ es ihn frösteln, und das hatte nichts mit der Kälte zu tun.
»Hallo?«, rief er. »Ist da jemand?«
Doch außer dem Kreischen der Turbine, dem Klappern der lockeren Holzverkleidung und dem Scheppern der Flügel im Wind hörte er nichts.
Er stapfte durch das Gras weiter zum Sockel der Mühle, wobei ihn seine Füße daran erinnerten, dass er bereits zwei Meilen gelaufen war. Mürrisch knurrend lehnte er den Gehstock an den Lattenzaun und ließ sich auf den brüchigen Betonboden nieder. Er zog die Jacke fester um sich und schob die Hände in die Taschen, denn er fror, und seine Gelenke schmerzten. Zehn Minuten würde er dem Initiator des mitternächtlichen Treffens geben, um aufzutauchen. Weitere zwei Minuten, um sein Anliegen vorzutragen und seine Absicht zu erklären. Wenn niemand kam, würde er nach Hause gehen und die Zettel wegwerfen. Er würde die albernen Mitteilungen vergessen, wie er über die Jahre so vieles andere vergessen hatte.
Er wünschte, er hätte die Handschuhe nicht zu Hause auf dem Küchentisch vergessen, und überlegte gerade, die Tabakpfeife, die immer in seiner Tasche steckte, anzuzünden, als aus dem Dunkel eine Stimme erklang.
»Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du kommst.«
Er schreckte zusammen, hievte sich auf die Füße und blickte mit zusammengekniffenen Augen in den düsteren Winkel bei der Scheune. Das Gesicht musste er nicht sehen, er wusste auch so, wem die Stimme gehörte. Der Blitzstrahl des Wiedererkennens durchfuhr ihn mit ganzer Wucht, traf ihn bis tief in seine Seele – was davon noch geblieben war.
»Meine Knochen sind zu alt, um noch so weit zu laufen«, sagte er mit ruhiger Stimme, trotz des Aufruhrs seiner Gefühle. »Vor allem um eine Zeit, wenn ein alter Mann zu Hause im Bett liegen und schlafen sollte.«
»Und wie schläfst du so?«
»Der Herr liebt die Seinen und lässt sie ruhig schlafen.« So etwa stand es in der Bibel. »Schließlich liebt Gott alle seine Kinder.«
Eine Gestalt trat aus dem Schatten, und das Gefühl von Verrat traf ihn so hart, dass ihm die Luft wegblieb und er weiche Knie bekam. Nicht in hundert Jahren hätte er das erwartet. Nicht das.
»Du kennst Gott nicht«, sagte die Gestalt. »Du kennst nur Lügen.«
In dem Moment bemerkte er das Gewehr, das sein Gegenüber mit dem Lauf nach unten hielt. Nicht bedrohlich. Eher wie ein Jäger es hielt, der nach einem langen Tag des Jagens müde und auf dem Weg nach Hause war. Dennoch klopfte sein Herz heftig.
»Was willst du?«, fragte er.
Das Lachen klang bitter. »Ich will, dass du verschwindest.«
Dutzende Gedanken malträtierten seinen Verstand – die Erkenntnis, dass er in Gefahr war, was ihn gleichzeitig fassungslos machte und wie eiskaltes Wasser auf einen freiliegenden Nerv traf, wie ein Tritt gegen einen gebrochenen Knochen.
Jetzt richtete sich das Gewehr auf ihn, Finger am Abzug. Das Zittern der Mündung kaum wahrnehmbar.
»Ich fürchte um deine Seele«, flüsterte er.
»Und ich um deine. Was noch davon übrig ist. Wir wissen beide, dass du nicht in den Himmel kommst.«
Die Laterne glitt ihm aus der Hand und fiel scheppernd zu Boden. Der Glaszylinder zerbrach, doch er registrierte es kaum. Heftig atmend, hob er den Arm und machte einen Schritt zurück. »Opfere dein Leben nicht für meins. Das bin ich nicht wert.«
Die geflüsterten Worte eines Gebetes wehten mit einer Brise herüber, eisig wie ein Schrei in der Nacht. Schlagartig wurde ihm alles klar. Er drehte sich um und lief los, mit schwerfälligen Schritten und ausgestreckten Armen. Keuchende Laute entwichen seinem offenen Mund. Der Schmerz, den er zuvor empfunden hatte, war Todesangst gewichen. Hektisch blickte er sich um, doch weder Häuser noch Bäume waren zu sehen, hinter denen er Deckung finden könnte, und so schleppte er sich zu dem wenige Meter entfernten Zaun. Der Wald war seine einzige Hoffnung. Wenn er den Stacheldraht überwand, könnte er es schaffen. Mit dem Rest würde er sich später befassen.
Er lief so schnell es seine Gelenke erlaubten, doch seine Schritte waren staksig und mühevoll wie die eines alten Hundes. Zweimal stolperte er, ruderte heftig mit den Armen und konnte sich gerade noch rechtzeitig fangen. Hinter sich hörte er die stampfenden Schritte seines Verfolgers, das Durchladen des Gewehrs und Worte, die er nicht verstand.
Dann traf ihn ein wuchtiger Schlag in den Rücken, wie ein Baseball, der ihn mit hundert Stundenkilometern zwischen den Schulterblättern erwischte. Er taumelte vorwärts, Donnerkrachen in den Ohren, und fiel vornüber.
Er schlug mit dem Gesicht so heftig auf den Boden, dass seine Nase knackte. Er fühlte die kalte Erde an seiner Haut, totes Wintergras stach ihm in den Leib. Er spuckte einen Zahn aus, fühlte die Lücke mit der Zunge. Als die Schmerzen seinen Körper durchfluteten, wurde ihm die Schwere seiner Verletzung bewusst, und eine hilflose Panik überkam ihn, der er nichts entgegenzusetzen hatte. Er lag einfach nur da, Nebelschwaden im Kopf. Warum konnte er nicht aufstehen? Warum konnte er nicht laufen?
Erst jetzt wurde ihm klar, dass er angeschossen und schwer verletzt war. Er blutete stark, konnte sich nicht bewegen. Der Schütze kam näher, blieb kurz vor ihm stehen. Er hob den Kopf, wollte sehen, was jene Augen offenbarten …
»Gott kannst du nichts vormachen«, sagte die Stimme, die er so gut kannte. »Er sieht in deinem Herzen, was andere nicht sehen können.«
Er wollte antworten, aber sein Mund war plötzlich voll. Als er ihn aufmachte, floss ein Schwall warmes, salziges Blut auf den Boden. Der schwarze Lauf des Gewehrs kam näher. Er versuchte sich darauf zu konzentrieren, doch seine Augen rollten nach oben weg. Dann spürte er die eiskalte Mündung an der Schläfe, roch das Waffenöl.
Mit geschlossenen Augen lauschte er dem Knarren der Windmühle, dem Drehen der Flügel und dem Flüstern des Windes im hohen Gras.
Eine Explosion aus weißem Licht.
Ein weiterer Donnerschlag.
Und die Windmühle stand still.
1. Kapitel
Achtzehn Jahre später
Doyle Schlabach war froh, die Eselstuten gekauft zu haben. Sein Datt, der letzten Winter mit ihm zur Pferdeauktion in Belleville gefahren war, hatte Vorbehalte gegen den Kauf gehabt. Nimm die Belgier, hatte er gesagt. Die ziehen besser und sind kräftiger. Doyle hatte noch nie mit seinem Datt über etwas diskutiert, und sein Urteilsvermögen bei Vieh anzuzweifeln wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Aber die beiden Eselstuten waren genau das gewesen, was er brauchte: zwar nicht ganz so stark wie die Belgischen Kaltblüter, aber klug und willig und einfacher zu halten. Laut Information des Züchters war ihre Mutter von einem Holländischen Kaltbluthengst gedeckt worden. Doyle war überzeugt, dass es im ganzen Tal kein anderes Team gab, das kräftiger ziehen konnte als die beiden. Und sie würden ihn nicht arm machen.
Heute Morgen erntete er Heu auf dem vierzehn Hektar großen Südfeld, das er bei der Versteigerung der alten Duffy-Farm für einen guten Preis bekommen hatte. Mit Hilfe seines Vaters hatte er die alte Scheune darauf abgerissen, den Schutt beseitigt, den Boden gepflügt und Alfalfa ausgesät. Im Frühjahr war das Tal von Gott mit viel Regen gesegnet worden und er dadurch mit einer reichen Ernte. Es würde das beste Jahr werden, das er je hatte.
Die Junisonne brannte Doyle im Nacken, als er die beiden Maultiere übers Feld lenkte. Der Duft des frisch geschnittenen Alfalfas stieg ihm in die Nase, und nicht zum ersten Mal dankte er Gott, dass er ihn so reich beschenkt hatte. Er dachte an die Mockturtlesuppe, die es zu Mittag geben würde, und das Wasser lief ihm im Mund zusammen. Mit einem Schnicken der Zügel trieb er die Tiere zu mehr Tempo an.
»Kumma druff!«, rief er. Macht los.
Das Klirren des Zaumzeugs, vermischt mit dem flinken Schnippschnapp der Messerklingen des Mähers versetzten ihn in jenen Zustand innerer Ruhe, die er stets bei der Feldarbeit empfand.
Er hatte das hintere Ende erreicht und wendete gerade, um auf dem Rückweg die letzten Büschel zu schneiden, als der Mähbalken gegen einen Stein stieß.
»Brrr.« Doyle brachte die Maultiere zum Stehen. »Was der schinner is letz?«, knurrte er. Was ist das denn jetzt wieder?
Die Gegend hier war nicht besonders steinreich, aber ein paar Brocken hatte er beim Pflügen und Einsäen doch entdeckt. Steine in einem Feld bedeuteten immer Ärger, und das Letzte, was er jetzt brauchte, war eine kaputte Klinge.
Er sah hinter sich zu der Stelle, wo die Messerklinge über dem Boden hing, und entdeckte den Übeltäter – einen großen Stein, der Farbe nach Kalkstein. Leise fluchend machte er die Zügel fest, schob die Handbremse nach vorn und stieg ab. Neben dem Mähbalken ging er in die Hocke, griff nach dem Stein, um ihn über den Zaun in den Wald zu werfen, hielt bei der Berührung aber ruckartig inne. Seine Nackenhaare sträubten sich.
Doyle nahm das runde Ding in die Hand und wusste sofort, dass es kein Stein war: zu leicht, wahrscheinlich hohl, und die Oberfläche zu glatt. Er wischte die Erde ab, drehte es um. Beim Anblick der vorstehenden Zähne, der Augenhöhlen und des schwarzen Nasenlochs schauderte ihn. Als passionierter Jäger und jemand, der sein Vieh selbst schlachtete, wusste er sehr gut, wie ein Tierschädel aussah. Das hier war keiner.
Er schoss aus der Hocke hoch, ließ den Schädel fallen und machte einen Schritt zurück, um ein Haar wäre er über den Mähbalken gefallen. Plötzlich wurde ihm die Nähe zum Wald bewusst, und ihm fielen die Geschichten ein, die er als Kind über diesen Ort gehört hatte. Obwohl es heute heiß war, bekam er Gänsehaut an den Armen. Mit dem Gefühl, Blicke im Rücken zu spüren, drehte er sich um und sah zu der Stelle, wo früher die alte Scheune gestanden hatte. Aber dort war niemand.
Schnell geiste, dachte er. Gespenster.
Auf wackligen Beinen wich er zurück, konnte den Blick aber nicht von dem Schädel lassen. Er kletterte auf den Mäher, setzte sich auf den Stahlsitz und zog mit zittriger Hand an dem Hebel, der den Mähbalken anhob.
»Kumma druff!«, rief er, die Zügel in der Hand, »ya!« Das Heu war vergessen, er trieb die Maultiere in einen leichten Galopp.
2. Kapitel
Samstagvormittags herrscht in der Innenstadt von Painters Mill geschäftiges Treiben. Alles pulsiert ein bisschen schneller, und eine Energie liegt in der Luft, die Autofahrer auf der Hauptstraße dazu verlockt, das Fenster herunterzulassen und mit allen Sinnen in dieses Gewusel einer amerikanischen Kleinstadt einzutauchen. Oder, wenn sie Zeit haben, in eine der altmodischen Parkuhren fünfundzwanzig Cent zu werfen und den Nachmittag mit Shoppen zu verbringen.
Ich heiße Kate Burkholder, ich bin die Polizeichefin in diesem hübschen kleinen Ort. Ich bin hier geboren und amisch aufgewachsen, doch mit achtzehn habe ich die Gemeinde der Amischen verlassen und bin ins nahe gelegene Columbus, Ohio, gezogen. Dort musste ich lernen, mit meiner Entscheidung klarzukommen und mich in diesem so anderen Leben zurechtzufinden. Ich habe die Abendschule besucht und die Hochschulreife erlangt. Danach bin ich aufs College gegangen, habe einen Abschluss in Strafrecht gemacht – und landete bei der Polizei. Ich habe Jahre gebraucht, um zu lernen, nicht mehr amisch zu sein. Und obwohl ich mich in dieser Zeit persönlich und beruflich enorm weiterentwickelt hatte, musste ich mir schon bald eingestehen, dass ich meine Heimat vermisste.
Als dann die Chefposition bei der Polizei hier frei wurde, kam ich zurück. Zwar bin ich noch immer Anabaptistin, jedoch nie zu meinen amischen Wurzeln zurückgekehrt. Das hat viele Gründe, einige amische Glaubensgrundsätze kann ich immer noch nicht akzeptieren. Ich arbeite daran, mich mit meiner Familie auszusöhnen, denn das ist mir wichtig. Manche Mitglieder der Amisch-Gemeinde weigern sich, mit mir zu reden, doch inzwischen verletzt mich das nicht mehr. Wie in den meisten Beziehungen, endet die Arbeit daran nie, und Painters Mill ist mein Zuhause.
Als Chief habe ich am Wochenende meistens frei, es sei denn, es gibt einen Notfall oder ich springe für einen meiner Officer ein. Beides ist an diesem Samstagmorgen nicht der Fall, und ich bin nur in der Stadt, um ein Vogelhaus abzuholen, das ich meinem Lebensgefährten, John Tomasetti, nächste Woche zum Geburtstag schenken will. Tomasetti ist Agent im Ohio Bureau of Criminal Investigation, der beste Freund, den ich je hatte, und die Liebe meines Lebens. Ich habe das Vogelhaus bei einem amischen Möbelbauer bestellt, dessen Laden etwas abseits der Main Street liegt. Er hat versprochen, es heute Morgen fertig zu haben, und ich freue mich darauf, es pünktlich zum Geburtstag überreichen zu können.
Ich sitze im Explorer und fahre im Schneckentempo die Main Street entlang, als der Polizeifunk zum Leben erwacht.
»10–6-A«, ertönt die Stimme meiner Mitarbeiterin, die am Wochenende in der Telefonzentrale arbeitet – der Polizeicode für Verkehrsbehinderung durch ein parkendes Vehikel.
Ich spreche ins Mikrophon: »Wo genau, Margaret?«
»Main Street, Chief. Joe Neely hat gerade angerufen, irgendetwas spielt sich da vor seinem Laden ab.«
Joe Neely ist der Besitzer eines der neuen Gewerbe in der Stadt, eines edlen kleinen Cafés namens Mocha Joe’s, wo ich schon unzählige Male war.
»Eine Schlägerei?«, frage ich.
»Noch nicht, aber er sagt, auf der Straße stehen Leute und streiten. Alle Parkplätze sind blockiert, und jemand weigert sich wegzufahren.«
Painters Mill ist eine Touristenstadt, wenn am Samstag der Verkehr zusammenbricht, ist das ein gewaltiges Ärgernis. »Ich bin ganz in der Nähe«, sage ich. »Ich kümmere mich darum.«
»Verstanden.«
Weiter vorn auf der Straße sehe ich nun bereits den Menschenauflauf. Ich mache das Blaulicht an und überhole das Auto vor mir. Aber der Verkehr stockt, also lasse ich den Explorer einfach stehen und gehe zu Fuß weiter. Als Erstes sehe ich einen amischen Buggy mit angeschirrtem Traber, dem sichtlich unwohl ist inmitten so vieler Menschen. Auf dem Beifahrersitz des Buggys sitzt eine grau gekleidete Frau. Sie trägt eine Kapp aus Organdy und hält ein zappelndes Kleinkind an sich gedrückt. Die meisten Buggys in dieser Gegend kenne ich, und ich weiß, dass dieser Abner Nisley und seiner Frau, Mary Jo, gehört. Sie sind Swartzentruber-Amische und die Eltern von neun Kindern. Jahrelang hatte Abner es unterlassen, am Buggy das Schild »Langsam fahrendes Vehikel« anzubringen, was in Ohio gemäß Straßenverkehrsordnung Pflicht ist. Ich hatte ihn ein halbes Dutzend Mal angehalten und verwarnt. Als das jedoch keine Wirkung zeigte, verpasste ich ihm stattdessen Strafzettel. Dass ihn seine Weigerung Geld kostete, überzeugte ihn schließlich, auch wenn er das Schild für überflüssigen Zierrat hält.
Im schiefen Winkel vor dem Buggy steht ein silberner Toyota RAV4 mit Ohio-Nummernschild. Eine Frau in Jeans und weißer Bluse mit hochgerollten Ärmeln schreit etwas in ihr Handy, gestikuliert aufgebracht und starrt den amischen Mann neben sich wütend an. Mehrere Passanten nehmen Videos mit ihrem Smartphone auf, vermutlich hoffen sie, damit einen viralen Hit in den sozialen Medien zu landen.
Ich neige den Kopf leicht zur Seite, um ins Ansteckmikro am Revers zu sprechen, aber da ist gar kein Ansteckmikro, denn an meinem freien Tag trage ich natürlich keine Uniform. Seufzend hole ich meine Polizeimarke heraus, dann bahne ich mir einen Weg durch das lärmende Durcheinander.
»Chief Burkholder?«
Ich blicke nach rechts, wo Joe Neely auf mich zukommt. Ich verlangsame meinen Schritt. »Was ist hier los?«, frage ich ihn.
Neely, der wie immer eine kaffeebefleckte Schürze und seine Mocha-Joe’s-Kappe trägt, geht neben mir her. Normalerweise ist er nicht aus der Ruhe zu bringen und bleibt selbst in der morgendlichen Rushhour gelassen, wenn die unter Koffein-Entzug leidenden Kunden wie Zombies vor seiner Tür Schlange stehen. Doch heute Morgen atmet er schwer, hat Schwitzflecken unter den Achseln und Schweißperlen auf der Oberlippe.
»Das Buggy-Pferd hat auf die Straße geschissen«, sagt er, »und die Dame mit dem Toyota ist reingetreten.«
»Das hat ihr vermutlich nicht gefallen«, murmele ich und dränge mich zwischen zwei Teenagerjungen hindurch, die stehen geblieben waren, um den Grund für die Aufregung herauszufinden.
Joe verzieht den Mund. »Sie ist stinksauer, Chief. Ist zu ihm hin und hat ihn angeschrien. Als ich sie dann bat, ihren Wagen wegzufahren, hätte sie mir am liebsten den Kopf abgerissen.«
»Wurde jemand handgreiflich?«, frage ich.
»Noch nicht, aber ich möchte nicht in der Haut des amischen Mannes stecken.«
»Mal sehen, ob ich die Gemüter beruhigen kann«, sage ich. Joe dreht sich um und geht zurück, ich dränge mich durch die Menschenansammlung.
Als Erstes sehe ich Abner Nisley, in der üblichen amischen Kleidung – Strohhut, dunkle Hose, Hosenträger, Arbeitshemd –, er steht mitten auf der Straße, in angespannter Haltung, den Blick auf den Asphalt geheftet. Die Hände hat er tief in den Hosentaschen versenkt. Die Frau in Jeans und der weißen Bluse steht keinen halben Meter vor ihm und schreit etwas, das ich akustisch nicht verstehe. Aber angesichts des sinnbildlichen Schaums vor ihrem Mund, gehe ich davon aus, dass es nichts Nettes ist.
Sie ist etwa dreißig Jahre alt, blond, blaue Augen und hochrote Wangen.
Ich erreiche die vordere Zuschauerreihe und steuere auf sie zu. »Ma’am? Ich bin von der Polizei in Painters Mill. Was ist das Problem?«, frage ich und halte meine Polizeimarke hoch.
Die Frau dreht sich zu mir um, zeigt zum Pferd. »Dieses Pferd hat überall hingeschissen! Direkt auf meinen Parkplatz!« Jetzt zeigt sie auf ihren Fuß. »Sehen Sie sich das an! Meine Sandale ist voller Scheiße! Das ist gesetzeswidrig.«
Ich sehe auf besagte Sandale, ohne beim Anblick zusammenzuzucken, was nicht einfach ist. Sie muss voll in die Pferdeäpfel getreten sein, und nun quillt der Mist zwischen ihren Zehen und unter ihren kunstvoll lackierten Nägeln hervor.
»Die Schuhe habe ich gerade neu gekauft.« Sie kneift den Mund zusammen und schüttelt den Kopf. »Das ist absolut ekelhaft. Verlangen Sie von den Amischen hier denn nicht, ihren Dreck wegzumachen? Warum benutzen die keine Tüten oder sonst irgendwas, um die Scheiße aufzuheben? Denken Sie doch nur an all die Krankheiten!«
In Ohio ist die Benutzung von Kotbeuteln für Pferde nicht gesetzlich vorgeschrieben. Einige Städte und Dörfer mit amischer Population haben zwar gegenteilige Verordnungen erlassen, Painters Mill gehört jedoch nicht dazu. Da diese Frau offensichtlich aufgebracht ist, behalte ich das für mich und versuche es diplomatisch.
»Hören Sie, ich habe ein paar Wasserflaschen und Küchentücher im Kofferraum«, sage ich ruhig. »Wir gehen zu meinem Wagen und säubern die Schuhe.« Ich blicke an dem Autostau entlang. »Können Sie Ihren Wagen bitte zurück auf den Parkplatz fahren?« Ich schenke ihr ein Lächeln. »Danach lade ich Sie zum Kaffee ein.«
Sie lächelt nicht. »Wasserflaschen? Machen Sie Witze? Ich bin zum Mittagessen verabredet. Ich kann da nicht hingehen und nach Scheiße riechen.« Wütend zeigt sie auf Abner Nisley. »Sie da. Spritzen Sie meinen Fuß ab, sofort!«
Abner sieht mich schulterzuckend an. »See is weenich ad.« Sie ist ein bisschen daneben.
Die Frau sieht ihn an, als habe er sie beleidigt, und würde ihm wohl gern eine runterhauen. In dem Moment fängt einer der Autofahrer im Stau an zu hupen. Das ist mein Zeichen, den Disput zu beenden, bevor er eskaliert.
Ich sehe die Frau an. »Fahren Sie Ihren Wagen auf den Parkplatz, dann finden wir eine Lösung. Jetzt, sofort. Sie behindern den Verkehr.«
»Chief Burkholder! Katie!«
Ich drehe den Kopf in Richtung der Stimme, die ich kenne, und sehe Beatrice Graeff auf uns zusteuern. Sie ist die Besitzerin des Blumenladens neben dem Café und gehört zum festen Inventar von Painters Mill. Weißhaarig und zierlich – sie wiegt sicher wenig mehr als vierzig Kilo – ist sie wie stets wie aus dem Ei gepellt mit Hosenanzug von Dior und einem Topfhut, ihrem Markenzeichen. Die Leute machen ihr Platz, als sie mit Handfeger und Kehrschaufel zu uns kommt. »Ich sammle schon den ganzen Sommer den Kot der Pferde auf«, sagt sie in die Runde. »Und ich sage Ihnen, das ist reines Gold. Ich hab hinterm Haus einen Kompostbehälter und eine Wagenladung Teerosen, die nur darauf warten, wieder eine Fuhre Stickstoff zu kriegen.«
Alle drei schweigen wir, als die schmächtige Frau vor uns stehen bleibt und Abner Nisley Handfeger und Kehrschaufel hinhält. »Wenn Sie so freundlich wären, junger Mann, meine Knie sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.«
Der amische Mann nickt, geht in die Hocke und fegt die Pferdeäpfel auf die Schaufel. Beatrice holt eine Plastiktüte hervor. »Schmeißen Sie’s rein, ich nehme alles.« Sie blickt auf die Schuhe der Frau und runzelt die Stirn. »Liebes, Sie gehen am besten zum Schuster unten in der Straße, Mr. Shook macht Ihnen die im Nu sauber.«
Nach zehn Minuten haben der Buggy und das Auto die Straße frei gemacht, und der Verkehr auf der Main Street fließt wieder. Ich stehe auf dem Bürgersteig vor Mocha Joe’s und nippe an meinem Kaffee, als mein Handy klingelt. REVIER steht auf dem Display, und ich nehme ab.
»Konnten Sie das übelriechende Problem lösen, Chief?«, fragt Margaret, ein verhaltenes Kichern in der Stimme. »Ich hab gehört, die Frau sei voll reingetreten.«
Ich lächele. »Desaster abgewendet.«
»Tut mir leid, dass ich Sie an Ihrem freien Tag behellige, aber hier stehen drei Herren, die Sie sprechen wollen. Anscheinend sind sie den ganzen Weg von Pennsylvania hierhergekommen.«
»Pennsylvania? Wissen Sie, was sie wollen?«
»Das wollten sie mir nicht verraten, Chief. Nur, dass es wichtig ist und sie ungern bis Montag warten wollen.« Sie senkt die Stimme. »Es scheint etwas Ernstes zu sein.«
Ich seufze, denke an das Vogelhaus, das ich dann wohl heute Nachmittag abholen muss. »In zwei Minuten bin ich da.«
Ich werfe den leeren Kaffeebecher in den Müll und gehe zum Explorer.
Das Polizeirevier von Painters Mill befindet sich in einem hundert Jahre alten Gebäude aus rotem Back- und hellem Sandstein. Es hat nichts von dem Charme der meisten anderen historischen Häuser der Stadt, innen ist es im Winter zugig und im Sommer drückend heiß, zudem voller unerklärlicher Geräusche und Gerüche, die wenigsten davon angenehm. Trotz aller Defizite ist das Revier mein zweites Zuhause, und wenn ich hier eintrete, sehe ich nicht die Risse in der Wand oder den schadhaften, schmutzigen Stuck, nicht das veraltete Mobiliar oder den verkratzten, hundert Jahre alten Holzboden. Stattdessen spüre ich eine Wärme, die nichts mit der Temperatur zu tun hat, sondern mit dem Gefühl, von Menschen umgeben zu sein, die ich schätze und respektiere.
Heute Morgen sitzt Margaret, die außerhalb der Öffnungszeiten des Reviers in der Telefonzentrale arbeitet, an der Rezeption. Sie hat das Headset auf dem Kopf und tippt mit fliegenden Fingern auf eine Tastatur, die so abgenutzt ist, dass die Buchstaben darauf unleserlich sind. Rechts von mir sitzen drei amische Männer – dem Aussehen nach Kirchenälteste – auf dem Sofa, sie wirken deplatziert und fühlen sich offensichtlich unwohl.
»Guder mariye«, sage ich. Guten Morgen.
Die Männer erheben sich, alle drei haben offenbar steife Knie oder Gelenkschmerzen. Angesichts ihres mehr oder weniger ergrauten Haars und ihrer gebeugten Haltung, sind sie vermutlich in ihren Siebzigern oder älter. Alle haben volle, Bärte und außer einem weißen Hemd dunkle Sachen an: schwarze Jacke und Hose, schwarzer flachkrempiger Filzhut, schlichte dunkle Schuhe. Ihr Gesichtsausdruck ist so nüchtern wie ihre Kleidung. Der Größte der drei tritt auf mich zu. »Mein Name ist Nelson Yoder. Ich bin der Bischof von Belleville in Pennsylvania.«
Wir schütteln uns die Hand. »Lancaster County?«, frage ich, verwundert, warum diese Männer von so weit herkommen, ohne vorher auch nur angerufen zu haben.
»Kish Valley«, sagt er.
Über Kish Valley weiß ich lediglich, dass es irgendwo mitten in Pennsylvania liegt und dass es dort eine kleine amische Population gibt. Das scheint man mir anzusehen, denn der kleine Mann mit den hellen blauen Augen und fünfzig Pfund Übergewicht um den Bauch herum neigt den Kopf und hält mir die Hand hin. »Eigentlich Kishacoquillas Valley«, sagt er mit heiserer Stimme, »das liegt im Zentrum des Staates. Mein Name ist Nathan Kempf, ich bin der Diakon.«
Ich schüttele seine Hand, die kalt ist und schwielig wie die eines Mannes, der noch immer viel körperlich arbeitet. »In Lancaster war ich schon«, lasse ich ihn wissen, »aber noch nie in dem Tal.«
Er grinst. »Das nehmen wir Ihnen nicht übel, Kate Burkholder.«
Ich grinse ebenfalls. Er gefällt mir.
Der dritte Mann tritt näher. Er ist dünn, hat den knorrigen Körperbau einer Vogelscheuche, einen Bart in der Form einer nassen Socke, und zwei fehlende Eckzähne. »Mein Name ist Mahlon Barkman«, sagt er. »Ich bin einer der Prediger im Tal.«
Auch wir schütteln uns die Hand.
»Wir sind Diener der alt gemee«, erklärt Yoder.
»Diener« ist ein deitscher Ausdruck und bedeutet so viel wie Amtsträger. Bei den Amischen sind das der Bischof, der Diakon und die Prediger; diese Männer sind also die gewählten Amtspersonen ihres Kirchenbezirks. Und »die alt gemee« ist »die Alte Kirche«. Doch während ich Pennsylvaniadeutsch verstehe, weiß ich nicht genau, welcher religiösen Ausrichtung unter den Amischen sie angehören.
»Sie haben eine weite Reise hinter sich«, sage ich.
Die Männer nicken unisono. Sie schieben die Hände in die Hosentaschen, haben die Knie leicht gebeugt und sehen zu Boden. Nur hin und wieder werfen sie Margaret einen Blick zu, die die Computertastatur zum Glühen bringt, während sie insgeheim jedem Wort lauscht.
»Wir haben ein Problem«, sagt der Bischof feierlich. »Wir benötigen Ihre Hilfe.«
Er ist der Wortführer der Gruppe, deren Körpersprache mir sagt, dass sie ein gemeinsames Anliegen haben und sich hinsichtlich ihrer Mission einig sind. Aus irgendeinem Grund brauchen sie mich, um ihr Ziel zu erreichen.
»Gehen wir in mein Büro.« Ich zeige zum Flur und werfe Margaret einen Blick zu.
Sie zieht schulterzuckend die Augenbrauen hoch, was so viel heißt wie: Was zum Teufel ist da los?
»Macht es Ihnen etwas aus, uns einen Kaffee zu machen?«, frage ich.
»Wollen Sie den Herren wirklich unseren Kaffee antun?«, flüstert sie.
Ich weiß nicht, ob sie das ernst meint, doch ich lächele, als ich die Tür zu meinem kleinen Büro aufschließe und die Männer hereinbitte. »Setzen Sie sich«, sage ich, dabei wird mir klar, dass ein dritter Stuhl fehlt; ich hole ihn schnell herbei.
Kurz darauf sitze ich am Schreibtisch, und auch die drei Männer haben Platz genommen, eine Tasse Kaffee in der Hand.
Ich trinke einen Schluck, unterdrücke das Bedürfnis, mich wegen des bitteren Geschmacks zu schütteln. »Was führt Sie zu uns nach Painters Mill?«
Nelson Yoder verzieht leicht das Gesicht. »Vor zwei Monaten hat einer unserer Glaubensbrüder bei der Heuernte Menschenknochen gefunden. Die Polizei kam, hat die Knochen mitgenommen und mit ihren Apparaten und Chemikalien das getan, was man in so einem Fall tut. Ein paar Wochen später wurden die Knochen identifiziert als die von Ananias Stoltzfus.«
Mir ist weder der Name noch der Fall bekannt, also warte ich.
Diakon Kempf übernimmt. »Ananias war lange Jahre Bischof. Er war ein guter Bischof und hat viele Kommunionen und Taufen, Eheschließungen und Exkommunizierungen durchgeführt.«
Mahlon, der Prediger, schüttelt den Kopf. »Ananias verschwand vor achtzehn Jahren spurlos, so als hätte er sich in Luft aufgelöst.« Wieder Kopfschütteln. »Es war für uns alle eine schlimme Zeit. Bestimmt können Sie sich denken, dass seine Kinder und Enkel außer sich waren vor Sorge und Kummer, weil niemand wusste, was mit ihm passiert war. Natürlich ist unsere Amisch-Gemeinde tätig geworden, und wir haben getan, was wir konnten. Wir haben überall gesucht, wir haben der Familie geholfen, wir haben gebetet, aber …« Der alte Mann zuckt die Schultern. »Er sollte nicht zurückkommen.«
Schweigen tritt ein. Ich sehe mir nacheinander ihre Gesichter an, entdecke Kummer darin, aber keinen, der über die Jahre abnimmt, sondern frischen Kummer, ausgelöst durch die jüngsten Neuigkeiten.
»Konnte die Polizei herausfinden, was ihm zugestoßen ist?«, frage ich.
Der Bischof blickt mich aus wässrigen Augen an und nickt kurz. »Der Sheriff hat gesagt, auf Ananias sei geschossen worden.«
»Zweimal«, fügt Mahlon hinzu.
»Dann war es also kein Jagdunfall oder Selbstmord«, sage ich zögernd, denn ich weiß, da kommt noch mehr. Und was auch immer es ist, es wird mir nicht gefallen.
Nathan streicht sich nachdenklich über den Bart. »Bei den Knochen lag ein Gewehr, ein rostiger Vorderlader, von Erde bedeckt.«
»Dieser Vorderlader gehört einem von uns.« Der Bischof sieht mich mitfühlend an. »Jonas Bowman.«
Der Name trifft mich wie Dynamit, das in meiner Brust detoniert, unerwartet und schmerzlich. Einen Moment lang bin ich so überrascht, dass ich glaube, mich verhört zu haben. »Jonas Bowman?«, wiederhole ich und fühle, wie meine Wangen zu glühen beginnen. »Sind Sie sicher?«
Die drei Männer tauschen auf eine Weise Blicke untereinander, dass ich mich frage, ob sie mehr über Jonas und mich und unsere gemeinsame Vergangenheit wissen, als mir lieb ist.
Mahlon sagt besorgt: »Bruder Jonas wurde vor zwei Wochen verhaftet. Wegen Mordes.«
Der Bischof starrt hinab auf seine Hände und seufzt. »Sie haben das nicht gewusst?«
Die amische Gerüchteküche hat eine überraschende Reichweite. Aber aus Gründen, die mir selbst nicht ganz klar sind, will ich ihm nicht sagen, dass ich in amischen Klatsch nicht eingeweiht bin und einige Gemeindemitglieder nichts mit mir zu tun haben wollen, weil ich die Glaubensgemeinschaft verlassen habe. Deshalb schüttele ich einfach den Kopf.
Ich kannte Jonas Bowman als Jugendliche. Sein Vater, Ezra, war Prediger unserer Kirchengemeinde hier in Painters Mill. In meiner Kindheit hat Jonas nur am Rande eine Rolle gespielt. Ich sah ihn beim Gottesdienst, und ein paarmal hat er meinem Datt auf der Farm geholfen. Als ich älter war, spielten wir gelegentlich Baseball und Hockey und gingen zusammen im Painters Creek schwimmen. Das alles änderte sich, als ich fünfzehn war und er mich nach einem Singen nach Hause fuhr. Das »Singen«, das gewöhnlich nach dem Sonntagsgottesdienst stattfindet, ist für amische Teenager eine Möglichkeit, Gleichaltrige näher kennenzulernen. Dabei sitzen die Mädchen auf der einen Seite des Tisches und die Jungen auf der anderen, und gemeinsam singen sie »lockere« Lieder, die sie abwechselnd vorschlagen.
Es war das erste Mal, dass ich ohne Begleitperson – Bruder oder Schwester, Elternteil oder eine Freundin – im Buggy eines Jungen mitfuhr. In jenem Sommer erlebten wir beide viele »erste Male«. Manche waren gut, manche … weniger. Jonas war neunzehn, und in dem Alter machen vier Jahre Unterschied sehr viel aus. Aber wir waren jung, und das war uns egal.
Plötzlich spüre ich den Blick der drei Männer auf mir und reiße mich aus meinen Gedanken, zwinge mich zurück ins Hier und Jetzt und starre sie an. Der Kaffee in meiner Hand ist kalt, mein Puls schlägt ein wenig zu schnell.
»Jonas hat abgestritten, etwas damit zu tun zu haben?«
»Er sagt, er hätte es nicht getan«, erwidert der Bischof.
»Er ist ein glaubwürdiger Mann«, fügt der Diakon hinzu.
Ich überlege, was zur Identifikation eines Vorderladers gehört, der achtzehn Jahre lang den Elementen ausgesetzt war. Die meisten Schwarzpulvergewehre haben Seriennummern, aber nicht alle, besonders nicht die älteren. Was auch auf ein amisches Jagdgewehr zutreffen kann.
»Hat die Polizei die Patronenhülsen gefunden?«, frage ich.
Alle drei Männer scheinen zu überlegen, dann antwortet Mahlon Barkman: »Eine der runden Kugeln wurde gefunden, glaube ich.«
»Hatte er ein Motiv?«, frage ich.
Die drei Männer werfen sich Blicke zu. »Jonas und Ananias waren nicht gut aufeinander zu sprechen«, sagt Nathan Kempf schließlich.
Der Prediger liefert die Erklärung. »Jonas’ Vater, Ezra, war ja Prediger. Es gab Streit wegen eines Traktors, den Ezra gekauft hatte, als seine beiden Pferde überraschend an der Schlafkrankheit gestorben waren. Ananias hat das nicht akzeptiert und Ezra unter Bann gestellt.«
Das ist ein wiederkehrendes Thema unter Amischen. Jemand, in diesem Fall Ezra Bowman, verstößt gegen die Regeln und wird vom Bischof dafür bestraft.
»Und mundtot gemacht«, fügt der Diakon hinzu.
»Zwei Wochen später verstarb Ezra plötzlich.« Mahlon stößt einen tiefen Seufzer aus. »Jonas hat Ananias die Schuld an seinem Tod gegeben. Er meinte, die Belastung hätte ihn umgebracht.«
»Jonas machte Ananias verantwortlich«, sagt Nathan. »Er war wütend, sie stritten sogar in der Öffentlichkeit.«
»Jonas hat sich schlecht benommen«, fügt er hinzu. »Er war jung, erst einundzwanzig, und unbeherrscht. Er machte Sachen.«
»Was für Sachen?«, frage ich.
»Er beschädigte Ananias’ Buggy.« Nathan zuckt die Schultern. »Wurde erwischt und bekam Ärger mit der Polizei.«
»Es war nur eine Kleinigkeit«, wirft Mahlon ein.
»Zwei Monate später verschwand Ananias«, ergänzt Nathan.
»Und die Polizei hat den Vorderlader eindeutig mit Jonas in Verbindung gebracht?«, frage ich.
»Der Sheriff ist zu Jonas gefahren und hat ihm das Gewehr gezeigt«, erklärt der Diakon. »Jonas gab zu, dass es ihm gehört. Am nächsten Tag wurde er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt.«
»So eine Sünde würde Jonas niemals begehen«, sagt Mahlon. »Er würde einem anderen Mann niemals das Leben nehmen.«
»Er hat um meine Hilfe gebeten?«, frage ich.
Der Bischof schüttelt den Kopf. »Darum würde Jonas nie bitten«, sagt er. »So etwas würde er nie jemandem aufbürden.«
»Sein Leid gehört für ihn zum Plan Gottes.« Diakon Kempf sieht die beiden anderen Männer an. »Nicht Jonas bittet um Ihre Hilfe, Kate Burkholder, wir tun das.«
Ich sehe sie gedankenverloren an, während zahlreiche abschlägige Antworten und Ausreden in meinem Kopf umhergeistern.
»Jonas hat eine Familie, für die er sorgen muss«, sagt Nathan. »Kinder und eine Frau. Er muss sich um seine Schreinerei kümmern, und trotzdem sitzt er im Gefängnis für eine Sünde, die er nicht begangen hat.«
»Die englische Polizei versteht unsere Bräuche nicht. Sie kennen Jonas nicht so, wie wir ihn kennen.« Mahlon presst die Lippen zusammen. »Niemand will uns zuhören.«
»Sie sind Polizistin, Kate Burkholder«, sagt Nathan. »Sie verstehen uns, wie wir denken. Und Sie verstehen auch das althergebrachte Recht.«
»Aber noch wichtiger ist, dass Sie Jonas Bowman kennen.« Der Bischof blickt mich eindringlich an, und ich erkenne in seinen Augen ein feines Gespür, eine Wahrnehmung, die mich nervös macht – aber auch Fragen, die wegen der amischen Anstandsregeln niemals gestellt werden würden.
Ich halte seinem Blick nicht länger stand, sehe hinab auf den Notizblock vor mir und kritzele etwas darauf. Währenddessen sage ich mir, dass Jonas niemals unsere stillschweigende Übereinkunft brechen würde.
»Wir haben von den Fällen hier in Painters Mill gelesen, die Sie gelöst haben. Sie sind eine gute Polizistin.« Nathan unterstreicht die Worte mit einem Nicken. »Wir bitten Sie um Ihre Hilfe.«
»Wir haben Geld«, wirft Mahlon ein. »Wir bezahlen Sie für Ihre Zeit und übernehmen die Reisekosten.«
Die Männer verfallen in Schweigen, als hätten ihre Überzeugungsbemühungen all ihre Energie aufgezehrt. Eine ganze Minute lang herrscht Stille, unterbrochen nur vom gelegentlichen Klingeln des Telefons im Empfangsbereich sowie von Margarets Tippgeräuschen.
Alles Gesagte wirbelt in meinem Kopf umher. Ich kann nicht aufhören, an Jonas zu denken. An den Jungen, den ich kannte, und den Mann, der er geworden ist. An die gemeinsame Zeit in jenem letzten Sommer. Den nachhaltigen Einfluss, den er auf mein Leben hatte. Und alles in einer Zeit, in der ich zu verletzlich und verwirrt und zu jung war, um zu wissen, dass manche Gefühle nicht kontrolliert werden und manche Taten nicht rückgängig gemacht werden können.
Jonas war charismatisch, charmant und ein Überredungskünstler. Wenn er etwas wollte, war er nicht zu bremsen. Er hat alles gegeben, sei es beim Baseball oder bei der Holzverarbeitung – sogar bei viel persönlicheren Angelegenheiten. Er war ein Mann, den man nicht unterschätzen durfte, er hat mein Leben auf eine Weise berührt, die mir in jenen jungen Jahren gar nicht klar war. Hatte er Fehler? Zweifellos – wie wir alle. Aber sie wurden abgemildert durch sein feines Gespür für richtig und falsch – und durch null Toleranz für Ungerechtigkeit. Wie kann es sein, dass ein Mann, für den es damals nur Schwarz oder Weiß gab, nun des Mordes verdächtigt wurde?
Während diese Männer ihr Anliegen vortrugen, habe ich mich gefragt, wie viel sie über mich und Jonas wissen. Ob ihnen bekannt ist, dass wir beide in jenem letzten Sommer, in dem er in Painters Mill war, eine Menge Schwierigkeiten hatten, die zum Bruch der Amisch-Gemeinde mit seiner Familie geführt hatten. Ob sie wissen, dass ich der Grund bin, warum seine Familie nach Pennsylvania gezogen ist.
»Ihnen ist sicher bewusst, dass ich in Pennsylvania nicht zuständig bin«, sage ich.
»Sie können aber trotzdem etwas tun, um uns zu helfen, nicht wahr?«, fragt Bischof Yoder.
Ich sehe von einem Mann zum anderen. »Ich kann lediglich versuchen, durch ein paar Anrufe herauszufinden, wie der Fall sich entwickelt.«
Wieder werfen sie sich Blicke zu, und diesmal schwingt Enttäuschung und ein unmissverständliches »Hab-ich-doch-gleich-gesagt« in ihrer Gestik mit.
Diakon Kempf erhebt sich. »Wir verbringen die Nacht im Motel hier in Painters Mill. Morgen fahren wir zurück in unser Tal.«
»Wir wären dankbar, wenn Sie unser Anliegen überschlafen, Kate Burkholder, bevor Sie eine Entscheidung treffen.« Der Bischof richtet sich langsam auf. »Es gibt sonst niemanden mehr, an den wir uns noch wenden können.«
Ich sehe den Männern beim Verlassen meines Büros hinterher, mir ist der Schweiß unter den Armen ausgebrochen, und ich spüre einen Knoten im Magen, der vorhin noch nicht da war.
3. Kapitel
Ich war Jonas Bowman zum ersten Mal an einem kalten, windigen Tag beim Schlittschuhlaufen begegnet, jedenfalls ist das meine früheste Erinnerung an ihn. Ich war elf Jahre alt und hatte mich aus dem Haus geschlichen, um mit meinem Bruder und ein paar anderen amischen Jungen auf dem zugefrorenen Teich der Farm meiner Eltern Eishockey zu spielen. Sie waren alle älter als ich, und als ich mit dem – von meinem Bruder Jacob geliehenen – Eishockeyschläger und meinen Schlittschuhen ankam, schlossen die anderen Jungen mich sofort vom Spiel aus.
Aber davon ließ ich mich nicht abschrecken. Während zwei der Jungen den Schnee vom Eis schaufelten, saß ich auf dem Baumstumpf neben der Feuerstelle und zog meine Schlittschuhe an; ich hoffte, sie würden ihre Meinung ändern, wenn sie sahen, wie gut ich war. Als dann eine große Eisfläche freigeräumt war, nahm ich den Eishockeyschläger und drehte ein paar Runden, um mich warmzulaufen. Ich flitzte über buckliges Eis, schlug einen imaginären Puck, konzentrierte mich auf die Technik und behielt die Jungs im Auge, um zu sehen, ob einer auf mich aufmerksam wurde. Vom anderen Ende des Teiches kam Marvin Beachy, mit dem ich zur Schule ging und der nur ein Jahr älter war als ich, auf mich zu. Er trieb seinen realen Puck mit kleinen Stößen vor sich her, und ich weiß nicht, was in mich gefahren war, aber ich klaute ihm den Puck quasi unterm Schläger weg und zischte damit übers Eis, bohrte die Schlittschuhe in die Oberfläche, dass die Eissplitter nur so sprühten. Gleichzeitig hielt ich Ausschau nach einem Verbündeten, dem ich den Puck zuspielen konnte. Ungefähr in der Mitte des Teiches hörte ich ein Pfeifen, dann Bravorufe, und mein Herz schlug höher. Hinter mir schrie Marvin etwas, aber ich war viel zu sehr auf seinen Puck konzentriert, um mich umzudrehen.
»Hey, seht mal, wie schnell sie ist!«
»Schneller als Marvin!«
Mit stolzgeschwellter Brust flitzte ich weiter übers Eis, hörte mich lachen – bis Eddie Weaver mir sieben Meter vom Ufer entfernt ein Bein stellte und mich zu Fall brachte. Ich hatte keine Chance, den Sturz abzufangen. Ich fiel der Länge nach in einen Haufen Schnee und Eisbrocken, ritzte mir trotz der Handschuhe die Handflächen auf und trotz zwei Paar Strumpfhosen die Knie.
»Das hast du davon, meinen Puck zu stehlen!«, schrie Marvin.
Ich rollte mich von dem Schneehaufen herunter und sah, wie Marvin seinen Puck an sich nahm. Neben ihm stand Eddie Weaver, stolz, den weiblichen Eindringling aufgehalten zu haben. »Mädchen spielen kein Eishockey«, sagte er grinsend.
»Ich schon!«, schoss ich zurück und stand auf.
Marvin zeigte auf mich. »Klar, guckt euch mal ihre dürren Beine an!«
Eddie lachte. »Ich wette, ihre Arme sind genauso dürr.«
»Und obenrum ist sie wahrscheinlich auch ganz platt«, murmelte ein anderer Junge, den ich nicht kannte.
Die Jungen krümmten sich vor Lachen, als hätten sie noch nie so etwas Lustiges gehört.
Die Knie taten mir fast so weh wie mein gekränkter Stolz, aber ich hätte nie geweint, selbst wenn mein Bein bloß noch an einem Hautfetzen gehangen hätte. Nicht in ihrer Gegenwart, niemals. Ich war starrsinnig genug, um damit bis zum Nachhauseweg zu warten.
Ich sah hinüber zu meinem Bruder, der, auf eine Schneeschaufel gestützt, am gegenüberliegenden Ufer stand und uns beobachtete. Er wusste, dass ich genauso gut spielen konnte wie die Jungen, jedenfalls die gleichaltrigen. Aber er blieb stumm.
Als ich so an dem zugefrorenen Ufer stand und zusah, wie die anderen sich aufwärmten, während meine Knie schmerzten und mein elfjähriges Herz vor Wut brannte, kam Jonas Bowman auf seinen Schlittschuhen angefahren, den Blick auf meine Knie geheftet. »Nicht schlecht für so ’ne halbe Portion«, sagte er.
Ich rollte mit den Augen. »Ich bin keine halbe Portion.«
Einen Moment lang sahen wir den Jungen beim Spielen zu, dann zeigte er auf meine Knie. »Du blutest.«
Ich hätte mir die Wunde gern angesehen, verkniff es mir aber. »Tut nicht weh.«
»Du bist ja echt tough.«
»Ich bin eine gute Hockeyspielerin, wirklich.«
Er griff in die Tasche und holte ein Taschentuch hervor. »Hier, bind das drum.«
»Brauch ich nicht.«
»Doch, das brauchst du.« Ein Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Er hob die Hand zum Mund, pfiff mit zwei Fingern und rief: »Diese halbe Portion hier will ich in meinem Team!«
Ab diesem Winter war ich ein Mädchen, das Eishockey spielen konnte. Und obwohl ich klein war und das falsche Geschlecht hatte, blieb ich bei der Teamaufstellung nie als Letzte übrig.
Jonas war an jenem Tag ungemein beeindruckt von meiner rebellischen Psyche. Das Kind in mir war davon überwältigt, dass ein älterer Junge sich für mich einsetzte, und dem Teenager, der ich bald sein würde, raubte es den Atem. Ich konnte nicht wissen, dass mein Herz im Sturm erobert worden war und die Atemlosigkeit, die meine Brust vor Stolz schwellen ließ, nur eine Probe dessen war, was noch auf mich zukommen würde.
Als ich in den Weg zur Farm einbiege, auf der Tomasetti und ich leben, bin ich in Gedanken noch immer bei jenem Tag auf dem zugefrorenen Teich. Auf dem Revier habe ich vorher noch das Sheriff’s Department von Mifflin County angerufen, die für Belleville, Pennsylvania, zuständige Strafverfolgungsbehörde. Der Deputy, mit dem ich sprach, wusste nicht viel über den Fall, bestätigte aber das meiste von dem, was die drei alten Männer mir erzählt hatten – dass Bischof Ananias Stoltzfus und Jonas Bowman vor achtzehn Jahren irgendeine Meinungsverschiedenheit hatten und Stoltzfus zwei Monate danach verschwunden war. Jonas wurde damals von der Polizei verhört, aber es gab nicht genügend Beweise, um ihn festzunehmen, und der Bezirksstaatsanwalt weigerte sich, einen Fall weiterzuverfolgen, der lediglich auf vagen Mutmaßungen beruhte.
Vor zwei Monaten wurden dann die Gebeine von Ananias Stoltzfus auf dem Feld einer Farm gefunden. Das Sheriffbüro hat die nahe Umgebung abgesucht und einen Vorderlader sowie eine Kugel Kaliber .50 gefunden. Weil das Gewehr sehr alt war, hatte es keine Seriennummer. Aber als sie es Jonas Bowman zeigten, gab er zu, dass es ihm gehöre, und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen.
Jonas wurde wegen Totschlags angeklagt und sitzt seither in Lewiston, der Justizvollzugsanstalt von Mifflin County. Die Kaution wurde auf fünfhunderttausend Dollar festgesetzt und bislang nicht hinterlegt, auch ein Gerichtstermin wurde noch nicht anberaumt. Eine rasche Internetsuche ergab, dass Totschlag im Staat Pennsylvania mit lebenslangem Gefängnis bestraft werden kann.
Bei einem Anruf in der Justizvollzugsanstalt erfuhr ich, dass Häftlinge nur von einem Anwalt oder von Amtspersonen, die mit dem Fall zu tun haben, angerufen werden können. Ich habe zwar Namen und Telefonnummer von Jonas’ Anwalt in Erfahrung gebracht, aber heute ist Samstag, und an Wochenenden ruft er anscheinend nicht zurück.
Ich parke hinter Tomasettis Tahoe, hole das Vogelhaus aus dem Kofferraum meines Wagens und bin auf halbem Weg zur Hintertür, als ich in der Scheune Musik höre. Eine der Schiebetüren steht offen, also klemme ich die Einkaufstüte unter den Arm und mache mich dorthin auf.
Die an den Hang gebaute Scheune im deutschen Stil ist rund hundert Jahre alt, und man sieht es ihr an. Über die Erdrampe erreiche ich die Tür und gehe hinein. Tomasetti steht neben einer schadhaften, längs an die Wand gelehnten Massivholztür. Daneben, an derselben Wand, hat er ein Holzregal in der Höhe einer Küchenablage sowie ein Regal, an dem eine Arbeitslampe klemmt, gebaut. Die Fortschritte, die er hier in der letzten Woche gemacht hat, kenne ich noch gar nicht, was mir bewusst macht, dass ich lange nicht in der Scheune war und zu viel arbeite.