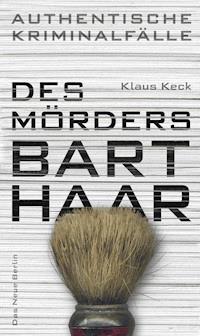Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Am 13. April 2007 findet man in Berlin-Friedrichshain an einem Baugerüst eine Leiche. Es sieht aus, als sei ein Arbeiter abgestürzt. Bald ermittelt die Kriminalpolizei, dass es sich um den 53-jährigen Ukrainer Alexej Loschkov handelt. Der Hinweis kommt aus Sachsen, wo die Polizei gerade eine Hanfplantage auf einem Bauernhof entdeckt und zwei Täter festgenommen hat. Doch wie hängen diese beiden Ereignisse zusammen? Der Autor Klaus Keck berichtet aus erster Hand von einem verwickelten Fall, der auch das Bundeskriminalamt beschäftigte und viel über die gegenwärtige Drogenszene in Sachsen erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
ISBN E-Book 978-3-360-50145-5
ISBN Print 978-3-360-01327-9
© 2017 Verlag Das Neue Berlin, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlinerscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel.com
Das Buch
Hanf sei harmlos, meint mancher, eine zu Unrecht geschmähte Kulturpflanze. »Gebt das Hanf frei«, fordern darum viele. Und haben dabei sogar Beistand aus der Politik. Der Autor schildert hier drei Fälle aus der Arbeit des Kriminalisten Hartmut Zerche, die diesen Umgang mit Cannabis zumindest ein wenig leichtfertig erscheinen lassen. Seine Darstellung ist ein Plädoyer gegen die Droge und für mehr Nachdenklichkeit. Zugleich gewährt er einen Einblick in die Polizeiarbeit beim Kampf gegen das Rauschgift.
Der Autor
Klaus Keck, Jahrgang 1960, stammt aus Sachsen. Nach dem Abitur und drei Jahren bei der NVA ging er zur Volkspolizei, absolvierte die Offiziersschule des MdI in Aschersleben und arbeitet seither als Kriminalist.
Der heutige Kriminalhauptkommissar leitete mehrere Dezernate und Sonderkommissionen.
Der Autor spendet den Erlös aus dem Verkauf dieses Buches an die Fachklinik für Drogenrehabilitation Wermsdorf.
Inhalt
Abwärts
Lustige Rosen
Dorf im Dunkeln
Abwärts
Kriminalkommissar Zerche spürte ein leichtes Vibrieren unter den Fußsohlen, das stetig an Stärke gewann. Der Impuls stieg die Unterschenkel empor, überwand die Knie. Wenig später erfasste er den ganzen Körper. Dann war der Lkw auch schon vorüber. Das Nachbeben wurde bereits von dem herankommenden nächsten Fahrzeug überlagert. Unablässig rollten die Autos. Der Grund, auf dem Zerche stand, wankte, war merklich instabil.
Er lehnte sich übers Brückengeländer. Auch das hatte den schwingenden Rhythmus übernommen wie das ganze Bauwerk, das noch 1945 zusammengeflickt worden war, nachdem die abrückende Wehrmacht es kurz zuvor in die Luft gejagt hatte. Seither war die Brücke wieder und wieder renoviert und der Plan eines Neubaus mehrmals verworfen worden, weil das Geld fehlte. Ende der achtziger Jahre sollte dann endlich gebaut werden. Zumindest war es verbindlich geplant …
Zerche warf die Kippe in die Elbe.
Die Stadt behalf sich schließlich damit, das Tempo zu drosseln. Inzwischen waren nur noch zehn Stundenkilometer erlaubt. Schritttempo auf der wichtigsten Ost-West-Verbindung über die Elbe zwischen Wittenberg und Riesa. Doch hinter Zerches Rücken entstand nun endlich die neue Spannbetonbrücke.
Das Wasser zu seinen Füßen strömte träge dahin. Es war nicht mehr so dunkel, nicht so schmutzig wie noch vor einigen Jahren. Viele Betriebe, deren Abwässer jahrzehntelang ungeklärt in die Elbe strömten, produzierten nicht mehr. Stillgelegt, dichtgemacht, abgewickelt. Und überdimensionierte Kläranlagen, die Investoren den Abwasserzweckverbänden aufgeschwatzt hatten, überzogen das Land. Nirgendwo mehr floss Ungeklärtes in die Elbe. Über die verbesserte Wasserqualität wurde inzwischen viel geschrieben, und noch mehr über die Lebensqualität entlang des Flusses geredet. Der politische Kalender zeigte das Jahr drei nach der Einheit. Den Hoffnungen der Wendezeit und euphorischen Prognosen der Politiker waren ernüchternde Tatsachen gefolgt, die blühenden Landschaften ließen auf sich warten.
Zerche spuckte in den Fluss. Die Elbe strömte stumm dahin, wie sie es seit Jahrtausenden tat. Das Flussbett war weit und nicht eingezwängt in eine ausgehobene Fahrrinne, einzig dazu bestimmt, viele Schiffe mit Tiefgang passieren zu lassen. Der Fluss war noch ein Strom mit Ufern, über die er treten konnte, ohne großen Schaden anzurichten. Dort unten, auf den Wiesen, hatten Russen und Amerikaner im April ’45 getanzt. Das Denkmal der Begegnung stand noch immer auf dem Vorsprung über der Elbe. Eine Zeit lang hatte man dann politisch Anstoß daran genommen, schließlich käme der Ruhm den sowjetischen Befreiern zu, und wollte es weghaben. Weil das nicht ging, errichteten die Stadtoberen ein weiteres Denkmal jenseits der Straße, das an die Befreiung Torgaus erinnern sollte. Das geschah im gleichen Jahr ’75, als erstmals irgendwo im Kosmos, aber genau über diesem Ort, eine sowjetische Sojus und eine amerikanische Apollo-Kapsel ankoppelten. Ein symbolisches, gleichwohl so temporäres wie folgenloses Ereignis insofern, als sich Ost und West unverändert spinnefeind blieben. Die beiden Denkmale aber standen noch. Obwohl viele sie schon wieder weghaben wollten, vor allem das eine, an dem nun jene Anstoß nahmen, die nicht mehr von Befreiern, sondern von Besatzern sprechen wollten.
Zerches Blick schweifte flussabwärts. Hinter der Eisenbahnbrücke reckten sich über einer modernen Industrieanlage zwei riesige Schlote. Das war mal das Flachglaskombinat, mit der in den achtziger Jahren gebauten Floatglasanlage Europas modernster Betrieb seiner Art. Und mit fast fünftausend Werktätigen der größte Arbeitgeber in der Region. Ein Zehntel davon war dort noch beschäftigt, ein halbes Tausend Arbeitsplätze. Der neue Eigentümer besaß Werke im Westen, Stammbetriebe geheißen, die aus Managerperspektive vorrangig ausgelastet werden mussten. Im Osten gab es überhaupt keine Stammbetriebe. Nur verlängerte Werkbänke. Für die die »Investoren aus dem Westen« Fördermittel von der Treuhand bezogen, mit denen sie nicht selten ihre Werke daheim sanierten. So viel verstand Zerche von kapitalistischer Ökonomie und organisierter Vereinigungskriminalität bereits. Er arbeitete schließlich bei der Kripo.
Hinter dem Glaswerk lag das Dorf, in dem Zerche auf einem Bauernhof lebte. Den hatte er vom Vater geerbt, und dieser wiederum von seinem Vater und so weiter. Nebst allen Äckern und Weiden. Zerche würde alles seinem Sohn vermachen, dem studierten Agraringenieur. Vor der Zeit, mit warmer Hand, wie die Alten sagten, würde er geben. Er war Kriminalist und kein Bauer, auch wenn er seine Herkunft vom Lande nicht verdrängte. Zerche war bodenständig und geerdet wie seine Vorfahren. Die Zeit seiner Ausbildung und Arbeit in der Hauptstadt, fern der heimatlichen Scholle, empfand er immer als eine Art Exil. Zerche kehrte zu seinen Wurzeln zurück, als die Mauer in Berlin fiel. Der verlorene Sohn fand freundliche Aufnahme in der Heimat, gute Polizisten waren überall gefragt. Wenngleich er mit einem Stern weniger auf den Schulterstücken in die neue Zeit startete. Aus dem Oberleutnant der K war ein Kriminalkommissar geworden.
Einige Möwen kreischten und jagten übers Wasser. Dieses permanente Schwingen und Vibrieren unter seinen Füßen nervte auf Dauer. Zerche löste sich vom Geländer und setzte sich in Bewegung, nachdem er einen flüchtigen Blick auf die Uhr geworfen hatte. Es ging bereits auf Mittag zu. Den Termin auf dem Brückenkopf hatte er persönlich und zu Fuß erledigt, er war lieber an der frischen Luft als im Büro. Und verband das Angenehme mit dem Unnützen: Was sollte er bei einem Karnickeldiebstahl auch ausrichten? Den Opa, der aufgeregt den Verlust eines Zuchttieres gemeldet hatte, konnte er allenfalls trösten. Einen Täter würden sie vermutlich nie finden, sollte ihnen Kollege Zufall nicht zu Hilfe kommen.
Wer mache so etwas, klagte der Rentner, wir hätten doch keine Nachkriegszeit, als die Leute klauten wie die Raben, um ihren Hunger zu stillen. Flüchtlinge aus dem Osten, Umsiedler geheißen, die Städter ohne Garten … »Ist es schon wieder so weit?«, hatte ihn der Bestohlene gefragt.
Die Feststellung war natürlich rhetorisch. Niemand hungerte, das Sozialnetz war ziemlich engmaschig, das der Westen übers Land geworfen und damit alle Bedürftigen aufgefangen hatte. Nur wer den Weg zum Amt und das Ausfüllen unzähliger Papiere scheute, musste zusehen, wo er blieb. Zerche kannte einige, die selbst dazu inzwischen zu faul waren. Vermutlich hatte sich einer von diesen Burschen seinen Braten in der Nacht auf dem Brückenkopf geholt. Aber lohnte die Mühe für einen Polizisten, sich auf die Suche nach ein paar Knochen zu begeben? Der Dieb hatte keinerlei Spuren hinterlassen, und wie sollte man beweisen, dass etwa die abgenagten Knochen in einer Mülltonne die des geklauten Karnickels waren? Immer vorausgesetzt, man würde sie überhaupt finden, bevor der Hund sie verbuddelt hatte. Diese Leute hatten immer einen Hund.
So ließ Zerche denn den Alten reichlich verärgert zurück. Der hatte ihn mit keineswegs freundlichen Worten zum Gartentor begleitet. Ha, von wegen: die Polizei – dein Freund und Helfer. Nie sei sie da, wenn man sie brauche!
Zerche hatte freundlich-jovial abgewiegelt, bis er sich gezwungen sah, den Redeschwall des Tatopfers zu beenden. Die Polizei könne nun mal nicht an jedem Kaninchenstall im Kreis Wache schieben, ließ er verlauten. Er hatte dabei das Tor aufgestoßen und den verärgerten alten Herrn von oben herab angelächelt. Er konnte gar nicht anders als von oben herabschauen, denn der Kaninchenhalter reichte ihm selbst mit seinem kecken Hütchen allenfalls bis zur Brust. Er musste bei dem Gedanken lachen, wie dieses Männlein das verschwundene Kaninchen von der Rasse Deutsche Riesen auf den Armen gehalten hatte, als es noch seines war. Ein Zwerg und ein Riese: was für eine ulkige Verbindung!
Einen schönen Tag noch, wünschte der Kriminalist beim Abgang, er werde Augen und Ohren offenhalten. Und seine Kollegen würden das natürlich auch. Sobald sie etwas in Erfahrung gebracht hätten, würde er sich wieder bei ihm melden, sagte Zerche und zog das Tor ins Schloss, dass es klackte.
Und wenn nicht?, rief Rumpelstilzchen hinterher.
Dann natürlich nicht, hatte Zerche geantwortet.
Zerche lief links am Schloss vorbei, durchs Fischerdörfchen, wie die Einheimischen dieses Areal am Elbufer nennen, weil dort vor langer Zeit einmal diese Zunft zu Hause war. Das war alles Historie. Langsam kehrten zwar die Fische wieder in die Elbe zurück, nicht aber die Fänger. Zerche konnte sich noch an jene Jahre erinnern, als er selber im Fluss angelte. Irgendwann verschmähten selbst die Katzen die Fische, weil sie entsetzlich nach Chemie rochen. Da stellte er das Stippen ein.
Der Kommissar wählte den kurzen Weg durch die Fischerstraße hinauf zum Markt. Hinterm Rathaus saß die Polizei, bis vor kurzem war es das Volkspolizeikreisamt, jetzt hieß die Einrichtung Direktion. Unterm Dach war die Kriminalpolizei untergebracht, dort hatte auch er sein Büro, das er sich mit Kollegen teilte.
Zur Linken stand die Mauer des einstigen Jugendwerkhofs. Er war der einzige im Land gewesen mit dem Attribut: geschlossen. Seit 1990 war der Geschlossene Jugendwerkhof offen und leer. Die Gebäude waren dem Verfall preisgegeben, niemand kümmerte sich darum. Zerche hatte gehört, dass ein Investor beabsichtige, daraus Eigentums- und Mietwohnungen zu machen. Wer würde freiwillig in ein solches Haus ziehen, hatte er sich gefragt. Aber wenn es als schick galt, in Hochbunkern und stillgelegten Bahnhöfen zu wohnen, wäre dies gewiss auch möglich. Wer dort einzog oder zuzog, musste außerdem nicht unbedingt wissen, welchem Zweck das Haus vormals diente. Die Erinnerung verschwand mit den Menschen, die einst hier lebten. So war der Lauf der Welt. Irgendwann würde niemand mehr in Deutschland existieren, der eine lebendige Erinnerung an die deutsche Zweistaatlichkeit haben würde. Das kollektive Gedächtnis reichte allenfalls achtzig Jahre zurück. Was davor lag, stand in den Geschichtsbüchern und interessierte nur noch die Historiker.
Zerche schaute in die Hafenstraße, die sich dem unwirtlichen Anwesen mit den hohen Mauern anschloss. Am Ende der Sackgasse erhob sich die ehemalige Töppchenbude. Jetzt stand überm Werktor der alte und neue Firmenname »Villeroy & Boch«, von 1948 bis 1990 war’s mal ein VEB.
Tempi passati, sagte sich Zerche auch beim Anblick der einstigen öffentlichen Badeanstalt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Badewannenlose Anwohner konnten dort bis vor kurzem für kleines Geld ein Vollbad nehmen. Die sogenannten Volksbrausebäder waren ausgangs des 19. Jahrhunderts in Mode gekommen, auch in Torgau richtete die Stadtverwaltung damals eins ein. Jetzt aber, wo fast in jeder Wohnung eine Dusche oder Wanne stand, hatte sich ihre Funktion erledigt. Und außerdem kostete so eine Einrichtung die Kommune Unterhalt. Irgendwo musste mit dem Sparen ja begonnen werden.
Zerche seufzte und schritt zügig weiter voran.
Zur Rechten tauchte das Internat der Penne auf, die er einst selbst besuchen wollte und nicht konnte. Konfirmation und Herkunft standen dem entgegen: Der Vater war Landwirt – zwar in der LPG, aber obendrein mit eigener Wirtschaft. Solche Bauernkinder mochte man nicht fördern. Damals hieß die Einrichtung Erweiterte Oberschule und trug den Namen »Ernst Schneller«, jetzt war sie Gymnasium und nach Johann Walter benannt, der weiland zu Luthers Tagen das erste evangelische Kirchengesangbuch zusammenstellte und in Torgau verstarb.
Der Weg stieg an, die Fischerstraße quälte sich zum Markt hinauf und auf ihr Zerche. Die Stadt war vor tausend Jahren auf einem Felsen gegründet worden, das später erbaute Schloss hieß darum »Hartenfels«. Häuser mit Sitznischenportalen aus Sandstein, an denen der Zahn der Zeit erkennbar nagte, säumten die steile Straße. Zerche kannte die Wohnungen dahinter, sie waren eng, dunkel, niedrig und muffig wie das Mittelalter. Wer dort lebte, tat dies vordringlich aus Not, nicht aus Liebe zur Renaissance. Wer konnte, bezog gern eine Neubauwohnung in Nordwest, dem Marzahn von Torgau. Zerche verfügte über genügend Fantasie, um sich vorzustellen, wie diese alten Häuser in begehrte Kleinodien verwandelt werden konnten, hätte man nur genug Geld. Doch wer würde sie dann bewohnen, will heißen: Wer konnte es sich dann noch leisten? Wer bliebe denn noch hier, wenn es kaum mehr Arbeit gab? Von der Geschichte allein konnte eine Stadt nicht leben, in einem Museum wurde allenfalls verwaltet und gestorben.
Sein Atem ging kurz, der Puls ein wenig schneller. Er müsse sich mehr bewegen, sagte er sich. Das sagte er sich stets, wenn er merkte, dass auch er so etwas wie einen Kreislauf besaß. Der Amtsarzt, der ihm gelegentlich die Hand auflegte und den Blutdruck maß, schüttelte stets besorgt sein Haupt. Jungejunge, pflegt er dann recht burschikos und wenig vornehm zu erklären, denn man kannte sich seit Jahren und hatte einst gemeinsam das Blauhemd getragen, beweg deinen Arsch! Der Appell trug manchmal Früchte. Heute zum Beispiel. Hielt aber selten vor.
Der Pförtner am Eingang der Polizeidirektion erwiderte Zerches Gruß und stippte sich an die rechte Schläfe. Gab’s was, fragte der Kriminalkommissar, um dass erwartete »Nö« zu vernehmen. Was sollte es hier im nördlichen Zipfel Sachsens schon geben? Wäre es anders, wenn sie der südliche Zipfel Brandenburgs wären? Vor drei Jahren hatte man das Volk im Kreis befragt, wohin es denn ziehen möchte. Die Mehrheit wollte sächsisch werden. Doch letztlich war es egal, welche Landesfahne überm Eingang der Wache hing. Ob grünweiß oder rotweiß: Provinz blieb Provinz. Zerche war es egal. Überall musste gearbeitet und gegen die Kriminalität angegangen werden.
Er erklomm schnaufend die Stiegen ins Büro. Kollege Karl, ein beleibter Gemütsmensch, im Berufe ergraut, wälzte irgendwelche Papiere, als Zerche durch die Tür trat.
»Na, erfolgreich gewesen bei der Ganovenjagd?«
»Und wie«, seufzte Zerche. »Karnickeldieb ist aber noch auf der Flucht.«
»Ich rate: mit’m Porsche!«
»Treffer. Darum schlage ich vor, dass du diesen Fall übernimmst. Du hast Kompetenz. Karnickelkompetenz sozusagen. Ich habe keine mehr, weil ich die Karnickel abgeschafft habe.«
Zerche traf ein Blick zwischen Zweifel und Vorwurf. »Warum das?«
»Ich kann kein Blut sehen. Wer sollte die Kaninchen schlachten?«
»Du kannst kein Blut sehen? Das ist mir aber neu. Und warum bist du dann bei der Kripo?«
»Wann fließt da schon mal Blut? Der Job ist doch so blutarm wie, wie …« Zerche rang nach einem überzeugenden Vergleich. »Wie eine Versicherungsvertretung.«
»Allianz oder HUK-Coburg?«
Beide brüllten los. Zerche entledigte sich seiner Jacke und hängte sie über die Lehne. Dann ließ er sich auf den Stuhl fallen. Er langte nach dem Berichtsbogen, suchte Durchschlagpapier und spannt alles in die Schreibmaschine. Ratschend verschwand das Papier hinter der Walze und tauchte vorn wieder auf. Danach spitzte Zerche die beiden Zeigefinger. »So, dann wollen wir mal.«
Wenn Zerche etwas an diesem Job hasste, so war es dieser Schreibkram. Er hatte nichts dagegen, dass jeder Anzeige – und sei diese noch so abseitig – nachgegangen wurde. Doch dass alles wie seit anno dunnemals schriftlich festgehalten, also dokumentiert werden sollte, nervte ihn. Es kostete Zeit und Energie. Die würde er viel lieber etwa in seine Weiterbildung stecken. In diesem Jahr hatte die sächsische Kriminalpolizei damit begonnen, Fachkommissariate für organisierte Kriminalität, kurz OK, und für Rauschgift, mithin zur Aufklärung und Bekämpfung von Drogenkriminalität aufzubauen. Auch in der Torgauer Kriminalpolizeiinspektion wurden drei Mann zu einem Rauschgiftkommissariat zusammengefasst.
Für die Kollegen, sofern sie aus dem alten Stamm kamen, war das alles Neuland. In der DDR kannte man das Problem nicht. Für die internationalen Drogendealer waren die Alu-Chips uninteressant und Territorien mit nicht konvertierbaren Währungen keine Märkte. Das änderte sich schlagartig mit der Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990. Die Währungsunion war zugleich eine Drogenunion. Vornehmlich aus den Niederlanden kamen zunächst Marihuana, bald Kokain und Heroin und zunehmend auch synthetische Drogen. In diesem Jahr, also 1993, hatten sie im Bereich der Kriminalpolizeiinspektion Torgau bereits 35 Fälle registriert. Drei Dutzend Mal waren Drogen konsumiert, gehandelt oder abgegeben worden. Zumindest hatte die Polizei von diesen 35 Vorfällen Kenntnis erhalten. Übers Jahr verteilt nicht eben viel, doch Zerche und seine Kollegen fürchteten, dass es nicht dabei bleiben würde. Vermutlich liefe jetzt hierzulande alles so ab, wie es ihre westdeutschen Kollegen seit den siebziger Jahren erleben mussten. Immer mehr vornehmlich jüngere Menschen in Ostdeutschland würden drogenabhängig werden, und im Gefolge nähme die Beschaffungskriminalität zu. Mit all ihren Auswüchsen einschließlich Prostitution. Nicht zu reden von den sozialen und medizinischen Folgen für die gesamte Gesellschaft.
Für Zerche stand außer Frage, dass das Rauschgiftproblem – beschönigend selbst in der Fachliteratur der Polizei als »Drogenmissbrauch« bezeichnet – ein gesellschaftliches Problem war. Wenn sich mit einer Ware Geld verdienen ließ, musste man mitunter ein Bedürfnis erst wecken, um es dann profitabel zu bedienen. Hatte man Hunger, musste man essen, das war ein natürliches Bedürfnis. Sich den Verstand wegzuballern war kein natürliches Bedürfnis. Der Begriff »Missbrauch« war darum für Zerche irreführend. Natürlich existierten Rauschmittel, seit man Trauben in Wein verwandelte und Bier braute. Noch bevor es Drogerien gab, in denen legal Heil- und Giftstoffe gehandelt wurden, wussten unsere Vorfahren um die halluzinogene Wirkung von Fliegenpilzen, Schlafmohn, Stechapfel und Hanf. Man inhalierte, trank, kaute oder rauchte nicht nur um des Rausches willen, sondern auch aus medizinischer Erwägung. Lange vor der Entstehung der Pharmaindustrie wussten sich Medizinmänner damit zu behelfen, was die Natur ihnen gab.
Aber dem gängigen Begriff »Missbrauch« haftete dennoch etwas Verklärendes an, wie Zerche befand, er verharmloste. Nicht jeder, der Bier trank, war oder wurde Alkoholiker. Nicht jeder, der einen Joint rauchte, wurde abhängig. Doch die Suchtgefahr war, insbesondere bei jungen Menschen, um vieles größer als etwa beim Alkohol. Es begann mit sogenannten weichen Drogen, dann wuchs das Bedürfnis nach härteren Drogen, um den Reiz, Kick genannt, zu steigern. Das war wie eine Spirale, die sich zu drehen begann und aus der man, je länger sie drehte, immer schwerer herauskam. Und neben den sogenannten Zumacher-Drogen, die auf dem Markt waren, kursierten inzwischen zunehmend auch die Fitmacher-Drogen.
All diese Entwicklungen und Konsequenzen interessierten den Kriminalisten Hartmut Zerche, der seit kurzem mit zwei Kollegen den Kampf gegen die Drogen in Torgau aufgenommen hatte. Er wollte lernen, sich mit Fachleuten austauschen, Erfahrungen sammeln – statt Protokolle über Karnickeldiebstähle mit mehreren Durchschlägen und mit Leidenschaft in die Schreibmaschine zu hämmern.
»Übrigens, die Ackermanns haben wieder angerufen.«
Karl riss Zerche aus seinem Gedankenflug. Der starrte noch immer auf das weiße Blatt vor sich in der Maschine.
»Wer?«
»Na, die Ackermanns aus Nordwest.«
Zerche begann seine Gedanken und Erinnerungen zu sortieren. Ach ja, richtig, er entsann sich der Anrufe eines aufgeregten Vaters, der seinen sechzehnjährigen Sohn nicht mehr im Griff hatte. Zerche hatte ihn jedes Mal zu beruhigen versucht. Für die Pubertät sei nicht die Polizei zuständig, setzte er dem Anrufer in beschwichtigendem Tone auseinander. Der Mann redete sich einmal derart in Rage, dass er schließlich meinte, wenn’s den Jugendwerkhof noch gäbe, wüsste er, wohin er seinen Jungen brächte. Weggesperrt und eine Weile aus dem Verkehr gezogen, damit er nicht mehr in den Kreisen verkehren könnte, die ihn verführten und auf die schiefe Bahn gebracht hätten. Nana, hatte Zerche entgegnet, in den Jugendwerkhof seien nur straffällig gewordene Heiminsassen gekommen, sein Sohn sei weder straffällig noch in einem Heim.
Und jetzt hatte sich Ackermann erneut gemeldet?
»Es werde immer schlimmer mit seinem Jungen, hat der Mann gesagt. Zerche muss helfen. Hier«, Karl reichte einen Zettel über den Schreibtisch, »ich habe mir seine Adresse geben lassen.«
Mit erkennbarer Lustlosigkeit griff Zerche nach dem Papier. Er wusste: Jetzt bekam er ein Problem gereicht.
»Konntest du ihn nicht abwimmeln?«
Karl hob schützend beide Hände. »Was hätte ich denn tun sollen?«
»Sagen, dass wir für Erziehungsprobleme nicht zuständig sind.«
»Vielleicht ist es ja kein Erziehungsproblem. Im Übrigen hat er dich verlangt.«
»Da hättest du sagen können, dass ich krank bin.«
»Ist ja eine tolle Ansage. Komm, hör auf …«
»Scheiße.« Zerche erhob sich wütend und streifte sich die Jacke über, der er sich vor Minuten erst entledigt hatte. Sein Ärger war ein wenig gespielt, was von seinem Kollegen leicht durchschaut wurde. Zerche nahm gern diese Aufforderung als Alibi an, dem Bericht zu entkommen, den zu schreiben er wenig Lust verspürte. Klar, aufgeschoben war nicht aufgehoben, er würde heute Abend wieder hier sitzen. Aber dankbar, wie ein Ertrinkender nach jedem vorbeitreibenden Strohhalm griff, so nützte er jede Gelegenheit, der Schreibmaschine den Rücken zu kehren. Oh, wie er die Bürokratie hasste.
»Schlüssel!« Zerche faltete das Blatt mit der Adresse und ließ es in der Brusttasche verschwinden. »Komm schon.«
Karl machte eine Kopfbewegung. »Hängt dort, wo er immer hängt. Papiere stecken im Handschuhfach.«
»Kannst schon in die Kantine gehen, ich esse, wenn ich zurück bin.«
»Warum plötzlich diese Eile?«
Die Frage hörte Zerche schon nicht mehr, er war bereits auf der Treppe. Dass er eilte, konnte man nicht gerade behaupten. Er lief gemessenen Schritts die Stufen hinab. Gebohnert müsste auch mal wieder werden, dachte er beim Blick aufs Linoleum zu seinen Füßen. Das lag nun auch schon seit Jahrzehnten dort. Die Bilder in den Büros und die Uniformen konnte man über Nacht wechseln. Bei den Dienstwagen dauerte es schon etwas länger. Und an das Mobiliar und die Ausstattung hatte man noch gar nicht gedacht. Das käme erst an die Reihe, wenn wir umziehen, hatte es geheißen. Ziehen wir denn um? Ja, wenn die Russenkasernen an der Dommitzscher Straße umgebaut sind. Ach so …
Ein Kollege kam ihm entgegen. Er hielt ihm ein Klemmbrett entgegen. »Hast du schon unterschrieben?«
»Was?«
»Den Protest gegen den Abriss der Elbbrücke.«
»Der ist doch schon längst beschlossene Sache. Im Übrigen: Polizei ist neutral, die muss sich bei solchen Entscheidungen raushalten.« Zerche griff nach der Liste.
»Ich bin Staatsbürger in Uniform und habe meine Meinung.«
»Das will ich doch hoffen. Aber du kannst hier nicht während des Dienstes an diesem Ort bei den Kollegen Unterschriften sammeln. Das geht dienstrechtlich nicht.« Schwungvoll schrieb Zerche seinen Namen in eine Spalte und setzte das Signum in die andere. »Und lass dich nicht vom Alten erwischen. Der ist nämlich der Meinung, dass das Ding wegmüsse.«
»Weiß ich. Der hat doch einen Knall wie alle, die meinen, man sollte auch im Wortsinne alle Brücken hinter sich abbrechen, um keine Zeit beim Zurückblicken zu verlieren. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.« Er lachte gequält.
Hm, grunste Zerche zustimmend und schritt weiter. Im Mai nächsten Jahres, so hatte die Verfügung aus dem Bundesverkehrsministerium geheißen, sollte die Flussüberquerung mit den genieteten Stahlbögen abgerissen werden. Es handele sich keineswegs um ein technisches Denkmal, das geschützt werden müsse, erklärten die Experten. Wenn schon kein technisches, dann aber mindestens ein historisches Denkmal mit großer Symbolkraft, hatten viele Torgau daraufhin lautstark geantwortet und eine Bürgerinitiative gegründet. Man konnte nicht alles der Verwaltung und »der Politik« überlassen. Wenn Leute aufmuckten gegen die Obrigkeit, war das ihr demokratisches Grundrecht, das bekanntlich in der DDR ziemlich eingeschränkt gewesen war. Und wohin das geführt hatte, konnte man 1989/90 tränenden oder lachenden Auges besichtigen.
Die Stadtverwaltung und die Landesregierung hatten der verständlichen Bürgerforderung die Kosten entgegengesetzt. Wir lebten jetzt im Kapitalismus, da müsste sich alles rechnen. Selbst der Idealismus. Neun Millionen würde die Sanierung der Brücke kosten, dazu in jedem weiteren Jahr 100000 DM für die Instandhaltung, zitierte die Obrigkeit aus irgendwelchen Gutachten. Und der gesunde Menschenverstand fragte: 100000 DM wofür? Für Blumenkübel auf dem Bürgersteig?
Die Stahlkonstruktion sei schrottreif, und außerdem: Wie würde sich das Monstrum aus dem 19. Jahrhundert neben der elegant geschwungenen, modernen Brücke aus dem 21. Jahrhundert ausnehmen? Bürger Zerche kannte die Argumente, er selbst hatte wiederholt an solchen Zusammenkünften teilgenommen. Die Front verlief zwischen konservativen »Erneuerern« und den vermeintlichen Betonköpfen, die an der Vergangenheit und an der Brücke hingen. Die Presse zitierte zwar auch den Sprecher des Fördervereins Europa-Begegnungen, der die Brücke als »Sinnbild der Völkerverständigung« bezeichnete, aber mehrheitlich hatte sich die Meinung durchgesetzt, bei mehr als 20 Prozent Arbeitslosigkeit in Torgau könne man sich diesen Luxus der Sanierung einfach nicht leisten.
Zerche sah die Sache politisch-historisch. Mit einigem Unmut las er Zitate in der Zeitung, die Zeitgenossen zugeschrieben wurden, die den 45er Handschlag von russischen und amerikanischen Soldaten keineswegs als Befreiung, sondern als Zusammenbruch der »deutschen Front«, als Niederlage, als Beginn der Besatzung bezeichneten. Sie verstehe gar nicht, zitierte eine Zeitung eine »ältere Frau« aus Torgau ohne Namen, was es da zu feiern gebe. »Die müssen doch verrückt sein.«
Er, der Kriminalist, gehörte zu den Verrückten. Auch er wollte, dass dieses ramponierte Symbol blieb, und hatte aus Prinzip etwas dagegen, wenn Geschichte vordergründig entsorgt und Vergangenheit verdrängt werden sollte. Aber als beamteter Staatsdiener hat er einen Dienstherrn. Diesem hatte er qua Eid zu gehorchen und das Staatsinteresse durchzusetzen. Und das hieß: Brückenabriss, und wenn es dagegen physischen Protest geben sollte, dann diesen zu brechen. Die Polizisten hätten also Menschen wegzutragen, obgleich sie vielleicht deren Überzeugung teilten und mit ihnen dort säßen, trügen sie nicht Uniform. Verrückte Welt …
Zerche brauchte keine zehn Minuten bis Torgau-Nordwest. Vor Jahren noch hätte es keine Probleme bereitet, im Neubaugebiet einen Parkplatz zu finden. Jetzt kostete es einige Mühe. Nahezu jeder hier hatte sich nach der Wende ein gebrauchtes Auto oder einen neuen Wagen vom Ersparten zugelegt.
Schließlich fand Zerche eine Lücke, in die er den grünweißen Opel quetschen konnte. Beim Aussteigen sah er die Fassade hinauf. Wie erwartet hingen nicht wenige Köpfe aus den Fenstern oder beugten sich über Balkonbrüstungen, dankbar für jede Abwechslung. Er ignorierte die neugierigen Blicke. Er wusste, dass nun jeder Schritt von Dutzenden Augenpaaren verfolgt wurde. Was macht der Bulle hier, zu wem geht er? Auch wenn Zerche keine Uniform trug, verriet ihn sein Dienstfahrzeug.