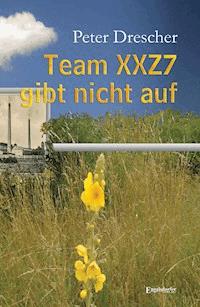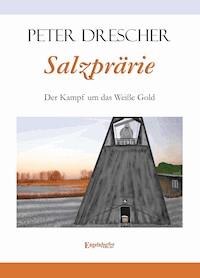
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Thüringer Vorderrhön, am Flüsschen Werra, herrschen noch um 1890 Rückständigkeit, Armut, nur wenige feste Straßen verbinden die abgeschiedenen Dörfer, in denen es keinen Strom, kein fließendes Wasser gibt. Nicht grundlos wird die Region als Armenhaus Deutschlands bezeichnet. Plötzlich tut sich etwas Geheimnisvolles. Fremde errichten riesige Bohrtürme. Sie suchen nach dem Weißen Gold, dem Kali-Salz. Von diesen Vorgängen weiß Sebastian Pflugbeil wenig. Er, der vierundzwanzigjährige Mitarbeiter einer kleinen Provinzzeitung, wohnt weiter entfernt, er fühlt sich unausgefüllt, träumt von aufregenden Reportagen für große Zeitungen, ja, er möchte abenteuerliche Bücher schreiben wie Karl May. Er bricht auf nach Leipzig. In der Messestadt empfängt ihn am Bahnhof der Vertreter einer Zeitung. Die Redaktion glaubt fälschlicherweise, dass er der Bote mit einem Geheimbericht vom entstehenden Thüringer Kalibergbau ist. Diese Sache, groß aufgemacht, würde die Auflage enorm erhöhen. Als der Irrtum erkannt wird, sucht Sebastian das Weite. Vom enthusiastischen Zeitungsmann regelrecht angesteckt, wird er selbst vom Salzfieber gepackt, fährt kurzentschlossen zu den Kalisuchern nach Thüringen. Der leitende Ingenieur gibt ihm im zweiten Anlauf Arbeit. Für ihn beginnt nahe beim Dorf Gilderoda im Kreise der raubeinigen Salzsucher ein ungewohntes Leben. Beim Tanz am Wochenende ernüchtert ihn die Ablehnung, die den Salzleuten von den Dorfburschen entgegen schlägt und die in eine wüste Schlägerei mündet. Andererseits bezaubert ihn bei der Geselligkeit Anna, eine einheimische Schöne. Die Gedanken an Anna lassen ihn fortan nicht los. Dann stößt der Trupp auf Salz. Um das Ereignis gebührend zu begehen, findet mit Dorfbewohnern, Arbeitern und Prominenz wie Landrat und Witwe des verstorbenen Kali-Hauptaktionärs eine Feier statt. Diese wird gestört, als Pfarrer Köttelbach, von der Polizei als »Unruhegeist« verschrien, die donnernde Frage stellt: »Ist es Recht, Bauern auf eigener Scholle in den Stand abhängiger Ausgebeuteter zu reißen?« Der entstandene Tumult wird erst durch den Auftritt des Kinderchores, der von Anna, der Lehrerin, betreut wird, abgebrochen. Unmittelbar nach dem letzten Lied stürzt ein junger Mann in den Saal, redet auf Anna ein. Sie verschwindet. Geht sie Sebastian aus dem Weg? Der ist verzweifelt, sucht bei einem Freund in der Stadt Rat. Doch er trifft ihn nicht an, erfährt von einem Nachbarn, dass der Freund, ein gescheiterter Bergmann, sich einen Traum erfüllt hat und zu den Petroleumfeldern nach Chile gezogen ist. Was nun? Erst einmal fährt er zu Mutters fünfzigsten Geburtstag. Nach diesem berührenden Zusammentreffen kommt er kaum zum Luftschöpfen, wird jäh hineingestoßen in eine Havarie am Bohrturm. Gefährlicher Wassereinbruch, Chaos, verbissene Rettungsaktion, der erste Tote ist zu beklagen. Das Leben geht weiter und frischer Wind fegt durchs Land.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER DRESCHER
Geb. 1946, aufgewachsen in Südbrandenburg, Berufsausbildung mit Abitur, schwere Erkrankung, längere Rehabilitationsphase, Buchhändlerausbildung, freier Autor, 18 Buchveröffentlichungen, Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller (VS) in ver.di, wohnhaft in Tiefenort (Thüringen).
Peter Drescher
SALZPRÄRIE
Der Kampf um das Weiße Gold
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2018
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild: Uwe Schreiber, Köthen
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Salzprärie – Der Kampf um das Weiße Gold
DER BISSIGE WIND PEITSCHT REGENTROPFEN GEGEN DAS VERWITTERTE GEMÄUER. Ich schlage den Jackenkragen hoch, drücke das schwere Friedhofstor auf, biege vom Hauptweg ab. An Vaters Grab lasse ich mich auf die an den Rändern bemooste feuchte, steinerne Bank nieder, beuge mich ein wenig nach vorn, presse die Hände auf die Oberschenkel.
Vater hatte sehr leiden müssen, sein Husten war immer schlimmer geworden, zuletzt wusste der alte Medizinalrat aus der Akazienstraße weder ein noch aus. Zurück gelehnt werde ich von grünen Ranken, die sich bis an die Bank winden, gestreift. Ich schließe die Augen, sehe Vater vor mir, den mittelgroßen, stets unauffällig, ja seriös gekleideten Mann mit dem gepflegten Schnauzbart. Sehe uns über die kleine Brücke gehen, vorbei an der Schmiede seines Bruders, meines Onkels Paul. Dessen Gartentore, prächtige Gitter und Geländer sind begehrt. Hin und wieder schaue ich in die Werkstatt, mich bezaubert das lodernde Schmiedefeuer, der wuchtige Amboss, das Schleifrad, das bei Benutzung von einem Kranz glitzernder Funken umgeben ist. Trotz aller Faszination bin ich aber schnell wieder bei ganz anderen Dingen, stelle mir vor, dass journalistische Beiträge von mir in großen deutschen Zeitungen erscheinen. Ja, ich träume sogar von selbst verfassten, erfolgreichen Büchern. Bücher wie die von Karl May, den ich verehre. Seine Romane stecken voller Spannung, und sein Leben, das nicht gerade glatte, ähnelt, bilde ich mir ein, meinem Dasein. Sein Brotberuf ist ihm keine Erfüllung, die heimatliche Enge quält ihn, in ihm wühlt der Drang nach Höherem.
Ich stoße mich von der Bank am Grab ab, nehme kaum den Regen wahr, trotte nach Hause. Als ich die Tür aufschließe, bin ich mir sicher, dass ich das so oft nicht mehr tun werde. Ja, warum soll ich die nicht mehr aufschließen? Eindeutig: Weil ich es hier nicht mehr aushalte. Meine Gedanken kreisen um die Ferne, wo es Neues, Schönes gibt. Aber ist es das Fernweh allein, die mich zu diesem Schritt treibt? Nein, Chefredakteur Heribert Maier ist es, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Er zitierte mich am Dienstag in sein Büro, thronte Macht und Selbstgefälligkeit ausstrahlend hinterm Schreibtisch, hauchte seinen Federhalter an und schoss plötzlich in die Höhe. Dann zerlegte er meine Zeitungsartikel, klaubte krümelkackerisch angebliche Mängel hervor. Er konnte sich das erlauben, schließlich war er der große Pressemann und ich nur kleiner Mitarbeiter. In seiner herablassenden Art bellte er: „Pflugbeil, unerhört! Sie sollen nicht albern poetisieren, lassen Sie diese unnützen Abschweifungen und musischen Ergüsse, Sie sind doch kein Dichter.“ H. der Große stützte sich auf den Schreibtisch. „Und noch etwas, Pflugbeil“, sein herrischer Blick machte mich klein, „wieso haben Sie in ihrem Artikel vom Schützenfest nicht die Teilnahme des Herrn Landrat gebührend hervorgehoben? Und warum missachten Sie wieder und wieder meine Anweisungen? Das sind schwere Entgleisungen!“
Maier war noch nicht fertig. Er griff nach einer Zeitung auf seinem Schreibtisch, wedelte mit ihr herum, es war, erkannte ich, nicht unsere Tagespostille, sondern „Der Rosenkavalier“, das Blatt für Gesellschaft und Unterhaltung. Ich war stolz, dort erstmalig einen Artikel untergebracht zu haben. Nun ja, nur vierunddreißig Zeilen, die mir aber, schätzte ich ein, trefflich gelungen waren. Eine Betrachtung über die bei uns kursierende Sage von den verschwundenen Zwergen. Warum, fragte ich in dem Beitrag, warum haben Menschen die im Groschenberg friedlich hausenden Zwerge vertrieben? Was haben sie ihnen getan? Als eine schreckliche Explosion den halben Berg zerstörte, glaubten der Überlieferung nach viele an ein Strafgericht.
Maier gefiel meine Interpretation des Sagenstoffes ganz und gar nicht. „Klimbim“, höhnte er. „Mutter Erde wehrt sich, schreiben Sie, so ein Blödsinn.“ Maier ließ den Federhalter fallen. „Pflugbeil, Sie sind ein Narr.“ Von lautem Schnauben untermalt, polterte er, den Arm Richtung Tür: „Raus!“ Ich habe beherrscht getan, mir meinen Hut übergestülpt und bemüht gemessen das Weite gesucht.
Das war vorgestern, und ich muss gestehen, dass mir seitdem das Atmen schwer fällt. Es ist so, als würde mein Brustkorb abgeschnürt. Soll ich weiterhin der kleine Mitarbeiter einer kleinen Zeitung sein? Verfasser von läppischen Beiträgen – Interview mit dem Löschführer der örtlichen Feuerwehr, Artikel über ein geselliges Männerchortreffen, Bericht vom Bau einer Öffentlichen Bedürfnisanstalt. Das kann es nicht sein!
Abends trinke ich ‒ noch immer missmutig ‒ im Ratskeller ein Bier, da plumpst ein Herr laut ächzend auf den Stuhl mir gegenüber. Er schaut mich aufdringlich an und beginnt ungefragt von Leipzig zu erzählen. Er ist Feuer und Flamme. „Die Messestadt wächst und wächst, ein reines Paradies.“
Das ist es, fährt es mir durch den Kopf. In der Großstadt Leipzig würden sich Träume realisieren lassen. Plötzlich sehe ich die Postkartenbilder vom belebten Augustplatz vor mir. Ich reibe mir die Augen, beachte nicht den Mann, der wechselt eingeschnappt den Tisch. Tage später quere ich entschlossen den Bahnhofsvorplatz, stehe dann vor dem Fahrkartenschalter, hole tief Luft, verlange III. Klasse nach Leipzig. Freundlich wird mir die Karte gegeben, ich stopfe das Wechselgeld in mein dick gewölbtes Portemonnaie, in dem ich meine Ersparnisse deponiert habe, 379 Reichsmark.
Auf dem Leipziger Hauptbahnhof erwartet mich eine wuselnde Menschenmenge. Etwas irritiert stehe ich da, gucke erstaunt, freudig und verlegen – alles vermischt sich. Ich mache ein paar langsame Schritte hin zur breiten Eingangstreppe, ein schmaler, ordentlich gekleideter Mensch mit rötlichem Überleger kommt auf mich zu, breitet theatralisch die Arme aus und begrüßt mich laut und herzlich.
Ist so ein Willkommensgruß in Leipzig üblich? Ich stelle meinen Koffer ab, ziere mich, der Rothaarige sagt: „Nun haben Sie sich nicht so. Die Droschke steht bereit, jetzt geht’s zur Redaktion.“
Was? Droschke, wohin bin ich geraten? Da der Name ‚Redaktion‘ gefallen ist, glimmt in meinen Augen ein Leuchten auf. Womöglich lacht mir das Glück, ich werde es riskieren. Der Herr führt mich auf den Bahnhofsvorplatz, dort übergebe ich dem Kutscher der bereit stehenden Pferdedroschke meinen Koffer, steige ein, mir gegenüber platziert sich aufatmend der Herr.
Marktbuden flirren vorbei, hohe Häuser, eine große Kirche. Das Häusermeer ist mir wie ein Symbol des Neuanfangs. In einer Nebenstraße hält die Droschke, wir steigen aus. Der Herr nickt dem Kutscher zu. „Abrechnung im Kontor.“
Unsicher folge ich ins Haus, betrete ein mit Schränken, Regalen, Karteikästen vollgestopften Raum. An einem klobigen Schreibtisch sitzt ein schnauzbärtiges dünnes Wesen mit Ärmelschonern. „Zum Gruße, mein Herr, zum Gruße.“ Es erhebt sich, schüttelt mir die Hand. „Nun, es läuft doch, wunderbar.“ Der dürre Mann stellt sich vor, sein Bart hüpft. „Mohbel, Chefredakteur.“ Er sinkt zurück in das Monstrum von Sessel. „Sie sind uns von Doktor Schücke angekündigt worden.“
„Wel,-wel,-welcher Doktor? Ich kenne keinen Schücke.“
Der Schnauzbart bietet mir einen Stuhl an, ich bleibe verunsichert stehen, und er mustert mich misstrauisch. „Sie sind doch der Informant aus Freiberg?“
Ich stütze mich an den Türrahmen. „Was wird hier gespielt, wer ist Schücke?“
„Na, hören Sie mal, das fragen ausgerechnet Sie.“ Mohbel stößt wie ein aufgeplusteter Ganter seinen Kopf nach vorn. „Professor Dr. Dr. Gottlieb Schücke, Inhaber des Lehrstuhles für Geologie und Chemie an der Bergakademie, eine hoch löbliche Persönlichkeit.“ Der Chefredakteur macht eine ausholende Geste. „Der Professor wandelt auf den Spuren von Justus Liebig.“ Er blinzelt mich vertraulich an. „Ist Ihnen ja bekannt.“
„Liebig, wer ist denn das nun wieder?“
„Tun Sie nicht so ahnungslos. Sie wissen doch bestens, wie bedeutend der Gießener Chemiker ist.“ Mohbel hebt triumphierend den Arm. „Ich sage Ihnen nichts Neues: der Professor hat bei seiner überragenden Forschertätigkeit ermittelt, dass Kalium notwendiger Nährstoff der Pflanzen ist. Bahnbrechend, bahnbrechend.“
„Und?“
„Na, hören Sie mal – durch Kaliumzufuhr wird Wachstum und Kraft erhöht, da lacht des Bauern Herz.“ Chefredakteur Mohbel stemmt sich vom Schreibtisch ab. „Sie stehen der Akademie nahe, sind gut informiert, wo ist also ihr Material? Sie wissen ja: Kali! Das Zeug ist wichtig.“ Mohbel kommt hinterm Schreibtisch hervor, hebt den Zeigefinger. „Natrium gleich Kali, das macht die Pflanzen munter, gut für den Stoffwechselprozess.“ Herr Mohbel bläst die Backen auf. „Ach, das brauche ich doch Ihnen nicht zu sagen. Wenn wir als Zeitung dranbleiben und mit Hintergrundstorys aufwarten, wird das wie eine Bombe einschlagen.“ Eine quiekende Lachsalve erschallt. „Wir ziehen das großartig auf, das wird ein, ja, ja, ein Hammer wird das.“ Er schmunzelt. „Gut für die Auflage. Die Honorarfrage klären wir, keine Bange.“
Ich wittere etwas ganz Neues, ein Kali-Abenteuer. Trotz der aufgeblitzten kribbeligen Neugierde bleibe ich aber ganz kühl. „Mein Herr“, ich lasse den Türrahmen los, „hier liegt ein Missverständnis vor.“
„Wieso Missverständnis?“ Der Chefredakteur fällt zurück in seinen Sessel.
Ich beiße mir auf die Lippen, ahne, einer Verwechslung zum Opfer gefallen zu sein. Wie komme ich da heraus? Krampfhaft bemühe ich mich um ein freundliches Gesicht. Der Chefredakteur schnaubt auf, schreit den Herren aus der Droschke, der sich klein macht und kein Wort hervorbringt, unbeherrscht an. Da klopft es! Die beiden Herren streichen sich flüchtig über ihr Haar, ein Bursche mit umgebundener Lederschürze tritt ein. „Die neue Ausgabe der Zeitung wird angeliefert.“ Die erhitzten Männer scheinen zur Besinnung zu kommen und verschwinden durch die Tür.
Meine flackernden Blicke überfliegen den Schreibtisch. Papier, Papier, rechts ein Briefumschlag, auf dem steht „An Herrn Professor Dr. Dr. Ludwig Schücke“. Als wäre ich von allen guten Geistern verlassen, greife ich mir hastig, ohne Überlegung den Brief, fahre zurück, als hätte ich heißes Eisen angefasst und lasse den Brief wieder auf den Schreibtisch fallen. Aus dem Nebenzimmer höre ich sich nähernde Schritte. Ich greife nach meinem Koffer und stiebe auf die Straße.
EIN FEUCHT-WARMER WIND SÄUSELT DURCH DIE STRASSE UND TREIBT UNRAT VOR SICH HER. Am Rande eines kümmerlichen, mit schmächtigem Gesträuch bestückten Parks lasse ich mich auf eine Bank nieder. Erstaunlicherweise ist mein Beinahe-Diebstahl am Verblassen, stattdessen sehe ich den erhobenen Zeigefinger des Chefredakteurs, höre ihn ausrufen: „Das Zeug ist wichtig.“ Das hat nicht nur geheimnisumwittert geklungen, sondern legt mir nahe, dieses „wichtige Zeug“ unbedingt stark zu beachten.
Ich scharre mit den Füßen, vernehme das Pfeifen einer Lokomotive und weiß, dass ich gar nicht so weit vom Bahnhof entfernt bin. Soll ich in den nächsten Zug nach Hause steigen? Ach, nicht das, das wäre ja ein Eingeständnis meines Misserfolges. Ich will nicht gescheitert sein! Ratlos gehe ich weiter, komme auf eine löchrige Straße, die wie der Park so gar nicht nach Messemetropole aussieht. Der kleine Laden, an dem ich vorbeikomme, könnte auch bei uns stehen, schaut aus wie der von Grönerts in der Kreuzstraße. Wenn ich mit Mutter einkaufen war, hat mir Frau Grönert mit einer silbernen Zange aus einem Glas neben der Kasse ein grasgrünes oder knallrotes Bonbon gefischt.
Das Schaufenster des kleinen Leipziger Ladens ist liebevoll dekoriert. Mein Blick bleibt an einer Galerie von Blechbüchsen hängen. Schnörklige Buchstaben teilen mit: Stollwerkkakao unter Verwendung von Bohnen aus deutschen Kolonien. Bei mir regt sich Kohldampf, ich betrete den Laden. Die Verkäuferin mit Häubchen und Schürze muss einen hungrigen Blick erkannt haben, weist fast neckisch auf die Platte mit Grützwürsten und fragt nach meinem Begehr. Ich lüfte meinen Hut. „Eine Semmel, zwei dieser herrlichen Würste.“ Beim Bezahlen frage ich wie nebenher nach einer billigen Unterkunft. Ich werde in den nächsten Tagen in Leipzig nach angemessener Arbeit suchen.
Die Krämersfrau kichert und macht sich am Sauerkrautfass zu schaffen. „Schräg gegenüber“, sagt sie, „Nummer vierzehn.“
Auf einem schmalen Schild am Haus Nr. 14 steht „Pension Himmelbett“, ein Pfeil weist in eine putzabgebröckelte schummrige Toreinfahrt. Ich tapse durch den Gang, klopfe an eine nur angelehnte Tür, stolpere etwas ungeschickt in den Raum. „Hoppla“, höre ich es. Helles Lachen. Hinter einem Pult sitzt eine kräftig geschminkte, starkbusige Frau. „Na, mein Herr, ein Himmelbett gefällig?“ Sie fixiert mich von oben bis unten und von unten bis oben. „Zimmer fünf.“ Ohne viel Federlesens händigt sie mir einen großen Schlüssel aus, an dem ein mit einer roten Fünf bemaltes Brettchen hängt.
Das enge Zimmer ist von äußerster Schlichtheit. Bett, Spind, eisernes Gestell mit Waschschüssel, am Fußende des hohen Bettes ein Stuhl und ein mit Wachstuch bezogenes Tischchen.
Vorübergehend wird es sich wohl hier aushalten lassen. Ich hänge meine Anzugsjacke über die Stuhllehne, die Wirtin bringt mir mit galanter Höflichkeit eine Flasche Bier. „Wenn Sie einen Wunsch haben, bitte rufen.“
Ich kaue durchaus mit Appetit an der Grützwurst, nage an der Semmel. Habe heute früh nicht an Reiseproviant gedacht, für so etwas ist, sollte ich ihn mal benötigen, Mutter verantwortlich. Mutter! Ich glaube ja nicht, dass sie über meinen Leipzig-Plan so richtig froh war. Aber ich bin ja nicht aus der Welt, und bei meiner Schwester, die oben im Haus zwei Zimmer bewohnt, ist sie in guten Händen.
Ich leere in großen Zügen die Flasche Bier. Und wieder sind meine Gedanken bei diesem Kali-Salz. In der Zeitungsredaktion ist eine verworrene Sache abgelaufen. Bin ich etwa Ärger entgangen?
Auf der rechten Tischecke stapeln sich zerfledderte Heftchen. Ich schaue näher hin – auf dem obersten Titelblatt das Bild einer kaum bekleideten Frau. Oho! So etwas gibt es eben nur in der Großstadt. Ich wische mir meine fettigen Hände am Taschentuch ab, blättere, lese, gucke mir die Bilder an, Bleibe mit den Augen an der prallen Brust einer reizenden Dame hängen. Für Sekunden rauscht das Bild von Eleonore vorbei, der schüchtern, mich lieb anlächelnden blonden Friseuse, die es mir leider nie ermöglicht hat, mehr als ihre beim Haareschneiden geschickt sich regenden Hände und, wenn sie sich bückte, die festen Waden zu bewundern. Ich schlage Seiten vor und zurück. So viele schöne Frauen! Als mein Rücken spannt – das Stechen zieht bis in den Hals –, klappe ich das Heft zu.
Es muss tiefste Nacht sein, als mich eigenartige Geräusche wecken. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, meine goldene Taschenuhr – Vater hat mir das Erbstück zur Konfirmation mit großer Geste überreicht – hängt an dem eisernen Waschgestell. Ich reiße die Augen auf, der schemenhafte Umriss einer Gestalt wird sichtbar. Ist’s die Wirtin? Nein, die ist zwar recht gut gepolstert, aber nicht so riesig wie diese Figur. Ich bekomme keinen Ton heraus, Angst bemächtigt sich meiner, werde ich wegen meines Briefdiebstahls gesucht? Ich rühre mich nicht, auch dann nicht, als die riesige Erscheinung in mein Bett kippt. Erst nach Sekunden bin ich in der Lage, mich frei zu strampeln und das Licht anzuschalten. Himmel, neben mir ein bärtiger Mann! Er dreht sich augenzwinkernd um und brabbelt: „Lenchen, mein Morgenstern.“ Dann schnellt er empor. „Wer bist denn du?“
„Und Sie, wer sind Sie? Ich bin im Zimmer fünf ordentlich einquartiert worden.“
„Ach, halt die Gusche.“ Er wälzt sich zur Seite und brummt ins Kopfkissen hinein: „Du hast doch nichts dagegen, dass ich die Hälfte deines Bettes benutze?“
Jetzt bin ich hellwach, sicher hat es keinen Zweck, zu Nacht schlafender Zeit auf ein anderes Zimmer zu dringen. Gleich früh haue ich ab. Werde mich jetzt natürlich nicht neben diese scheußliche Person legen. Auf dem Stuhl in der Ecke wickle ich mich in die Zudecke – mein „Gast“ hat nicht mitbekommen, dass ich sie weggezogen habe – und nicke nach einer Weile tatsächlich ein.
Helle Kringel auf meinem Gesicht. Die Morgensonne! Der Mann schnarcht, hastig kleide ich mich an, zerre am Schlipsknoten, glätte meine Haare, schnappe meinen Koffer und bezahle bei der arglos lächelnden Vermieterin.
An einem Stand vor dem Bahnhof schlürfe ich einen Pott Kaffee, kaufe mir zwei Stücke Obstkuchen und eines mit Zuckerguss. Im Wartesaal fasse ich einen Entschluss.
DER DAHIN SCHNAUFENDE ZUG GIBT MIR ZEIT, MEINE GEDANKEN ZU SORTIEREN. Was auf mich zukommen wird, weiß ich nicht. Sollen mich deshalb Ängste quälen? Quatsch, im Gegenteil, ich fühle Aufbruchsstimmung, als würde ich in Karls Mays Prärie mit den wilden Büffelherden und federgeschmückten Rothäuten reisen. Am Zugfenster huschen endlose Felder vorbei, weit hinten blinken ein paar Dächer, ein schiefergedecktes Kirchlein hebt sich heraus. Die komische Nacht steckt mir in den Gliedern, es fällt mir schwer, die Augen offen zu halten. Alles verschwimmt, ich döse, träume. Von unserem Marktplatz mit der Postmeilensäule, dem Hutgeschäft, dem Bücherladen, an dessen Schaufenster ich mir als Kind oft die Nase platt drückte. Und Vater taucht auf, der mir nach dem Schulabschluss eine Stelle in einem Büro besorgte. Begeistert war ich nicht gerade, und nach der Lehre bemühte ich mich um eine Stellung im Handelskontor „Schulz & Schulze“ in der Nachbarstadt. Ich wurde angenommen, schloss dort mit Erhard, dem Botenjungen, Freundschaft. Hatte dem Erhard eine von mir selbstgedichtete Geschichte zu lesen gegeben, in der es um einen Wasserungeheuer im chinesischen Meer ging. Sie gefiel ihm und er schlug mir vor, Artikel für den Heimatanzeiger zu schreiben. „Mensch, Basti, du hast das drauf“, lobte der Freund. Er brüstete sich: „Kenne den Redakteur, erledige Botendienste für ihn, dem überreiche ich persönlich deine Geschichten.“ Als dann einige kleine Sachen von mir – ich nannte sie Reportagen – tatsächlich erschienen, fühlte ich mich wie Karl May. Einmal steckte ich Erhard ein Liebesgedicht von mir zu, er schenkte es seiner Freundin Lotte, die war entzückt.
Ich reiße die Augen auf, der Zug nähert sich Eisenach. War dort noch nie, habe nur gehört, dass die Stadt mit Sebastian Bach und Martin Luther zu tun hat. Große Persönlichkeiten. Vielleicht kann ich an die heranreichen, wenn ich wichtige, bedeutende Zeitungen, Berliner Anzeiger zum Beispiel, Münchner Neue Nachrichten, die Vossische, mit spannenden Reportagen versorgt habe, richtige Reportagen – nicht aus der Prärie, nein, aus dem entstehenden Thüringer Kalirevier.
In Eisenach lehne ich minutenlang an der gekachelten Wand der erstaunlich pompösen Bahnhofshalle, atme durch, begebe mich nach draußen. Dem Ausgang gegenüber erstreckt sich eine strauchige, leicht bergan führende Fläche, rechts ducken sich kleine Häuschen. Ich erkundige mich bei Passanten höflich nach dem Bergamt. Keiner kann mir etwas sagen, es ist so, als existiere so ein Amt überhaupt nicht. Bin ich einer Illusion aufgesessen?