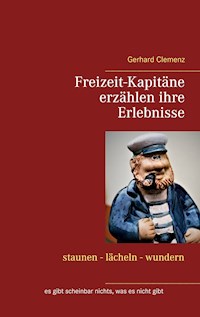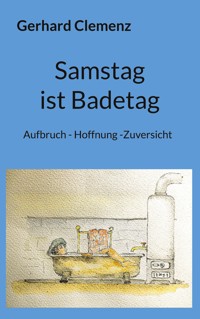
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine typische Kleinfamilie erzählt ihr Leben in den Jahren 1945 bis zum Ende der sechziger Jahre. Wie hat man diese Zeit gemeistert, wie hat man gewohnt, gearbeitet, gegessen, was konnte man sich leisten, was gab es zu kaufen, wieviel hat man verdient, konnte man sich einen Urlaub leisten, welche Kleidung trug man, gab es Kindergeld, konnte man sich ein Auto leisten, hatten Frauen einen Führerschein, wie sah Schule aus, ging man ins Kino, hatte man einen Fernseher, wann wurde man volljährig, welche Musik hörte man, wie hoch war das Taschengeld und, und, und? Eine Fülle von Fragen. Die Geschichte führt uns durch einen Teil des Lebens dieser Kleinfamilie in einer damaligen Kleinstadt. Zentrale Figur ist eine Frau, die aus einer Großstadt auf das Land wechselte wegen der Liebe. Von Wien auf einen deutschen Bauernhof. Ohne zu zögern. Aufbruch, Aufbau, Hoffnung und Zuversicht und alles mit einem kräftigen Schuss Mut. Sehr viel Mut. Erzählungen werden durch statistische, technische und wirtschaftliche Angaben ergänzt. Ein Buch mit Geschichte, Information, einen kräftigen Schuss Humor und der indirekten Frage: "War früher alles besser, oder doch nicht so recht?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Durch Zufall zur Idee
Auf dem Tischchen vor einem Stadtcafé steht mein frisch gebrühter Cappuccino, daneben die Tageszeitung. Morgendliche Entspannung. Genauso entspannt wie Er. Er, dort auf dem Sockel aus Stein. Er lebt schon lange nicht mehr. Steinalt ist er. Er hat viel erlebt, viel gesehen. Viel Gutes und weniges Gutes, Fröhliches und Abscheuliches. Aber, da ist noch jemand. Er steht auf einem Brunnen im Garten. Sein Gesicht drückt irgendwie Hoffnung und Zuversicht aus. Hoffnung und Zuversicht, dass das Gute und das Fröhliche das weniger Gute und das Abscheuliche besiegen kann.
Hier trifft man sich. Jung und Alt, Arbeitende aus der Nachtschicht, Rentner, Studierende oder einfach Leute, die hier am Morgen ein Frühstück bestellen. Tagespresse gratis.
„Kennen wir uns nicht?“, die fast überfallartige Frage einer männlichen Person. Erkannt. Jugendbekanntschaft, also aktuell zwischen fünfzig und hundert. Lange nicht mehr getroffen.
Nach rund einer halben Stunde Austauschaktion unserer Aktivitäten und Lebensumstände der letzten rund zwanzig Jahre, Meinungen zum aktuellen Weltgeschehen, Politik, Arbeitswelt, Sozialstruktur und Kultur sind wir beim Thema.
Wie war das früher, was haben Menschen zu erzählen, die aus heutiger Sicht vor rund hundert Jahren oder sogar etwas früher geboren wurden, was haben sie alles erlebt? War damals alles besser, einfacher, unbeschwerter oder vielleicht doch nicht? Oder war es einfach anders? Wie und mit was haben sie gelebt, wie war ihr Tagesablauf, ihre Arbeit, ihr Einkommen, was konnten sie sich leisten, wie haben sie gewohnt, kannten sie das Wort Urlaub, hatten sie einen Fernseher, ein Motorrad, ein Auto, eine Waschmaschine, gingen sie ins Kino oder in Konzerte, waren sie in den Bergen oder am Meer unterwegs?
Hatten sie den Mut etwas Neues zu wagen, hatten sie Hoffnung auf Besserung, wenn es nicht so gut ging? Hoffnung und Mut zum Aufbruch.
Zwei Menschen erzählen uns ihre Geschichte. Zwei Menschen, die aus heutiger Sicht vor etwas mehr als einhundert Jahren das Licht der Welt erblickten. Eigentlich sind es drei. Sie könnten uns viel erzählen, wenn wir sie fragen könnten. Die Kommunikation mit ihnen ist aber, realistisch betrachtet, unmöglich. Sie halten sich längst ganz wo anders auf. Bis auf einen. Hauptdarsteller sind Zwei, deren Lebensgeschichte stellvertretend für die vieler anderer steht. Ich nenne sie einfach Mimi und Fritz. Aber da ist noch einer dabei. Ein Kleiner, zumindest am Anfang. Ich nenne ich ihn einfach Fritzchen.
Irgendwie sind aber auch wir Teil dieser Geschichte und ich hoffe, dass es uns die Augen für eine Sichtweise öffnet, Krisen nicht so zu empfinden, als ob es sie noch nie vorher gegeben hätte. Es gab in der Vergangenheit genug schlimme Zeiten und es wird immer wieder Zeiten geben, die uns oder unseren Nachkommen große Probleme und Kopfzerbrechen bereiten werden, Ängste und Unsicherheit auslösen. Jede Generation wird sich fragen, war es gestern besser oder schlechter? Möchte ich im <Gestern> leben oder doch besser im <Heute>? Oder vielleicht ein Stück vom <Gestern> und ein Stück vom <Heute>?
Nur eine einzige Meinung gibt es dazu nicht. Wichtig ist aber, dass wir das <Gestern> nicht vergessen, es realistisch einordnen und uns damit etwas auskennen.
Geschichte ist nicht tot, sie lebt. Und, <aus der Geschichte lernen> ist nicht unbedingt die schlechteste Empfehlung und nicht die schlechteste Strategie.
Tauchen wir mit ein in ihre Zeit und bummeln durch diesen Cocktail aus wahrer Geschichte mit Hoffnung, Zuversicht und Mut.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Der Markgraf auf seinem Sockel in der Mitte des Schlossplatzes
Kapitel 2: Der steinerne Markgraf auf seinem Brunnen
Kapitel 3: Diese Stadt ist bunt und die Menschen hier sind bunt
Kapitel 4: Hier lebten die Beiden, die uns ihre Geschichte erzählen Eine Geschichte von Aufbruch, Hoffnung und Mut
Kapitel 5: Das Fritzchen erblickt problemlos und natürlich das Licht dieser Welt
Kapitel 6: Fritz, also der alte, kommt kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges auf diese Welt
Kapitel 7: Die Beiden verbringen eine sehr glückliche Zeit in dieser absolut nicht schönen Zeit
Kapitel 8: Wien, die Stadt und mit ihr die Wiener und die Wienerinnen haben nichts zu Lachen
Kapitel 9: Tausche Großstadt gegen Dorf, Gemeindebau gegen Bauernhof
Kapitel 10: Gegenüber dem Bauernhof befindet sich ein Bader
Kapitel 11: Mimi ist angekommen, angekommen in einem Dorf mit dem gruseligen Beinamen Gaßhenker
Kapitel 12: Die Beiden wohnen zusammen unter einem Dach, in einer gemeinsamen Wohnung und schlafen im gemeinsamen Bett
Kapitel 13: Fritzchen kommt am Bauernhof auf die Welt, auf einem Sofa
Kapitel 14: Das Pflänzchen Wirtschaftswunder beginnt langsam Blüten anzusetzen
Kapitel 15: Ihre Wohnungssituation ist sehr bescheiden, aber gut
Kapitel 16: Heute ist Waschtag
Kapitel 17: Sonntag ist Bratentag und nicht für jede Gans ist dieser Tag ein Glückstag
Kapitel 18: Oberstes Gesetz der Küche ist, es wird nichts weggeworfen
Kapitel 19: Das Angebot an Wohnraum ist immer noch gering, vor allem aber an Wohnungen in ausreichender Größe
Kapitel 20: Samstag ist Badetag
Kapitel 21: Hinter dem Ofen gluckst es und Einwecktöpfe dampfen
Kapitel 22: Die Auswahl an Medien ist nicht gerade üppig
Kapitel 23: Der Sonntag ist heilig
Kapitel 24: Arbeit ist Mangelware und Kindergeld ein Fremdwort
Kapitel 25: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit
Kapitel 26: Feste soll man feiern, wie sie fallen
Kapitel 27: Ein Zug dampft durch die Stadt
Kapitel 28: Bohnenkaffee, Symbol für Wiederaufbau und Wirtschaftswunder
Kapitel 29: Nähen, Stricken, Häkeln – nicht jedes Kleidungsstück kommt <von der Stange>
Kapitel 30: Die Schule steht vor der Tür
Kapitel 31: Ohne Geld in der Tasche ist das Leben nur halb so schön
Kapitel 32: Weihnachten naht
Kapitel 33: Das Städtchen, in dem die kleine Familie wohnt, befindet sich in der amerikanischen Besatzungszone und ist Standort von US-Kasernen
Kapitel 34: Reisen in unbekannte Länder, viele Dias und Diavorträge
Kapitel 35: Fahrradfahren ist mit Risiken verbunden und eine Zahnarztpraxis ist keine Kuschelecke
Kapitel 36: Musik im Blut
Kapitel 37: Das Tanzbein musss geschwungen werden
Kapitel 38: Marktwirtschaft und Wirtschaftswunder
Kapitel 39: Das Reisefieber bricht unaufhaltsam aus
Kapitel 40: Es ist Frühjahr, die Bäume schlagen wieder einmal aus und ein Käfer kommt geflogen
Kapitel 41: Vier Räder und neue Ziele mit Überraschungen
Kapitel 42: Es schneit - es schneit sehr viel - manchmal auch weniger oder überhaupt nicht
Kapitel 43: Zu viel Süßes macht dick, aber zu mager ist auch nichts - Schreckgespenst Erholungsheim
Kapitel 44: Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Kapitel 45: Die Gesellschaft wandelt sich
Kapitel 46: Das Leben verändert sich radikal
Kapitel 47: „Lassen wir es gut sein damit“, meinen die Beiden
1
Der Markgraf auf seinem Sockel in der Mitte des Schlossplatzes
Vor seinem Schloss. Vor seiner Universität, die er gründete. Stattlich sieht er aus. Er, Markgraf Friedrich III von Brandenburg-Bayreuth. Erklärter Gegner kriegerischer Auseinandersetzungen, hoch gebildet und ein Mäzen und Förderer der Kunst und Wissenschaft.
Gleich dahinter der Schlossgarten mit viel Grün und hohen Schatten spendenden Bäumen. Wege sind exakt gezirkelt. Gerade. Eingebettet lauschige Ecken mit Bänken aus Stein und Holz. Zum Entspannen und Ausruhen. Auf den Grünflächen sitzen Studierende und schmökern in ihren Büchern oder kommunizieren mit ihren vielen digitalen und lebenden Freunden. Man verspürt einen Hauch französischer Lebensart.
Und, hier steht noch ein Markgraf, ein anderer. Er steht nicht auf einem Sockel, er steht auf einem Brunnen.
Vor dem Schloss bieten Bauern aus dem Umland ihr Gemüse, Obst, Blumen, Eier, Käse und geräucherte Fische der Stadtbevölkerung zum Kauf an.
Gemüse der Bauern, vorrangig aus eigenem Anbau, Eier von freilaufenden glücklichen Hühnern oder Forellen aus eigenen Teichen, Käse in allen Variationen, auch von Ziege und Schaf, Oliven aus südlichen Ländern.
Eine Farbenpracht sind die Blumen als Sträuße oder zum Einpflanzen auf dem Balkon oder im Garten. An einem Stand am Eck gibt es frische Crépes und im Winter gebratene Maronen. Eigentlich heißen sie ja Maroni. Es duftet verlockend.
Man unterhält sich beim Kauf und nimmt diese Dinge nicht aus einem stummen, leblosen Regal im Supermarkt oder beim Discounter. Ein Markt lebt. Dieser Markt lebt. Und das ist gut so. Ein Treffpunkt. Einheimische, Zugereiste, Sprachen vieler Länder, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und Kleidung. Ein Kulturmix der Händler und Kunden.
Voll Zuversicht steht er vor seinem Schloss – der Markgraf
2
Der steinerne Markgraf auf seinem Brunnen
Da steht er, schon wieder ein Markgraf, ganz oben auf der dreistufigen Felsenpyramide aus Sandstein. Aber, was will er dort oben? Eigentlich nichts, er hat sich auch nicht selbst dort oben platziert. Es waren verschiedene Hugenottenfamilien, die ihm als Dankeschön diesen Brunnen stifteten und sich auch selbst dort verewigten.
Man hat das Gefühl, als wolle er sagen, auch ich habe hier damals Menschen aus anderen Ländern gesehen, ihnen eine neue Heimat gegeben. Menschen mit anderer Sprache. Eine Sprache, die man hier nicht kannte, nicht verstand.
Markgraf Christian Ernst aus dem Geschlecht der Hohenzollern.
Eine Art Déjá vue? Irgendwie schon, denn wir spazieren durch eine Stadt, die ihre erste Blüte französischen Emigranten, den Hugenotten, zu verdanken hat.
Um das Jahr 1680 flohen sie aus Frankreich, nachdem sie aufgrund ihres protestantischen Glaubens durch das Edikt von Fontainebleau durch Ludwig XIV, den allseits bekannten Sonnenkönig, als Feinde des katholischen Glaubens brutal verfolgt wurden. Ziele waren vor allem protestantische Gegenden des heutigen Deutschlands.
Hier wurden sie von den Landesfürsten dieser Glaubensrichtung wohlwollend aufgenommen. Humanitär, aber auch nicht ohne wirtschaftlichen Grund. Ihre besonderen handwerklichen Fähigkeiten schätzte man. Handwerk, das man in dieser Form hier nicht kannte.
Hutmacher, Handschuhmacher und Strumpfwirker. Gewerbe, in denen sie hohe Kompetenz hatten. Rund eintausend waren es, die hier ankamen. Hier, in dieser Stadt.
Die verarmte und notleidende heimische Bevölkerung war nicht unbedingt hoch erfreut über deren Zuzug. Unbekannte Menschen aus einem für sie völlig unbekanntem Land. Unbekannte Sprache, unbekannte Umgangsformen und die Teilung des ohnehin knappen Wohnraums, waren nicht gerade ein vierblättriges Kleeblatt oder ein heutiger Sechser im Lotto.
Deja vue. All das war schon einmal da und wird sich immer irgendwie wiederholen. Es gab immer Menschen, gibt sie und wird sie auch in Zukunft geben, die ihre alte Heimat aufgeben und einen Platz in einer neuen Heimat suchen.
Aufgeben wollen oder aufgeben müssen. Freiwillig oder unfreiwillig. Aus beruflichen oder wirtschaftlichen Gründen, wegen Verfolgung, Hunger, Krieg und Zerstörung oder einfach der Liebe wegen. Auch das soll es geben, gegeben haben und wird es immer wieder geben.
Ganz oben ist er – Markgraf Christian-Ernst – auf seinem Brunnen
3
Diese Stadt ist bunt und die Menschen hier sind bunt
Nicht alle, das wäre ja fast schon wie in einem Märchen. Aber überwiegend macht alles einen eher entspannten Eindruck. Das ist gut so.
Diese Stadt, dieser Ort, gestern und heute eine eher kleine gemütliche, gerade schon oder noch, Großstadt. Universität mit fast allen Fakultäten, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Unternehmen, deren Namen man eben kennt. Interessante und begehrte Arbeitsplätze. Hohes pro Kopf-Einkommen, dafür aber sehr hohe Mieten und nahezu unerschwingliche Immobilienpreise. Also nichts Ungewöhnliches. Eine Stadt im südlichen Teil Deutschlands, in Bayern. Wenn man ein kleines Fähnchen auf der Landkarte im Detail einpickst, dann steckt es im Bereich Franken.
Ist aber nicht wichtig, denn solche Städte und Gemeinden gibt es viele und die Geschichte könnte sich auch genauso gut wo anders zugetragen haben.
Es gibt auch kleine Brauereien. Sie brauen die für diese Gegend typischen Biere und das in echt kupfernen Kesseln. Einer befindet sich sogar in einem echten uralten Bierkeller aus Sandstein und der Gerstensaft fließt in Steinkrüge direkt aus dem Fass in diesem Keller. Kühl, lang, dunkel und irgendwie geheimnisvoll ist er. Der Keller,
In der warmen Jahreszeit ein überaus beliebter Treffpunkt von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Ein buntes Völkergemisch und Sprachengewirr trifft sich hier auf hölzernen Bierbänken unter schattigen mächtigen Bäumen.
Wenn man genau hinhört, erhascht man tatsächlich noch urwüchsige, einheimische Töne. Zum Glück. Alt neben Jung, Professor neben Installateur, Bankkaufmann neben Gärtner, Single neben Familie mit Kleinkind, Hochdeutsch neben Dialekt.
Man versteht sich. Eben bunt und nicht grau. Lebendig und nicht öde, nicht eintönig, nicht langweilig.
Zwei Flüsse, genauer gesagt ein Fluss und ein Bach, fließen durch die Stadt, verbreiten angenehme Kühle, aber auch oftmals unangenehmes Hochwasser und Überschwemmungen.
Viel Wald und grüne Wiesen lassen die Stadt atmen. Wanderschäfer ziehen mit ihrer Herde über diese Flächen und halten die Wiesen am Leben.
Hochhäuser reihen sich ein in die große Anzahl von Einfamilienhäusern. Ein Hochhaus kann sich sogar rühmen, das höchste Bayerns zu sein. 80 Meter ist dieser Wohnturm hoch, hat 27 Etagen und hört auf den Namen <Langer Johann>. In dieser eigenen Wohnstadt leben Menschen aller möglichen Nationalitäten, Berufe und Einkommensklassen, Singles und Paare, Alt und Jung zusammen. Ob man so ein Gebäude schön findet oder eher nicht, muss man für sich selbst entscheiden.
Zahlreiche Weiher prägen die Landschaft. Naherholungsvergnügen unmittelbar in Stadtnähe. Ruderboote und Tretboote eines Bootsverleihers gleiten geräuschlos dahin und Stand-Up Paddler versuchen sich im Gleichgewichtstraining. Selbst ein Segelclub schickt seine kleinen Jollen in die Fluten. Nachwuchsskipper können hier ihren Segelschein erwerben.
Unzählige Störche stolzieren durch die Feuchtwiesen. Ihr Tisch ist gedeckt. Graureiher und Kormorane kreisen über den Weihern und fischen ihre Nahrung flink aus dem Wasser. Nicht zur Freude der Teichwirte.
Eine immer größer werdende Anzahl von Störchen verzichtet auf die lange und gefährliche Flugreise in südliche Winterquartiere. Sie bleiben einfach hier. Es gefällt ihnen hier und die wärmer werdenden Winter decken ihren Tisch auf den feuchten Wiesen.
In den Bächen, die das Weiherwasser speisen, wohnen Biberfamilien. Sie arbeiten perfekt. Dämme stauen das Wasser auf und Bäume knicken um. Natur.
Ein riesiges Netz an Fahrradwegen macht diese Stadt zu einer fahrradfreundlichen Gegend. Nicht immer zur Freude überzeugter Automobilisten und so mancher Fußgänger ist auch nicht unbedingt erfreut, wenn er wieder einmal einen Seitensprung machen muss. Die warnende Glocke eines Radlers oder der Ruf „geh zur Seite“ oder „Achtung Fahrrad“ fordert unmissverständlich das Wegerecht für das Zweirad.
Seitensprung. Gymnastische Einlage und ganz umsonst.
4
Hier lebten die Beiden, die uns ihre Geschichte erzählen Eine Geschichte von Aufbruch, Hoffnung und Mut
Oder besser gesagt, die drei. Hier erlebten sie das, was sie uns erzählen und nehmen uns mit in ihre damalige kleine Welt. In ihre Welt, die von Hoffnung und Mut zum Aufbruch geprägt war. Ihre einzige Chance auf ein anderes Leben, eine bessere Zukunft.
Um es kurz zu machen, es waren ganz normale Menschen. Keine VIPs, very important persons, oder Ähnliches. Nein, ganz normale Menschen ohne Imponiergehabe und profilneurotische Anwandlungen. Ihre Wurzeln befanden sich in völlig unterschiedlichen Regionen. Und das macht das Ganze besonders interessant. Ganz besonders bunt.
Aber da ist noch der dritte, der Kleine. Er hat zwei Vornamen. Einer davon genau wie sein Vater, Fritz. Ich nenne ihn einfach so. Um Verwechslungen zu vermeiden, hört er, der kleine Fritz, in dieser, auch seiner Geschichte, auf Fritzchen.
Die damaligen Vornamen der männlichen Wesen klangen schon etwas anders als heute. Leon, Finn, Jonas, Luka oder Noah hätte die zuständigen Ämter vermutlich vor eine nahezu unlösbare Aufgabe gestellt und den Blutdruck der Beschäftigten gefährlich ansteigen lassen. Nein, die Männer von damals hörten eher auf Ludwig, Hans, Georg, Helmut, Siegfried, Christian, Ernst, Josef, Hubert, Jakob oder eben Fritz.
Zwei Vornamen, wozu, genügt nicht einer?
Lisa-Marie oder Ann-Kristin klingen wunderbar, haben aber nichts mit mehrfachen Vornamen zu tun. An erster Stelle steht hier immer der eigentliche Name und an zweiter Position eben ein zusätzlicher Name, der aus irgendeinem Grund gewählt wurde. Früher war das bei Jungen in der Regel der Name des Vaters oder bei Mädchen der Mutter. Oft erfolgte sogar der Zugriff auf den Namen der Großeltern.
Unser Fritz heißt daher auch Fritz Georg, weil sein Vater Georg hieß. Ist völlig egal, es ist der Fritz.
Bei Frauen uferte das oft aus und so entstanden zum Beispiel Eva Maria Josephine oder Klara Antonia Magdalena. Im Alltag kam nur Eva oder Klara zum Einsatz, aber wehe, wenn Maria und Josephine oder Antonia und Magdalena bei offiziellen Dokumenten unterschlagen wurde, dann war das Dokument ungültig.
Galt selbstverständlich auch für die Männer. Der Fritz ohne Georg hätte spätestens bei der Heiratsurkunde ein Problem bekommen.
Ist auch heute noch so. Was in der Geburtsurkunde steht, gilt. Es steht in allen offiziellen Dokumenten, wie Personalausweis, Pass oder Führerschein. Und, was in einem Personalausweis oder Pass steht, ist verbindlich. Selbst bei einem eher unbedeutenden Vorgang, wie das Abholen einer bei der Post gelagerten Sendung muss der gesamte Name nachgewiesen werden.
Ein gewichtiges Beispiel dafür war das notwendige Aufgebot für die Heirat. Fehlte hier auch nur ein Name, war das Ganze ungültig.
Oftmals verwendete man sogar andere Namen, die ein Leben lang hielten. Sie waren aber nicht offiziell.
Und so kam es, dass die Mimi eigentlich gar nicht Mimi hieß, sondern offiziell Rudolfine Leopoldine. Vermutlich wollte man mit diesen Mehrfachnamen die Familientradition wahren.
Ein ehemaliger deutscher Politiker bringt es immerhin auf neun Vornamen und hört auf Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester. Viel Spaß beim Unterschreiben.
Fritz, also der alte Fritz, stammt aus einem Bauernhof in einem Dorf, nicht weit entfernt vom Spielort dieser Geschichte.
Mimi, unsere zweite Hauptperson, kommt ganz wo anders her. Sie ist ein waschechtes Großstadtkind aus der Stadt der Musik, der Opern, der Operetten und des Walzers und des berühmten Schmähs.
Eine Hochburg der berühmten Habsburger mit dem ehrwürdigen Kaiser Franz-Josef und natürlich der etwas umtriebigen Kaiserin Elisabeth. Sisi. Meistens unterwegs, kaum zu Hause.
Wo war ihr Zuhause überhaupt? Im Schloss Schönbrunn in Wien oder doch eher in Bayern? Dort wo sie das Licht der Welt erblickte als Tochter des Herzogs Max Joseph und seiner Frau, Prinzessin Ludovika Wilhelmine.
Die beiden steinernen Markgrafen, der eine auf seinem steinernen Sockel, der andere oben auf dem Brunnen, regungslos, ruhen in sich selbst und doch hat es den Anschein, als wollen sie sagen: „vergesst nicht wie es früher war, erinnert euch. Ob es früher besser, schlechter, schöner, entspannter oder eher grausam war, das können wir euch nicht sagen. Findet es selbst heraus. Ebenso den Namen dieser Stadt. Gar nicht so schwierig“.
Ja, sind wir gespannt auf das, was sich in dieser Zeit abspielt. Tauchen wir ein in die Vergangenheit, die noch gar nicht so lange vergangen ist. Fühlen wir uns als ein Teil dieser Zeit. Fühlen wir mit und versuchen diese Zeit zu verstehen.
5
Das Fritzchen erblickt problemlos und natürlich das Licht dieser Welt
an einem warmen Tag Ende August. Genau zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Problemlos und sehr natürlich, also ohne vorprogrammiertes Datum, ohne profilneurotische Lifeshow in facebook, Instagram, Twitter oder sonstigen sogenannten sozialen Medien.
Ohne vibrierendem neurotischen Vater, der schon Wochen vorher das gesamte Klinikpersonal zur Weißglut bringt, weil das bereits vor neun Monaten gebuchte Einzelappartement erst kurz vorher frei wird.
Ohne Gipsabdruck des einmaligen Babybauchs der Mutter. Trophäe. Wo diese Trophäe anschließend ihren Platz findet, wird wohl ein gut gehütetes Geheimnis bleiben. Vielleicht kann man sie im Internet ersteigern oder ein Künstler eröffnet damit eine Sammlung. Babybäuche in Gips.
Und dann die langersehnte Meldung für alle hunderttausend Freunde und Freundinnen im Netz. Sehnsüchtiges Warten, Bangen und Hoffen hat ein Ende. Uns ist ein Kind geboren, das schönste, das es je gab. Ist doch klar. Was sonst? Dazu eine halbseitige Anzeige der vor Glück taumelnden Omas und der ebenso faszinierten Opas in der Presse. Es sollen und müssen alle wissen, ein Wunderkind hat das Licht der Welt erblickt.
Wenn einem so etwas widerfährt, das ist schon ein Glas Champus wert. Getreu dem uralten Werbeslogan eines uralten Weinbrands. Er hört mit seinem Vornamen auf Asbach.
Nein, so nicht. Aber immerhin kennen Mimi und Fritz den Komfort des Rooming in. Nicht extra gebucht. Nicht nötig, es findet alles auf einem Sofa in der guten Stube des Bauernhofes der Familie statt.
Sofa ist so etwas wie eine Couch.
Kachelofenwärme, Zinkwanne, das heiße Wasser vom Küchenherd. Einzige Helferin, die Hebamme. Diese gute Fee erledigt alles professionell. Das Fritzchen, also der kleine Fritz, hat diesen Vorgang bestens und stressfrei überstanden. Ebenso wie seine Mama, die Mimi.
Im August Geborene können, was ihre Sternbilder angeht, nur Jungfrauen oder Löwen sein. Was besser ist, bleibt ein Geheimnis der Sterne.
Der Löwe startet am 23. Juli und endet am 23. August. Nachdem Fritzchen Ende August geboren wird, ist er eindeutig eine Jungfrau.
Ein Jungfraumensch befindet sich im sechsten Zeichen des Tierkreises. Planet ist der Merkur und Element ist die Erde.
Verzichten wir auf Details, da dieses Thema ja ohnehin sehr gemischte Gefühle auslöst. Für viele ein absoluter Schwachsinn, für andere der absolut sichere Beweis für ihr gelebtes Lebensmotto.
Im machen Cafés gibt es ihn, den in ein Stück Papier verpackten Würfelzucker. Nur absolute Ignoranten öffnen das Papier, ungeachtet der aufgedruckten Weissagung oder verschmähen diesen kleinen süßen Gruß sogar.
Und dabei ist ihnen etwas Elementares entgangen. Auf der einen Seite hätten sie nämlich die positiven und auf der anderen die negativen Eigenschaften eines Sternbildes entdeckt. Und mit etwas Glück sogar ihr Eigenes. Notfalls erfolgt ein Tausch. Jungfrau gegen Krebs oder Löwe gegen Waage.
Diese wunderbaren Würfelchen werden in den Folgejahren überwiegend gegen gefühllose Papierröhrchen auswechselt. Aus ihnen rieselt der Zucker wie Schnee. Darauf ist kein Platz für Eigenschaften einer Jungfrau, eines Löwen oder eines Krebses.
Wenn man mit der positiven Seite beginnt, kann ein Jungfraumensch durchaus mit sich und der Welt zufrieden sein. Die Jungfrau ist analytisch, arbeitsam, bescheiden, ehrlich, exakt, flexibel, geschickt, praktisch, strukturiert, zurückhaltend, zuverlässig, intelligent und klug. So sagt es jedenfalls das Zuckerpapier.
Die Schwächen muss man nicht so ernst nehmen. Intolerant, kleinlich, kritisch, kühl, misstrauisch, nörgelnd, pedantisch, perfektionistisch, rechthaberisch, verklemmt. Also nicht gerade verlockend. Aber wer weiß denn schon, ob das wirklich alles so stimmt.
Und wenn schon, es ist ja nur ein Würfelzucker.
Etwas Glück gehört also schon bei seiner Geburt dazu, dass man den richtigen Stern erwischt.
Mimi ist ein Wassermann, also eigentlich eine Wasserfrau, und Fritz ein Fisch. Wassermänner und Wasserfrauen kommen im Februar zur Welt und Fischmänner und Fischfrauen im März.
Im Sternzeichen des Wassermanns Geborene sind aufrichtig, einfallsreich, fortschrittlich, freiheitsliebend, freundlich und gesellig, hilfsbereit, willensstark und zukunftsorientiert. Aber auch distanziert, rebellisch und wechselhaft. Ihr Lebensmotto lautet: Ich bringe meine Individualität zum Ausdruck. Wassermann-Menschen akzeptieren bereitwillig so manchen Umweg, um an ihr Ziel zu gelangen. Für Freunde sind sie immer ein sicherer Hafen bei Problemen. Jedenfalls laut der Astrologie und des Würfelzuckers.
Der Fischmensch ist hilfsbereit, sensibel und verträumt, romantisch und geheimnisvoll. Attestiert wird ihm ein sehr gutes Einfühlungsvermögen, Bescheidenheit und er ist verständnisvoll anderen Menschen gegenüber. Angeblich ist er etwas verträumt und legt sich nur ungern schnell fest. Für seine Mitmenschen ist er immer da, wenn er gebraucht wird. Jedenfalls laut der Astrologie und des Würfelzuckers.
Wahrheit oder Hokuspokus? Antwort ist offen.
Wenn man im Gebirge auf einer Berghütte oder an Bord eines Schiffes in den nächtlichen Sternenhimmel blickt, kann dieser Blick schon mystische Gedanken auslösen, weil dieses unendliche Weltall unverständlich, unvorstellbar und unbegreiflich erscheint.
Sicher und real ist aber, der Würfelzucker ist süß.
Fritzchen interessiert das alles irgendwie und so verfolgt er in seinen späteren Lebensjahren die Fernsehsendungen von Heinz Haber. Als Jugendlicher faszinieren ihn zwei seiner Bücher mit den Titeln <Unser blauer Planet> und <Bausteine unserer Welt>.
Heinz Haber war Physiker und konnte die Zusammenhänge des Universums so erklären, dass man sie auch ohne wissenschaftliche Bildung sehr gut verstehen konnte.
6
Fritz, also der alte, kommt kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges auf diese Welt
Eine Zeit der Entbehrungen, der Selbsthilfe, kurzer politischer und wirtschaftlicher Lichtblicke. Es sind Lichtblicke, die aber sehr schnell wieder ihr Licht verlieren, in der Dunkelheit der Realität verschwinden, abtauchen. Zusammenbruch der Wirtschaft, Geldentwertung, hohe Arbeitslosigkeit, Hunger.
Wie die meisten seiner Altersgenossen verbringt er während des Naziregimes mehrere Jahre beim Arbeitsdienst und wird dann planmäßig Soldat. 1940.
Nein, er geht nicht in den Widerstand und nicht in den Untergrund, ebenso wenig wie die meisten Menschen in dieser Zeit. Er schlägt aber auch keine militärische Karriere ein, wird kein Offizier oder ähnlich Hochdekoriertes, trägt keine braune Uniform mit auf Hochglanz polierten Stiefeln wie die Schlägertrupps der SA. Er wird Soldat. Einfach Soldat.
Mutlos, zu ängstlich für den Widerstand, Mitläufer und einfach eingetaucht in die große Masse? Letzteres trifft wohl am ehesten zu, so wie für die meisten, die vielen hunderttausend anderen.
Als klassisches Landei kommt er nicht etwa zur Infanterie oder sonstigem Bodenpersonal der Deutschen Wehrmacht, nein Seemann soll er werden. Eigentlich wird er aber doch keiner oder zumindest kein richtiger. Eine Art Seemann ohne Schiff und Meer.
Die Voraussetzungen hätte er. Wenn auch nur in sehr kleinem Rahmen. Durch seinen kleinen Heimatort, also eigentlich ein Dorf, fließt ein Fluss und es gibt viele Weiher.
Die Familie besitzt sogar ein Paddelboot. Ein wunderschönes klassisches Faltboot. Der Boden aus Gummi, die Oberfläche aus dunkelblauem Stoff und die Form wird durch ein Gestänge aus hell lackiertem Holz erzeugt. Ein Boot von Klepper.
Die Geburtsstunde für diese Boote war 1907 als der Rosenheimer Schneidermeister Johann Klepper die Lizenz zur Alleinfertigung des Bootstypen Delphin von Alfred Heurich zum Bau erwarb. Heurich war der Pionier moderner Faltboote. Mit der Gründung der Klepper Faltbootwerft GmbH im Jahre 1919 begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert. 1929 war Klepper der Marktführer in diesem Bootssegment. Kapitän Romer schrieb Geschichte, als er mit einem 6,40 m langen Faltboot von Klepper den Atlantik überquerte. Als Erster mit so einem Boot. 58 Tage benötigte er von Lissabon in Portugal nach Virgin Island in den USA. 1956 überquerte Dr. Hannes Lindermann mit einem Serien-Faltboot der Serie Aerius II in 72 Tagen diese Strecke. Diese Alleinüberquerung ist bis heute die Einzige mit dieser Bootsgröße. Das Unternehmen gehört seit 2020 zur Klepper Lifestyle AG in Hamburg, die Produktion erfolgt nach wie vor in Rosenheim.
Aber was hat das mit der Seefahrt zu tun? Nichts, überhaupt nichts. Aber wirklich gar nichts.
Offenbar holt man Wehrdienstleistende aus dieser Region gerne zur Marine. Absolut fern von jeglicher See. Fern von Sturmgebraus, hohen Wellen und wehmütigen Abschiedsszenen beim Ablegen der Schiffe. So etwas kennen sie nicht, haben sie noch nie gesehen.
Kurzer Blick nach vorne.
Dem Fritzchen wäre es später fast ebenso gegangen als er mit achtzehn Jahren für die Bundeswehr als voll tauglich gemustert wird. Als sich der gestrenge Offizier, Major oder sonst was in voller Größe mit eingezogenem Bauch und geschwellter Männerbrust vor ihm aufbaut und ohne jede erkennbare Regung in seinem Gesicht fragt, wo er denn gerne dienen möchte. Fritzchen, leicht eingeschüchtert von der militärischen Größe seines Gegenübers antwortet nur kleinlaut „überall, nur nicht bei der Marine“. Also gut, die Frage seines Gegenübers war ohnehin nur von rhetorischer Natur und seine Antwort „Ich beglückwünsche Sie, Sie haben die Ehre bei der Marine dienen zu dürfen“, stand ebenfalls bereits fest. Na bravo, signalisiert sein Gehirn, auf diese Ehre kann ich nun wirklich verzichten. Warum nicht bei den Gebirgsjägern, schließlich bin ich doch seit Kindesbeinen mit meinen Eltern im Gebirge unterwegs, liebe die Berge und habe gerade mit dem Klettern begonnen, rotiert es in seinem Gehirn. Nein, er soll zum Meer. Muss zum Meer, wird einberufen zur Ausbildung für das Meer. Auf Masten klettern, in den Ausguck, nach Seeräubern Ausschau halten, Segel bergen, Deck schrubben und was sonst noch alles.
Bestanden hätte er einen etwaigen Intelligenztest, warum Gebirgsjäger eigentlich Gebirgsjäger heißen, ohnehin nicht. Wer oder was, soll denn da gejagt werden? Gämsen, Steinböcke oder gar die berühmten Wolpertinger?
Matrose ist einfacher. Das sind die Jungs mit den schicken blauen und weißen Anzügen, den stolzen Mützchen und den weinenden Mädchen, wenn die Jungs in See stechen.
Dass ihm das Ganze erspart blieb, verdankt er eher seiner vorhandenen Unfähigkeit eines Fahranfängers. Diese Unfähigkeit katapultiert ihn und sein Motorrad, das offenbar ein etwas gestörtes Verhältnis zu Kurven hat, auf direktem Weg in einen Acker. Der Grenzstein hätte nun auch nicht unbedingt in seiner Flugbahn stehen müssen. Ergebnis, ein angeknackster Wirbel.
Fritz, also der alte, bewahrt ihn zum Glück davor, dass ihm die Ärzte in der Klinik seinen harten Schädel aufsägen. Diagnose Schädelbruch. Fritz, inzwischen Fachmann in der Röntgentechnik und Diagnostik, nimmt den Herren im weißen Kittel die Aufnahmen einfach aus der Hand und zeigt ihnen, was wirklich Sache ist. Alles nur kein Schädelbruch. Fehldiagnose. Die Herren im weißen Kittel nicken und folgen brav. Zum Glück. Der harte Schädel bleibt zu.
Dafür haben sie aber zunächst den angeknacksten Wirbel übersehen. Hätte es auch nicht unbedingt gebraucht, aber die Marine bleibt ihm wenigstens erspart. Ausgemustert oder militärisch umgebettet. Ersatzreserve 2 steht im Bericht. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist ihm auch egal, Hauptsache, er ist die Marine los.
Blick wieder zurück.
Fritz, also der alte, kann weder einen geknacksten Wirbel noch einen eingedellten Schädel vorweisen. Also, ab zum Leuchtturm und zur Marine. Nur Seemann wird er nie, denn seine Einheit fährt nicht zur See. Sicher sein großes Glück, sonst hätte er vermutlich irgendwo auf dem Meeresgrund seine letzte Ruhe gefunden. Und die See kennt bekanntlich keine Kreuze und keine Gräber und auf einem Seemansgrab blühen bekanntlich auch keine Rosen.
Jedenfalls lautet so der Text dieser alten Seemannsschnulze, was aber zu stimmen scheint.
Nein, er dampft nicht über die Meere und taucht nicht ab in einem U-Boot. Braucht keine Angst vor Torpedos anderer Schiffe zu haben, keine Angst vor Wasserbomben, die U-Boote zerstören können. Nein, er hat die ehrenvolle Aufgabe der Flugabwehr. Kurz als Flak bezeichnet. Flak kommt von dem Wort Flugabwehr-Kanone.
So wartet er also, gemeinsam mit seinen Kameraden, an der Nordseeküste am plattdeutschen Strand, wo die Fische meistens im Wasser sind und selten an Land. Wenn der Schöpfer eines Liedes aus dem Genre Schnulze, Recht hat.
So sitzen sie also auf einem Wachturm und warten auf die angreifenden Flugzeuge der Feinde. Engländer, Franzosen, Russen und Amerikaner. Zusätzlich bewaffnet mit einem Karabiner. Geflogen kamen nur Engländer. Während seiner Anwesenheit kommt aber überhaupt nichts angeflogen. Sein Glück.
Karabiner hat hier nichts mit einem Karabiner zu tun, wie man ihn zur Sicherung beim Klettern, auf dem Bau oder beim Anleinen eines Hundes verwendet. Es war die Bezeichnung für das Gewehr.
Und wie steht es um die Kanone aus dem Wort Flak? Nichts, die gibt es nicht. Jedenfalls nicht in seiner Stellung. Keine Kanone weit und breit. Keine Kanonenkugeln zum Losfeuern. Nichts.
Nachdem die großen Feldherren in ihren sicheren Kommandozentralen offenbar vermuten, dass es keine Luftangriffe von der See aus geben wird, verlegt man die Einheit, in der unser Fritz dient, ganz weit weg. Weg vom Meer. Weit weg von den Wellen, weit weg vom Strand und den Fischen im Wasser. Nicht gleich in die Wüste, aber immerhin rund 1200 Kilometer Richtung Süden. In die Stadt des Walzers, der Musik, der ehemaligen Kaiserfamilie aus dem Geschlecht der Habsburger.
Zunächst unverständlich, denn außer der bekannten blauen Donau ist auch hier weit und breit kein Wasser in Sicht. Allenfalls der nahe Neusiedler See, aber der ist zu flach, dass von ihm ein Angriff mit Kriegsschiffen ausgehen könnte. Allenfalls mit Segeljollen, Ruderbooten oder Tretbooten, was aber militärstrategisch eher untauglich erscheint. U-Boote würden bei durchschnittlich zwei Meter Wassertiefe auch nicht vollständig verschwinden und im Schlamm stecken bleiben.
Von dort droht keine Gefahr. Aber die großen Kriegsstrategen vermuten Angriffe aus der Luft auf diese Stadt. Kluge Burschen offenbar, denn die lassen nicht lange auf sich warten. Hier sind die Marinesoldaten aus dem Landrattenregiment offenbar genau richtig.
Die Deutsche Wehrmacht errichtete in den Jahren 1942 bis 1945 in Wien sechs Türme aus <allerbestem> Beton. Sie dienten zur Luftabwehr und als Luftschutzbunker. Und so erhielten sie ihren Namen Flak-Türme. <Beste deutsche Wertarbeit>, die man auch an anderen Gegenden, zum Beispiel in der Normandie oder in Norwegen, noch <bewundern> kann. Bestaunen. Kopf schütteln. Fragen bleiben. Nach Kriegsende verzichtete man auf die Sprengung wegen der unmittelbaren Nähe zu Wohnhäusern. Heute stehen diese Dinger auch als Mahnmale für den damaligen Wahnsinn und Irrsinn jedes Krieges. Einer dieser Türme wurde sogar einer interessanten Verwendung zugeführt. Er steht immer noch im Stadtteil Mariahilf im Esterhazy Park. In diesem Stadtteil befindet sich auch die Mariahilfer Straße. Viele Jahre immer die etwas graue Maus im Schatten der großen Kärntner Straße und des Grabens, der zur Hofburg führt. Nobelgeschäfte und königlich-kaiserliche Hofkonditoreien. Inzwischen hat sie sich kräftig verändert und sich zu einer interessanten und sympathischen Shoppingmeile gewandelt. Also, hier steht er noch, der alte Flak-Turm. Und diesen hat die Sektion Austria des Österreichischen Alpenvereins in eine Art Stadtfelsen verwandelt, indem sie an der Außenwand unzählige künstliche Klettergriffe angebracht hat. Was also während des irrsinnigen Krieges als Abwehr gedacht war, dient heute Anhängern des Klettersports als Trainingsanlage. Ein Fels in der Stadt, ein urbanes Gebirge, wenn auch ohne Gipfelkreuz. Sportgerät und Mahnmal zugleich.
Fritz, der Marinesoldat ohne Salz und Meer, ohne Sturmgebraus und Wellen ist in Wien. Gewechselt vom Nordseestrand an den Donaustrand. Gewechselt in die Stadt des Walzers, der Operette, der Lebensfreude. Er sitzt mit seinem Karabiner auf dem Betonturm, beobachtet den Himmel, wartet auf den Feind und hofft sehnlichst, dass er nicht kommen wird.
Fritz ist ein erklärter Naturfreund und so nutzt er jede freie Minute für Ausflüge in die nahegelegenen Berge, Hügel und Wälder. Urige Vorgebirgshütten laden zum Verweilen ein, ein frischer Kaiserschmarren und ein Glas Wein aus den umliegenden Weinbergen gehören dazu.
Ja, und da ist es offenbar passiert. Amor, dieses umtriebige Schlitzohr, schlägt ohne Vorwarnung zu. Gnadenlos. Kennt man ja.
Mimi ist ein Kind dieser Stadt, das erkennt man schon an ihren Vornamen. Wer heißt denn schon Rudolfine Leopoldine? Die Leopoldine erbt sie von ihrer Mutter, die eben Leopoldine heißt. Die Rudolfine erbt sie von ihrem Vater, der heißt Rudolf.
Genauso wie der ehemalige Kronprinz, Kaiserin Sisis Sohn.
Da sie aber kein Sohn wurde, wird aus dem Rudolf einfach eine Rudolfine.
So einfach und unkompliziert ging das. Ganz ohne ermüdende Sitzungen, Diskussionen bis zur Erschöpfung, Chats und Smalltalks bis endlich klar ist, wie die Kleine oder der Kleine heißen soll. Und am Ende heißt er nach ermüdenden stundenlangen Chatrunden dann doch einfach Paul oder sie Lisa-Pauline. Mehrheitsentscheid der Community. Der so vielen unzähligen Netz-Freunde. Lauter echte Freunde. Verteilt über den gesamten Globus.
Da es aber noch nicht so einfach möglich ist, das Geschlecht des Kindes schon im mütterlichen Bauch zu bestimmen, hält man sich alle Optionen offen. Wäre sie ein Bübchen geworden, hätte es eben auf Rudolf Leopold gehört.
Rudolfine Leopoldine, im Alltag viel zu kompliziert, viel zu lang und so wird schnell eine Lösung gesucht. Gefunden. Fini. Damit nicht genug, als Zweitname Mimi. Und schon sind es vier. Rudolfine Leopoldine hört aber nur auf zwei. Auf Fini oder Mimi. Genügt.
Gipfelküsse sind bekanntlich eine uralte Bekundung der gemeinsamen Freude über den bezwungenen Berg. Alle Gefahren besiegt, alle Qualen des Aufstiegs vergessen. Glückshormone sprudeln wie ein Wasserfall.
Eine junge Frau hängt am Seil eines Kletterpartners und fällt diesem am Ende der letzten Seillänge nach dem letzten Griff im harten Fels in seine sicheren Arme. Aber, was ist das? Hinter ihm sitzt ein potenzieller Konkurrent. Ein gutaussehender Blonder mit blauen Augen. Der will nichts anderes als dort oben in aller Ruhe sitzen. Nicht auf seinem Flakturm, diesem seelenlosen Betonklotz ohne Gipfelkreuz. Nein, er sitzt hier oben auf dem Gipfel eines Felsens. Unbeschwert die Natur genießen, den wolkenlosen blauen Himmel, die reine Bergluft. Einatmen. Ausatmen. Aufsaugen.
Und da kommt ausgerechnet jetzt etwas Schwarzhaariges, Langhaariges mit hübschen braunen Augen und irgendwie verführerisch in ihrer halblangen weiten Kletterhose und Bluse die Steilwand herauf und blickt zu ihm. Sie könnte auch vorbeischauen, links oder rechts davon. Oder ihren Seilpartner anschauen, der sie sicher nach oben bringt. Mensch Amor. Du altes Schlitzohr.
Wären es zwei rivalisierende Steinböcke gewesen, hätte es ganz schön gekracht. Ihre knochenharten Gehörne hätten sie so lange gegeneinander geschlagen bis der Schwächere eingesehen hätte, es sei wohl besser den Rückwärtsgang einzulegen und dem Rivalen die umworbene Steinbockfrau zu überlassen.
Fritz ist kein Steinbock, er ist Fisch. Jedenfalls in seinem Sternzeichen. Kämpfe und Auseinandersetzungen sind ihm zuwider.
Mimi taucht nicht aus dem Wasser auf wie eine Meerjungfrau, obwohl sie laut ihrem Sternzeichen ein Wassermann ist. Eigentlich eine Wasserfrau. Nein, sie kommt vom sicheren Boden auf den schmalen Gipfel eines Berges. Ja, so ist es geschehen dort oben. Aber wie kam der Blonde mit seinen blauen Augen dort hinauf? Dort, wo nur Kletterer zu Hause sind? Steinböcke oder Gämsen in Menschengestalt?
Auf den meisten Bergen gibt es auch einen leichtesten Weg nach oben und oft ist es ein problemloser Weg. Normalweg nennet man ihn. Nicht immer ganz einfach, auch wenn es der leichteste ist. Aber hier schon.
Genau diesen Weg hat der Matrose der Landmarine gefunden.
Es hat gefunkt und die Beiden werden ein Freundespaar. Amor hat sich offenbar ganz schön ausgetobt. Der junge blonde Deutsche und die junge schwarzhaarige Wienerin werden unzertrennlich.
Ein blonder deutscher Soldat als Freund. Damalige Beziehungen waren komplizierter als heute. Eltern führten in der Regel das Regiment und gaben die Richtung vor. Unabhängig vom Alter ihrer Kinder. Offenbar war das aber bei den Beiden überhaupt kein Problem. Deutsche Soldaten waren damals in den Augen der Zivilbevölkerung keine wilden Gesellen und Österreich war ja sogar Teil des damaligen deutschen Reiches. Nein, man war sogar froh, dass sie da waren, denn man hatte eine furchtbare Angst vor der drohenden Gefahr der herannahenden russischen Armee.
7
Die Beiden verbringen eine sehr glückliche Zeit in dieser absolut nicht schönen Zeit
und verloben sich auch sehr bald. Sehr zur Freude von Mutter Leopoldine, was eigentlich erstaunlich ist. Denn, dass ihre Tochter nach Kriegsende die angestammte Heimat verlassen und zu ihrem künftigen Mann ziehen wird, ist ziemlich klar.
Mimi ist gelernte Schneiderin für Damenoberbekleidung und Herrenhemden, arbeitet aber seit Kriegsbeginn als Krankenschwester im Spittal. So nennt man in Österreich das Krankenhaus.
Und dieses Spittal befindet sich unmittelbar gegenüber der elterlichen Wohnung. Es wird von Ordensschwestern geleitet und ist Zufluchtsort für die weibliche Bevölkerung nach dem Einmarsch der alliierten Truppen. Vor allem die Angst vor Übergriffen russischer Soldaten ist allgegenwärtig, da man sie als eher unkultiviert einschätzt. Ihre Kultur ist aufgrund von Erzählungen eben anders, ihre Sitten rau, fremd, unberechenbar.
Man hofft auf die Schutzfunktion, die Achtung und den Respekt der Engländer, Franzosen und Amerikaner.
Im Luftschutzkeller des Wohnhauses sitzt auch zeitweise das nuschelnde Wiener Komikeroriginal Hans Moser.
Mimis Wohnung und damit auch die ihrer Mutter und ihres Bruders befindet sich in einem typischen Wiener Gemeindebau.
Wer Wien <a bisserl> kennt, weiß auch was Gemeindebauten sind. Es sind städtische Wohnanlagen, die nach sozialem Standard vermietet werden. Meistens sind es Wohnungen ähnlicher Größe. Zimmer, Kuchel, Kabinett. Ein Wohnzimmer, eine Küche, im Dialekt Kuchel, und ein kleineres Zimmer, das Kabinett, und ein Schlafzimmer. Bad gab es damals keines, aber natürlich ein WC. Das Bad, das keines war, bestand aus einem Lavur. Dusche Fehlanzeige. Der Begriff Kabinett ist aus dem französischen Wort Cabinet abgeleitet und meint damit ein kleines Zimmer, eine Kabine. Weingenießer kennen diesen Begriff. Beim deutschen Wein ist es ein Prädikat für Qualitätsweine der gehobenen Güteklasse mit eigener Prüfnummer. Entstanden ist das Ganze um das Jahr 1500 in einem Kloster, wo man besondere Weine in einem eigenen Zimmer lagerte, das Cabinet. Und ein Lavur? Nichts außerirdisches, ganz einfach wieder einmal ein Begriff aus dem berühmten Wiener Französisch, ein Überbleibsel der unrühmlichen Gastspiele von Napoleon Bonaparte Ende des 18. Jahrhunderts in dieser Stadt. Dieses Ding ist nichts anderes als eine große Waschschüssel, meist aus Porzellan und heißt richtig Lavoir. Absolut getreu aus dem Französischen übernommen. Nur etwas anders, eben wienerisch, ausgesprochen. Mit diesem Gerät, beziehungsweise mit dem Wasser darin, reinigte man den gesamten Körper. Eine Art Miniatur Spa Oase.
Dieser Gemeindebau gleicht einer kleiner Burganlage. Die einzelnen Gebäude reihen sich nahtlos in einem riesigen Kreis aneinander und die Lücken schließen kleine Mauern mit einem Eingangstor. Das rechtliche und wirtschaftliche Regiment führt ein Hausbesorger, also ein Hausmeister. Er ist der Chef, unangreifbare Respektsperson und nach seiner Pfeife wird getanzt. Er achtet sehr genau darauf, dass auch wirklich immer alles in bester Ordnung ist. Zum Beispiel das Säubern und anschließende Einwachsen der Treppen. Und auf diesen kann man buchstäblich essen, so sauber sind sie. Den Abschluss einer Stufe bildet eine Messingschiene, die immer auf Hochglanz poliert ist. Hochglanz.
Dieser kleine Häuptling ist aber auch für alles ansprechbar und handelt sofort. Ein tropfender Wasserhahn hat im Handumdrehen ausgetropft, eine nichtschließende Türe schließt sofort wieder und ein undichtes Fenster ist sofort wieder dicht. Sein Name, Wenzel Jelinek. Nicht nur Jelinek, es ist der Herr Jelinek. Kein Gastarbeiter, Irrtum, ein waschechter Urwiener.
Kein Wunder, dass sein Name etwas böhmisch klingt, haben doch viele Wiener und Wienerinnen dortige Wurzeln aus der berühmten K.u.K.-Zeit.
Österreich war während der K.u.K.-Zeit ein Vielvölkerstaat mit Bürgern aus Kroatien, Slowenien, Italien, Ungarn, Tschechien oder Polen. K.u.K. ist eine Art Wortspiel aus der Ungarisch-Österreichischen Monarchie von 1867. Das erste K steht für kaiserlich und kommt vom Kaiser Österreichs, das zweite K gehörte dem König von Ungarn.
Bekanntester Vertreter dieser Epoche ist der altehrwürdige Kaiser Franz Joseph aus dem Geschlecht der Habsburger und seine Frau und Kaiserin Elisabeth, bekannter als Sisi.
Der heute berühmteste Wiener Gemeindebau ist das Hundertwasserhaus. Es gibt aber auch noch den Marxer Hof. Ein Gemeindebau mit großer Vergangenheit aus dem damaligen Roten Wien, benannt nach Karl Marx. Er steht im 19. Gemeindebezirk Döbling, ganz in der Nähe von wunderbaren Heurigenlokalen in Grinzing und Heiligenstadt. Mit einer Länge von rund eintausend Metern ist es die größte zusammenhängende Wohnanlage der Welt. Erbaut wurde diese Anlage 1930 und erlangte während der Februarkämpfe 1934 traurige Berühmtheit. Seine rund 1300 Wohnungen sind auch heute noch alle bewohnt und sehr begehrt. Auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man in Wien ist und sehr viel ruhiger und entspannter als der von Touristen aus aller Welt umlagerte Hundertwasserbau.
Eine Art musikalisches Denkmal setzten Musiker wie Wolfgang Ambros, Georg Danzer und die EAV (Erste allgemeine Verunsicherung) mit dem Liedtitel >Du bist die Blume aus dem Gemeindebau< dieser Wiener Wohnungsbesonderheit.
8
Wien, die Stadt und mit ihr die Wiener und die Wienerinnen haben nichts zu Lachen
Der Krieg macht ernst und in der Zeit von April 1944 bis März 1945 wird die Stadt gezielt bombardiert und nach Einmarsch der Truppen durch Panzer und Kanonenfeuer schwer beschädigt. Auch der berühmte Stephansdom, das Wahrzeichen Wiens mit der riesigen Glocke, die Pummerin, wie sie die Einheimischen liebevoll bezeichnen, ist schwer beschädigt. Er brennt. Wie der Brand letztlich ausgelöst wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Die Gerüchteküche kocht.
Mimi und ihre Familie haben Glück im Unglück, ihr Wohnbezirk bleibt von Angriffen nahezu verschont. Ein kleines Wunder.
Rund 21 Prozent der Häuser waren zerstört oder schwerst beschädigt, die Infrastruktur nahezu völlig lahmgelegt. Mehr als 10.000 Tote - die schreckliche Bilanz. Eine schreckliche Bilanz, die aber leider auch in anderen Städten ähnlich oder noch schlimmer aussah.
Ein Glück im Unglück war, dass alle vier Siegermächte in der Stadt sind und so eine Art Kontrolle stattfinden konnte.
Der Film mit dem Titel <Die Vier im Jeep> aus dem Jahre 1950 aus Schweizer Produktion offenbart die Konflikte der Vertreter der Siegermächte deutlich.
Um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, war vereinbart worden, dass der Erste Bezirk, das ist der Bereich um den Stephansdom herum, durch Amerikaner, Franzosen, Engländer und Russen gemeinsam kontrolliert werden soll. Bald stellte sich der kulturelle Gegensatz zwischen den westlichen Vertretern und den Vertretern Russlands heraus und wie gut es für die Bevölkerung war, dass westliche Militärvertreter eine Art Führungsrolle übernahmen.
Mimi hat schon wieder ein kleines Glück. Ihr Wohnbezirk wird der Englischen Zone zugeordnet. Damit sind zumindest die größten Ängste und Befürchtungen gebannt.
Fritz überlebt diesen Horror durch seine ihm angeborene Schläue und Intelligenz. Gerade noch rechtzeitig zum Ende der Kampfhandlungen hat er diesen Zirkus verlassen und ist auf sehr mysteriösen Wegen nach Süddeutschland gelangt und dort den Amerikanern freiwillig in die Hände gelaufen. Mit ihm eine ganze Reihe seiner Kameraden. Auch schlau.
Die Gefangenschaft bei den Amerikanern ist kein Zuckerlecken. Aber im Vergleich zu dem, was ihn in Wien erwartet hätte, ist das die weit angenehmere Variante.
Am 8. Mai 1945 endeten dann in Deutschland die Kampfhandlungen dieses wahnsinnigen Krieges. Das tatsächliche Ende war jedoch erst nach der japanischen Kapitulation am 2. September 1945 erreicht. Ausgelöst wurde dies durch den Abwurf zweier schrecklicher Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki.
Die Stadt, vor deren Toren das Heimatdorf von Fritz liegt, hat zum Kriegsende gerade mal rund 46.000 Einwohner. Der Umsicht des Oberbürgermeisters ist es zu verdanken, dass ihr die Zerstörung erspart bleibt. Die Kapitulation erfolgt wenige Minuten vor Ablauf des Ultimatums. Wäre das nicht erfolgt, hätten Panzer der US-Armee die Stadt planmäßig dem Erdboden gleich gemacht. Und so bleibt auch den angrenzenden Dörfern das Schicksal der Zerstörung erspart, was man so vielen anderen Städten ebenso gewünscht hätte.
Der kluge Oberbürgermeister kann den für die Verteidigung der Stadt zuständigen deutschen Kommandeur in allerletzter Minute davon überzeugen, dass nur eine kampflose Übergabe das Leben von rund 60000 Einwohnern, davon rund 8000 Fremdarbeitern, ca. 5000 Evakuierten und 7000 Verwundeten retten kann. Nach mehrmaliger Weigerung stimmt er zu. In allerletzter Minute. Fünf vor Zwölf.
Er selbst überlebt nicht. Ob er sich selbst richtete oder erschossen wurde, bleibt ein Rätsel.
Es kehrt so etwas wie Ruhe ein. Aber eben nur so etwas wie. Offenbar ist noch eine Kugel in einer Panzerkanone übrig, die abgeschossen werden muss. Muss offenbar sein. Sie muss hinaus aus dem Rohr. Und, sie findet auch noch ihr Ziel. So wird noch in allerletzter Minute die Außenmauer eines Bauernhofes durchlöchert. Es ist der Bauernhof von Fritzens Familie.
Nicht jammern, ändert nichts, ran an die Arbeit und aufbauen. Alles geht sehr flott. Ein Glücksfall, dass alle noch leben. Wirklich leben.
Nicht alle Kriegsheimkehrer, die körperlich lebten, lebten auch wirklich. Ihre Seelen waren oft zerstört, ihre Herzen gnadenlos beschädigt. Tot geglaubte Freunde, Verlobte und Ehemänner löschten lange Zeit nach ihrer unerwarteten Heimkehr oft Seelen und Herzen aus ohne dies zu wollen.
Der wirtschaftliche Glücksfall ist, dass die Fertigungsbetriebe in der Stadt nicht zerstört sind, da sie nicht für die Kriegsindustrie arbeiten, sondern medizinische Geräte und Messgeräte herstellen.
Hier ist auch die Wiege der Produktion für Röntgengeräte. Kein Zufall, da der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen in Zusammenarbeit mit Mechanikern der Universität dieser Stadt im Jahre 1897 das erste funktionsfähige Röntgengerät schuf.
Auch ein Glücksfall für Fritz, er kann ziemlich direkt an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren. Hat Arbeit und Lohn. Nicht selbstverständlich in dieser Zeit.
9
Tausche Großstadt gegen Dorf, Gemeindebau gegen Bauernhof
Mimi lebt in Wien, einer von Bomben, Granaten und Panzerbeschüssen schwer beschädigten und in Teilen zerstörten Stadt. Die Stadt brennt. Telefon oder Fax gibt es nicht. Fehlanzeige. Was bleibt ist nur der Briefverkehr. Und der funktioniert erstaunlich gut.
Die schwarzhaarige Wienerin ist wild entschlossen, die umtriebige Großstadt mit ihren ehemals gemütlichen Beisln, ihrem wunderschönen Umland, den Parks, der Oper, der Theater, des Praters, der Museen, der Hofburg, des Stephandoms, der Fiaker, der Karlskirche und vielen anderen schönen Dingen aufzugeben und in ein Kleinstadtmilieu zu wechseln. Besser gesagt, in ein Dorf.
Passt irgendwie zu ihrem Sternbild Wassermann. Angeblich sollen darin Geborene die Freiheit und Lebenslust lieben, immer neue Herausforderungen suchen, vor nichts zurückschrecken und am liebsten die gesamte Welt teilen. Die perfekten Partner sind angeblich Menschen in den Sternzeichen des Fisch, Schützen, der Waage oder des Zwillings. Eines genügt, Fritz ist Fisch.
Ein Dorf, das man mit einer Lupe auf der Landkarte suchen muss. Ein eingemeindeter Vorort des Kleinstädtchens. Aber Dorf bleibt eben Dorf.
Großstadtkind wandelt sich zum Landei.
Natürlich ist ihre Heimatstadt momentan in weiten Teilen in Schutt und Asche gelegt, aber sie wird wieder entstehen. Auferstehen aus Schutt und Asche. Zu neuem Leben erwachen. Ebenso wie andere Städte mit diesem Schicksal. Dem Schicksal jedes Krieges.
Zu groß ist die Energie und der Mut der Menschen zum Wiederaufbau und Neuanfang und bei aller schweren Not dominiert trotzdem die Freude, dass diese Schreckenszeit endlich vorbei ist. Befreit von der Naziherrschaft. Nicht nur dort, in allen Städten mit diesem Schicksal ist das so. Aber eben auch dort.
Amor hat ja bereits gnadenlos zugeschlagen. Er hat es geschafft, eine junge Frau zu so einen Schritt, einen Schritt ins Unbekannte, zu überreden. In eine völlig andere Welt, eine Welt mit vielen Fragezeichen. Amor hat ihr in ihr Herz geflüstert, <geh doch einfach, du schaffst das schon, pack deine Koffer>.
Nie war sie vorher dort, nie hat sie vorher gesehen wie es dort aussieht. Es gibt keine Bilder. Was sind es für Menschen, die dort wohnen? Rund 500 Kilometer entfernt von ihrer Heimatstadt.
Und sie tut es trotzdem. Ohne jeden Zwang und ohne familiäre Klammergriffe und Verhinderungsversuche. Erstaunlich und mutig.
Wenn es nur ein Koffer wäre, vollgestopft mit Klamotten und etwas Kleinkram, kleine Erinnerungen an zu Hause. Nein, es ist mehr, viel mehr. Sehr viel mehr.
Spätsommer 1945. Endstation in einer damals unbedeutenden Kleinstadt, rund 60 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt, aber mit einem eigenen Bahnhof. Warum endet hier der Zug, in dem diese junge Frau sitzt? Warum ausgerechnet hier? Warum ist er nicht weiter gefahren zum eigentlichen Ziel?
Es ist das heillose Durcheinander in dieser Zeit. Eine Zeit, in der das Ende doch noch nicht so richtig zu Ende ist und ein Neuanfang noch nicht funktioniert.
Erstaunlich aber ist, dass überhaupt so etwas wie ein Zug fährt.
Die schwarzhaarige Wienerin ist nicht allein. Nein, nicht mit einem zufälligen Begleiter oder einer Begleiterin, einer Mitreisenden, die ebenfalls auf dem Weg in eine unbekannte Zukunft unterwegs ist.
Nein, ihre Begleitung besteht aus einer stattlichen Anzahl von Möbeln und Hausrat. Und die sind in einen Viehwaggon verladen. Vermutlich hat sie sich gesagt, wenn ich schon aufs Land ziehe, dann nur mit meinen Möbeln. Niemals ohne meine Möbel. Wer weiß, ob die dort überhaupt welche haben? In diesem Dorf. Und wenn schon auf einen Bauernhof, dann ist ein Waggon, in dem sonst Kühe oder Schweine transportiert werden, genau das Richtige. Dann habe ich wenigstens schon mal die Landluft in meiner Großstadtnase.
Diese Möbelstücke in Wien aus der Wohnung zum Bahnhof zu bringen, gleicht einem kleinen Kunststück. Aber nichts ist unmöglich und organisieren ist an der Tagesordnung.
Eine Gabe, die das Überleben sichert.
Also gut, Mimi, das Großstadtkind, offiziell im Pass natürlich Rudolfine Leopoldine, sitzt mit ihren Möbeln in dieser für sie absolut unbekannten Kleinstadt fest und weiß nicht, wie diese Ladung zu ihrem neuen Wohnort kommen soll.
Sie kommt sich vor wie Auswanderer im 18. Jahrhundert, die in das für sie unbekannte Amerika übersiedelten. Prärie. Weites Land. Fremde Sprache. Kein Plan. Alles unbekannt. Neuanfang mit vielen Unbekannten.