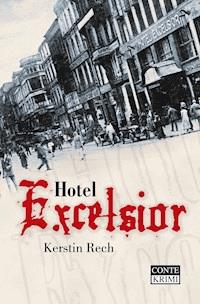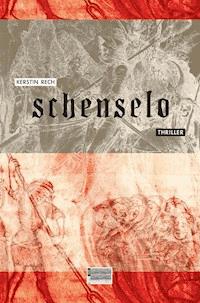Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle hundert Jahre darf zu Sankt Martin ein Mühlweiler aus dem Jenseits zurückkehren und sich an dem rächen, der für seinen Tod verantwortlich ist. Fast zwangsläufi g gibt es in diesem Jahr somit einen Mord aufzuklären. Doch die Dorfbewohner sind der Meinung, der Täter weile längst im Jenseits. Wird Hauptkommissar Gerber aus Blieskastel weltliche Gründe und einen reellen Mörder finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
- Prolog -
Sie ist tot. Der Herr sei ihrer Seele gnädig. Und der Herr stehe auch euch bei, denn es trägt jemand aus diesem Hause Schuld an ihrem Tod. Und sie weiß das. Und sie wird wollen, dass jemand nachstirbt.
HoltdieFlaschemitdemBranntweinausdemSchrankunddieGläserundsetzteuchzumir.Undnunhörtmirzu.
Sogleich müsst ihr die Fenster öffnen, sonst kann ihre Seele nicht hinausfliegen. Wenn die Seele hinausgeflogen ist, müssen Augen und Mund verschlossen und das Gesicht mit einem Tuch bedeckt werden. Die Tote muss ihre Ruhe finden und daran gehindert werden, jemanden nachzuholen.
Hier in diesem Haus darf heute Nacht niemand schlafen. Wer hier schläft, stirbt nach.
Stellt geweihte Kerzen auf! Unbedingt. Sie dürfen nicht verlöschen. Wenn sie verlöschen, stirbt jemand nach.
Alle Spiegel müssen verhängt oder umgedreht werden. Wenn die Seele sich spiegelt, erschrickt sie und es stirbt jemand nach.
Näht ihr Totenhemd einen Abend bevor sie zu Grabe getragen wird und betet für ihre Seele. Wenn ihr Totenhemd zu früh genäht wird, stirbt jemand nach.
Wenn sie dann unter der Erde liegt, besprengt ihr Grab mit Weihwasser, stellt ein Grabkreuz auf und lasst die Glocken läuten, damit sie ihre Ruhe findet und nicht wiederkommt.
Bedenkt auch, es ist nicht gut, wenn man zu viel von der Toten spricht oder ihren Tod zu sehr beklagt. Damit könnte man sie zurückrufen.
Habt ihr das alles getan, ist es gut. Vergesst aber nie, dass der Tag ihres Todes der elfte November ist. Sie ist an einem besonderen Tag gestorben. Der elfte November ist nämlich der Tag des Heiligen, den wir Sankt Martin nennen. Sankt Martin ist sehr mächtig. Er ist einer der Mächtigsten in Gottes Heerschar und er vermag viel. Oh, glaubt mir, er vermag sehr viel.
Oh! Ich wage gar nicht daran zu denken. Ich wage gar nicht es auszusprechen. Aber ich muss! Ich muss!
Aber zuvor gebt mir einen Schluck Branntwein.
Gott vergelts euch, ihr lieben Leut. Jetzt ist meine Kehle nicht mehr so trocken.
Kommt näher, damit ich flüstern kann. Noch ist der Pfarrer im Haus und er soll’s nicht hören. Kommt näher und hört mir genau zu: Wenn sie ihn anflehen sollte, dass sie zurückkommen möchte, wenn sie ihn anflehen sollte, an jenem Tag, welcher der hundertste Sankt-Martins-Tag sein wird, kann er ihr diesen Wunsch erfüllen. Und dann und dann, gnade euch Gott, dann wird sie jemanden nachholen. Und es wird auf unnatürliche Weise sein und keiner im Dorf wird je wieder froh werden. Jedem in Mühlweiler wird die schreckliche Erkenntnis offenbar werden, dass die Pforte, die ins Jenseits führt, von beiden Seiten aus durchschritten werden kann. Welch grauenhafte Vorstellung! Und an diesem Tag wird Angst herrschen in Mühlweiler. Angst vor denen da drüben, die wütend sind, weil sie tot sind und weil ihr lebt. Die so voller Neid sind, weil sie keine Wärme mehr spüren können. Sie werden euch quälen und so viele wie nur möglich zu sich hinüberziehen. Also betet zu dem Heiligen Martin, auf dass er sie nicht erhört. Betet! Betet!
Aber überlegt auch, dass keiner der Seligen und der Heiligen so viel Macht besitzt wie Sankt Martin. Und vergesst nie euch zu fragen, woher diese Macht kommt. Kommt sie allein von unserem Herrn? Oder steckt vielleicht der Leibhaftige dahinter? Und zu wem betet ihr dann?
Gebt mir noch einen Schluck Branntwein. Lasst gleich die ganze Flasche hier bei mir, damit Gott es euch vergelt und damit heute Nacht keiner nachstirbt. Auch nicht das Kind. Trinkt noch ein Glas und betet, dass das Kind nicht nachstirbt. Wenigstens nicht heute Nacht. Nicht heute Nacht! Damit nicht beide zum elften November sterben. Tut es mir nach, trinkt und betet. Mehr können wir nicht tun.
- I -
Alexandra saß auf dem Boden der alten Scheune. Sie hatte die Beine bis zum Kinn angezogen und die Arme fest darum geschlungen. Durch jede Ritze des Gebälks kroch die kalte, feuchte Morgenluft. Sie fror, aber sie wollte hier bleiben. Sie wollte hier sitzen bleiben, bis dieser Tag vorüber wäre. Sie schaute durch die Öffnung, durch die man früher das Heu hochgezogen und eingelagert hatte, hinüber zum Dorf, das auf der anderen Seite der so genannten Gnadenwiese lag.
Sie sah den verbliebenen Fetzen des frühmorgendlichen Novembernebels nach, die langsam über die feuchte Wiese zogen. Zarte Gebilde, die beim Dahintreiben immer mehr zerfaserten, bis nichts mehr von ihnen übrig bliebe und sie nur noch Tau auf den Gräsern wären. Sie mussten diesen verfluchten Martinstag, den elften November, nicht miterleben wie sie. Einfach nicht mehr da sein, dachte sie wie jedes Jahr an diesem Tag.
Könnte sie doch auch zu Tau werden oder besser, zu Asche. Zu grauer Asche, die der Wind in alle Richtungen verwehen würde.
In alle Richtungen?, grübelte sie. Geht das überhaupt, dass der Wind in alle Richtungen gleichzeitig bläst?
Wen könnte sie fragen?
Ihre Lehrer?
Würden die ihre Frage überhaupt verstehen?
Ihren Vater?
Der würde sie, je nach Stimmungslage, entweder mit leeren Augen anglotzen oder sie wüst beschimpfen.
Tante Gerlinde?
Onkel Oskar?
Die würden sich nur Sorgen machen, was sie jetzt wieder im Schilde führte.
Ihre große Schwester Karoline?
Die konnte ihr gestohlen bleiben. Und das bis zum jüngsten Tag.
Wenn er doch nur schon vorbei wäre, dieser elfte November. Aber es war noch viel zu früh. Der Tag hatte gerade erst begonnen, und es würden noch viele lange Stunden vergehen. Es war gerade mal eine halbe Stunde her, da hatte sie mit ihrem Vater zusammen in der ungeheizten, hässlichen Küche gefrühstückt, und er hatte ihr einen Zehn-Euro-Schein über den Tisch zugeschoben.
Zehn Euro! So viel hatte er ihr noch nie gegeben. Bestimmt war es ein Versehen gewesen.
»Zum Geburtstag«, hatte er gemurmelt, ohne sie anzusehen. Und nach Schnaps hatte er gerochen. Und nach Zigaretten. Nach fauligen Zähnen. Und nach alt und ungewaschen. Wie immer.
»Danke«, hatte sie leise gesagt, das Geld eingesteckt, war aufgestanden und grußlos aus dem Haus gegangen. Mit gesenktem Kopf durch das Dorf gelaufen. Über die Gnadenwiese. Zu der Scheune, die seit ewigen Zeiten vonniemandem mehr genutzt wurde, außer von ihr. Hier war der Ort, an dem sie allein sein konnte. Wenn sie wollte. Und sie wollte oft mit sich allein sein.
Verstockt sei sie, sagten die Leute.
Eine blöde Kuh, sagten ihre Mitschüler.
Eine Mörderin, sagten … Nein, sie sagten es nicht, die Mühlweiler, aber sie dachten es. Alle im Dorf dachten es. Sie spürte es tagtäglich an den Blicken, mit denen sie sie aus den Augenwinkeln heraus belauerten. Sogar Onkel Oskar und Tante Gerlinde, die Schwester ihrer toten Mutter, hielten sie heimlich für eine Mörderin und betrachteten sie voller Argwohn.
Was erwarteten sie alle von ihr? Was befürchteten sie? Dass sie immer weiter morden würde? In irgendjemanden hineinkriechen würde, wie sie in ihrer Mutter drinnen gewesen war, und dann morden? Wie sollte das überhaupt gehen?
Wie genau hatte sie eigentlich ihre Mutter getötet? Das hatte ihr bisher noch keiner sagen können. Auch Tante Gerlinde nicht. Hatte sie ihre Mutter von innen her aufgefressen?
Wenn es sich Alexandra recht überlegte, war Tante Gerlinde sogar die Schlimmste von allen. Sie tat immer so freundlich und fürsorglich. Achtete darauf, dass sie regelmäßig Gemüse und andere gesunde Sachen aß, schaute immer wieder im Haus bei ihr und ihrem Vater vorbei. Putzte, wenn es allzu schmutzig war und nahm ihre Kleider zum Waschen und Bügeln mit zu sich nach Hause. Aber die Blicke, von denen Tante Gerlinde glaubte, sie bemerke sie nicht, waren misstrauisch und lauernd. Wie sehr musste Tante Gerlinde sie hassen, dass sie all das Gute tat, nur um sie und ihren Vater noch schlechter, noch erbärmlicher aussehen zu lassen.
»Wie schlampig die Kleine herumläuft«, hieß es …
»Ja, wenn die Mutter fehlt. Und die arme Gerlinde tut, was sie kann«, hieß es …
»Dieser versoffene Vogelsang ist eine Schande für unser Dorf! Wir wären alle besser dran ohne die Vogelsangs«, hieß es im ganzen Dorf.
Alle waren böse und gegen sie.
»Dann bringt uns doch um, wenn ihr euch traut«, murmelte Alexandra traurig. »Bring du uns doch um, Tante Gerlinde. Misch doch einfach Rattengift in deinen Wirsingauflauf, den du so gerne zu uns rüber bringst. »Damit das Kind ein paar Vitamine kriegt«, äffte sie ihre Tante nach.
Tante Gerlinde kann mich ruhig hassen. Ich hasse sie genauso, wie ich Karoline hasse, die mir auch die Schuld am Tod unserer Mutter gibt und der es am liebsten wäre, wenn Papa und ich auch tot wären. Einfach abgehauen ist sie und hat sich nicht mehr um mich gekümmert. Genau an ihrem achtzehnten Geburtstag hat sie ihre Sachen gepackt und ist abgehauen. Und ich war so doof und habe ihr noch ein Geburtstagsgeschenk gebastelt. Das hat sie nicht mal angesehen. Nur weg von uns wollte sie. Die blöde Kuh! Sie braucht auch gar nicht mehr wiederkommen!
Sie schlug mit der Faust auf den Boden und schautetrotzig hinüber zum Dorf.
Die Nebelfetzen über der Gnadenwiese waren verschwunden. Die Sonne ließ sich hinter den dünnen Schleierwolken mehr erahnen als sehen und machte den Tag auch nicht freundlicher.
Aus der Richtung des Hofes des Bauern Alfred Rost, des reichsten Bauern der Gegend, hörte sie Getrappel. Kurz darauf sah sie ihn auf einem seiner Pferde heranreiten. Er ritt an der alten Scheune vorbei, über die Gnadenwiese auf Mühlweiler zu.
Also ging es schon los mit den Vorbereitungen. Das Pferd würde von Rost vor der Kirche angebunden werden und alle Kinder im Dorf würden es bestaunen, als hätten sie noch nie in ihrem Leben ein Pferd gesehen.
»Das Sankt-Martins-Pferd! Das Sankt-Martins-Pferd!«, würden sie rufen. So was Blödes. So was Kindisches.
Alexandra rümpfte die Nase. Nein, zu diesen Blöden wollte sie nicht gehören.
WarummusstegeradeSanktMartininMühlweilersogroßgefeiertwerden?,dachtesiewütendundverzweifelt.DieKinderbekamenschulfrei,dieberufstätigenErwachsenennahmensicheinenTagUrlaub.DasDorfwurdegeschmückt,eswurdenKuchengebackenundGlühweinundKinderpunschgebraut.UndamAbendspieltendanndieMitgliederderFreiwilligenFeuerwehrMühlweilerdieberühmteSzenenach,inderBischofMartindesWegesgerittenkommtundeinemfrierendenBettlerdieHälfteseinesMantelsreicht.
Die Rolle des Bettlers übernahm in diesem Jahr ihr Vater. Sie genierte sich deswegen und es war ein weiterer Grund für sie, nicht zu dem Dorffest zu gehen. Nach dem kleinen Schauspiel würde es einen Umzug geben, bei dem Sankt Martin durch das ganze Dorf reitet, gefolgt von den Kindern mit ihren Laternen.
» Ich geh mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir …«,
begann sie abfällig zu singen, so wie es ihr Vater sang, wenn er betrunken war. Ihr fiel nicht auf, dass ihre Stimme mit jedem Satz kindlicher wurde, immer sehnsüchtiger nach Kindheit.
» … Im Himmel da leuchten die Sterne
Und hier unten da leuchten wir
Mein Licht ist aus
Ich geh nach Haus
Rabimmel, rabammel, rabumm
Ein Lichtermeer zu Martins Ehr
Rabimmel, rabammel, rabumm«
Und das ganze Brimborium, weil Sankt Martin war, der elfte November, ihr Geburtstag und der Todestag ihrer Mutter – deren Leben endete, als ihr Leben begann und die sie auf dem Gewissen hatte.
Sie griff in die Tasche ihrer Jacke und holte ein Feuerzeug heraus, auf dem ein Totenkopf abgebildet war. Ein älterer Mitschüler aus der siebten Klasse hatte es ihr mit der Bemerkung geschenkt, das würde gut zu ihr passen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihn gut leiden können, hatte sich sogar auf dem Sommerfest der Schule ein bisschen in ihn verliebt. Aber als er das zu ihr gesagt hatte, fing sie an ihn zu hassen. Trotzdem hatte sie das Feuerzeug mit dem Totenkopf darauf von ihm angenommen. Es sollte sie daran erinnern, dass man besser niemanden mögen sollte. Keine Mitschüler und auch sonst niemanden.
Sie schob ein paar herumliegende Heuhalme zu einem kleinen Scheiterhaufen zusammen. Das Heu war feucht. Sie hielt das brennende Feuerzeug daran. Aber, wie sie schon vermutet hatte, ließ sich der kleine Scheiterhaufen nicht entflammen. Enttäuscht ließ sie die Schultern hängen und legte sich flach auf den Bauch. Sie vergrub ihr Gesicht in den Armen und atmete tief ein. Das feuchte Holz und das feuchte Heu rochen so gut. So echt.
Sie stellte sich vor, sie läge in einem Sarg und diese Vorstellung fand sie gar nicht gruselig.
- 2 -
Alexandra schreckte auf. War sie kurz eingeschlafen? Sie hatte gar nicht gemerkt, dass jemand gekommen war. Jetzt hörte sie jemanden lachen. Da musste ein Mädchen sein. Direkt vor der Scheune. Sie robbte vorsichtig bis zu dem Ausguck vor und schaute hinunter.
Tatsächlich, dort unten saß Svenja Schröder auf einem Stapel alter Bretter. Alexandra kannte sie nicht besonders gut, denn Svenja war schon dreizehn und damit für sie fast schon eine andere Generation. Sie wusste aber, dass sie an der Schule in der Theatergruppe war. Zwar nur mit mäßigem Erfolg, aber dennoch hielt sie sich für die Beste von allen.
Neben Svenja saß Florian, der Sohn vom Bauern Rost.
Er legte Svenja den Arm um die Schultern und versuchte sie an sich zu ziehen. Er schien sehr nervös zu sein.
Er will sie bestimmt küssen, dachte Alexandra und unterdrückte ein Kichern.
Svenja schupste ihn weg. Florian rutschte seitlich vom Stapel und landete auf dem Boden.
»Du bist blöd!«, lachte Svenja.
»Ich bin nur ausgerutscht.«
»Mit dem Hintern auf dem Holz?«
Florian ging nicht auf die Frage ein und setzte sich wieder neben sie.
»Mir ist langweilig mit dir!« Sie wollte aufstehen, aber Florian hielt sie am Arm fest.
»Warte doch! Wir sind doch gerade erst gekommen.«
»He! Lass mich los, du Idiot!«
»Warum bist du denn überhaupt mit mir hierher gekommen, wenn du gleich wieder gehen willst?«
»Weil du so gebettelt hast, dass du mal mit mir allein sein willst! Und ich dachte, wenn ich dir mal nachgebe, gibst du endlich Ruhe! Du Idiot!«
»Sag nicht immer Idiot zu mir! Ich bin kein Idiot!«
»Pah!« Sie stand auf und schaute auf ihn herab.
»Ich bin kein Idiot. Ich weiß mehr als alle anderen. Ich weiß als Einziger, was heute passieren wird. Und das wird megabrutal!«
»Was denn?« Neugierig geworden setzte sie sich wieder neben ihn. »Hast du etwas vor?«
»Heute ist St. Martin.«
»Mensch Florian! Du bist ein doppelter Idiot! Das weiß doch jedes Kind. Mühlweiler und der alle Jahre wieder Martinstag. Das ist doch öde. Und es wird von Jahr zu Jahr öder.«
»Aber dieses Jahr wird es nicht wie alle Jahre wieder sein. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr.«
»Und warum sollte das so sein?« Svenja zog einen Kaugummistreifen aus ihrer Jackentasche, wickelte ihn aus und schob ihn in den Mund. Das Papier schnippte sie in Florians Richtung. Es traf ihn an der Nase. Er tat so, als bemerke er es nicht.
»Weil es mir die alte Dobel erzählt hat, als sie mal zur Erntezeit bei uns auf dem Hof war. Ich habe es gehört. Und die alte Dobel kannte sich aus in solchen Sachen. Sie hat auch Kräuter gesammelt und solche Sachen.«
»Ja, solche Sachen, solche Sachen! Die alte Dobel ist schon lange tot.«
»So lange auch wieder nicht. Drei Jahre oder so.«
»Pah! Und? Was interessiert mich die alte Dobel? Sie war doch nur eine alte Hexe, die immer irgendwelche Gruselgeschichten erzählt hat. Aber niemanden hat es je interessiert. Sie hat nur genervt.«
»Nein, das hatte nichts damit zu tun, dass sie genervt hat. Die Mühlweiler hatten alle Angst vor ihr, weil sie wussten, dass ihre Geschichten wahr waren. Vielleicht nicht alle, aber zumindest die meisten.«
Svenja lachte und Florian wurde unsicher.
»Okay«, gab er klein bei, »wenn nicht die meisten, dann aber wenigstens ein paar. Ein paar von ihren Geschichten waren schon wahr.«
Svenja rollte gelangweilt mit den Augen. »Mir doch egal. Hast du Zigaretten?«
»Nein, aber ich kann dir nachher welche besorgen. Ich habe nämlich extra Taschengeld von meinem Vater bekommen, weil ich heute Abend den Sankt Martin spiele.«
»Du? Du siehst doch noch gar nicht aus wie ein Sankt Martin.«
»Wie sieht denn ein Sankt Martin deiner Meinung nach aus?«
»Wie ein Mann eben.«
»Und wie sehe ich aus?«, fragte er zögerlich.
»Willst du das wirklich wissen?«
Florian nickte und schluckte.
»Du siehst aus wie Goofy!«
»Man sieht mich ja gar nicht richtig. Ich trage nämlich eine Ritterrüstung«, sagte er und hoffte, dass sie nicht merken würde, wie sehr sie ihn mit ihrer Bemerkung getroffen hatte.
»So eine Rüstung ist doch viel zu schwer, damit klappst du doch zusammen, du dürrer Goofy!«
»Sie ist aus Pappe.«
»Aus Pappe? Ha! Das ist ja witzig. Kein anderer Sankt Martin vor dir hat je eine Rüstung getragen und schon gar keine aus Pappe.« Sie lachte.
»Und wenn schon! Es ist doch nur symbolisch.« Er knetete verlegen seine Hände. »Außerdem musst du auch an das Pferd denken. Ein Mann mit einer richtigen Rüstung ist doch schwerer als einer mit einer Rüstung aus Pappe.«
»Mir egal, ob sie aus Pappe ist oder aus sonst was. Und dein Taschengeld kannst du dir sonst wohin stecken. Ich will jetzt eine verdammte Zigarette rauchen. Jetzt! Kapiert?« Svenja stand wieder auf. »Und warum der Sankt-Martin-Mist dieses Jahr etwas Besonderes sein soll, hast du auch noch nicht gesagt.«
»Das ist gar nicht so einfach zu erklären.« Florian rang mit den Worten.
Svenja kaute laut auf ihrem Kaugummi und schaute gelangweilt auf ihn herunter.
»Heute, genau heute wird jemand sterben! Garantiert!«, sagte Florian hastig und übergangslos. Und wie so oft in seinem Leben, wusste er nicht wohin mit seinen Händen.
»Wer?Jemanddenichkenne?JemandausunsererKlasse?OderirgendwerirgendwoaufderWelt?Dasgiltdannabernicht.WeilnämlichimmerirgendwoaufderWeltirgendwerstirbt.«
»Das sage ich dir erst, wenn ich dich küssen darf«, antwortete er und war selbst erstaunt über seine plötzliche Kühnheit.
Svenja zuckte mit den Schultern, setzte sich wieder neben ihn, nahm ihr Kaugummi aus dem Mund und wandte ihm ihr Gesicht zu.
FlorianriebsichanseinerHosedieschweißnassenHandflächentrocken,nahmihrGesichtinbeideHändeundschobihrseineZungezwischendieZähne.Erhoffte,dasserallesrichtigmachteundsienichtanfangenwürdezulachen.
Svenja lachte nicht, aber nachdem sie genug davon hatte, schupste sie ihn von sich weg und steckte ihren Kaugummi wieder in den Mund.
»Also los, sag jetzt, wer heute stirbt! Oder darf ich mir jemanden aussuchen?«
»Aussuchen? Nein, das geht nicht«, antwortete Florian, noch ganz benommen von dem Kuss.
»Wäre auch zu schön gewesen. Ich denke die meisten in Mühlweiler würden wollen, dass der widerliche Vogelsang krepiert.« Sie hielt kurz inne und überlegte. »Nein, das wäre gar nicht so gut. Wen könnte man dann verarschen?« Sie lachte und Florian lachte schüchtern mit. »Also jetzt sag schon, du Langweiler, wer stirbt heute?«
»Eigentlich weiß ich das nicht so genau.«
Svenja versetzte ihm einen heftigen Schlag gegen die Schulter und sprang auf.
»Du hast mich angelogen! Du wolltest nur einen Kuss! Und ich sage dir, dich zu küssen ist ekelig! Ich glaube, ich muss gleich kotzen!«
Demonstrativ spuckte sie ihm ihren Kaugummi vor die Füße.
»Hör doch zu!«, rief er verzweifelt, aber sie stapfte beleidigt davon.
»Warte doch! Ich erzähle dir die ganze Geschichte.«
Sie hob, ohne sich umzudrehen, die Hand und zeigte ihm den Mittelfinger.
»ImviertenJahrhundertzogMartinvonToursdurchdieLandeundtatGutes.WiezumBeispielmitdemMantel,denerteilteundvondemerdieeineHälftedemBettlergab!«,rieferihrhinterher.»UnderkamauchdurchMühlweiler!UndhiererweckteereinenTotenzumLeben!IneinemHaus,woheutedieKirchesteht!HörstduSvenja?ErerweckteeinenTotenzumLeben!UndderTotehatsichdannandemgerächt,derfürseinenTodverantwortlichwar!«
Florian stand auf, formte seine Hände zu einem Trichter und rief ihr weiter hinterher: »Und alle hundert Jahre, so geht die Legende weiter, an Sankt Martin darf ein Toter aus Mühlweiler nach Mühlweiler zurückkommen und sich an dem rächen, der für seinen Tod verantwortlich ist! Heute kann es ganz schön blutig werden! Ist doch irre, oder? Und das Beste ist, der Tote braucht es nicht einmal selbst zu tun, er kann auch einen Lebenden damit beauftragen. Und der darf den Auftrag nicht ablehnen!«
Florian schaute ihr nach, wie sie unbeeindruckt weiterging. Er steckte die Hände in die Hosentaschen, drehte sich enttäuscht zur Scheune um und sagte leise: »Und dieses Jahr wird es wieder so weit sein. Die hundert Jahre sind um.«
»Wenn heute Nacht keiner stirbt in diesem Kaff, darfst du mich nie wieder küssen und auch sonst nichts machen!«
Florian drehte sich um. Svenja stand mitten auf der Gnadenwiese und wiegte sich, wie sie es wahrscheinlich im Fernsehen gesehen hatte, lasziv in den Hüften.
»Es wird jemand sterben. Ganz sicher. Ich verspreche es dir.«
Svenja lachte ihn aus und setzte ihren Weg zurück ins Dorf fort, ohne sich noch einmal nach ihm umzusehen.
Und Florian dachte, was rede ich denn da? Wie soll ich denn dieses Versprechen halten? Wenn heute Nacht niemand von sich aus stirbt, müsste ich ja jemanden umbringen. Oder Svenja würde mich vor allen lächerlich machen und würde sich nie in mich verlieben. Das wäre schrecklich.
Einen Augenblick dachte er sogardaran, sichselbst umzubringen. Dann hätte er Recht gehabt und würde nicht als Idiot dastehen, und gleichzeitig hätte er seinem Vater wieder eins ausgewischt.
Sich selber umbringen? Nein. Das würde er nicht tun. Das könnte er nicht.
Wäre er denn überhaupt im Stande, jemand anderen umzubringen? Ja, natürlich, er war ja kein Feigling. Er musste auch nicht lange überlegen, wer das sein könnte. Es gab in Mühlweiler einen Menschen, den er hasste und den er umbringen könnte. Und damit würde er vielen sogar einen Gefallen tun, denn niemand im Dorf konnte Werner Vogelsang leiden.
Er ballte die Fäuste und ließ den Hass in sich hochsteigen. Und während er wütend davonstapfte, kochte sein Blut so heiß, dass er das Gefühl hatte, sein Kopf würde platzen.
Jemand in Mühlweiler wird heute Nacht sterben, hatte Florian gesagt.
Alexandra sah ihm traurig nach. Seine Geschichte hatte ihr Angst eingejagt und sie hatte aufsteigende Tränen unterdrücken müssen.
Jemand?
Sie!
Ich bin die Einzige im Dorf, die Schuld am Tod eines anderen Menschen ist. Meine Mutter wird zurückkommen und sich an mir rächen! Obwohl ich es nicht mit Absicht getan habe. Ich war ja noch so klein!
Sie wartete noch, bis Florian außer Sicht war, dann stand sie auf und kletterte langsam die Leiter hinunter.
Als sie unten das schwere Tor hinter sich zuschob, wusste sie, dass sie ihre geliebte Scheune nie mehr betreten würde, dass sie heute zum letzten Mal über die Gnadenwiese auf Mühlweiler zulaufen und dass sich dort heute Abend ihr Schicksal erfüllen würde.
- 3 -
Die Sankt-Martins-Kirche, erbaut im achtzehnten Jahrhundert, war eine mit Anleihen an den Spätbarock erbaute Saalkirche. Der Zwiebelturm mit der Welschen Haube ragte hoch in den Himmel.
Im Innern der Kirche hatte Pfarrer Peck die Gemeinde um sich versammelt und hielt seine Sankt-Martin-Predigt, in der er zur Nächstenliebe aufrief.
Auf dem Kirchenvorplatz richteten derweil die freiwilligen Helfer die Tische und Bänke her und heizten dem alten Glühweinofen tüchtig ein.
Der Martinstag, der sich bislang so grau präsentiert hatte, wie man es von einem Novembertag erwartete, verabschiedete sich plötzlich am Westhimmel in grandiosen Farben von Rot, Orange und Türkis. Doch niemanden in Mühlweiler, der an dem Sankt-Martins-Fest teilnahm, interessierte das meteorologische Schauspiel. Sie alle warteten auf die Dunkelheit, die für die passende Stimmung zum traditionsreichen Schauspiel notwendig war, das gleich beginnen würde.
Aus der Kirche drang das Lied, das, wie jedes Jahr am elften November, die Messe beendete:
»St. Martin, St. Martin
St. Martin ritt durch Schnee und Wind
Sein Ross, das trug ihn fort geschwind
St. Martin ritt mit leichtem Mut
Sein Mantel deckt ihn warm und gut
Im Schnee saß, im Schnee saß
Im Schnee da saß ein armer Mann
Hat Kleider nicht, hat Lumpen an
O helft mir doch in meiner Not
sonst ist der bittre Frost mein Tod
St. Martin, St. Martin
St. Martin zieht die Zügel an
sein Ross steht still beim armen Mann
St. Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt
St. Martin, St. Martin
St. Martin gibt den halben still
Der Bettler rasch ihm danken will
St. Martin aber ritt in Eil’
Hinweg mit seinem Mantelteil«
Dann begannen die Kirchenglocken zu läuten. Gleich würde die Gemeinde aus der Kirche kommen, allen voran die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen.
Auf dem Kirchplatz zündeten die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr ihre Fackeln an. Der Spielmannszug stellte sich in Position. Das Sankt-Martins-Pferd, ein Brauner mit weißer Blässe, scharrte nervös mit den Hufen und ließ ein paar Pferdeäpfel auf das Kopfsteinpflaster fallen.
Alfred Rost zog den Braunen fester an den Zügeln und zischte: »Verdammtes Mistvieh!«
»Kann ja mal passieren. Der arme Gaul steht hier ja auch schon seit heute morgen«, sagte Isidor, der alte Knecht vom Rost, zu dessen Aufgaben es gehörte, mit Besen, Schaufel und Blecheimer bereit zu stehen, um Voraussehbares solcher Art sofort zu beseitigen.
»Weil es die Tradition so will. Frag mich, wer von den Alten sich so einen Mist ausgedacht hat, dass der Gaul den ganzen Tag vor der Kirche stehen muss.«
»Da hast du Recht, Bauer, das ist wirklich Mist. Aber war es nicht dein Großvater, der das eingeführt hat?«, entgegnete Isidor grinsend, während er die Pferdeäpfel auf die Schaufel kehrte.
Rost machte ein wütendes Gesicht und trat verächtlich gegen den Eimer, in den Isidor gerade die Pferdeäpfel kippen wollte.
»Die alte Dobel hat immer gesagt, diesen Brauch hätte dein Großvater eingeführt, damit er den Gaul nicht einen ganzen Tag lang selber füttern musste.«
Isidors meckerndes Lachen wurde von einem weiteren Tritt des Bauern, dieses Mal in Isidors Hintern, jäh beendet.
»Wo ist denn der Florian? Er muss doch auf dem Pferd sitzen, wenn die Feierlichkeiten losgehen. Oder spielt ein anderer den Martin?«, fragte Oskar Peschl, der neben Rost stand und leicht verärgert dessen unflätigesBenehmen beobachtete.
Da die Mühlweiler Freiwillige Feuerwehr seit Alters her den Sankt-Martins-Tag veranstaltete und Oskar, neben seinem Amt des Gemeindevorstehers, der verantwortliche Feuerwehrhauptmann von Mühlweiler war, fühlte er sich für den reibungslosen Ablauf und nicht zuletzt auch für den festlichen Rahmen der Veranstaltung verantwortlich. Und dazu gehörte, dass man ordentlich angezogen war und vor allem, dass man sich ordentlich benahm.
»Keine Ahnung wo er ist. Er wird schon kommen.«
Wollen wir’s hoffen, dachte Oskar und gab dem Führer des Spielmannszugs ein Zeichen, dass sie noch einen Moment mit der Musik warten sollten.
»Wahrscheinlich geht ihm der Arsch auf Grundeis und er hockt auf dem Klo.«
Oskar schaute Rost missbilligend an. Wie konnte man nur so abfällig über sein eigen Fleisch und Blut reden.
»Dein Junge ist schon in Ordnung, so wie er ist, Alfred«, sagte Oskar und streichelte den Hals des Pferdes, das mit einem nervösen Herumwerfen des Kopfes reagierte. Erschrocken zog er seine Hand zurück.
»UndwobleibtdeinversoffenerSchwager?«,fragteRost.»WahrscheinlichhockterinderSakristeiundkipptsicheineFlaschehinterdieBinde.DaswarwirklicheinesaublödeIdeevondir,VogelsangdenBettlerspielenzulassen,HerrFeuerwehrhauptmann.«
Oskar drückte sich vor der Antwort. Rost hatte ja Recht. Sein Schwager sollte schon längst als Bettler an der Kirchenwand kauern und elend dreinblicken, um dann auf ein Zeichen von ihm ganz unterwürfig auf den heiligen Martin hin zu kriechen und zu lamentieren. Da Sankt Martin alias Florian jedoch noch nicht auf seinem Pferd saß, konnte sich auch sein Schwager Vogelsang noch Zeit lassen. Aber hoffentlich, so Oskars Stoßgebet, verkürzt er sich die Wartezeit nicht mit einer Flasche Schnaps.
Er atmete tief durch und ließ seinen Blick langsam über die Szenerie wandern. Die Mühlweiler standen im Halbkreis um den Kirchenvorplatz und nach und nach füllten sich die Reihen so dicht, dass sie Schulter an Schulter standen. Doch niemand, außer Oskar, sah die Neuankömmlinge, die nach der Sitte der vergangenen Jahrhunderte, in denen sie gelebt hatten, gekleidet waren. Nur er konnte sie in diesem Augenblick sehen, jene unsichtbaren Vorfahren, die in den vergangenen Zeiten hier das Fest des Heiligen Martin gefeiert hatten. Es erfüllte ihn mit Stolz, dass diese Tradition noch immer fortlebte und er hoffte, dass die Altvorderen mit dem heutigen Abend zufrieden sein konnten. Sein Phantasiegebilde löste sich langsam auf.
Oskar wandte sich Rost zu. »Ich habe vor kurzem eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, da ging es um einen alten Totenkult in Südamerika.«
»Und?«, fragte Rost desinteressiert zurück.
»Da wurden die mumifizierten Ahnen bei jedem großen Fest aus ihren Gräbern geholt und durften mit den Lebenden feiern.«
Rost sah ihn an, als wäre er nicht ganz bei Sinnen.
Isidor legte seine Schaufel neben den Eimer, kam zu Oskar herüber und beäugte ihn ungeniert.
»Merkwürdig, dass du so etwas sagst. Auf so einen Gedanken bist du früher nie gekommen.«
»Ich habe diese Dokumentation auch erst vor ein paar Tagen gesehen, Isidor«, entgegnete Oskar, dem es auf einmal ganz mulmig wurde.
»Du weißt, was heute für ein Tag ist?«, fragte Isidor leise.
»Ja, das weiß ich, Isidor.«
»Alle hundert Jahre.«
»Ammenmärchen von der alten Dobel.«
Isidor kicherte und ging wieder zu seinem Eimer und seiner Schaufel zurück.
»Blödsinn! Alles Blödsinn!«, zischte Rost und Oskar nahm sich vor, zu diesem Thema nichts mehr zu sagen.
Die Kinder, die schon in dem Alter waren, in dem sie es lächerlich fanden eine selbst gebastelte Laterne zu tragen, standen beisammen und schienen sich über irgendetwas köstlich zu amüsieren. Am meisten kicherte Svenja, die Tochter von Hans Schröder, genannt Schröderhans, dem die Metzgerei und die Gaststätte gehörten. Sie deutete zum Nebengebäude der Kirche, das im Dorf nur Silencium hieß, in dem sich, außer der Sakristei, auch eine Küche, eine Toilette, ein Mehrzweckraum sowie eine kleine Nische für stille Gebete befanden, die dem Nebengebäude ursprünglich den Namen gegeben hatte.