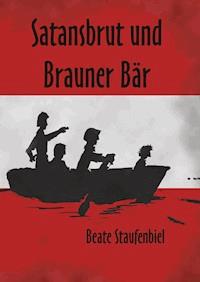
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Hör mir jetzt gut zu: Manchmal ist es besser, vergangene Dinge ruhen zu lassen." Aber Jan hört nicht auf Adrian, den Bäcker. Es ist Sommer 1939: Europa steht kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges. Jan ist 12 und ein begeisterter Hitlerjunge. Da sein Vater vor seiner Geburt bei einem Autounfall gestorben ist, leben Jan und seine Mutter alleine in Berlin. Sie kommen nur mit Mühe über die Runden. Seine Mutter möchte nun heiraten und nach München ziehen. Sie ist schon vorgereist und hat ihn bis zu den Sommerferien bei der Nachbarin gelassen. Jetzt, da Jan einen neuen Vater bekommt, fragt er sich zum ersten Mal in seinem Leben, wie sein richtiger Vater war, und er möchte sein Grab sehen. Seine Mutter hat Jan nie viel erzählt. Er reißt aus und fährt per Anhalter in das kleine Heimatdorf seiner Eltern. In dieser trügerischen ländlichen Idylle stolpert er in ein tödliches Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Roman nach einem Treatment von
Beate Staufenbiel
und
Richard Böhringer
Personen, Orte und Handlungen sind frei erfunden,
der geschichtliche Hintergrund aber leider nicht.
Für meine Eltern, Tanten und Onkel
Ich danke...
...Jürgen Adam und Marlene Müller für besonders aufmerksames Lesen und treffende Korrekturvorschläge
...Monika Heine, Rafaela Langnickel und Eva für das Lesen und Kommentare zur ersten Version
...Richard Böhringer für die detaillierten und ergiebigen Diskussionen und Streitgespräche über die Charaktere und Handlung
Historische Anmerkung
1939
Die Nationalsozialisten sind seit 6 Jahren unter der Führung von Adolf Hitler als Reichskanzler an der Macht. 1933 waren sie durch eine Wahl an die Spitze gelangt und haben systematisch jede Opposition unterbunden und deren Anführer verfolgt, verhaftet oder ermordet.
Die Juden dienen als Sündenbock und werden für alle Probleme verantwortlich gemacht. Durch Drangsalierung und Strafen werden viele zur Auswanderung gedrängt, aber nicht alle bekommen die Erlaubnis, in ein anderes Land einzuwandern. Viele Länder, z.B. die Niederlande oder Frankreich, erweisen sich später als Falle, weil Juden nach dem Einmarsch der deutschen Truppen auch dort verfolgt werden. Menschen, die ihnen helfen, werden ebenfalls bestraft und verhaftet.
Am 9./10. November 1938 wurden jüdische Geschäfte, Synagogen und Wohnungen von der SA und Bürgern zerstört. Diese Nacht wurde wegen der vielen Scherben „Kristallnacht“ genannt, heute „Reichsprogromnacht“.
Das Leben der Kinder wird von der Hitlerjugend (HJ) und dem Bund Deutscher Mädchen bestimmt (BDM). Zuerst war die Teilnahme freiwillig, später Pflicht. Ab dem 10. Lebensjahr kommen Jungen zum Jungvolk. Dort sind sie „Pimpfe“, anschließend folgt die Mitgliedschaft in der HJ. Ziel der Ausbildung ist die Vorbereitung zum Soldaten. Ab dem 18. Lebensjahr folgen der Reichsarbeitsdienst und Reichswehr.
Rede von Hitler am 4.12.1938: „Diese Jugend lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn nun dieser Knabe und dieses Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre, und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS...
… Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben und sie sind glücklich dabei.“
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Nachtrag
1
Unruhig döst Jan eingepfercht zwischen staubigen Kartoffelsäcken auf der Ladefläche eines kleinen, alten Lasters. Sein brauner Ledertornister schaukelt sacht zu seinen Füßen. Die Wolken vom Morgen haben sich verzogen, und nun brennt die Sonne ziemlich unbarmherzig. Aber Juli ist halt Juli. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und hinterlässt einen dünnen Schmierfilm. Auf der sich dahin schlängelnden, schmalen Landstraße reiht sich mit erstaunlicher Regelmäßigkeit ein Schlagloch an das andere, und der Laster steuert jedes einzelne gewissenhaft an. Jedes Mal hüpfen sein Tornister und die Kartoffelsäcke wie auf Kommando in die Höhe. In der Wochenschau hatte Jan viele Männer gesehen, die Hitlers Autobahnen bauten. Für diese enge Straße war wohl nichts mehr übrig gewesen. Wahrscheinlich sind die kleinen Dörfer nicht wichtig genug; Hitler denkt halt an das ganze, große Deutschland. Eine ewige, endlose Straße mit kleinen Dörfern. Hie und da mal ein kleiner Laden. Das ganze erinnert Jan an die billige Perlenkette seiner Mutter. Viel Band, wenige Glasperlen. Keine Juwelen. Die war ein Geschenk von Jans Vater. Jetzt trägt sie sie nicht mehr – nicht seit sie ihren „Neuen“ hat. Der hatte ihr auch was richtig Hübsches geschenkt. „An so einem zauberhaften Hals muss doch etwas Zauberhaftes hängen“, hatte er gesagt. Jan hätte kotzen können.
Hier ist alles tot. Nicht zu vergleichen mit dem quirligen und lärmendem Treiben in seinem Hinterhof in Berlin. Überall gibt es auf den Straßen was zu gucken und Jungen zum Spielen. Wenn er auch in den letzten beiden Jahren wenig Zeit dazu hatte. Jan knallt fest mit dem Kopf an das Führerhaus und verzieht das Gesicht. Er rubbelt sich die schmerzende Stelle und inspiziert seine Hand – blutet nicht. Gut. Wenigstens wird ihm von dem Geschaukel nicht übel. Ihm war mal auf einem Kettenkarussell schlecht geworden und er musste brechen. Das war schon sehr peinlich gewesen. Aber da war er auch noch ein kleiner Junge. Außer dem knatternden Motor des Lasters ist kein anderes Auto zu hören. Endlose Kurven durch sonnenverbrannte Wiesen und Felder. Jan löst das schon gelockerte schwarze Halstuch ganz, wurschtelt sich aus dem kurzen Braunhemd und legt beides und den braunen Lederknoten sorgsam auf den Tornister zu seinem Fahrtenmesser. Er schließt die Augen. Wenn er heute Abend zurückkommt, wird die olle Frau Lenz ganz schön rumzetern. Sie hätte seiner Mutter versprochen auf ihn aufzupassen. Er solle gefälligst dankbarer sein und seiner Mutter nicht dauernd Schwierigkeiten machen. Er solle nicht immer nicht nur an sich denken. Sie würde es seiner Mutter berichten; er solle nur sehen. Soll sie doch. Ihm ist es egal. Der Laster hält mit einem Ruck. Stimmen. Jan reckt sich und versucht neben dem Fahrerhaus die Ursache für ihren Stopp auszumachen.
„Sind wir in Großebardeloh?“, ruft er. Keine Antwort.
Der alte Fahrer schlurft mit einer vierköpfigen Familie mit Koffern zur Ladefläche. Alle sehen etwas zu fein und auf jeden Fall zu warm gekleidet für diese Art der Reise aus. Jan blinzelt in die unsicheren Augen der beiden Kinder. Der Mann gibt dem Fahrer zögernd ein paar Scheine. Ganz schön viel Geld. Wo der Fahrer ihn umsonst mitgenommen hat. Irgendwann nickt der Fahrer leicht und macht die hintere Heckklappe auf. Der Vater hilft zuerst dem Mädchen, dann dem Jungen und schließlich der Frau hoch. Dann schwingt er sich selber hinauf. Der Fahrer spuckt gelangweilt auf die Straße. Die Frau lächelt aufmunternd den Kindern zu und hilft ihnen aus den Jacken. Hübsch ist sie eigentlich, denkt Jan. Der Laster zuckelt unterdessen weiter. Sie macht ihr Kleid an einem Sack schmutzig, aber es scheint sie nicht zu interessieren. Der Junge und das Mädchen, beide höchstens gerade in der Schule, gucken Jan mit großen Augen an, dann sein Hemd und dann den Rest. Jan ist sich der uneingeschränkten Bewunderung der Kurzen sicher. Als der kleine Junge die Hand nach dem Messer ausstreckt, schlägt sie ihm der Vater hart herunter. Der Junge senkt den Kopf und murmelt etwas, aber mehr zu seinem Vater als zu Jan. Jan kraust die Nase. Er mag es nicht, wenn Eltern so offensichtlich etwas gegen die Sache haben. Deshalb nimmt er sein Messer und reicht es dem Jungen.
„Kriegste auch bald.“ Jan lächelt gönnerhaft.
Der Junge nickt langsam und schaut unsicher zu seinem Vater. Der blickt schnell zur Seite und traut sich nicht, unter Jans scharfem Blick irgendetwas zu sagen. Der Junge streicht über die „Blut und Ehre“-Schrift und reicht Jan das Messer vorsichtig zurück. Trotz der Wärme kuschelt er sich an seine Mutter. Die Frau betrachtet Jan ernst. Keiner sagt etwas. Jan wird es zu dumm. Diese Leute haben eine Macke. Er lehnt den Kopf an einen Sack und fällt in einen unruhigen Halbschlaf.
Als Jan die Augen wieder öffnet, steht die Sonne merklich tiefer. Der Junge und das Mädchen vertreiben sich die Zeit mit dem Fadenspiel, bei dem der eine einen Faden zur Schlaufe zusammengebunden zwischen den aufrecht gegenüber gehaltenen Handflächen gespannt hält und der andere mit Daumen und Zeigefingern hinein greift um, den Faden dann möglichst geschickt in veränderter Anordnung zu übernehmen. Jan hat das Spiel noch nie gemocht. Er verheddert sich immer. Die beiden scheinen das oft zu spielen. Jan schiebt sich hoch auf einen Sack. Seine ehemals schwarze kurze Cordhose ist völlig verstaubt und ganz grau. Er entdeckt einen ziemlich breiten Fluss ein Stück weit neben der Straße. Mal ist er hinter einem kleinen Wald verschwunden, und schon in der nächsten Kurve taucht er wieder auf. Das Wasser glitzert fantastisch. Rechts und links vom Fluss stehen einzelne Weiden und kleine Büsche. Dichtes Schilf wechselt mit sandigen Buchten ab. Jan kneift die Augen zu und stellt sich vor, wie er dort am Ufer ins kühle Wasser rennt. Dummerweise wird ihm dadurch erst richtig warm. Er öffnet schnell wieder die Augen. Eine Reihe riesiger Pappeln saust an ihnen vorbei. Jan stellt sich auf, hebt übermütig den rechten Arm und brüllt: „Heil!“ Sofort hat er ein schlechtes Gewissen. Hinter ihm hört er ein glucksendes Geräusch. Der Vater reicht eine Feldflasche herum und verzieht keine Miene. Sogar eine Spur verächtlich sieht er aus. Der soll bloß aufpassen. Jan guckt wieder nach vorn zum Wasser. Unten im Fluss planschen ein Dutzend Kinder. Und wieder schiebt sich ein Wäldchen davor. Jemand zupft an seiner Hose. Es ist der Junge. Er hält ihm lächelnd die Flasche hin. Jan rutscht wieder runter, bedankt sich nickend und nimmt einen Schluck. Dann gibt er dem Jungen die Flasche zurück.
Der Laster zockelt in eine Allee. Schatten flattern nun über sie dahin. Jan zieht sich hoch. Angenehme Luft weht ihm ins Gesicht. Er klopft auf das Führerhaus.
„Ist es noch weit?“, brüllt er gegen den Wind.
Keine Antwort. Vielleicht hat der Fahrer nichts gehört. Er hämmert noch einmal auf das Metall. Der Fahrer rührt sich nicht. Ein Schlagloch wirft Jan auf die Kartoffelsäcke zurück. Langsam drückt seine Blase. Obwohl er eigentlich nur schwitzt. Wenn er allein wäre, würde er das Problem schon lösen. Aber so. Er betrachtet missmutig die Familie. Die Kinder dösen rechts und links im Arm der Mutter; die Erwachsenen haben die Augen geschlossen.
Der Laster schaltet herunter und hält an. Jan rutscht hoch und schaut sich um. Auch die Familie wird munter. Ein kleines Dorf ist neben der Straße aufgetaucht.
Der Fahrer lehnt sich halb aus dem Fenster. „Großebardeloh!“
Jan dreht sich höflich zu dem Vater: „Wollen Sie auch hier aussteigen?“
„Bei uns wird es eine etwas längere Reise“, antwortet der trocken, ohne Jan anzublicken.
Jan schenkt der Familie keine weitere Beachtung, schnappt sich seine Sachen und springt von der Ladefläche auf die staubige Straße.
„Vielen Dank fürs Mitnehmen!“
Jan schlägt sich den Staub aus der Hose.
„Wenn du meiner wärst, würde ich dir die Ohren langziehen. Und ´ne Tracht Prügel kriegtest du dazu.“
„Wieso haben Sie mich dann mitgenommen?“
Der Fahrer brummt irgendetwas und schaltet.
„Ich bin schon zwölf. Außerdem fahr ich zu meinem Vater.“
Der Laster fährt an.
Jan stutzt, läuft neben dem Fahrerhaus ein paar Schritte und schlägt auf die Fahrertür. „Halt!“
Der Fahrer bremst wieder. „Was ist?“
„Wissen Sie zufällig, wo hier der Friedhof ist?“
Der Fahrer mustert ihn: „Aber du bist sicher, dass hier dein Vater wohnt?“
Jan setzt ein unschuldiges Gesicht auf. „Ich war noch nicht oft hier.“
„Mir soll’s egal sein. Einfach die Straße da vorne lang.“ Der Fahrer deutet auf eine noch schmalere Seitenstraße, die links am Dorf vorbeiführt. Er löst die Bremse und der Laster zockelt wieder los. Jan blickt ihm und der Familie noch einen Moment nach, dann dreht er sich um, und fitscht zum nächsten Busch.
Er zieht sich wieder sein nun doch leicht zerknittertes Braunhemd an, bindet das Halstuch ordentlich um und trabt los. In Großebardeloh sagen sich Fuchs und Hase sicher nicht „Gute Nacht“, da ist höchstens Platz für einen von beiden. Drei, vier, nein fünf Straßen zählt Jan. Alle dichtgedrängt, mit kleinen Häusern rechts und links und einer kleinen Kirche in der Mitte. So, wie es sich für ein Dorf gehört. Viel Himmel gibt’s hier. In Berlin sieht er den weniger. Schwalben zischen rufend durch die Luft. Eine Schule kann er auch nicht entdecken. Keine Post, kein Kaufhaus, kein Kino, kein gar nichts. Ziemlich öde hier. Jan tun die Leute hier jetzt schon leid. Berlin ist da schon etwas anderes. In der Abendsonne ist niemand zu sehen. Nur ein Hund und eine Katze dösen in respektvollem Abstand im Erd- und Obergeschoss eines Baumes. Der Fluss müsste doch auch hier sein. Die Straße biegt dann weiter vom Dorf weg ab, in eine leichte, bewaldete Senke, durch die ein Bach führt. Immer stromabwärts gehen, dann kommt man zum Fluss, dann zum Meer. Das hat er sich von einem der Geländespiele im HJ-Lager des letzten Sommers gemerkt. Hoffnungsfroh steigt Jan aus der Senke wieder hoch. Er bleibt wie angewurzelt stehen. Felder. Nichts als Felder und Wiesen. Weiter hinten geht es wohl zum Fluss runter. Entmutigt lehnt er sich an einen großen, knorrigen Baum. Der Baum reicht hoch und hat unzählige gekrümmte Äste. Jan schwingt sich gekonnt auf den untersten ausladenden Ast. In seinem Hinterhof gibt es keinen einzigen Baum; der kahle Hof taugt nur zum Straßenfußball, aber sein Hordenführer jagt sie auf jeden Baum, der ihm geeignet erscheint, die Spreu vom Weizen zu trennen, wie er sagt. Jan ist natürlich Weizen, auch wenn er sich nicht ganz sicher ist, was Spreu bedeutet. Auf jeden Fall will er bald Hordenführer werden. Dann kann er die anderen scheuchen. Jan klettert bis in die Spitze. Angst hat er keine. Felder und Wiesen und Wälder. Gesprenkelt mit kleinen Bauernhäusern. Ein klitzekleiner, viereckiger Wald neben der Straße ein Stückchen weiter. Die Straße endet einfach. Feldwege führen weiter. Nun kann er auch den Fluss sehen. Und die orangene Abendsonne, ganz weit dahinter, tief am Horizont. Schön sieht das aus. Großebardeloh. Er sitzt fast auf der Höhe der Dachfirste: der kleine Kirchturm ragt aus der Mitte. Irgendwo muss er doch sein. Jan kneift die Augen zusammen, wischt sich noch mal den Schweiß weg. Hier oben ist es angenehm. Der viereckige Wald. Tatsächlich entdeckt er eine kleine Abzäunung um ihn herum. Er klettert flink wieder hinunter und rennt los – nur den Wald vor Augen.
Ein rostiger alter Metallzaun mit Spitzen und einem Tor, gerade groß genug, dass ein Beerdigungszug hindurchpasst, grenzt den Friedhof von der Außenwelt ab. Innen stehen alle Arten von Hecken, Bäumen, Büschen und von der Hitze arg gebeutelte Blumen. Jans Herz klopft. Er hat es geschafft. Jetzt muss er es nur noch finden. Unschlüssig bleibt er einen Moment stehen. Jan späht über das Tor. Die Gräber sind mit viel Platz drum herum angelegt, aber alles ist verwinkelt und durch die Büsche unübersichtlich. Das Tor ist nur angelehnt. Jan stößt es auf, und es quietscht gewaltig. Fast jedes Grab ziert eine Grabplatte oder sogar ein richtiger Grabstein und ist mit Kantensteinen eingefasst. Es gibt kleine Platten und größere; einige wenige Gräber haben eine Figur. Nichts im Vergleich zu dem, was er schon in Berlin gesehen hat. Friedlich ist es hier. Ein paar Vögel zwitschern vergnügt. Jan tritt an das erste Grab: „Volker Meier. 1855-1925“. Jan zuckt mit den Schultern. Dann beginnt er einfach rechts und liest stirnrunzelnd die Inschriften auf den Grabsteinen. Manche sind verwittert. Am Ende dreht er um und liest die gegenüberliegende Seite. Langsam kämpft er sich durch die Grabreihen. Eine nach der anderen. Er hat nicht gedacht, dass der Friedhof hier so groß ist. Einige Gräber haben keinen Grabstein. Ihm wird mulmig. Was ist, wenn er es am Ende doch nicht findet? Daran hat er gar nicht gedacht. Abrupt bleibt er vor einem kleinen Grabstein stehen. Es hat einen Moment gedauert, bis er wirklich verstanden hat, was er da liest: „Walter Schwarz 1902 – 1927“. Er betrachtet das Grab. Das ist es. Er hat es geschafft. Auf dem kleinen Viereck steht das verdorrte Unkraut gleichmäßig kniehoch. Wenn die kleine Grabplatte und eine dreckige Vase mit zwei frischen Sommerblumen nicht wären, wüsste man gar nicht, dass da überhaupt ein Grab ist. Irgendwie hatte er es sich hübscher vorgestellt. Vor allem nicht so unwichtig. Entschlossen bückt er sich und befreit die Mitte, von der er annimmt, dass sie die eigentliche Grabstelle ist, vom gröbsten Unkraut und wirft es ohne viel nachzudenken auf das ordentliche Nachbargrab. Nach einer Weile macht er einen Schritt zurück und betrachtet sein Werk. Besser. Dann legt er ordentlich sein Fahrtenmesser auf die Grabplatte und holt ein fetttriefendes Butterbrotpaket und einen Apfel aus seinem Tornister. Er setzt sich ein Stückchen neben dem Grab auf den Weg, wickelt das Butterbrot aus dem Papier und isst eine Weile. Er denkt nach. Seine Mutter hat ihm nie viel über ihn erzählt. Es hatte ihn allerdings nie interessiert. Was weiß er denn? Ein Autounfall auf der Fahrt von Berlin nach Großebardeloh. Noch vor seiner Geburt. Dass er Vertreter für Herrenbekleidung war. Doofer Beruf, aber er hatte ein Auto und ist bestimmt viel herumgekommen.
Da ist etwas. Jemand. Er dreht sich um.
2
„Hallo.“
Ein sommersprossiges Mädchen in einem luftigen, blauen Kleid mit weißer Schürze balanciert barfuß auf einem Grabstein vier Gräber weiter. Es lächelt ihn spitzbübisch an. Auch das noch. Ein Mädchen. Er will jetzt allein sein.
„Wo kommst du denn her?“
Jan schaut verbissen auf das Grab seines Vaters.
„Kannste nicht reden?“
Jan beißt von seiner Stulle ab.
„Oder willst du nicht?“
„Vielleicht will ich ja nicht mit dir reden“, platzt es aus Jan heraus und deutet auf ihren rechten Fuß auf dem Grabstein. „Man tut das nicht.“
„Ist ja noch nicht zwölf.“ Das Mädchen hüpft vom Grabstein.
„Wie, zwölf?“ Jan ist irritiert.
Das Mädchen schüttelt verständnislos den Kopf. „Geisterstunde.“
Jan nickt langsam: „Geisterstunde.“ Die hat nicht alle Tassen im Schrank.
Das Mädchen nickt eifrig. „Ich heiße übrigens Susanne. Wie heißt du?“
„Ist mir egal, wie du heißt.“
„Ich bin zwölf und mein Vater ist der Dorfbäcker.“
„Ist mir auch egal.“
Susanne legt den Kopf zur Seite. „Na, wenigstens bin ich nicht bekloppt.“
„Ich bin nicht bekloppt.“
Susanne nickt bedächtig.
Jan beißt wieder von seiner Stulle ab.
„An was denkst du?“, fragt Susanne.
„An nichts.“ Mädchen.
„Das ist ziemlich schwer, an nichts zu denken“, meint Susanne kritisch.
„Jungen können das“, sagt Jan verdrießlich.
„Und warum kannst du mir nicht sagen, wie du heißt?“
Jan seufzt. „Ich heiße Jan, komme aus Berlin und besuche das Grab meines Vaters.“
„Wohnst du alleine mit deiner Mutter?“
Jan nickt.
„Ich wohne mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen. Meine Mutter ist da vorne beerdigt.“ Sie zeigt auf das Grab mit dem Balanciergrabstein. „Ich besuche sie ziemlich oft. Und dann erzähle ich ihr alles, was so passiert.“
„Was soll in diesem Kuhkaff schon passieren?“ Jan beschließt, dass Mädchen eine ziemlich blöde Erfindung sind.
Susanne hält inne und kommt auf ihn zu. Sie deutet auf das Grab. „Der da ist dein Vater?“
Jan steht nun auf. „Mein Vater ist nicht ‚Der da‘.“
„Na gut. Walter Schwarz ist dein Vater?“
Jan nickt. Susanne pfeift leise vor Erstaunen.
„Was ist?“ Jan wird stutzig.
Susanne lacht ihn wissend an. Das gefällt Jan gar nicht. Dann dreht sie sich um und geht über die Gräber hüpfend in Richtung Ausgang.
„Was ist?“, ruft Jan ihr laut hinterher.
Schließlich dreht sie sich um. „Klar, dass du keine Angst vor der Geisterstunde hast. Wenn ich die Enkelin der Hexe wäre, hätte ich das auch nicht.“ Damit dreht sie sich um und verschwindet zwischen den Büschen. Jan schaut ihr verdutzt nach. Dann schnappt er seine Sachen und rennt ihr nach.
Das Grün der Büsche hat sie verschluckt. Die ersten Meter rennt Jan hübsch artig den Weg zurück, dann schießt Jan zwischen den Gräbern und Grabsteinen hinter Susanne her. Er achtet aber darauf, nicht auf die eigentlichen Grabstellen zu treten. Suchend läuft er über den nun dämmrigen Friedhof. Der ist von der Mitte aus betrachtet etwas unübersichtlich. Er entdeckt das Tor und Susanne, die die letzten Meter auf einem Bein darauf zu hüpft. Mit einem Schlussspurt hat er sie erreicht.
„Ich bin der Enkel von wem?“, platzt es aus ihm heraus.
„Der Hexe“, sagt Susanne schnippisch, geht durch das Tor und lässt es hinter sich zuschlagen.
Jan stößt es ärgerlich auf und läuft neben sie. „Nu erzähl schon!“
„Du musst doch wissen, wer deine Oma ist.“ Susanne schaut ihn prüfend von der Seite an. „Aber klar, der Herr kommt aus Berlin und hier ist nur das Kuhkaff.“ Susanne klettert zwischen einem Weidezaun durch und stapft geradeaus über eine Kuhwiese aufs Dorf zu. Nach kurzem Zögern folgt Jan. Misstrauisch beäugt er die Kühe, die ihn wiederkäuend interessiert beobachten. Als eine aufsteht und ihm gemächlich folgt, werden seine Schritte merklich schneller.
„Weiß ich vielleicht nicht“, gibt Jan zu.
Susanne nickt bedächtig. „Wenn Walter Schwarz dein Vater ist, und der der Sohn der Hexe, dann musst du ihr Enkel sein. Ganz einfach.“
„Wer ist die Hexe?“
„Die Hexe halt.“ Susanne mag auf einmal die Richtung nicht mehr, die diese Unterhaltung nimmt.
„Warum heißt die Hexe ‚Hexe’?“
„Weil sie hext.“ Susanne marschiert jetzt einen Schritt schneller.
War ja klar, dass das jetzt als Antwort kam, denkt sich Jan. „Warte doch mal.“
Susanne bleibt stehen. „Kannst du auch hexen?“
„Was? Quatsch.“
„Hätte ja sein können.“
„Kannst du mich zu ihr bringen?“, fragt Jan.
Susanne schüttelt den Kopf. „Nie im Leben.“
„Warum nicht?“
„Es ist die Hexe! Keiner geht da hin“
„Ihr seid ja alle bekloppt hier. Und du bist ein blödes Mädchen!“
Nun marschiert Jan voran.
„Ich bin kein blödes Mädchen.“ Susanne bleibt stehen.
„Biste wohl.“ Jan dreht sich zu ihr um.
„Bin ich nicht.“
„Biste doch. Und feige noch dazu. Ein richtiger Angsthase.“
Susanne gibt sich geschlagen. „Also gut, ich bring dich hin.“ Sie biegt seitwärts vom Dorf in Richtung Fluss ab. „Und ich bin nicht feige.“
„Biste wohl“, denkt Jan und folgt ihr.
Susanne wandert mit Jan quer über Wiesen und Felder, schnurstracks auf einen Wald zu. „Warum bist du denn nicht mit deiner Mutter gekommen?“
Jan beißt sich kurz auf die Lippe. „Meine Mutter hat keinen Urlaub bekommen. Sie hat gemeint, ich wäre ja nun schon groß und könnte auf mich selber aufpassen.“
„Sie hat dich ganz alleine von Berlin hierherkommen lassen?“ Susanne staunt Jan ungläubig an.
Jan nickt selbstbewusst. „Hat ja bestens geklappt.“
Susanne fragt skeptisch: „Und wie kommst du wieder zurück?“
„Na, so wie ich hergekommen bin. Einfach an den Straßenrand stellen.“
„In Berlin kommen bestimmt öfter Autos am Straßenrand vorbei als hier“, meint Susanne nachdenklich.
„Was hast du denn da um den Hals hängen?“ Jan zeigt auf einen dünnen Lederriemen um ihren Hals, an dem kleine Sachen hängen.
„Mein Amulett.“
Jan versucht genauer auf das Ding zu schauen. Bereitwillig hält sie es ihm vor die Nase. Ihr Gesichtsausdruck sagt allerdings, dass das nun so sinnvoll ist, wie Perlen vor die Säue zu werfen. Jan versteht immer noch nicht, was er da sieht, also will er es anfassen. Susanne zieht es wieder zurück.
„Ich kann’s doch nicht richtig sehen.“
Susanne geht weiter. „Du wirst es eh doof finden.“
„Was ist es denn? Jetzt bleib doch mal stehen.“
„Ich dachte, du willst schnell zur Hexe.“ Schließlich bleibt sie stehen und hält es ihm demonstrativ vor die Nase.
Jan fasst das Ding an und schaut es genau an.
„Was ist das?“
An dem Lederband hängen eine kleine Feder, ein Stückchen Fell, ein durchbohrter Pfennig, ein rundes Stück Leder mit bunten Glasperlen und ein aufgeklebtes Kleeblatt.
„Das Stückchen Kaninchenfell ist von dem Pelzkragen meiner Mutter. Den Pfennig hat mein Papa mir durchbohrt, und das Kleeblatt hat mir Thomas, das ist mein Bruder, mal geschenkt. Ist aber schon fast ganz abgeblättert. Die kleine Feder hab ich gefunden.“
Jan staunt und weiß nicht so richtig, was er sagen soll. Wenn er jetzt sagt, was er denkt, wird sie ihn nicht zur Hexe bringen. „Braucht man so was hier?“, fällt ihm schließlich ein.
„Wenn man die Hexe nicht zur Oma hat, ja“, gibt sie patzig zurück.
Dann dreht sich Susanne nach vorne und bleibt stehen. Sie wird etwas fahl um die Nase und zeigt auf ein altes, kleines Fachwerkhaus in einiger Entfernung, unter großen Bäumen, von einer Hecke umringt und dicht vor einem Waldrand. „Da ist es!“
Jan fällt Hänsel und Gretel ein.
Susanne schaudert. Richtig unheimlich sieht es aus. „Ich glaub, ich geh jetzt mal wieder zurück. Papa wartet schon.“
Jan überholt Susanne und sagt leise grinsend zu ihr: „Angsthase, Pfeffernase.“
Susanne bleibt stehen. Eiskalt ist ihr auf einmal. Eigentlich kann es ihr egal sein, was dieser fremde Junge von ihr denkt. Ist es ihr aber nicht, und sie versteht nicht, wieso. Sie gibt sich einen Ruck und folgt ihm zögernd. „Bin ich nicht.“
Jan hat noch nie an Hexen geglaubt, aber er muss zugeben, dass dieses Haus auch ihm unheimlich ist. Keine Gardinen, kein warmes Licht von innen. Die beiden nähern sich dem Haus längs der Hecke. Kurz vor dem Haus gehen sie auf die Knie und krabbeln auf allen Vieren weiter bis in den Garten. Sie ducken sich hinter Johannisbeeren. Niemand ist zu sehen. Besorgt blickt Susanne zum Himmel. Der erste Stern taucht schon auf. Ihr reicht es. Sie ist genau da, wo sie um diese Uhrzeit nicht sein will. „Siehst du, keiner da. Aber da wohnt deine Oma.“
Jan kriecht auf das Haus zu. Susanne packt ihn am Gürtel, aber Jan befreit sich. Das Haus zieht ihn magisch an.
Susanne kriecht mit zusammengebissenen Zähnen hinterher und hält ihn am Hemd fest. „Komm hier weg. Das ist nicht gut, wenn wir hier sind.“ Eine Fledermaus umschwirrt den Schornstein. Susanne fühlt sich ziemlich elend.
Jan dreht sich zu Susanne. „Ich geh da jetzt rein.“
Susanne schluckt.
„Du musst nicht mitkommen.“
„Ich hab keine Angst“, flüstert Susanne mit zittriger Stimme.
3
Beide kriechen bis zur Tür. Jan steht auf und klopft sich den Staub aus den Kleidern. Schließlich wohnt hier seine Oma, und da will er einigermaßen ordentlich aussehen. Zögernd macht Susanne es ihm nach. Entschlossen legt Jan die Hand auf die Klinke und drückt. Die Tür öffnet sich mit leisem Knirschen.
„Sie ist offen“, meint Jan begeistert.
Susanne schüttelt den Kopf. „Natürlich ist sie offen. Warum sollte man eine Tür abschließen?“
Jan schaut sie schief an. Erst will er etwas erwidern, dann dreht er sich um und verschwindet im Dunkel. Susanne schleicht hinterher.
Jan ist stehengeblieben. Susanne schaut über seine Schulter. Alles um sie herum ist düster. In einem uralten Herd flackert ein kleines Feuer. Die dunkle, verrußte Holzdecke ist niedrig und der Raum irgendwie schräg. Die Wände sind blau gestrichen. Ein kleiner Holztisch mit zwei Stühlen steht in der Ecke. Die langen Schatten von überall hängenden Kräutern tanzen im Feuerschein auf den Wänden. Susanne bewegt sich keinen Millimeter. Jan reißt sich zusammen. Ein deutscher Junge ist halt furchtlos. Und wenn nicht, sollte man es wenigstens nicht sehen. Und Susanne schon gar nicht. Geht Gott sei Dank auch nicht bei der schummrigen Beleuchtung. Er nimmt sich ein paar Kräuter und riecht vorsichtig daran.
„Nicht!“, zischt Susanne, „du weißt doch gar nicht, ob die giftig sind.“
Jan zuckt lässig mit den Schultern und hängt die Blätter zurück. Er schleicht zur schiefen Flurtür. In diesem Moment flitzt eine Katze, die unbemerkt unter einem Stuhl gekauert hatte, an ihm vorbei in den pechschwarzen Flur.
Susanne kreischt auf. „Das ist sie!“
„Das ist wer?“
„Die Hexe.“ Susanne legt ihre Hand auf die Stuhllehne, aber sie zittert so stark, dass die Hand auf der Stuhllehne auf und ab federt.
Jan schaut sie ungläubig an. „Du spinnst.“
Susanne ist außer sich. „Nein, tu ich nicht. Hexen können das. Die verwandeln sich in Katzen. Und wieder zurück.“
Jan lacht los. „Glaubst du das echt?“ Er findet es mutig von sich, jetzt zu lachen. Er ist eben ein richtiger Kerl.
Susanne wird ein bisschen rot. „Du hast keine Ahnung. Das ist so.“
Jan grinst immer noch, dreht sich um und betritt den Flur. Susanne setzt tapfer einen Schritt vor den anderen, bis zur Tür.
Der Flur entpuppt sich als feuchte, dunkle, muffige Diele mit ein paar kleinen alten Türen und einer augenscheinlich wackeligen Treppe. Etwas Kleines, Schwarzes huscht über den Lehmboden an der Wand entlang und verschwindet unter einer schweren Truhe. An den Wänden sind Umrisse von getrockneten Kräutern und einem verstaubten Pflug zu sehen. Jan schaut sich um. Susanne steht immer noch auf demselben Fleck und traut sich nicht weiter. Mutig stolpert Jan zu einer Tür und öffnet sie vorsichtig. „Hallo?“, sagt er leise. „Jemand da?“
Ein kleiner Raum. Das winzige Fenster ist mit Pappe zugeklebt. Die Scheibe ist wohl kaputt. Es ist ein Vorratsraum mit Dutzenden von gefüllten Einmachgläsern in verstaubten Bretterregalen. Er kommt sich etwas blöd vor. Egal.
Er lugt in den nächsten Raum. Dieser ist größer. Durch zwei kleine Fenster fällt dämmriges Licht auf eine uralte, abgewetzte Couch, einen Tisch, zwei alte Sessel, eine Holzanrichte und einen Ofen in der Ecke. Jans Blick bleibt an etwas hängen. Auf der Anrichte stehen gerahmte Fotos ordentlich auf einem weißen Deckchen. Jan tastet sich durch den Raum. Er stolpert böse über einen Korb mit Strickzeug. Er macht einen Hüpfer auf einem Bein und zieht die Luft ein, vergisst den Schmerz aber sofort wieder. Andächtig hebt er ein Foto nach dem anderen hoch. Es ist so dunkel, dass er kaum etwas darauf erkennen kann. Kurzerhand schnappt er sich alle und läuft zu Susanne in die Küche. Er hebt die runde, eiserne Herdplatte ab. Es ist es ihm egal, ob er Lärm macht. Er will die Fotos sehen. Susanne zuckt bei jedem Kratzen und Scheppern der Herdplatte zusammen. Jan beugt sich vor und hält das erste Foto dicht unter seine Nase. Er muss aufpassen, dass das er nicht zu nah an die Flammen kommt. Im roten Flammenlicht kann er es sehen: eine junge, adrette Frau mit einem Baby. Dann das nächste: ein niedlicher Junge; und das letzte: ein junger Mann mit Autobrille und Lederkappe. Jan hantiert gefährlich nahe am Feuer mit den Bildern. Das muss er sein! Der junge Kerl grinst frech in die Kamera. Im Hintergrund sieht man eine große Kirche. Mitten auf dem Foto ist eine Widmung. „Für meine liebe Mutter“, steht da. Er hat noch nie ein Bild von seinem Vater gesehen. Jan hat die Umgebung vergessen; er versucht sich jede Einzelheit einzuprägen. Susanne hopst ungeduldig hin und her.
Knarrende Schritte. Susanne linst vorsichtig durch die Tür in die Diele. Eine schwarze Gestalt in langem Rock erscheint oben auf der Treppe. Susanne kreischt, macht zwei Hopser: „Sie kommt! Sie kommt!“ Und schon ist sie draußen.
Jan hört die knarrenden Schritte auf der Treppe. Jan umfasst das Foto in seiner Hand fester. Der dunkle Schatten taucht in der Tür auf.
„Pack! Verschwindet!“, zischt die Hexe, greift den Reisigbesen neben der Tür. Jans Knie werden weich. Blitzschnell fliegt der Besen auf ihn zu. Er umklammert die Fotos, duckt sich, kriecht unter den Tisch. Dabei fallen die Bilder auf den Boden.
Der Besen kracht an die Wand. Jan greift nach den Fotos, kann aber so schnell nur eins festhalten und fliegt fast zur Tür. Mit einem schrillen Schrei holt die Hexe den Besen und wirft ihn ihm hinter her. Krachend spürt er den Besen im Rücken. Er stolpert in die Nacht und rennt zur Hecke und weiter. Dann bleibt er stehen. Ein Pfiff. Susanne hockt winkend in einiger Entfernung vom Haus hinter einem Busch an der Straße mit seinem Tornister. Er schaut sich seine Beute an. Viel kann er nicht erkennen, aber es ist das Foto von dem jungen Mann. Grinsend trabt er auf sie zu. Sein Rücken schmerzt etwas. Susanne ist sauer. Irgendwie ist ihr ihr Gekreische peinlich, anderseits hatte sie mal wieder Recht mit der Hexe.
Triumphierend hält er ihr das Foto unter die Nase. „Mein Vater.“
Susanne wirf einen kurzen Blick darauf und steht pikiert auf. „Mir egal. Ich geh jetzt nach Hause.“ Sie geht los.
Jan nimmt seinen Tornister und rennt hinter ihr her. „Warte doch mal.“
Susanne wartet nicht. Jan läuft nun neben ihr.
Susanne ist immer noch angefressen. „Das war deine Oma. Zufrieden?“
Jan nickt begeistert.
„Und was machst du jetzt?“
Jan kratzt sich am Kopf. „Weiß nicht. Nach Hause, denk ich.“ Eigentlich hatte er sich bis jetzt keine Gedanken über das Danach gemacht.
„Ich glaub nicht, dass jetzt noch ein Auto kommt.“ Mitfühlend klingt das nicht.
Sie erreichen die Landstraße, wo Jan vor ein paar Stunden angekommen ist. Ihm kommt es wesentlich länger vor. Jan setzt sich unter die mittlere von drei einsamen Laternen. Susanne ist unschlüssig. Dann setzt sie sich zu ihm. Jan betrachtet fasziniert das Foto.
Nach einer Weile meint sie: „Er hätte dir aber trotzdem ein paar Fotos von sich geben sollen. Das ist doch blöd, wenn man noch nicht mal weiß, wie der eigene Papa aussieht.“
„Da ist er ja gar nicht mehr zu gekommen. Ich war noch nicht auf der Welt, da ist er mit dem Auto schon verunglückt. Er und Mama wollten heiraten. Hat sie mir erzählt. Und dann ist es halt passiert. Auf einer Heimfahrt von Berlin nach hier hin.“
„Und deine Mutter hat auch keins?“
Jan denkt kurz nach, dann schüttelt er den Kopf.
„Deine Mutter hat kein Foto? Gar keins?“
„So sehr hab ich mich nie dafür interessiert. Ich hab früher mal gefragt, da hat sie gesagt, dass ich noch zu klein wäre, für so eine Reise.“
Grillen zirpen. Susanne schaut die Straße rauf und runter, aber es ist genau, wie sie gedacht hatte. Kein Auto. Nicht ein einziges. „Nüscht.“
Jan holt aus seinem Tornister einen alten Brief hervor, den er sorgfältig in einem Schulbuch transportiert hat. „Hier. Guck. Das hat er Mama geschrieben. Aber pass bloß auf! Ich muss ihn wieder zurücklegen. Sonst merkt sie was.“
„Abgehauen biste, was?“
Jan zuckt mit den Schultern.
Susanne nickt. Vorsichtig nimmt sie den Brief. Mit gerunzelter Stirn liest sie langsam und stockend die erwachsene Handschrift. Dann lacht sie. „Das ist ja ein Liebesbrief! Hier. Da hat dein Vater darunter geschrieben: ‚Dein frecher Flusspirat.‘ Und das er sie wieder da treffen will, wo sie sich immer treffen. Ganz geheim. Nicht mal sein Name steht da.“ Susanne kichert.
Ärgerlich nimmt Jan ihr den Brief wieder weg. „Er hat sie halt gemocht.“
Susanne kichert noch, nickt dann aber. „War da kein Umschlag dabei?“
Jan schüttelt den Kopf. Er stutzt und fingert noch einmal das Foto hervor, dann wieder den Brief. Seine Kinnlade klappt herunter.
„Was ist?“, fragt Susanne irritiert.
„Da guck. Die Handschriften sind nicht gleich.“ Er hält ihr beides hin. Susanne prüft sie gewissenhaft, und wirklich – beide Handschriften könnten verschiedener nicht sein. Beide schauen sich an.
„Versteh ich nicht“, meint Susanne.
Entschlossen packt Jan den Brief wieder sorgfältig in das Buch, dann in den Tornister und steht auf.
„Wo willst du hin?“, fragt Susanne.
„Ich frag die Hexe, was das soll. Sie ist schließlich meine Oma.“ Und schon hat er sich umgedreht und marschiert im Eiltempo wieder in die Dunkelheit. Susanne zieht eine Grimasse. Dann springt sie auf und läuft hinter ihm her.
„Du willst noch mal da hin?“ Susanne bleibt tapfer neben ihm. Erst mal.
„Du musst ja nicht mit.“ Jan wird irgendwie übel. Aber nicht wegen der Hexe. Und auch nicht wegen der Dunkelheit. Irgendwas passte ganz und gar nicht.
Susanne ist hin- und hergerissen. Sie blickt zu den auf einmal sehr gemütlich wirkenden Häusern mit erleuchteten Fenstern, dann auf den dunklen Weg vor ihnen. Ein Käuzchen schreit.
„Ist es wohl schon zwölf?“, flüstert sie.
Jan schüttelt den Kopf. Sie bleibt bei ihm. Bald sind sie so weit von zu Hause weg, dass sie auch nicht mehr allein zurück will. Sie kommt sich ziemlich dumm vor. Da hat sie sich ja in einen schönen Schlamassel gebracht. Beide schweigen, und die Welt um sie herum wird immer dunkler.
Schließlich stehen beide wieder vor dem Haus der Hexe.
Sie hocken sich unter einen Obstbaum. Die Küche ist nun beleuchtet, und der Schatten der Hexe ist zu sehen.
„Wir dürfen auf keinen Fall mehr hier sein, wenn es zwölf ist. Sonst ist es aus mit uns“, flüstert Susanne; mehr zu sich und ein bisschen zu Jan.
Entschlossen steht Jan auf. „Quatsch.“
„Warte.“ Sie drückt ihm ihr Amulett in die Hand.
Ohne drüber nachzudenken, stopft er es in seine Hosentasche. Sein Kopf tut weh. Dann marschiert er geradewegs auf das Haus zu.
Susanne krabbelt zu dem breitesten Obstbaum der kleinen Obstwiese und linst hinter dem Stamm hervor.
Gerade als Jan die Hand auf die Klinke legen will, fliegt die Tür auf. Jan stolpert im Lichtkegel zurück. Er blinzelt. Die Hexe steht mit ihrem Besen drohend in der Tür. Susanne wagt kaum zu atmen. Irgendwie hatte er sich eine Großmutter immer anders vorgestellt.
„Ich bin kein Dieb“, sagt Jan leise und ruhig. Er hält ihr das Bild hin. Bei dem Licht kann sie bestimmt nichts sehen. „Das ist das Foto aus ihrem Wohnzimmer“, erklärt er vorsichtshalber, aber so, wie die Hexe guckt, ist das wohl unnötig.
„Gib es zurück!“, zischt sie.
„Ist das Walter Schwarz?“ Jan gibt sich entschlossen.
„Unnützes Pack.“ Die Hexe brummelt es so leise, dass er es kaum versteht.
„Ist das hier Walter Schwarz?“ Er lässt sich nicht verjagen. Und schon gar nicht von einer alten Frau. Oder einer Hexe.
Die Hexe taxiert ihn irritiert.
„Wer ist auf dem Foto?“ Jan wird zunehmend forscher.
„Walter.“
„Dann ist das mein Vater!“, triumphiert Jan.
Das Gesicht der Hexe verdüstert sich zusehends.
„Und darum sind Sie meine Oma.“ Jan beginnt den Satz siegessicher, aber der Rest kommt ziemlich leise über seine Lippen.
„Gib das her!“ Die Hexe humpelt langsam auf Jan zu. Irgendwie ist sie schief in der Hüfte. Sie hat Jan fest im Blick.
„Aber ich hab kein Foto von meinem Vater... “
Die Hexe reißt mit einer schnellen Handbewegung Jan das Foto aus der Hand. Hinter dem Baumstamm greift Susanne nach ihrem Amulett. Als sie es nicht findet, kaut sie vor Aufregung auf dem Fingernagel ihres Daumens herum.
Jan verwünschend schlürft die Hexe zurück ins Haus.
„Warten Sie!“ Jan holt den Brief aus dem Tornister. „Meine Mutter hat mir gesagt, dass Walter Schwarz mein Vater ist.“
Die Hexe dreht sich in der Tür um; Jan geht auf sie zu. Er hält ihr den Brief in einigem Abstand vor die Nase, bedacht, dass sie ihm den nicht auch noch wegnimmt.
„Ich war heute auf dem Friedhof. Hab sein Grab besucht. Und sie hat mir den Brief gegeben. Na ja. Eigentlich hat sie ihn mir nicht gegeben. Sie hat ihn mir gezeigt und gesagt, dass er von meinem Vater wäre. Und dass sie ihn mir geben würde, wenn ich erwachsen bin.“
Die Hexe starrt Jan an.
Jan zeigt auf seinen Brief. „Das hat mein Vater geschrieben. Und das Geschriebene sieht anders aus als das auf dem Foto.“
Die Hexe wirft einen kurzen Blick auf den Brief, dann schaut sie wieder Jan an. Der steckt den Brief sicherheitshalber in seine Hemdtasche.
„Wie heißt deine Mutter?“, fragt sie trocken.
Jetzt erst kann er ihr Gesicht sehen. Alt und richtig zerfurcht. Mit zwei Warzen. Eine über dem linken Auge, eine auf ihrem Kinn.
„Marie Wilke“, stottert er.
Die Hexe schaut über Jan hinweg in die Dunkelheit. Ihr Gesicht spiegelt Abscheu. Susanne versucht etwas weiter hinter dem zu schmalen Baum zu verschwinden.
„Ins Unglück hat sie meinen Walter gestürzt. Das hat sie getan. Tod ist er.“
„Das ist unfair“, gibt Jan zornig zurück.
„Eine Hure war sie.“
Jan wird rot. Und versteht eigentlich gar nichts mehr.
„Rumgehurt hat die. Durchs halbe Dorf. Mein Walter ist nicht dein Vater.“
„Meine Mutter ist keine Hure!“
„Hau ab!“
Jan schnappt sich wieder das Foto. Er hält es der Hexe vor die Nase. „Das ist mein Vater!“
Die Hexe fasst Jan blitzschnell am Kinn und dreht Jans Kopf langsam prüfend hin und her. „Genau wie der Satan. Damals.“
„Wie wer?“ Jan zieht wütend sein Kinn aus ihrem Griff und macht einen Schritt zurück.
„Spross des Satans. Du bist eine Satansbrut!“, faucht die Hexe.
„Bin ich nicht. Ich glaube nicht an Satan, Hexen und so’n Zeug. Sie sind meine Oma. Jawohl.“ Jan zeigt auf das Foto in seiner Hand. „Und der hier ist mein Papa. Und….“
Die Hexe kreischt: „Und jetzt weg mit dir! Ich will dich nie wieder sehen! Du bist der Spross des Bösen!“
Jans Arme hängen schlaff neben seinem Körper. „Von wem?“
„Wer hat alles Böse über uns gebracht? Wer? Und er ist einer davon.“
Jan schaut sie verständnislos an.
Die Hexe macht einen hinkenden Schritt auf ihn zu.
„Das Böse! Das Böse!“ Blitzschnell greift sie nach dem Foto.
Aber Jan ist auf der Hut, zieht es weg, schnappt sich seinen Tornister und rennt.
„Satansbrut!“ Die Hexe macht ein paar humpelnde Schritte hinter ihm her, gibt aber rasch auf.
„Das hier ist mein Vater!“, brüllt Jan im Laufen. Heulend stolpert er an Susanne vorbei den Weg hinunter. Erleichtert flitzt Susanne hinterher.
Jan trottet neben Susanne die dunkle Straße entlang. Er schämt sich seiner Tränen. Er schnieft und wischt sich mit der flachen Hand die Nase ab. Nach einer Weile wird er ruhiger. Er muss seine wirren Gedanken sortieren.
„Sag mal, was meinte die mit Satansbrut?“, fragt Jan leise.
Susanne zuckt mit den Schultern, aber dann fällt ihr ein, dass Jan das ja im Dunkeln gar nicht sehen kann. „Weiß nicht“, sagt sie leise. Sie gehen ein paar Meter schweigend nebeneinander.
Jan versucht es wieder: „Sie hat gesagt, dass ich eine Satansbrut bin und: ‚Wer hat alles Böse über uns gebracht?‘“
„Strassberg sagt immer, dass die Juden alles Böse über Deutschland bringen“, denkt Susanne laut.
„Wer ist Strassberg?“
„Unser Lehrer.“
„Du meinst, die Hexe hat gesagt, dass ich wie ein Jude aussehe?“ Jan wird schlecht.
„Du hast sie an irgendwen erinnert.“
„Du kommst von hier!“
Susanne überlegt eine Weile. „Da kann nur einer in Frage kommen.“
„Wer?“
„Rosenstolz.“ Susanne zögert.
Jan wartet, und obwohl er ihr Gesicht nicht richtig sehen kann, spürt er, dass Susanne nicht weiß, wie sie es sagen soll.
„Ja, also was?“ Jan bleibt stehen.
Susanne gibt sich geschlagen. „Rosenstolz ist der Dorfjude.“
Jan schaut sie nur an.
„Die Hexe meinte halt, du sähest ihm ähnlich.“ Susanne schaut auf den Boden. „Und du wärst der Spross des Bösen und einer.“
„Hure“, fügt Jan kaum hörbar hinzu.
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












