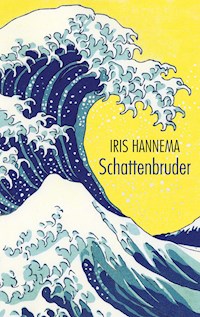
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Hebes Bruder Alec war ein professioneller Freediver. Seit er bei einem seiner Tauchgänge ums Leben kam, ist für Hebe die Welt nicht mehr so, wie sie einmal war. Wie ist er wirklich gestorben? Und was bedeutet eigentlich die Postkarte, die er ihr beim Abschied in die Hand gedrückt hat? Alecs Spuren führen sie nach Japan in das pulsierende Herz von Tokio und schließlich nach Ishigaki, einer Insel im tiefblauen Ozean ... Auf der Suche nach dem, was Alec ihr nicht sagen konnte, entdeckt Hebe, wie es ist, allein zu reisen, sich von allem Vertrauten zu lösen und in einem Land zurechtzukommen, in dem sie niemanden kennt. Wer aber ist die Fremde, die sie beobachtet und ihr unheimliche Nachrichten hinterlässt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
IRIS HANNEMA
Schattenbruder
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
Sie ist schön. Ich nenne sie Belle. Ich weiß, in welcher Jugendherberge sie wohnt. Unweit von mir; es gibt keine Zufälle. Die Leute gehen achtlos mit Informationen um, müsst ihr wissen. Manche nutzen sogar das kostenfreie Flughafen-Wifi oder besuchen ihre Facebookseite in einem Internetcafé. Tut das nie. Es öffnet Türen zu sämtlichen Geheimnissen: euren Mails, euren Nachrichten, euren Fotos, euren Buchungen, euren Passwörtern. Direkt zu euch.
Sieben Monate vorher
Es gibt sie. Vogelmenschen. Sie denken wie Vögel, sind aber zu sehr Mensch, um zu fliegen. Sie leben in zwei Welten. In der einen Welt wollen sie ihren Körper, in der anderen nicht. Sie wollen rennen, verschwinden, bleiben, sinken, treiben, sich in einen Traum transformieren und zugleich existieren.
Das sind die Menschen, die reisen.
Seit sieben Monaten weiß auch ich, dass sich das Leben nicht dadurch ändert, indem man es sich abends vor dem Zubettgehen nur fest genug wünscht. Es passiert, wenn etwas von außen dich entzweischneidet und vom glücklichen Teil deiner selbst trennt. Wer schon einmal einen lebenden Fisch auf einer Wiese hat liegen sehen, weiß, was ich meine. Nach einem Leben schnappend, das es nicht mehr gibt, Augen aus Glas und ein Mund, der schreien will, aber keine Stimme mehr hat.
Bevor mein Bruder starb, hatte ich noch nichts Außergewöhnliches in meinem Leben durchgemacht, alles war normal. So normal, dass mir sämtliche Farben standen. Zu meinen Augen passte am besten Tintenblau. Jetzt nicht mehr, denn sie haben sich verändert. Jetzt steht mir nur noch Schwarz, perfekt als Farbe für Reisende, weil es keine Aufmerksamkeit erregt und auch nicht so schnell schmuddelig aussieht.
An einem Dienstag im September ging ich mit meinem Bruder zum letzten Mal unter der grellweißen Beleuchtung von Amsterdam-Schiphol zum Zoll, der Grenze zu no man’s Land. Er würde eine Flugreise antreten, ich ihm wie immer zum Abschied hinterherwinken. Eine unserer festen Familientraditionen war dieses handgelenkeverrenkende Hinterhergewinke, auch wenn wir zu Hause waren und einer von uns bloß zum Supermarkt ging. Wir winkten, bis der andere hinter den Speicherhäusern aus dem 19. Jahrhundert mit ihren Seilwinden im Dachgiebel verschwunden war.
Erst später machte ich mir klar, dass sämtliche Familientraditionen, die mein Bruder und ich teilten, sich ums Abschiednehmen drehten. Ein Vorzeichen habe ich darin nie gesehen; eher etwas von Reisenden untereinander. Ich war bis dahin noch nie allein verreist, wusste allerdings, dass ich das irgendwann tun würde. Auch dass ich nach Japan fliegen würde, war mir klar. Das war unser beider Land, obgleich mein Bruder und ich es nie zusammen besuchen sollten.
Alec und ich wurden bei den richtigen Eltern geboren, ein Volltreffer, aber aufgewachsen sind wir geografisch zu weit nördlich. Dramatisch und emotional, wie wir beide veranlagt waren, wären wir besser südlich unserer Landesgrenzen zur Welt gekommen. Dort, wo Familie ungeniert über alles geht und wo zu Mittag immer warm gegessen wird.
Aber etwas oder jemand hatte sich in den GPS-Koordinaten getäuscht, und wir waren im Amsterdamer Onze Lieve Vrouwe Gasthuis geboren worden, in den beinahe perfekten Niederlanden. Das Einzige, was mein Bruder und ich an unserem Geburtsland auszusetzen hatten, war die fehlende Zurückhaltung. Jeder sagte, was er dachte, und das geißelte unsere Emo-Herzen; jetzt allerdings sehe ich, dass wir das einfach nicht gewohnt waren. Streitigkeiten oder Kritik wurden bei uns zu Hause nicht ausgesprochen, sondern wie Gallensteine pulverisiert und durch gemeinschaftliche Mahlzeiten verflüssigt. In Zeiten der Krise füllte sich unser gigantischer Baumtisch mit unseren Lieblingsgerichten, mit Körben voll Brot und Schälchen mit in Scheiben angerichteter gesalzener Butter. Von klein auf durften wir schon ein kleines Schlückchen Weißwein trinken, wenn wir wollten. Auch das schien bei anderen Familien nicht die Norm zu sein. Der Kontrast zwischen uns nördlichen Südländern, die sich lieber die Zunge in Stücke hackten und wiederkäuten, als dem Familiengegenüber unumwunden die Wahrheit zu sagen, und dem Rest der Niederlande war groß. Als mein Bruder und ich dahinterkamen, dass man in Japan auch nicht alles einfach so sagen kann, wollten wir keine Italiener mehr werden, sondern Japaner. Ein ganzes Volk, das aus Respekt vor dem Gegenüber behutsam mit Worten ist, da gehörten wir hin. So begann unser Fetisch für alles Japanische.
Auf das unveränderbare Früher zurückblickend sehe ich, dass wir unsere gesamte Jugend hindurch von einem Ort auf der Welt träumten, wo wir besser hinpassen würden als zu Hause. Keine Ahnung, weshalb wir uns beide in unserem Amsterdamer Universum zwar sicher, aber nicht frei fühlten.
An diesem Dienstag im September gingen wir wortlos durch die Gänge von Schiphol, vorbei an Check-in-Schaltern, vor denen lange Schlangen warteten. Reisen begann mit Leiden, und das akzeptierten wir. Durch die vielen Flughafen-Dezibel und den nahenden Abschied fühlten wir uns etwas schwerhörig und matt. Alec hatte seine Abschiedskarte für mich in der einen Hand. Mit der anderen hielt er meine so fest, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass er mich in einer Viertelstunde loslassen und in jene Tax-Free-Welt hinüberwechseln würde. Noch immer gibt es für mich nichts Intimeres, als jemandes Hand zu halten. Man kann sich Hand in Hand mit einer Person nicht allein fühlen, selbst wenn man diese nicht kennt. Es ist nicht so, dass man nach dem Loslassen der Hand das Gefühl hat, verlassen zu sein, sondern eher umgekehrt: Deine Hand ist noch warm, an ihr klebt noch die gegebene Liebe.
Eine andere Familientradition war die Karte, die mein Bruder dabeihatte. Immer, wenn Alec ins Ausland fuhr, schenkte er mir eine Ansichtskarte mit einer Botschaft, etwas aus seinem Geistesinneren nach außen Gekehrtem, über das ich nachdenken sollte. Zum Beispiel diese:
«Wenn du jemals auf Reisen gehst, Sissie, musst du das hier untersuchen: Was tun Menschen, wenn sie anscheinend nichts tun?» (Mai 2015 – Kolumbien)
Ich habe alle seine Karten aufgehoben.
Je näher wir dem Zoll kamen, desto wärmer wurde mir. In diesem Teil des Flughafens herrschte Sauerstoffmangel, und ich zog meine Jacke aus und knotete sie mir um die Hüften. Es half nicht, ich bekam immer noch kaum Luft und wäre am liebsten nach draußen gerannt. Ich sagte zu Alec, ein Flughafen sei ein fürchterlicher Ort, wenn man selbst nicht fliegt. Die Hinterherwinkenden blieben mit ihrem alten Leben verbacken, während die Koffermenschen in Luftköchern entrannen.
«Für dich», erklärte ich ihm, «ist das hier ein Megawartezimmer mit angekoppelten Milchstraßen zu Traumdestinationen. Wenn du nur langsam genug bist, wird dein Name sogar noch zweisprachig aufgerufen. Für mich ist es, als würde ich an der Tür zu einem großen Fest stehen, lauter Leute ein- und ausgehen sehen, aber selbst nicht hineindürfen. Not invited.»
«Gerade weil es so schwierig für dich ist, bin ich dir ja auch besonders dankbar, dass du mich hierher begleitest», sagte Alec und spielte Luftgeige, womit er meinte: Du redest ins Blaue hinein, aber mit einer schönen Musik unterlegt hören sich deine Worte an wie von Shakespeare.
Mein Bruder Alec und ich waren keine unbedingten Verfechter von Kiss and ride: Wir zogen das Abschiedspflaster sukzessive ab, langsam und schmerzhaft, kein Härchen auslassend. Abschied nehmen war unsere Tradition, darin waren wir gut. Oder schlecht, weil wir den Moment wie Hubba-Bubba-Kaugummi in die Länge zogen.
Was wir normalerweise taten, war, uns unaufhörlich voreinander zu verbeugen. Während er mit seinem Reisepass in der Hand auf den Grenzschutz-Schalter zusteuerte, um sich dann hinter dem Zoll aufzulösen, drehte er sich mindestens siebzig Mal um, und jedes Mal verbeugten wir uns wie Japaner voreinander.
Sich verbeugen steht in Japan für Respekt und Demut. Man küsst sich nicht zum Abschied, gibt sich auch nicht die Hand, sondern man verbeugt sich. Je tiefer man das tut, je näher die Nase dem Boden kommt, desto mehr Respekt erweist man jemandem.
Alec war hübsch, muskulös und eitel und überhaupt nicht demütig. Die Verbeugungen waren sarkastisch gemeint. Wie alle Wettkampf-Freitaucher liebte er seinen Körper. Wie ein Athlet. Er war stolz auf seinen Körper und sorgte für ihn wie eine reiche Witwe für ihren Pudel. Seine Tätowierungen passten zu dieser Eitelkeit, und alle waren japanisch, aber ich muss sie aus meiner Erinnerung hervorkramen, weil ich leider keine Fotos von all seinen Tattoos gemacht habe.
Auf jeden Fall hatte er die berühmte Manga-Figur Astro Boy auf dem Rücken. Eine Art großes Baby mit einer schwarzen Haartolle. Auf seiner Brust war Ebisu zu sehen, der Gott des Glücks und der Unterwasserwelt. Über den Pobacken stand in Mega-Buchstaben AKB48, der Name einer beliebten japanischen Girl-only-Band, reiner J-Pop-Kitsch. Nicht, weil er ihre eingängige Musik mochte, sondern weil die einst achtundvierzig und mittlerweile achtundachtzig Sängerinnen von AKB48 nie alle zusammen auftraten und zudem so oft wechselten, dass man nie wusste, wer gerade in der Band war und wer nicht. Alec liebte alles, was vage, vorübergehend und austauschbar war, daher seine Faszination für die Band. Auch hatte er einen Fetisch für japanische Mädchen in Schuluniformen.
Über seine Arme schlängelten sich japanische Blüten, rosa, weiß und rot, düstere Blumentattoos im Yakuza-Stil. Japaner und Tätowierungen, das geht nicht zusammen, man darf damit noch nicht einmal ins Schwimmbad. Einzig Mitglieder der japanischen Mafia, der Yakuza, sind in Japan tätowiert (obgleich ich vermute, dass mittlerweile immer mehr japanische Hipster vom Typ Künstler mit blondierten oder lila gefärbten Haaren mit Tattoos an verborgenen Stellen unter der Kleidung, nur für Intimi gedacht, die Welt bevölkern). Anständige Japanerinnen und Japaner tun es jedenfalls nicht. Mein Bruder wollte kein anständiger Mensch sein, im Gegenteil. Er wollte anders sein, anders leben, und er wollte gewinnen. Die Goldmedaille im Apnoetauchen erobert man, indem man tiefer und länger unter Wasser bleibt als alle. Was man kann, können nur sehr wenige Menschen auf der Welt. Das Gefühl, Teil einer einzigartigen kleinen Gruppe von Auserwählten zu sein, gehörte meiner Meinung nach zu dem Sport. Alle Freitaucher, die mittlerweile bei uns ein und aus gegangen waren, waren ebenso eitel und fanden wie er das Leben ohne Freitauchen extrem öde. Genau wie Alec suchten sie unter Wasser XTC im Reagenzglas, zeitweiliges Glück, etwas, das hin und her pendelte zwischen «nicht möglich» und «bin fast am Ziel».
Als wir an diesem Septemberdienstag bei den Zollschranken ankamen, blickte mein Bruder schon nervös auf seine Armbanduhr. Er befürchtete immer, sich zu verspäten; ein Tick von ihm. Mir dagegen widerstrebte es sehr, mich beeilen zu müssen, was indirekt ja vielleicht das Gleiche war.
«Geh nur schon», sagte ich, obwohl er noch gut zwei Stunden bis zu seinem Flug hatte. Ich spürte, wie angespannt er war, dass er fort oder jedenfalls schon unterwegs sein wollte.
«Nein, ich will noch nicht Abschiednehmen, Sissie.»
«Was ist los? Bist du nervös, oder was?», fragte ich zurück. Er brach zu einem Training auf und nicht zu einer Meisterschaft, darum verstand ich seine Anspannung nicht. Alec fühlte sich öfter nicht gut. Früher sagte er dann, er hätte Fledermäuse im Kopf, Unruhe und Lärm, worüber er keine Kontrolle besaß, und ich ging davon aus, dass er jetzt auch einen seiner Nebelmomente hatte. Ich fragte nie spezifisch danach, das verärgerte ihn.
«Wieso nervös?», sagte er stirnrunzelnd, als hätte ich ihn gebeten, mit seinem nackten tätowierten Hintern einen Stepptanz hinzulegen.
«So ein Gefühl», antwortete ich und zuckte mit den Achseln. Damals war ich noch so eine, die andere fragte: «Was denkst du jetzt?» oder «Ist etwas?» Sehr bohrend und nervig, aber ich wollte immer alles für andere tun und in Ordnung bringen. Vielleicht fühlte ich zu viel. Das denke ich jetzt. Dass ich zu der Zeit noch wie eine Lamellenjalousie war, zu viel und zu hartes Licht durchließ.
«Vergiss nicht, Sissie», Alec war ernst geworden, jetzt begann seine Prä-Reise-Predigt: «Nie auf hohen Absätzen laufen, und auch nie mit deinen dummen Zehenslippern auf die Straße. Immer nur in Schuhen, mit denen du davonrennen kannst. Und alles ist eine Waffe: Schreibstifte ins Auge, Bücherrücken gegen den Adamsapfel, und mit einem Handtuch kann man jemanden würgen. Und denk an das Messer, das ich dir geschenkt habe.»
«Alt-klu-ge Rat-schlä-ge», artikulierte ich wie eine Vorschullehrerin und tat so, als würde ich es mir mit einem Stift auf der Handinnenfläche notieren.
«Jetzt im Ernst, Hebe. Eines Tages wirst du dich erinnern, dann darfst du dich bei mir bedanken. Denk an deine Ellbogen, das sind die besten Waffen, die du hast.» Mein drei Jahre älterer Bruder bereitete mich schon mein ganzes Leben auf mögliche Katastrophen vor. Ich boxte, seit ich fünfzehn war, weil er es wollte. Wenn ich sagte: «Ich habe doch dich!», wurde er böse und meinte, ich müsste lernen, für mich selbst zu sorgen, dürfte nie von einem anderen abhängig sein, erst recht nicht von ihm.
«Ellbogen», wiederholte er und schlug dabei mit seiner flachen Hand auf seinen.
«Jaha!», antwortete ich.
«Jaha was?», rief er drohend und packte mich, fing an, mich zu kitzeln oder eher zu foltern.
«Los, wehr dich, du Schlaffi!» Aber ich musste lachen, und wenn ich lachte, hatte ich keine Kraft.
«Jaha, aaauuu, stopp!», schrie ich viel zu laut für einen Flughafen und versuchte, mich aus seinen Schwimmerarmen zu befreien.
«Jaha was?», und er tat, als würde er Klavier spielen, Bach auf meinen Rippen.
«Lieber Alec», rief ich immer noch lachend und versuchte, mir nicht in die Hosen zu machen.
«Lieber Alec was?»
«Jaha, lieber Alec», presste ich mit Mühe hervor, und da ließ er mich los. Mehrere Leute schauten jetzt zu uns her, und ich hatte Lust zu verkünden, er sei mein Bruder und sie sollten sich gefälligst um ihren Kram kümmern, aber das war nicht der Punkt. Ich hätte mich einfach lieber zu Hause verabschiedet, im Schatten und ohne Zuschauer. Jetzt hatte unser Abschied etwas Unnatürliches.
«Very well, Sissie», sprach er mit seinem affigen britischen Lehrerstimmchen und umarmte mich. Fast hätte er mich zerquetscht und meine Lungen zum Kollabieren gebracht, aber ich sagte nichts. So fühlte sich physische Bruder-Schwester-Liebe an, hart und echt.
Ich fühlte den wasserdichten Rucksack, der schlaff auf seinem Rücken hing. Es war nicht viel darin. Je leichter man reist, desto mehr Reisender ist man, und das war er: jemand, der loslassen und Menschen und Dinge hinter sich lassen konnte. Ich war noch nicht so, sondern schleppte bei Urlauben mein halbes Zimmer mit.
Nach seiner zerquetschenden Umarmung zog er seine Jacke aus und gab sie mir. Die würde ich mit nach Hause nehmen und in unserer Garderobe aufhängen. Wenn ich Alec wieder von Schiphol abholte, würde sich der Herbst schon dem Winter zuneigen, und ich würde seine Snowboardjacke mitbringen, damit ihm im Zug nicht kalt wurde. Dass mein Bruder den niederländischen Winter mit eisblauen Himmeln nicht mehr erleben, dass er die Niederlande nie wiedersehen würde, wusste ich da noch nicht. Ich verabschiedete mich noch von einem Bruder, der wiederkommen würde.
Bevor er fortging, gab mir Alec einen weißen Umschlag, auf dem mein Name stand.
«Erst im Zug öffnen, ja, Sissie?», warnte er mich. Erst da sah ich, dass seine Augen rot waren und kleine Tränenpfützen in ihnen standen.
«Warum weinst du?» Ich war nicht überrascht von seinen Tränen, das kannte ich, sondern eher vom Augenblick. Alec war nämlich sehr gut im Abschiednehmen.
«Ich weine nicht», murmelte er.
«Ich sehe es doch.»
Ich winkte ihm nach, bis ich seinen blonden Hinterkopf zwischen zwei Zollschaltern hindurchhuschen sah, und danach war er wie von einem Monster verschluckt – zack! – weg. Er hatte sich kein einziges Mal umgedreht. Ich hatte bis zum letzten Augenblick gedacht, er würde sich in einem Schwung umdrehen und auf und ab springen und sich sehr tief und lang vor mir verbeugen. Oder zurückkommen, um sich noch einmal zu verabschieden und danach nochmals in die Schlange einzureihen, sich dann doch so wie immer umdrehen und wie ein Japaner verneigen. Aber das geschah nicht. Alec war, ohne sich umzuschauen, durch den Zoll gegangen. Normalerweise fand ich es ja cool, dass mein Bruder kein Handy besaß, aber jetzt überfiel mich das verzweifelte Gefühl, jemanden nicht erreichen zu können, aber so gern sprechen zu wollen, dass man sein eigenes Handy am liebsten in Stücke geworfen hätte.
In seinen Augen hatten die traurigsten kleinen Lichter gestanden, aber erst als er weg war und durchs Niemandsland zu seinem Gate ging, wusste ich plötzlich, dass ich ihn nicht hätte gehen lassen dürfen. Ich hätte ihn in ein Restaurant mitnehmen und sämtliche Gerichte auf der Karte für ihn bestellen sollen, damit der Tisch so gefüllt war, dass ein Beistelltisch geholt werden musste und er sein Flugzeug verpasste.
Wenn, ja wenn. Pustekuchen.
Ich ging zurück zur Ankunftshalle, unter der die Züge wie gelbe Schlangen hin und her durch die Tunnel fuhren, und wartete dort auf Bahnsteig 1a. Als die Bahn einfuhr, erschien sie mir plötzlich wie das traurigste Gefährt, das ich jemals gesehen hatte. Es war, als wäre ich es und sähe mich selbst, gelb und elend. In Japan wäre das hier ein supersonischer weißer Zug mit flacher, schnabelförmiger Nase, der auf die Sekunde genau abfuhr. Im Zug würden sich die Schaffner verbeugen, um den Passagieren Ehre zu erweisen, und er würde so megaschnell fahren, dass es sich beim Gang zur Toilette anfühlen würde, als stünde man unter dem Einfluss von g-Kräften.
In dem leeren Wagen roch es nach Pommes. Ich entschied mich für eine Sitzbank, die ziemlich sauber aussah, ohne überquellenden Müllbehälter, und einen Platz in Fahrtrichtung, mit der Zugspitze nach Amsterdam.
Auf meinem Schoß lag seine Jacke; eine Hülse, mein Bruder ohne Bruder darin.
Als wir aus dem dunklen Bahnhof glitten, war ich überrascht, dass die Sonne noch so hoch am Himmel stand. Bisher hatte es sich wie Abend angefühlt, das Ende von etwas, doch es war früher Nachmittag. Sonnig sogar, ein potenzieller Tag für den Park. Die vorhandene Sonne ließ mich aber zunächst kalt. Ich musste noch verarbeiten, dass ich wieder diejenige war, die nach Hause zurückfuhr, und er derjenige, der abgereist war. Ich starrte auf die silbrigen Gebäudemassen, wo Menschen ihr Leben in diesem schrecklichen Neonlicht fristeten, von dem man eine bleiche Haut und Bouillonaugen bekommt.
Dann fiel mir Alecs Karte wieder ein. Ich angelte sie sofort aus meinem Rucksack und riss den zugeklebten Umschlag auf. Darum wollte mein Bruder, dass ich die Karte erst im Zug öffnete. Er wusste, dass ich mich in dem grauen After-Moment des Verabschiedethabens allein und traurig fühlen würde, und die Karte war die Ernte des Abschieds. Alec hatte sich letztes Jahr «Sissie» auf sein Herz tätowieren lassen und darunter in japanischer Schrift meinen Namen, Hebe (). Ich sei immer bei ihm, versicherte er, wenn ich ihn über Skype sprach, wo immer er auch sei, und dann schob er seine Brust vor das Mikroauge seines Notebooks.
Da stand es wirklich.
Keine Ahnung, wo Alec seine Karten kaufte; jedenfalls war er sehr gut darin. Originelle Exemplare zu finden war eines seiner Hobbys. Die Vorderseite dieser Ansichtskarte zeigte ein eisernes Tomoe, ein bekanntes Symbol aus dem japanischen Shintoismus, das an sich überschlagende Wellen erinnert. Es ist das Samurai-Symbol für Wasser; ich kannte es, weil Alec ganz versessen auf Symbole war. Ein Tomoe wurde früher als Schutz gegen Feuer betrachtet.
Nach seinem Tod erhielt die Karte Bedeutung. Schmerz ist Feuer. Es brennt dir das Herz weg und hinterlässt fürchterliche Blasen und Narben. Alec hatte eine Karte mit einem Tomoe als Schutz gegen den Schmerz gewählt, den er verursachen würde.
An dem letzten bisschen Alec schlürfend las ich die Rückseite seiner Abschiedskarte. Ich zählte die Zahl der Silben. Ja, Alec hatte ein Haiku verfasst; eine berühmte, ultrakurze japanische Gedichtform, methodisch unterteilt in drei Zeilen: die erste fünf Silben, die zweite sieben, die dritte Zeile wieder fünf. Macht siebzehn.
Der Zug wurde langsamer, als wir in den Süden Amsterdams einfuhren. Ich betrachtete die Rückseite von Gebäuden, sah Menschen hinter Glas auf Bürostühlen, den Rücken der Stadt. Die Stadt war anders ohne Alec, unheimlicher.
Keine Ahnung, wie er es hinbekommen hatte, die japanischen Schriftzeichen mit der Hand auf die Karte zu schreiben. Bestimmt kannte er um mehrere Ecken jemanden, den er gebeten hatte, das zu tun. Ein kleiner Scherz von Alec. Jetzt musste ich jemanden suchen, der oder die Japanisch lesen und mir übersetzen konnte, was da stand.
Sofort kam mir der Geistesblitz, bei dem japanischen Restaurant gleich hinter uns vorbeizuschauen, wo wir manchmal mit meinen Eltern und Alec gegessen hatten. Das letzte Mal waren wir dort gewesen, um mein bestandenes Abitur zu feiern. Wir hatten an diesem Abend darüber gesprochen, was ich mit meinem Leben anfangen sollte; etwas, das ich nach wie vor nicht weiß. (Weiter als beim benachbarten Italiener zu arbeiten, manchmal in der Spülküche, manchmal als Bedienung, manchmal half ich beim Zusammenhauen der Desserts, bin ich noch nicht gekommen.)
Es ist, als würde jemand dich fragen, ob du in einem Wort beschreiben kannst, wer du bist. Unmöglich. Danach musst du eine Trennlinie zwischen dem ziehen, was du bist, und dem, was du kannst oder womit du dich beschäftigen willst, aber das gelang mir weder damals, noch tut es das bis heute. Es ist, als stünde eine gemauerte Wand zwischen mir und der Zukunft. Die Frage ist zu groß, die Lösung zu wichtig.
Alec gab mir an diesem Abend in dem japanischen Restaurant eine Karriereempfehlung, und zwar, dass ich reisen sollte, bevor es «zu spät» sei.
«Zu spät für was?», hatte ich gefragt.
«Bevor du an Langeweile stirbst wie ein Goldfisch in seinem Glas», hatte er geantwortet und dabei auf das Restaurantaquarium gezeigt, in dem ich, soweit ich etwas von Fischen verstand, keine Goldfische oder Nemos herumschwimmen sah.
«Eine postapokalyptische Reise, schön!», hatte ich resümiert und ein Zombiegesicht aufgesetzt.
«Nein, ein grausiges Aquariumleben.» Er hatte mir einen Fischmund mit hervorquellenden Augen gezeigt.
In Amsterdam-Zuid stieg ich aus und begab mich hinab in den Fahrradkeller. Perfekt als Tatort für einen Mord; ich kam nicht gern hierher. Ich kettete mein Fahrrad los und schob es rasch hinauf ins Licht. Rund um den Bahnhof sah ich die Welt wieder, zu der ich nicht gehören wollte. Ich könnte nie den ganzen Tag im Neonlicht sitzen. Und immer bewegt sich ein stetiger Strom von Menschen in Bürouniform über den zentralen Platz, alle mit leerem Blick und dennoch in strammem Marschtempo in eine Richtung. Sie scheinen sich nie zu fragen, wohin sie gehen, sondern ihre Bestimmung schon sämtlich zu kennen. Als wüssten sie sich auch außerhalb der hohen, grazilen, schimmernden Gebäude, in denen sie arbeiten, durch ihren Beruf geschützt.
Durch den kleinen Fahrradtunnel unterquerte ich die Autobahn und radelte zu dem japanischen Restaurant.
Man saß noch beim Lunch. Es war der gleiche Typus von Büromenschen wie beim Bahnhof. Schwarze Jacketts hingen über Stuhllehnen, Handys lagen auf den Tischen.
Ohne je selbst in Japan gewesen zu sein, empfand ich die Einrichtung als typisch japanisch. Besonders das Einfache daran: Dunkles Holz auf dem Boden, riesige durchscheinende Lampions an der Decke, sanftes Licht. In der Glasvitrine lagen die rohen Fischstreifen und die Austern auf Eis. Im «Private-Dining»-Bereich waren die mit Schwalben bemalten Papiertüren zugeschoben. In den Schuhregalen standen Lederschuhe mit schmal zulaufenden Spitzen und teuer aussehende Pumps, auf denen zu laufen mir Alec verboten hatte, weil man damit einen wackligen Stand hat und auch nicht wegrennen kann. In dem Restaurant selbst durfte man seine Schuhe anbehalten, aber wer in den Privaträumen aß, musste sie nach japanischer Sitte ausziehen. Witzig, die ganzen Geschäftsleute dort wie spielende Kinder in Socken dasitzen zu sehen.
Der eigenartige Abschied von meinem Bruder umhüllte mich noch. Ein Gefühl kann man einschließen, gefangen halten. Hätte ich ihn weiter löchern sollen, weswegen er weinen musste? Ich habe nie versucht, meinen Bruder gewaltvoll aufzubrechen. Ich hasse diese «Hätte-ich-nur»-Gedanken. Sie ergeben den gleichen frustrierenden Herzschmerz wie Liebeskummer und bringen einem rein gar nichts: Deine Vergangenheit ist in Stein gemeißelt und nicht mehr zu ändern.
Ich ging zu dem Japaner an der Bar. Ich erkannte ihn von dem Besuch, als wir hier zu viert gegessen hatten. Er schien der Besitzer zu sein oder jedenfalls jemand, der schon jahrelang hier arbeitete, und ich fragte, ob ich ihn um einen Gefallen bitten dürfte.
«Natürlich», nickte er höflich, und selbst wenn er keine Lust oder Zeit für mich hatte, ließ er sich das nicht anmerken. Das war typisch japanisch – Alec und ich fanden es beneidenswert: Man weiß nie, was jemand denkt oder fühlt, das Gesicht ist kein Aushängeschild dessen, was in einem vorgeht, sondern eine Maske der Höflichkeit. Ich gab ihm die Karte und bat ihn, mir die japanischen Schriftzeichen zu übersetzen.
«Da steht ‹Ultra-Individuum› oder ‹ultra-einzigartig›», übersetzte er mit seiner Lesebrille auf der Nase.
«Ultra-Individuum oder ultra-einzigartig», echote ich, die Worte kostend, weil sie so neu waren.
«Ist das etwas typisch Japanisches?», erkundigte ich mich, aber sein Gesicht hatte schon etwas Fragendes gehabt, als er das Wort aussprach.
«Nicht, dass ich wüsste», sagte er leise.
«Ultra-Individuum bedeutet vielleicht einfach, dass jemand perfekt ist?», versuchte ich.
«In Japan ist Perfektion kein Bestreben.»
«Nein?», fragte ich dümmlich.
«In Japan», fuhr er fort, «nennen wir das Wabi-Sabi, etwas, das unfertig ist, unperfekt. Der Geist kann damit arbeiten. Was soll jemand noch auf dieser Erde, wenn er oder sie perfekt ist? Dann hat dein Geist nichts mehr zu tun, ist fertig, Buddha geworden, erleuchtet.»
Ich nickte, obwohl ich noch verarbeiten musste, was er alles gesagt hatte. Er gab mir die Karte wieder und erkundigte sich nach dem Absender.
«Mein Bruder», antwortete ich. «Er mag Rätsel, gibt absichtliche Halbinformationen. Er mag keine vorgekauten Sachen, sondern will, dass die Menschen sich anstrengen und selbst nachdenken.»
«Dann hat er Wabi-Sabi gut verstanden», lachte der Mann.
«Ganz herzlichen Dank, arigatō.» Ich machte eine kleine Verbeugung, aber nicht zu tief, höflich, aber nicht übertrieben. Ich versprach ihm, dass wir bald mal wieder mit der ganzen Familie zum Essen kommen würden – was wir nie getan haben. Ohne es je untereinander ausgesprochen zu haben, vermeiden meine Eltern und ich alle Orte, an denen wir jemals zu viert gewesen sind. Am liebsten wäre mir, sie würden auch das Haus mitsamt allen Erinnerungen darin verkaufen, aber das wollen meine Eltern nicht. Sie wollen die ganzen Erinnerungen an Alec auch weiter um sich fühlen. Am bedrückendsten für mich ist, dass sie sein Zimmer intakt gelassen haben. Noch immer hängt die Hoffnung in der Luft, dass er zurückkommen wird, lediglich auf Reisen ist, dass er noch irgendwo existiert. Sein Zimmer ist ein Raum geworden, in dem statt Frischluft diese falsche Hoffnung hängt. Ich betrete es nie.
Drinnen in dem japanischen Restaurant, zwei Straßen von unserem Haus entfernt, war es dämmerig gewesen, aber einmal draußen schien mir die Sonne geradewegs in die Augen. Es war, als befände sich das Restaurant außerhalb der Zeit. Auf dem Gehweg davor las ich Alecs Karte nochmals:
Sissie,
such nicht danach, wer du bist, sondern danach, wer du sein willst.
Werde ein
Wandle, unser Land,
er, der ohne mich fortging,
hat das, was du suchst.
Geh auf die Suche danach.
Love you long time.
Dein Bro, :-x, Alec
Zehn Tage später klingelte das Telefon und ich hob ab. Das war der Moment, in dem mein Leben von einem Samuraischwert entzweigeschnitten und in zwei Leben zerteilt wurde. Die Schnittlinie war dieser Anruf.
Ich hörte die Stimme sagen, sie sei von der niederländischen Botschaft, und die Stimme fragte, ob meine Eltern zu Hause wären. Ich hörte mich «die sind nicht da» sagen. Die Stimme fragte, ob ich die Schwester von Alec Lispector sei, und ich sagte: «Ja, ich bin Alecs jüngere Schwester». Die Stimme sagte, sie habe sehr schlechte Nachrichten und es täte ihr furchtbar leid, mir mitteilen zu müssen, dass Alec ertrunken sei.
Ich stand in der Küche mit dem Telefon am Ohr und konnte die Stimme nicht mehr hören, weil das Dach unseres Hauses aufriss und die Dachterrasse, die Dachziegel, der Schornstein, alles herabstürzte.
Es konnte nicht sein, Alec machte keine Fehler, und doch wusste ich, es stimmte. Ich fühlte, dass er nicht mehr da war, dass er in meiner Welt nicht mehr existierte. Die Stimme hinterließ ihre Nummer, damit wir sie zu unserer Zeit zurückrufen konnten, um alles Weitere zu besprechen. Es tue ihr furchtbar leid, sagte die Stimme wieder, bevor sie auflegte.
Ich schaute um mich und stand in einem Kriegsgebiet.
Die Leute werden in Zukunft sagen: «Hebe, du musst dein Leben weiterleben.» Vergiss es, das ist ein Scheiß-Rat. Der einzige Rat, von dem man etwas hat, ist: Geh als Erstes kaputt und steh dann wieder auf.
TEIL 1
1a. (K)eine
«Sissie, now is the time to watch and observe, not to judge.»
(Mai 2013 – Kalifornien)
Während ich durchs Niemandsland gehe, vorbei an den Duty-Free-Stores, fühle ich mein Leben durch mich hindurchziehen: Reservoirs voll gebrauchter Gedanken, die ganzen mit «Warum» beginnenden Fragen, fallende Erinnerungen, die Beulen machen.
Seit dem Anruf ist mein Leben ein konstanter Slalom durch alle Zeiten, hauptsächlich die Vergangenheit, und ich versuche, sämtlichen sieben Weltmeeren auszuweichen, inklusive Küsten, Stadtstränden, Postern von paradiesischen Stränden, aber auch Filmen, in denen das Meer, Sand, die Unterwasserwelt, Waterboarding im Irak oder Badeorte vorkommen.
Ich will meinen Bruder vergessen und niemals vergessen, denn mein Bruder war noch längst nicht fertig und andererseits wieder doch, denn wer tot ist, ist fertig. Fertig und vorbei. Jetzt will ich weg, mich abstoßen von meinem alten Leben in Amsterdam wie vom Rand eines Schwimmbeckens und davonschwimmen, weit, weit fort.
Das Allerlei aus Büfettrestaurants, Austern- und Kaffeebars, internationalen Zeitungs- und Elektronikgeschäften macht einen traurigen Eindruck. Alle hasten in hohem Tempo daran vorbei, als wären es Museen. In dem Souvenirladen allerdings stehen Leute, sie probieren gerade Wooden-Shoe-Pantoffeln. Weniger niederländisch als Holzschuhe aus Stoff geht eigentlich nicht, und doch erinnern sie Ausländer an Holland. Das ist das Eigenartige an Erinnerungen: Sie brauchen gar nicht mal zu stimmen.
Ich bleibe nicht stehen, brauche nichts zu kaufen, möchte nichts kaufen, Sachen sind schwer, und ich will im Gegenteil leichter werden.
Den Fahrsteig, der die Gates entlangführt, benutze ich nicht. Das gibt einem etwas öffentlich Müdes, als wolle man nicht an der echten Welt teilnehmen und sich stattdessen gedankenlos in Richtung der Sektion «Traum und Illusion» bewegen. Ich laufe lieber, ich laufe gern, es gibt mir das Gefühl, dass ich und die Erde es zusammen okay haben.
Ich muss noch mal aufs Klo, will mir die Zähne putzen, pinkeln, die Wasserflasche auffüllen und in den Spiegel schauen, und biege zu einem Toilettenblock zu meiner Linken ab. In den Damentoiletten steht eine Reinemachefrau an die Wand gelehnt da und blickt unbeirrbar weiter auf ihr Handy, als ich hereinkomme.
«Guten Morgen.»
«Kuut Morken», antwortet sie.
Für die meisten Menschen ist sie bestimmt unsichtbar, eine Fliege an der Wand, aber ich will, dass sie weiß, dass ich sie sehe. Ich weiß auch, dass ich das tue, weil ich selbst gern gesehen werde, aber das ist mir gleich.
Ich merke schon jetzt, wie ich mit mir selbst umgehe, seit ich allein auf Reisen bin: Ich rede in der Wir-Form mit mir. Das fühlt sich nicht merkwürdig an, ist es aber dennoch. Wir treten mal kurz aus, wir putzen uns die Zähne, wir haben Zeit genug. Mit wem rede ich eigentlich, wenn ich «wir» sage? Einem Alter Ego? Nein, nach meiner Auffassung spreche ich diejenige an, die mich all diese Dinge tun sieht. Passiert das, wenn man allein reist, dass man sich selbst allmählich als Reisegesellschaft betrachtet?
Ich putze mir die Zähne, um den Eisengeschmack meiner Abreise wegzuspülen, und denke darüber nach, was Alleinreisen eigentlich ist, wie es ist, was man den ganzen Tag tut, wenn man reist, aber eine konkrete Antwort hat niemand mir geben können. Ich betrachte mich in dem Toilettenspiegel. Ein Gesicht ohne Berge. Ein Flachlandgesicht, auf dem alles zu sehen ist. Ich sehe müde aus, farblos, und der Spiegel bekommt die Schuld, er ist zu sklavisch.
Ich heiße Hebe, sage ich in Gedanken zu dem Spiegel, aber ich will diesen Namen nicht mehr, er nimmt zu viel Platz ein. Es ist der Name von einer, die ich nicht mehr sein will. Ich brauche einen Reisenamen, etwas Neues, etwas, das nichts mit meiner Vergangenheit zu tun hat, einen Namen in giftig-grellen Fluorfarben.
«Wie heißen Sie?», frage ich die Reinemachefrau, die immer noch an die Wand gelehnt dasteht und wie hypnotisiert mit ihrem Handy zugange ist. Sie schaut mich fragend an.
«What’s your name?», versuche ich.
«My name is Zhuli but everybody calls me Girl», antwortet sie freundlicher als ich es erwartet habe.
«Girl», wiederhole ich, «great name.»
«Thank you», erwidert sie lächelnd.
«And your name?»
«Still thinking about it», sage ich und sie lacht. Ich weiß sicher, dass sie mich versteht: ein Name kann schwerer wiegen als ein Rucksack mitsamt einem Sonnenschirmfuß aus Beton darin. Manchmal gelingt es nicht zu sagen, was man sagen will, weil man nicht weiß, was man will. Manchmal dagegen gelingt es, und dieses Stadium habe ich erreicht. Ab jetzt heiße ich «Girl», ein Name ohne Vergangenheit, so anonym wie eine Reisende: Ab jetzt bin ich (K)eine.
Meine Eltern haben mich beim Zoll verabschiedet. Fürchterlich war das. Ich hatte das Gefühl, dass es mir vor Schuldgefühlen die Rippen zerreißt. Seit sieben Monaten bestehen wir aus einer Drei-Einheit. In der Kirche, in der wir einst für kurze Zeit die Kindermesse besuchten, bis Alec und ich es beide nicht mehr wollten, steht «drei» für das Kreuzzeichen, das man machen soll; der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Den Sohn gibt es nicht mehr. Drei ist eine schlechte Zahl, einer bleibt immer außen vor; drei, das lahmt. Und doch sind wir nun zu dritt, es haut nicht hin und doch ist es so.
Nachdem wir im La Place Kaffee getrunken hatten, meine Eltern aßen ein belegtes Brötchen dazu, ich nichts, Nervosität hatte meinen Magen auf Haselnussgröße schrumpfen lassen, standen wir vor dem Zoll.
Derselbe Ort, ein anderer Abschied.
Um uns her winkten Familien, die aussahen, als ob sie genau das Gleiche fühlten wie wir. Sie schienen ebenfalls an Abschiedsschmerz zu leiden. Auf einmal wurde mir schwindelig und ich wollte nicht mehr fort. Es fühlte sich an wie pures Heimweh, und das Gefühl kannte ich von früher, wenn ich mal auswärts schlief: die Angst, zu Hause vergessen zu werden.
Der Flughafen, die Gesichter um mich herum, diese Schwimmbad-Geräuschkulisse, das scheußliche Neonlicht bekamen etwas Unfestes und Zittriges, als hätten sich das Leben und sogar meine eigenen Eltern auf einmal von mir gelöst. Ich stand in Fantasyland. Ich sah mich hier wieder mit Alec stehen, vor nur sieben Monaten, und ich musste ganz schlimm weinen. Danach ging es wieder. Tränen machen hässlich, aber mit ihnen fließt Trauer ab, und ich war lieber hässlich als verzweifelt.
Alec wollte nicht, dass ich abhängig von ihm würde, aber mein Gefühl sagte mir, dass er und ich immer abhängig voneinander gewesen sind. Das sind komplizierte Gedanken, wenn jemand tot ist, von der anderen Seite gibt es keine Antwort mehr. Es ist wie mit Gott telefonieren zu wollen.
Ich würde in «unser» Land fliegen, nach Japan. Alec hatte gesagt, er hoffte, dass ich nach der Schule auf Reisen gehen würde. In Amsterdam bleiben konnte ich einfach nicht, hier quälte mich dieses Nicht-Warten auf Alec, das sich wie ein Nonstop-Warten auf jemanden anfühlte, der nicht mehr wiederkommen würde. Die erste Zeile des Dreizeilengedichts, das Alec auf seine letzte Karte geschrieben hatte, lautete: Wandle, unser Land. Was er mit den beiden anderen Zeilen gemeint hatte, wusste ich nicht, aber die erste erschien mir klar: dass ich mich wandeln und bewegen, mich auf den Weg machen sollte in unser Land.
«Wir sind sehr stolz auf dich, Hebe», flüsterte meine Mutter, als ich ging. Meine Mutter, die seit Alecs Tod zehn Kilo leichter ist und dadurch eher aussieht wie ein junges Mädchen, eine purere Version ihrer selbst. Meine Eltern fanden es sehr gut für mich, dass ich mich für einen eigenen Weg entschieden hatte in dem Versuch, mit meiner Trauer umzugehen, einen Weg in den Fußspuren seiner letzten Karte, es hatte auch etwas von einer Wallfahrt.
«Ich bin auch stolz auf euch», rief ich zurück.
Mit weichen Knien und elektrisch geladenen Füßen, die bibberten, als ob ich vorhin erst meine Rollschuhe ausgezogen hätte, näherte ich mich dem Zoll. Ich würde abreisen, und meine Eltern blieben allein in Amsterdam zurück, ihre Kinder beide verschwunden, mit dem Unterschied, dass das eine noch skypen konnte, das andere nicht.
Ich winkte so lange, bis ich durch den Zoll war und die Grenzbeamten mir eine «gute Reise» gewünscht hatten – herzerwärmend. Es gefiel mir, dass jemand mir mal etwas Leichtes und Positives wünschte: eine gute Reise, nach all den Malen in letzter Zeit, in denen jemand «wie schlimm» und «ist das schlimm» gesagt hatte. Es war das Wort, das ich die letzten sieben Monate vielleicht am häufigsten gehört hatte: schlimm. Ich verstand auch, warum das so war: Es ist die einfachste Manier, das Wort «tot» zu umschiffen.
Während ich weiter in Richtung Gates durch den Flughafen ging, wiederholte ich es, schlimm, schlimm, schlimm, und es wurde immer merkwürdiger und hässlicher.
So geht das mit Wörtern.
1b. F8
Mein Gate hat einen Tastaturnamen, F8, mit Ziel Tokyo, und ich setze mich so nah wie möglich an die Ausgangstür. Um mich herum sitzen Japaner mit extrem großen Handys und langen Köchern mit Postern aus dem Van Gogh Museum auf dem Schoß. Sie fahren nach Hause, ich von zu Hause fort; dasselbe Flugzeug, dieselbe Destination, aber derart andere Gefühle.
Wir haben noch anderthalb Stunden bis zum Abflug, aber ich sitze schon da, habe Angst, meinen Flug zu verpassen, das habe ich schon so oft geträumt. In diesen Träumen passiert immer dasselbe. Ich betrete ein Flugzeug, und nachdem ich angeschnallt bin und mich umschaue, sitze ich plötzlich doch nicht im Flieger, sondern im Wohnzimmer meiner Eltern. Mist, wieder daheim.
Mit dem Gefühl, gescheitert zu sein, wache ich dann auf.
Ich schaue durch das Riesenfenster von F8 nach draußen. Das Flugzeug schimmert – come fly with me – in der Sonne, und ich sehe die Piloten mit ihren weißen Hemden schon im Cockpit sitzen. Die Fenster eines Flugzeugs sind wie schmale Augen in einem verfeisteten weißen Körper aus amerikanischem Aluminium. Kleine Menschlein in fluoreszierenden Westen mit schützenden Mickymausohren auf dem Kopf umwuseln die Maschine auf Elektrokarren, während sie gefüttert wird. Ein dicker Schlauch lässt das Kerosin mit der gleichen Gewalt in sie hineinschwappen, wie es in Texas aus der Erde spritzt. Fast fünfzigtausend Kilo erheben sich demnächst in die Luft: die einzeln abgepackten Mahlzeiten (Abendessen und Frühstück), Kaffee, Teebeutel, das ganze Wasser, die Coladosen, Weine, alkoholfreie Biere, Sakes und Fruchtsäfte. Und dann noch sämtliche Champagner- und Cognacflaschen für die Businessclass-Menschen und natürlich auch die steinähnlichen Brötchen, die einem mit so einer gruseligen Zange angereicht werden.
Auf der Seite bewegen sich die Koffer über ein Fabrik-Fließband hinein. Meinen großen Rucksack entdecke ich auf die Schnelle nicht, doch ich vertraue dem System.
Ich habe meine kleine Rucksacktasche, die als Handgepäck mitgeht, zwischen meine Füße auf den Boden gestellt, aber ich überlege es mir, nehme sie auf den Schoß und lege meine Arme darum: Ich kann momentan alles Glück von sämtlichen Göttern gebrauchen. Eine meiner Klassenkameradinnen hatte syrische Eltern, und sie stellte ihre Schultasche nie auf den Boden, ein soweit ich weiß arabischer Brauch – etwa in der Art, dass es sonst Unglück bringt und den bösen Blick. Vielleicht hatte es auch mit Hygiene zu tun, bei ihr daheim zog man genau wie in Japan die Schuhe gleich an der Haustür aus.
Auf meinem Schoß liegt jetzt mein halbes Reiseleben in beigem Canvas: eine Flasche Wasser, gesalzene Mandeln und getrocknete Feigen, meine Zahnbürste, eine Minitube Zahnpasta, ein Buch (Pocket, kein schweres Hardcover), eine Garnitur Unterwäsche, Socken, T-Shirt, Kapuzenpulli, schnelltrocknende Hose, Kontaktlinsenflüssigkeit, meine Brille, Gesichtscreme, orangefarbene Ohrenstöpsel und eine Schlafmaske. Sollte mein aufgegebenes Gepäck verlorengehen, dann habe ich für die ersten Tage alles. Tipp von Alec, wem sonst.
Jetzt, wo ich sitze und nichts Konkretes zu tun habe, lodert der Zorn wieder auf. Astrid, meine beste Freundin, hat schon zwei Tage nichts von sich hören lassen. Ich bin mir unschlüssig über unsere Freundschaft. Als ich Astrid erzählte, dass ich nach Japan fliegen würde, sagte sie nicht «spannend» oder «wie stark von dir», sondern fragte bloß irritiert, wann ich denn wiederkäme.
«Weiß ich noch nicht», gab ich wahrheitsgemäß an.
«Wieso, weiß ich noch nicht?», hatte Astrid grämlich und verletzt geantwortet: «Du wirst doch wohl wissen, wann du wieder zurückkommst?» Nein, dumme Kuh, das weiß ich nicht, ich bin die Besitzerin eines Überraschungstickets, aber das traute ich mich nicht zu sagen. Ich konnte bei Astrid nicht direkt reagieren, die Worte kamen immer erst hinterher, zu spät und darum mit Bedauern vermischt.
Ich hätte ihr sagen müssen, sie möge bitte schön Rücksicht auf mich nehmen, genau wie ich auf sie. Und wie sehr ich es hasste, dass sie mich so zutiefst verletzen konnte, und dass ich manchmal sogar den Verdacht hatte, sie würde absichtlich Zitrone über allem ausdrücken, was bei mir roh, steakrot und offen war. Und doch will ich sie nicht verlieren.
Sie betrachtet es als Hochverrat, dass ich jetzt allein auf Reisen gehe, und beantwortet das mit Schweigen, dem App-Tod: wohl online sein, aber nichts erwidern. In ihrer letzten App-Nachricht von vor zwei Tagen stand: «Wenn du jetzt gehst, wird es danach nie mehr dasselbe sein.» Hätte ich sie nicht so gut gekannt, hätte ich gedacht, es sei lieb gemeint, emotional, anhänglich. Aber ich kenne sie zu gut und zu lange und weiß, es soll eine Drohung sein: Don’t you fucking dare to leave.
Mit meiner Abreise ohne sie habe ich unseren Pakt als Forever-Friends entzweigerissen, und alle unsere Routinen kullern wie M&M’s über den Boden. Das macht sie wütend, aber nicht, weil mein Leben entwurzelt ist, sondern weil ihr Leben jetzt durcheinander liegt.
Ich nehme mein Handy aus dem vorderen Fach meines Rucksacks, habe zum Nachdenken gerade keine Lust mehr. Ich betrachte das Weltall, das ich als Hintergrundfoto habe, eines dieser mitgelieferten Standard-Handyfotos mit einem schwarz-lila Himmel mit gelben Punkten, entworfen in Kalifornien, produziert in Shenzen. Die ganze Fakesterne sind also chinesisch und erst wenige Jahre alt, obwohl es so wirkt, als sähe man ein echtes Foto der NASA mit Millionen Jahre alten Sternen.
Ziemlich unheimlich, wie fake alles ist. Ich mag keine Fakes. Der Tod ist zwar echt, fühlt sich merkwürdigerweise aber auch fake an, umkehrbar, wie etwas Vorübergehendes. Etwas weiter ist eine Ladestation, ich habe noch 72 Prozent und beschließe dennoch, ein wenig nachzuladen, für den Fall, dass. Ich stehe ungeschickt auf und mein Handy fällt auf den Boden, zum hundertsten Mal vielleicht. Manche heben verstört die Köpfe. Tut mir leid, würde ich sagen wollen, aber ich schweige natürlich; nur in meinem Kopf bin ich mutig. Schnell hebe ich es vom Boden auf, und dann sehe ich es. DASKANN DOCH ZUM TEUFELNICHT WAHR SEIN! Ich stecke es in die Tasche, wie wenn nichts wäre, ich will nicht, dass die Leute sehen, wie rot ich bin, dass mir die pure Panik zu Kopf steigt, und gehe möglichst ruhig zu der Ladestation, vor der ein leerer Hocker steht. LASSES VERDAMMT NOCH MAL NICHT WAHR SEIN, NICHT JETZT!
Ich zücke mein Handy wieder und sehe mich reflektiert auf einem dunklen Display, zerschlagen in kleine Stücke: ein blasses Splittergesicht, zum Igel geworden, bitte nicht berühren. Die Displayscherben sind lose, schneiden mir in die Finger, und ich bekomme Lust, mein Handy noch weiter an der Wand dieser stündlich gereinigten Flughafentoiletten zu zertrümmern. Nein, erst an die Ladestation anschließen, dann einfach neu einschalten, kommt in Ordnung, Handys sind keine rohen Eier oder Babyköpfchen. Aber auch mit eingestecktem Ladegerät und wie eine Verrückte auf «Ein» drückend, geschieht nichts, zero, nada.
Ich lasse mein Handy an der Ladestation hängen und gebe ihm eine halbe Stunde, da kann es in aller Ruhe aus dem Land der Dämmerung zurückkehren (vielleicht war es leerer als ich dachte? O falsche Hoffnung, let it be) und demnächst wieder unvermittelt aus seinem mechanischen Tod hervorphönixen, stellt sich die Sache als mobiles Koma und nichts Endgültiges heraus.
Ich schaue mindestens tausend Mal auf mein Handgelenk, bevor eine halbe Stunde, na gut, zwanzig Minuten, vorbei sind. Erst jetzt fällt mir auf, wie sehr man auf sich selbst angewiesen ist, mit den eigenen Gedanken zurechtkommen muss, wenn man kein Handy mehr hat. Die ganze Zeit liegt es mit dem Display nach unten auf dem Tisch, damit ich seine ramponierte Visage nicht zu sehen brauche. Dann schalte ich es wieder ein, das Boarding für die Businessclass-Passagiere hat mittlerweile schon begonnen, doch nichts geschieht. Das Display bleibt schwarz und es erscheint kein Batteriesymbol, selbst kein schwacher, fahler Hauch von Licht im Hintergrund. Zum ersten Mal befürchte ich jetzt wirklich, dass es vorhin kaputtgegangen ist, und sofort will ich nicht mehr ins Flugzeug. Allein unterwegs, darauf bin ich geistig vorbereitet, aber nicht ohne Handy, das ist zu allein, ab-so-lut nicht so gemeint, nicht das, was ich will, ICHWILL DAS NICHT, das hier ist WIEDER ETWAS, DAS ICH NICHT WILL, UND WAS DENNOCH PASSIERT. ZUM TEUFELAUCH.
Es fühlt sich wirklich an, als ob noch etwas gestorben wäre, ich muss auf der Reise doch ein Handy mithaben, das hier ist ein schlechter Scherz und ich will es nicht, aber je mehr ich mich dagegen sträube, desto wütender werde ich. Das habe ich nicht verdient, denke ich, ein lähmender Gedanke, der mich nur noch mehr zum bedauernswerten Opfer macht, und so fühle ich mich auch. Ein Opfer, weil mein Handy tot ist, und mein Bruder. Ich kenne nichts Beruhigenderes als Kamillentee, Birneneis und bis zehn zu zählen, und in Ermangelung der ersten beiden zähle ich halt bis zehn. Es mag kindisch sein, aber Zählen hilft wirklich.
Gut, es geht nicht mehr, und jetzt rein ins Flugzeug, kauf dir halt in Tokio ein neues, Schluss mit diesem Gejammer. Ich hasse es, gesagt zu bekommen, ich würde mich anstellen, und darum sage ich es extra zu mir selbst, um mich zu ernüchtern: STELLDICH NICHT AN, MENSCH,ES IST NUR EIN HANDY!
Denn wichtiger als dieses Handy ist die Reise, die vor mir liegt. Alec wollte, dass ich auf Reisen gehe, etwas suche, etwas in Erfahrung bringen würde.
Er hat mir ein Ziel gegeben. Und dafür bin ich ihm zutiefst dankbar.
2. Halb Tier, halb Mensch
«Höre auf niemanden sonst als das Meer, es erzählt dir das, was du wissen musst: das, was du schon wusstest.»
(Oktober 2016 – Miami)
Als wir wie die Schafe ins Flugzeug dirigiert werden, klopfe ich direkt vor dem Einsteigen kurz mit der flachen Hand auf die Außenseite. Kälter als ich erwartet hatte. Die Temperatur aus extremer Höhe klebt noch an der Flugzeughaut.
Mein Platz ist an der Gangseite, beim Online-Einchecken hatte ich nach einem idiotisch langen Hin und Her, nicht zu nah bei den Toiletten, in Flügelhöhe, unbedingt am Gang, diese Sitznummer angeklickt und festgelegt. Ich will während des zwölfstündigen Flugs nach Tokio aufstehen können, wann ich möchte. Natürlich hätte ich auch gern nach draußen geschaut, meine Klebenase am Klebefenster, aber sich bewegen zu können finde ich wichtiger. Freiheit heißt, wählen zu können, die Beine zu strecken, wann du es willst, nicht um Erlaubnis fragen zu brauchen, um zur Toilette zu gehen, und immer Wasser trinken zu können. Freiheit heißt übrigens auch, «Lass mich nie allein» zu schreien und danach allein auf Reisen zu gehen.
Meine Sitznachbarin an der Fensterseite sitzt schon, und wir grüßen uns. Nina, Amerikanerin. Hebe, Niederländerin. Ich vergesse, Girl zu sagen, verzeihe mir aber, ich habe meinen Namen gerade erst drangegeben. Wir teilen eine Zweisitzbank, und so muss weiter niemand mehr herein oder heraus. Ich klicke den Gurt fest und ziehe meine Turnschuhe aus. Menschen tröpfeln herein, wursteln mit ihrem Handgepäck, schauen so müde, als hätte der Flughafen ihre gesamte Energie aufgesaugt. Männer mit giftig-knallorangen Westen und vor Papieren überquellenden Klemmbrettern gehen durch den Gang. Zählen sie Passagiere? Suchen sie jemand? Endlich schließt sich die Flugzeugtür mit einem knallharten Schlag, und ich verspüre eine gigantische Erleichterung.
Um mit einem Flugzeug zu reisen, muss man erst durch eine Minihölle, bevor man in Richtung Himmel darf.
Erst wartet man von einem Bein aufs andere hüpfend in einer Mega-Märchenparkschlange. Dann muss man seine halbe Tasche in einen schmutziggrauen Behälter entleeren und auf Socken, mit erhobenen Händen wie ein Arrestant, in einem Röntgenapparat stehen und sich von übellaunigen Sicherheitsleuten anschreien lassen. Und das alles unter dem Gestank von Schweißfüßen und Nervenanspannung. Erst danach, wenn man das alles überlebt hat, wird man wie eine Kugel in Richtung Freiheit geschossen.
Die kleinen Videoschirme neigen sich aus den Sitzen und springen simultan an, die Flugzeuggötter plus die Crew heißen uns auf Japanisch und danach auf Englisch willkommen.
«Danke, dass Sie sich für unsere Gesellschaft entschieden haben», flötet die Lautsprecherstimme. Das habe ich nicht, erwidere ich in Gedanken, sondern nur das billigste Ticket genommen, und das wart ihr.
«Come on», grinse ich in Richtung meiner Sitznachbarin Nina, als das Notlandungsvideo gezeigt wird: «Als ob auf diesem Planeten noch irgendwer in ein Flugzeug steigt, der nicht weiß, wie so ein Gurt funktioniert.» Sie lacht laut und lange, als hätte ich gerade einen guten Witz gemacht.
«You’re so beautiful», sagt sie und legt ihre Hand kurz auf meine Wange. Das finde ich etwas eigenartig, aber auch lieb. Amerikaner sind nun mal ziemlich hugging-mäßig drauf, und etwas extra Liebe kann ich durchaus gebrauchen.
Cabin crew, arm doors and cross check.
Wir werden rückwärts geschleppt, weg vom Gate. Abreisen, das erinnert mich an Avocados, weil die fast sofort braun werden, wenn man sie aufschneidet, genau wie Äpfel oder Bananen: Ist das Messer erst drin, kann man nicht mehr zurück.
In der Kabine wird das Licht gedimmt, wir machen Bodengeschwindigkeit, und es hat schon etwas von einer Vorbereitung auf etwas Schreckliches. Mein Magen scheint hinter meinem Nabel zu schweben und sein Gleichgewicht zu suchen, und dann steigen wir auf, endlich, die Erlösung.
Vom Boden aus gesehen sind wir jetzt so ungefähr ein Federstrich am blauen holländischen Frühlingshimmel geworden und ziehen diesen weißen Rauch hinter uns her, Flugzeugfürze. Verschwunden für diejenigen, die am Boden zurückgeblieben sind. Innerlich befreit. Ich schaue über meine Sitznachbarin hinweg auf die von landwirtschaftlichen Maschinen gezogenen Mondrianstreifen und weiter hinten die schnurgeraden grauen Autobahnen mit den winzigen Autos, die nach irgendwohin unterwegs sind. Jetzt drehen wir und ich sehe das Meer und die













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















