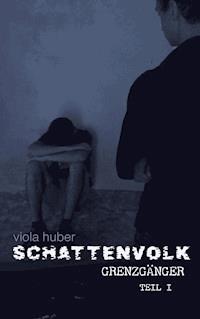
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Teil I Sie wurden geschlagen - weil sie Rebellen im Untergrund sind. Sie wurden zerrissen - um sie gegeneinander auszuspielen. Sie kämpfen in zweiter Generation gegen die Blütezeit des Schuldenreduktionssystems. Nach dem entscheidenden Schritt in die Öffentlichkeit wurde das Schattenvolk durch eine Razzia zerschlagen. Ein Verräter ist unter ihnen, und nun liegt es an Bray, seine Leute zu schützen. Die Regierung hält Ronan gefangen, und Verhandlungen um Geld und Macht gefährden selbst die Jüngsten von ihnen. Vertrauen ist alles, was ihnen geblieben ist. Im Kampf um ihre Freiheit müssen sie lernen, mit den Augen ihrer Feinde zu sehen, - und Risiken eingehen, die ihre Fähigkeiten, wie auch ihre Freundschaft hart auf die Probe stellen. „Jeder von uns musste Freunde oder Familie zurücklassen. Sowas ist für niemanden leicht. Es ist okay, wenn du dir Sorgen machst oder dich fragst, wie's ihnen geht oder was sie gerade machen. Es zeigt nur, dass du sie liebst und deine Gefühle ihnen treu bleiben. Und diese Loyalität“, er deutete bezeichnend auf die Herzgegend des Jüngeren, „ist deine Waffe, Imago. Nur so kannst du sie beschützen, indem du uns gegenüber loyal bist! Und mehr als nur das, mit dieser Ausbildung hier stehen dir Wege offen, an die du früher noch nicht mal im Traum gedacht hättest. Überleg doch nur, was du ihnen als Angehöriger der Elite alles bieten kannst!“ Umbra, EXASS-Agent im Rang Alpha
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
With every dawn the shadows grow deeper, like ruthless hands, greedy for my dreams – and should I betray you, they ll catch ME instead ...
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
1
Schwärze.
Tief atmete sie ein. Dann wieder aus.
Noch bevor sie die Augen öffnete, wusste sie, dass sie sowieso nichts sehen würde. Immer noch umgab sie die Finsternis.
Nur ihre volle Blase sagte ihr, dass es allmählich Morgen sein musste. Automatisch richtete Alyssa sich auf, winkelte die Beine an. Dicht neben ihr traf klirrendes Metall auf harten Betonboden. Eins der wenigen Geräusche, die ihr sagten, dass sie noch lebte. Die Ketten schepperten hinter ihr her, bis ihre suchenden Hände im Dunkeln auf einen wohlbekannten Gegenstand stießen. Ally umklammerte den Plastikrand und zog den Eimer unter sich. Die eisernen Fesseln reichten wie immer gerade so weit, damit sie sich über ihm erleichtern konnte. Der Uringeruch störte sie kaum – sie war weitaus schlimmeren Gestank gewöhnt, der sie in den letzten Jahren umgeben hatte. Selbst jetzt noch schien der Modergeruch des Kanalverstecks, das lange Zeit ihr Zuhause gewesen war, an ihrer Kleidung und im Haar zu haften. Ebenso hatte sie sich dort an Dunkelheit gewöhnt.
Das Einzige, was sie hier in den Wahnsinn trieb, war die Stille. Vor allem in den ersten Tagen hatte ihre nahezu geräuschlose Umgebung ihr den Eindruck vermittelt, sie würde in einem unterirdischen Bunker gefangen gehalten, der ihr die Luft zum Atmen nahm. Wann immer die Stille vom Knirschen des Türschlosses unterbrochen wurde – was zweimal am Tag der Fall war, selten auch dreimal – drohte ein lautloser Schrei ihr Inneres zu zerreißen. Angst, Wut, Hilflosigkeit und Schmerz; all das wurde mit einem Schlag angeknipst, jedes Mal, wenn er zu ihr hinein kam. Jedes Mal, wenn im Lichtkegel seiner Taschenlampe die Deckenbeleuchtung aufblitzte und der schemenhafte Lichtschalter auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, die ihr durch die Ketten verwehrt blieb.
Dennoch schwieg Alyssa weiterhin, auch wenn ihr Wächter ihr wieder und wieder dieselben Fragen stellte.
Niemals, niemals würde sie Ronan verraten, wie auch keinen anderen ihrer Freunde! Niemals würde sie sich verraten! Sollten sie sie doch hungern lassen oder anketten, bis die Eisen ihre Haut abrieben! Sie würde den Geduldsfaden ihrer Peiniger so lange auf die Probe stellen, bis er irgendwann riss …
Das Mädchen ließ sich zurücksinken, lehnte sich mit dem Rücken zur Wand, an welcher die Ketten befestigt waren. Mit geschlossenen Augen lauschte sie auf die Stille, die höchstens mal vom Quietschen der Stahltüren oder dem Rasseln ihrer Ketten unterbrochen wurde.
Wenn man sehr, sehr genau hinhörte, konnte man entfernt Geräusche vernehmen, die an einen Heizungskeller erinnerten. Die seltsam einsame Stimmung in der Zelle wurde damit noch unterstrichen – Ally jedoch fand darin Ruhe und ein kleines bisschen Hoffnung. Denn dieses Geräusch war der Beweis dafür, dass sie in einem großen Gebäude festgehalten wurde. Auch hatte sie festgestellt, dass außerhalb ihrer ‚Zelle’ in den Fluren Teppiche sein mussten, die in Kombination mit dicken Wänden alle anderen Geräuschquellen stark abmilderten.
Knack.
Obgleich sie ihn kannte, ließ der Klang sie erneut hochfahren. Die Tür wurde aufgeschoben. Ein heller Lichtkegel blitzte ihr entgegen. Geblendet blinzelte sie in das altbekannte Szenario.
„Sarah Delay!” Er ging vor ihr in die Hocke. „Sagt dir das was, Schnucki?”
Alyssa schwieg verbissen. Sie spürte, wie der metallene Druck um ihr rechtes Handgelenk nachließ, nur um gleich darauf ihr Fußgelenk zu umschließen.
„Nichts?” Auch die andere Kette wechselte ihre Position, gab ihrem Körper geringfügig neue Bewegungsfreiheit. Im Halbdunkel schüttelte der uniformierte Beamte den Kopf, wie ein ungeduldiger Grundschullehrer, der vergeblich versuchte, seinem Schüler auf die Sprünge zu helfen. „Nun, mir sagt es jedenfalls was …”
Er stand auf, ging zurück zur Tür und öffnete beiläufig seinen Aktenkoffer, den er wie immer dort abgestellt hatte. Wenige Schritte später war er wieder bei ihr und stellte einen Pappbecher mit Cola sowie eine Tüte Donuts neben ihr ab. Die erste richtige Mahlzeit seit Tagen, doch Ally würdigte sie kaum eines Blickes. Stur starrte sie an die gegenüberliegende Wand.
„Sarah Delay”, fuhr ihr Wächter fort, als würde er aus einem Schulbuch zitieren, „ist im Alter von zehn Jahren spurlos in Austen, North Carolina verschwunden. Laut Polizeiakten eine Ausreißerin, die mit ihren Adoptiveltern nicht klar kam, an die ihre drogensüchtige Mutter sie mit acht Jahren abgegeben hatte. Bis vor Kurzem galt Sarah als vermisst gemeldet. Inzwischen wurde ihre Leiche gefunden. Sie hätte lieber bei ihrer Familie bleiben sollen …”
Kein Ton kam über Allys Lippen, dieses Mal jedoch, weil der Schreck ihr nicht nur die Sprache, sondern auch ihr Denken verschlug. Dann, wie eine Stichflamme, regte sich etwas in ihr.
„Sie lügen!”, presste das Mädchen heiser hervor. Als ob sein Interesse über Prämiengeld und Karriere hinausgehen würde, aber darauf fiel sie nicht rein!
„Nein, Schnucki, ich zähle nur die Fakten auf. Sarah Delay wurde zuletzt lebend bei einer Razzia gesehen, die das Schattenvolk und unter anderem dich, mein Fräulein, hat auffliegen lassen. Sie hat einen unserer Einsatzkollegen tätlich mit einem Messer angegriffen. Als er sie abwehrte, ist sie unglücklich gestürzt und noch im Krankenwagen an ihren Verletzungen gestorben. Ihre Adoptiveltern haben sie vor wenigen Tagen identifiziert.”
Alyssa merkte, wie ein Schauder ihren gesamten Körper erzittern ließ. Noch immer meinte sie zu spüren, wie die groben Männerhände sich um ihre Arme schlossen, sie erbarmungslos die Metalleiter hinauf ans Tageslicht zerrten.
Sie hatte nach Sarah geschrien. Immer und immer wieder, doch ihre Freundin schien vom Dunkel der Kanalhalle verschluckt worden zu sein …
„Sie lügen …“ Ein fast tonloses Flüstern. Wieder versagte ihr die Stimme, da nun Tränen ihr den Hals zuschnürten. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie der Beamte erneut den Kopf schüttelte.
„Hör mal, Mädchen, ich frag’ mich wirklich, was ihr an diesem Dreckloch findet, wo ihr genauso gut dorthin zurück könnt, wo ihr eigentlich herkommt!”
Irritiert zuckte Allys Kopf herum. Misstrauisch starrte sie in das nur schemenhaft erkennbare Gesicht des Mannes, der ihr dennoch so vertraut war wie die Dunkelheit in dieser Zelle.
„Was ich sagen will”, fuhr er fort, nun plötzlich wieder so unnahbar wie zuvor, „wenn du mir nicht bald deinen richtigen Namen nennst, bin ich gezwungen, deinen Fall an eine höhere Instanz weiterzugeben – die mit Rebellen kurzen Prozess macht! Also, überleg dir gut, ob du weiterhin so bockig sein willst, Schnucki! Deine Identität und die deiner Komplizen kann dir höchstwahrscheinlich das Leben retten. Und ein volles Geständnis würde auch das Urteil abmildern, das dich bald erwartet!”
Regungslos beobachtete sie, wie der Beamte sich von ihr entfernte, seinen Koffer ergriff und den Raum verließ. Erst, nachdem die Tür hart ins Schloss gefallen und dieses von außen verriegelt war, wagte Alyssa, sich zu rühren.
Das Gesicht zur Wand, sackte sie zu Boden. Verzweifeltes Schluchzen ließ die unerbittliche Stille in den Hintergrund treten.
2
Aufs Neue erfüllte das Sirren und Sprudeln der Kaffeemaschine den Raum. Chester R. Benson, seines Zeichens Sergeant in der Task Force Schattenvolk, atmete genüsslich den aromatischen Duft ein. Über den Rand seiner Tasse hinweg betrachtete er eingehend das junge Mädchen, das wie hypnotisiert in seinen Kaffee starrte. Dunkles, wirres Haar verbarg halb ihr bleiches Gesicht. Ab und zu blitzten braune Augen, die von tiefen Ringen gezeichnet waren, unter den Strähnen hervor, wenn sie auf der Uhr nachsah, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Er bemerkte ein leichtes Zittern ihrer Finger, die unentwegt an der Tasse herumspielten.
Leila Cane, so ihre angegebenen Personalien, war ein weiteres Schattenvolkmädchen, das seine Nerven hart auf die Probe gestellt hatte. Erst vor zwanzig Minuten hatte sie sich dazu bereit erklärt, mit ihm zu kooperieren, da er ihr angedroht hatte, ihre kleinen Geschwister im Fall ihrer Hinrichtung in ein Arbeitsprojekt zu stecken. Mittlerweile war einer seiner Kollegen dabei, die Zwillinge in sein Büro zu holen. Der Onkel, bei dem er telefonisch die Personalien der drei überprüft hatte, musste sich in der Zwischenzeit auch schon auf den Weg gemacht haben.
Wie Leila so dasaß, verspürte Benson beinahe Mitleid mit ihr. Wenn Roger Cane tatsächlich ihr Vormund war, konnte er sich denken, weshalb sie ein Leben im Kanal vorgezogen hatte. Cane war ein aktenbekannter Kleinkrimineller, der es meisterhaft verstand, seine Spuren und solche, die eventuell zu ihm führten, zu verwischen. Laut den Gerüchten beherrschte er selbst das Fälschen von Ausweisen perfekt – ein Grund, weshalb allein die Angabe seines Namens den Sergeant stutzig gemacht hatte. Doch bisher konnte niemand Cane diesbezüglich etwas nachweisen, und da er sich ohne zu zögern aufgemacht hatte, Leila und die Kinder abzuholen, war eine Verwandtschaft zwischen ihnen keinesfalls ausgeschlossen.
Bensons Blick glitt hinüber zum Fenster, wo einer ihrer besten Agenten im Rang Alpha ebenfalls eine Kaffeepause machte. Obgleich er mit dem Rücken zu seinem Vorgesetzten und der Gefangenen stand, wirkte Umbra deutlich angespannt. Nicht nur, dass er wie alle anderen eine harte Nacht hinter sich hatte, ihn hatte man außerdem mit der Aufgabe betraut, sich um die Epsilon-Agenten zu kümmern. Keine leichte Aufgabe für einen so jungen Mann.
Ein Klopfen an der Tür riss Sergeant Benson aus seinen Gedanken.
„Herein!” Er stellte die Kaffeetasse ab, als der beauftragte Beamte auch schon die beiden Kinder durch die Tür schob. Ein Junge und ein Mädchen von etwa sieben bis acht Jahren, die zunächst wie festgewachsen auf der Stelle standen. Dann, unvermittelt, fing das Mädchen an zu heulen und stürzte auf die große Schwester zu. Nun begann auch ihr Zwillingsbruder zu schluchzen.
„Boahr, nee!” Fluchend trank der Agent am Fenster seine Tasse leer, stellte sie scheppernd auf dem Sims ab. „Das muss ich mir echt nicht anhör’n!” Genervt zog er seine Balaklava über Mund und Nase und knallte die Tür hinter sich zu.
Leila hatte Mara auf ihren Schoß gezogen und einen Arm um Ben gelegt. Sie drückte einen Kuss auf das Haar des kleinen Mädchens, strich mit einer Hand tröstend über die Schulter ihres Bruders.
„Ist schon gut”, murmelte sie leise. „Onkel Roger holt uns gleich. Keine Angst, wir bleiben zusammen.”
Als Roger Cane zehn Minuten später das Büro betrat, hatten Ben und Mara sich dank Orangensaft und ein paar Keksen wieder beruhigt. Dennoch merkte Leila, wie die Zwillinge misstrauisch den Mann beobachteten, vor dem sie im letzten Winter zum Schattenvolk geflohen waren.
Roger aber bog sich die für sie verfahrene Situation mal wieder so zurecht, wie es ihm in den Kram passte.
„Sergeant Benson!” Aufgeräumt begrüßte er den Beamten, der die Kleinen und sie in den letzten drei Tagen – und sie selbst auch nachts – unbarmherzig verhört hatte. „Sie glauben nicht, wie froh ich bin, dass Sie die drei gefunden haben!”
Ein freundliches Händeschütteln, dann kam Roger auch schon auf sie zu und drückte sie kurz an sich.
„Lei, weißt du eigentlich, was für Sorgen ich mir um euch gemacht habe? Du hättest doch nicht abhauen müssen, wir hätten das doch auch so regeln können, Kind! Und dann auch noch die Kleinen mitnehmen, das war unverantwortlich! Wenn du unbedingt mit für sie sorgen willst, dann such dir meinetwegen einen Nebenjob, bis du alt genug bist für die Vormundschaft. Aber bitte jag mir nie wieder so einen Schrecken ein!”
Trotz ihres Ekels vor ihm konnte Leila nichts anderes als staunen, wie er seine wahren Hintergründe geschickt als einen harmlosen Familienstreit tarnte. Wortlos nickte sie, griff unterm Tisch nach den Händen der Zwillinge. Roger wuschelte Ben und Mara durch die Haare, führte ganz selbstverständlich Smalltalk mit dem Sergeant, während sie die Formalitäten regelten. Nachdem Benson die Ausweise geprüft hatte, ohne eine Beanstandung zu finden, füllte Roger ein Formular aus, in dem er bestätigte, der rechtmäßige Vormund seiner Nichten und seines Neffen zu sein. Sein Gehabe wirkte täuschend echt – so wie damals, als er ihnen zum ersten Mal Obdach und ein sicheres Leben angeboten hatte.
Doch als sie hinter Cane und ihren Geschwistern durch die Tür ging, spürte sie Bensons Blick auf sich ruhen. Sie hatte dem Beamten versprochen, für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen. Über die Schulter nach hinten sehend, konnte sie gerade noch die skeptische Miene des Sergeants durch den sich schließenden Türspalt erkennen.
Mit dem Knacken des Schlosses ließ sie all den Horror der Gefangenschaft hinter sich. Ein Schauder durchfuhr ihren Körper, als sie Rogers Arm um ihre Schultern spürte.
„Siehst du, Süße? Ich hab dir gesagt, wir würden nochmal Partner werden …”
Sie wusste, der Sergeant würde sie nie wieder mit Fragen quälen. Denn Roger würde dafür sorgen, dass das Nachtleben der Stadt sie verschluckte.
3
Um sie herum schritten Schuhe vorbei. Stöckelschuhe. Halbschuhe. Turnschuhe. Schuhe mit Schnüren und Klettverschlüssen. Schuhe ohne Verschluss zum Reinschlüpfen. Manche gingen schnell und spitzhackig vorüber, andere elegant und gelassen.
Jedes Paar Schuhe, das sie sah, wirkte von Mal zu Mal verschwommener. Aus allen Ecken hallten Lautsprecheransagen, verzerrt wie aus einem Radio, das irgendwo weit weg stand. Dampfend und zischend setzten sich Züge in Bewegung oder wurden mit lautem Quietschen zum Stillstand gebracht. Ab und zu schnappte sie einzelne Satzfetzen aus dem stetigen Gemurmel der Passanten auf. Obwohl es noch früh am Morgen war, herrschte am Hauptbahnhof reger Betrieb. Schon seit Stunden hatten die Geschäfte, Zeitungs- und Essensstände geöffnet. Rote und schwarze Buchstaben warfen stumme Fragen in den Raum.
Sie trugen öffentlich aus, ob man Ronan hinrichten würde. Es sollte ein Blickfang sein, die Leser anlocken – und wirkte trotzdem schockierend.
Ein kalter Windhauch fuhr vom Bahnsteig draußen in die Halle hinein, ließ die beiden Gestalten auf der Bank schaudern.
Instinktiv drückte Melody sich an die Schulter ihres Freundes. Den Blick immer noch starr auf die vorbeieilenden Menschen gerichtet, kämpfte sie mühsam gegen die Tränen an. Auch wenn sie all die leuchtenden Zeitungstitel ignorierte, die Angst in ihrem Magen blieb. Schließlich schluchzte sie erstickt auf, verbarg das Gesicht in Corvins Flanellhemd.
Ein schwarz-weiß-kariertes, schlabberiges Ding, das Doc Murphy ihm geliehen hatte. Der schwarze Ledermantel, den ihr Freund sonst immer trug, war einfach zu charakteristisch, hatte er gesagt. Dennoch fühlte Corvin sich einfach nicht wie er selbst, zumal das Hemd kaum vor Kälte oder Regen schützte. Bisher hatte seine Aufmerksamkeit, von fast ebenso düsterer Anspannung wie die von Melody, den Männertoiletten schräg gegenüber gegolten. Jetzt aber, da Mel ihren Heulkrampf an seiner Schulter zu unterdrücken versuchte, fuhr sein Kopf erschrocken zu ihr herum.
„Hey”, zischte er ihr leise zu, um sie nach kurzem Zögern doch in seine Umarmung zu ziehen. „Ist gut …”
Ihre Antwort war ein weiteres Schluchzen.
„Mel! Reiß dich zusammen!”
Ein lautes Schniefen, gepaart mit einem Luftschnappen.
„Er ist mein Bruder, Corv, und alle anderen … sie -”
„Schhht!” Der Junge unterbrach ihr Gestammel, indem er mit einem sanften Kuss ihre Lippen verschloss. Eine Hand drückte beruhigend ihre Schulter, während die andere ihr Kinn anhob. Eindringlich sah Corvin ihr in die Augen.
„Hör mir zu, wir müssen jetzt der Reihe nach vorgehen! Jamie und Stella sind beim Doc erstmal in Sicherheit, aber wir müssen ein sicheres Versteck finden, wo wir alle unterkommen können. Das würde auch Ronan wollen, okay?!”
Stockend nickte Melody.
„Gut … „Corvin atmete tief durch. „Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass uns nicht jeder auf den ersten Blick erkennt … „Er griff in die Hosentasche, zog eine Handvoll Geldscheine sowie das reichlich zerknitterte Stück Papier hervor, das er nun zum unzähligsten Mal auseinanderfaltete. Nachdem er seiner Freundin das Geld in die Hand gedrückt hatte, suchte er in seiner Gesäßtasche nach Murphys Mobiltelefon.
„Geh du schonmal vor”, Corv nickte in Richtung der Läden. „Ich versuch’s nochmal …”
Fast automatisch drückte er auf Wahlwiederholung, verglich noch einmal die dort eingegebene Zahlenreihe mit der Nummer auf dem Zettel. Langsam folgte er Mel in einigem Abstand. Seine Hand zitterte vor Aufregung, als er abwartend das Handy gegen sein Ohr hielt. Doch bereits nach wenigen Pieptönen erklang erneut die mechanische Stimme, dies ist die Mailbox des Anschlusses von … Dreimal hatte er schon draufgesprochen!
Genervt klappte Corvin das Handy ein und schob es zurück in seine Tasche. Melody war inzwischen unschlüssig vor dem Friseursalon stehen geblieben. Als sie sich fragend zu ihm drehte, schüttelte er resigniert den Kopf.
Seit Tagen versuchte er, seinen Bruder zu erreichen, aber Justin hatte ständig sein Handy ausgeschaltet … Allmählich kam ihm das komisch vor -
„Glaubst du nicht, dass die uns rauswerfen?” Mels unsichere Stimme durchschnitt seine Gedanken, erinnerte ihn gleichzeitig an all die anderen Sorgen, die sie zu bewältigen hatten.
„Blödsinn”, brummte er schroff. „Wir müssen nur selbstbewusst genug auftreten! Also stell dich nicht so an …”
Ohne ein weiteres Wort stieß er die Ladentür auf, die mit sofortigem Gebimmel verkündete, dass Kundschaft da war. Verdutzt schaute Melody auf die spiegelnde Glasfläche, die sich nun zwischen ihr und Corvin befand. Sie musste nochmals tief Luft holen, bevor sie den Rest ihrer Selbstbeherrschung zusammennahm und ebenfalls über die Schwelle trat.
Zu Mels Verblüffung mussten sie tatsächlich nicht lange verhandeln, um auf der Stelle einen Termin zu bekommen. Ihr Freund brachte den skeptischen Friseuren Argumente entgegen, die gleichermaßen unverschämt wie überzeugend waren. Der Höhepunkt der ruhigen, jedoch recht bissigen Debatte war, dass Corv dem Ladeninhaber klar machte: Wenn seine Angestellten es schaffen würden, ad hoc solche verdreckten Streetkids wie sie wieder für die Gesellschaft zumutbar zu machen, würde das eine Riesenpublicity geben. Als der geschniegelte Anzugträger noch hämisch wissen wollte, ob sie das denn bezahlen konnten, hatte Corvin ihm mit einem eiskalten „Reicht das?” ein Geldbündel vor die Nase geknallt.
Nun, da sie in diesem unglaublich weichen Friseurstuhl saß und ihr Haar von lauwarmem Wasser und duftendem Schaum umspült wurde, konnte Melody nicht anders, als vor Wohlbehagen die Augen zu schließen. Ihren letzten Friseurbesuch hatte sie als kleines Kind genießen dürfen, damals, als Ronan und sie noch bei ihrem Dad lebten. Ein Kinderfriseurbesuch, bei dem das Wichtigste das Schokoladeneis zum Schluss gewesen war … Ronan hatte ihr tatsächlich weismachen wollen, Haareschneiden würde weh tun! Aber sie hatte ihn ausgetrickst, und ihm nachts heimlich mit ihrer Bastelschere ein paar Strähnen abgeschnitten. Er war noch nicht mal aufgewacht, also tat es NICHT weh …
Einen Moment lang schwankten ihre Gefühle erneut zwischen verzweifelter Hilflosigkeit und der ungewohnten Behaglichkeit. Dann spürte sie ein warmes weiches Handtuch an ihrem Kopf, das um ihr Haar herum zu einem Turban gefaltet wurde. Das Wohlgefühl siegte. Wenig später saß Melody vorm Spiegel und beobachtete voll Interesse, wie die Friseuse die Blondierung anrührte. Dass Leute einfach so ihre Haarfarbe verändern konnten, hatte sie schon als Kind fasziniert … Als wenig später die ersten Haarspitzen fielen, bemerkte sie erstaunt den neuen Glanz, die Geschmeidigkeit, mit der sie sich ringelten und scheinbar vor der Schere zu fliehen versuchten.
Während Mel mit wachsender Begeisterung verfolgte, wie sich ihre langen Haare von stumpfem Braun in einen pfiffigen Stufenschnitt mit blonden Strähnen verwandelten, hatte ihr Freund sich wieder dem Geschehen außerhalb des Geschäfts zugewandt. Durch die Plakate und spiegelverkehrten Buchstaben auf der Scheibe huschten seine Augen immer wieder zu den Männertoiletten. Nach und nach fielen seine verfilzten dunklen Strähnen, die ihm zuvor bis auf den Rücken gereicht hatten, zu Boden. Nur unregelmäßig sah er in den Spiegel, ob auch nicht zu viel abgeschnitten wurde. Wenn sein Blick nicht an den Sanitäranlagen hängenblieb, ruhte er meistens auf Mel, die seit langem endlich mal wieder ein wenig entspannter aussah. Auch wenn sie es versucht hatte zu vertuschen, so war ihm klar, dass sie seit der Verhaftung ihres Bruders und der anderen Schattenvolkmitglieder kaum geschlafen hatte. Immer wieder war er in den letzten Nächten wach geworden, weil seine Freundin heimlich weinte und sich nicht mehr zurückhalten konnte. Gerade jetzt, in dem hellen, beißenden Neonlicht des Friseursalons, fielen ihm die Schatten unter ihren Augen auf, sah er den Schmerz, der unterschwellig in ihrem aufgewecktem Blick lag, mehr als deutlich.
Corvin wusste, Mel liebte ihren Bruder. So wie er seinen eigenen Bruder liebte. Er wusste auch, wie es war, plötzlich ohne Familie dazustehen. Nur, dass er mit dem Schattenvolk sozusagen seine zweite Familie verloren hatte. Und ihm war klar, wie schlimm es war, seinen Schmerz nicht einfach rausweinen zu können. Zwar hatten sie im Kanalversteck nie ihre privaten Probleme besprochen, aber dennoch hatten sie sie teilen können. Jeder hatte jeden akzeptiert, weil sie alle wussten, dass ihr gemeinsamer Traum eines besseren Lebens weit weg von ihrer Vergangenheit lag.
Doch diese Geborgenheit war schlagartig zertrümmert worden – und die einstigen Kanalbewohner wie unzählige kleine Scherben in alle Richtungen zerstreut. Für Stella, Mel und Jamie war er das Einzige, was vom Schattenvolk noch übrig war. Die vertrauensvollen Blicke der Kinder und Melodys Tränen um Ronan sprachen Bände. Doc Murphy hatte heute Morgen mit ihm Tacheles gesprochen.
Corvins Kopf tat weh vom vielen Nachdenken. Sein Bauch tat weh vor Angst. Doch er hatte die Entscheidung lang genug hinausgezögert. Er war derjenige, der einen Weg finden musste, die verbliebenen Mitglieder wieder zusammenzuführen. Nur so konnten sie am Ende verhindern, was die Schlagzeilen der Boulevardpresse heute schon prophezeiten.
Sein Blick glitt abermals zu den Sanitäranlagen. Definitiv Plan B, mal abgesehen davon, dass er wahrscheinlich vor Aufregung gleich wieder aufs Klo rennen musste. Lieber wollte er Schritt für Schritt vorangehen, wie Murph ihm vorgeschlagen hatte. Zu einem Unterschlupf, der hoffentlich ein Zuhause werden würde – so wie er es ganz früher, bevor Garry auftauchte, gewesen war …
4
Der junge Mann regte sich kaum. Stocksteif, mit aufgestützten Ellbogen und unterm Stuhl verschränkten Beinen, saß er am Schreibtisch. Sein Blick war starr auf das knittrige Foto gerichtet, das er in den Händen hielt. Nur seine Finger bewegten sich etwas. Mit dem Daumen der rechten Hand strich er vorsichtig über das Bild, berührte sachte die Kleinste der vier Personen, die dort abgelichtet waren. Ein glückliches Ehepaar mit seinen beiden Kindern. Das Mädchen auf dem Foto war vielleicht zwei Jahre alt. Ein freches Grinsen auf den Lippen, thronte es auf den Schultern eines Teenagers, der nicht minder stolz auf seine kleine Schwester zu sein schien.
Er war so sehr in seine Gedanken vertieft, dass das plötzliche Aufschwingen der Tür ihn regelrecht hochschrecken ließ. Von einer Sekunde auf die andere saß der Agent aufrecht da, mit durchgestrecktem Rücken und alle Sinne aufs Äußerste gespannt.
„Umbra!”
Pflatsch!
Die hingeworfene Zeitung fegte beinahe seine Kaffeetasse vom Schreibtisch. Doch noch nicht mal ein Wimpernzucken des Alphas verriet, dass er dies registriert hatte. Er hielt den Blick bereits aufmerksam auf Calum Rainey gerichtet, als er heimlich das Foto in seiner Hosentasche verschwinden ließ.
„Ja, Sir?”
„Du übernimmst heute für Benson!”
„Wie Sie wünschen, Sir.” Umbras scharfen Augen war nicht entgangen, dass sein Vorgesetzter sich über irgendetwas ärgerte. „Darf ich fragen, weshalb?”
„Wirf einen Blick auf die Titelseite”, wies Rainey ihn an.
Der junge Agent zog die Tageszeitung zu sich heran, überflog rasch die Überschriften.
Insiderwissen vs. Todesurteil – Droht ‚Robyn’ die Hinrichtung?
„Ein Skandal”, fuhr sein Vorgesetzter schlecht gelaunt fort, „sowas an die Presse zu geben!”
„Und Sie glauben, Benson ist dafür verantwortlich?”
Rainey schwieg einen Moment, ehe er sich langsam zu seinem Agenten umdrehte. „Teils, teils, würde ich tippen.”
Umbra hob fragend die Augenbrauen.
„Ich nehme fast an, dass einer deiner Youngsters dahinter steckt!”
„Sie meinen -”
„Du weißt genau, wen ich meine! Benson hat sich wahrscheinlich nur ein bisschen verplappert, wie es unter Kollegen ab und an passiert …“ Calum Rainey war näher getreten, das Gesicht nur Zentimeter von dem Umbras entfernt. „Der Bursche ist verdammt schlau, mindestens so sehr wie du! Also sorg dafür, dass du die Kontrolle behältst! Und als erstes wirst du den gottverdammten Namen von dieser Göre rauskriegen. Eine etwas verschärftere Variante von ‚guter Bulle, böser Bulle’, wenn du verstehst …”
Der Alpha-Agent nickte, ohne auch nur eine Miene zu verziehen.
Das Essen stand immer noch unangerührt da, als sie erneut hörte, wie jemand die Tür aufschloss. Alyssa machte sich nicht einmal die Mühe, aufzusehen. Den Rücken zur Wand gelehnt, saß sie regungslos dort und starrte zu Boden. Sie wusste auch so, dass es sich diesmal nicht um Sergeant Benson handelte.
Es war der maskierte Agent. Seine Schritte waren unverkennbar. Steif und hart wie die eines einsamen Soldaten, der ständig im Gleichschritt marschierte. Ihn schickten sie immer, wenn sie bei ihr gegen eine Wand stießen. Ein winziger Triumph für die Gefangene, der sich im Endeffekt jedoch nicht auszahlte. Denn wo andere kurz davor standen, entnervt das Handtuch fallen zu lassen, fing für Umbra der Spaß erst an … Er war stets das letzte und stärkste Werkzeug in dem schwierigen Unterfangen, nach und nach ihren Willen zu brechen. Und seine Methoden wurden von Mal zu Mal rücksichtsloser … Du musst jetzt stark sein, Ally. Du musst -
KRACH. Der Lärm, der lautstark das Zufallen der Tür verkündete, riss sie aus ihren Gedanken. Sie spürte seine Hand an ihrem Arm. Unbarmherzig riss er sie auf die Füße, um sie in derselben Bewegung mit der Kraft seines Körpergewichts gegen die kalte Steinwand zu drücken.
Verzweifelt japste Alyssa nach Luft.
„Diesmal ist Schluss mit den Ratespielchen, verstanden?!”, zischte er ihr ins Ohr. Der schmerzhafte Druck seines Unterarms presste sich für endlose Sekunden noch stärker auf ihre Brust. Ein panischer Laut entfuhr der Gefangenen. Umbra lachte verächtlich, als er sie wieder zu Boden stieß.
Keuchend und die Augen vor Angst geweitet, hielt das Mädchen seinen Blick nun auf den maskierten Agenten gerichtet, der aufreizend gelassen vor ihr auf und ab schritt.
„Also, Ally. Wo waren wir stehen geblieben? Ich meinte, wir waren dabei herauszufinden, wofür Ally steht, nicht wahr, Ally?”
Alyssa schluckte trocken. Wer auch immer ihren Peinigern von ihrem Spitznamen erzählt hatte, musste wohl auch derjenige sein, der für ihre Verhaftung verantwortlich war. Ein Verräter, der das Vertrauen aller missbraucht hatte …
„Zählen wir mal die Fakten auf”, fuhr Umbra gelangweilt fort. „Es gibt natürlich nicht allzu viele Namen, für die Ally stehen kann …”
Ein Verrat, durch den ihre beste Freundin gestorben war. Neben Sarah war Ronan der Einzige gewesen, dem sie absolut blind vertraut hätte … Ob sie ihn auch hierher verschleppt hatten? Vielleicht nur wenige Mauern getrennt von ihr? Ob er auch so litt wie sie – oder vielleicht sogar noch mehr …?
Außer bei ihm und seiner Schwester konnte sie nur noch von den Kindern sicher sein, dass sie keine Verräter waren. Bray und Damian fielen ohnehin weg, da sie selbst von der Polizei gesucht wurden. Blieben noch Corvin, Leila, James, Justin und Joanna …
Unerwartet spürte sie einen Stoß. Heftiger Schmerz durchzuckte ihre linke Hüfte. Im Halbdunkel von der Wucht seines Fußtritts überrascht, wurde Alyssa zur Seite geschleudert. Unterdrückt wimmernd blieb sie am Boden liegen.
„Sieh mich an, wenn ich mit dir rede!”, herrschte Umbra sie an. Als sie nicht reagierte, zerrte er sie erneut hoch. Wie zuvor von seinem Griff gegen die Wand genagelt, konnte sie selbst durch den Stoff der Sturmhaube seinen Atem auf ihrer Wange spüren.
„Weißt du, an sich hab ich nichts gegen Ratespiele”, flüsterte er ihr ins Ohr. „Aber es ist nicht gerade fair, wenn die Lösung eins zu einer Million steht … Weißt du, wie viele Alyssas und Alisons und wie sie alle heißen, im Land als vermisst gemeldet sind? Aber wo ich gerade von fair rede …”
Er trat einen Schritt zurück. „Robyn, ach nein, Ronan wird eurer Freundin Sarah wohl bald in den Märtyrertod folgen, wenn er so weitermacht … und das, obwohl er einen Sohn hat, wenn ich richtig informiert bin. Da war Leila um einiges vernünftiger. Sie hat kooperiert, um bei ihren Geschwistern bleiben zu können … wusstest du, dass Wissen tatsächlich Macht bedeutet, Ally?” fragte er wie nebenbei. „Ich könnte mir vorstellen, dass du einiges weißt … Oder besteht eure Bande in Wirklichkeit nur aus Kanalratten, die sich in ihrem Loch gegenseitig wärmen und alle für sich allein jagen?”
Schockiert starrte sie ihn an. Denn bereits während er sprach, hatte sie erkannt, dass Umbra recht hatte. In seinen Worten lag eine Wahrheit versteckt, von der er selbst wahrscheinlich nur einen Bruchteil erkennen konnte.
Wissen bedeutete Macht. Das Wissen um ihren wahren Namen! Ihr Name konnte Ronans Leben retten – und vielleicht sogar das des Schattenvolks. Ein Name, der bereits mächtig gewesen war, bevor sie ihn abgelegt hatte …
„Tun wir nicht. Wir sind mehr als nur eine Bande!”
Das Mädchen atmete tief ein und wieder aus.
„Und mein Name ist Alicia Wakefield.”
Trotz der Maske konnte sie erkennen, wie das siegessichere Lächeln auf Umbras Lippen darunter gefror.
5
Es war verblüffend, wie sehr eine neue Frisur auch das Innere eines Menschen verändern konnte. Melody erkannte sich selbst kaum wieder, doch sie musste zugeben, dass ihr neues Äußeres ihr gefiel. Im Spiegel sah ihr nicht mehr das unscheinbare kleine Mädchen, sondern eine durchaus hübsche Teenagerin entgegen. Ihre nun stufig geschnittenen, teilweise aufgehellten Haare fühlten sich federleicht an – so sehr, dass sich auch das Gewicht der Angst in ihrem Bauch ein wenig zu lösen schien. Auch Corvins kürzeres Haar machte beinahe einen anderen Menschen aus ihm. Seine sonst so filzigen, schwarzen Strähnen hatten nun einen seidigen Glanz bekommen, der durch eine rebellische, feuerrote Strähne noch mehr unterstrichen wurde. Verwundert musste Mel feststellen, dass ihr die leichten Wellen, die sich hier und da bei ihm bildeten, noch nie aufgefallen waren.
Ihr Freund jedoch schien sein neues Aussehen gerade mal ebenso hinzunehmen wie die Tatsache, dass heute die Sonne schien. Ganz in seine Gedanken vertieft, lief er in seinem üblichem Tempo voraus. Melody war froh, dass sie sich inzwischen an seine schnellen Schritte gewöhnt hatte und im Abstand von ein paar Metern mithalten konnte. Verwirrt sah sie sich um, als sie gewahr wurde, wie sehr sich die Umgebung um sie herum verändert hatte. Anstatt der beeindruckenden Wohnhäuser und Firmengebäude, wie sie im Zentrum zu finden waren, wurden hier die Straßen von grauen, viereckigen Klötzen mit kleinen Fenstern gesäumt. Das bisschen Grün, das an verschiedenen Ecken zu sehen war, wurde von dem eintönigen Baustil nahezu verschluckt. Eine Gegend, die man wohl mit Recht als Mietskaserne beschreiben konnte, dachte Melody sich, während sie einen Schritt schneller ging. Dass Corvin ein bestimmtes Ziel hatte, war ihr bereits klar, seit sie den Friseurladen verlassen hatten – doch dieses Viertel machte sie nun doch unsicher.
„Wo -„, irritiert drehte sie sich um, da sie ihren Freund plötzlich überholt hatte. Dieser war unerwartet stehen geblieben. Mel folgte seinem Blick, der auf eines der Viereckshäuser gerichtet war. Ein Mann war herausgetreten, der sich nun in die Gegenrichtung entfernte, so dass sie nur seinen Rücken erkennen konnte. Fragend sah sie ihren Freund an. Ohne darauf einzugehen, schob Corvin die Hände tief in die Hosentaschen.
„Komm mit”, wies er sie halblaut an. Es klang seltsam unsicher, fast wie eine Bitte. Zögernd ging Melody neben ihm her. Die Haustür war noch nicht ganz zugefallen, und nachdem sie hindurchgeschlüpft waren, blieb Corvin vor einer der Wohnungen stehen. Neugierig warf Mel einen Blick auf das Klingelschild.
Walker, stand dort.
Stirnrunzelnd kramte Melody in ihrer Erinnerung, ob Corv diesen Namen irgendwann mal ihr gegenüber erwähnt hatte. Das schrille Klingeln und seine Hand, die plötzlich ungewohnt hart die ihre umklammerte, ließ sie zusammenzucken. Hinter der Tür erklangen Schritte, und wenig später wurde sie aufgezogen. Die Frau auf der Schwelle, sie mochte wohl Ende Dreißig sein, blicke sie zuerst fragendfreundlich an, ehe sie im nächsten Moment schreckensbleich im Gesicht wurde. Ihre Augen waren starr auf Corvin gerichtet, als würde sie einem Geist gegenüberstehen.
„Du?!” Ihre erstickte Stimme klang nicht minder geschockt.
Allmählich dämmerte Melody, wohin ihr Freund sie geführt hatte. Corv setzte gerade an, etwas zu sagen, da hatte die Frau auch schon ausgeholt und ihm eine heruntergehauen.
„Was glaubst du eigentlich, wer du bist?!”, herrschte sie ihn an. „Erst zerstörst du auch noch unsere restliche Familie, und dann tauchst du hier auf, als wär nichts gewesen!” Mit einem verächtlichen Kopfschütteln musterte sie Melody. „Aber ich hätte mir ja denken können, dass du genauso wirst wie er – ”
„Por favor, Mum, kann ich auch mal was sagen?!”, unterbrach Corvin ihren Wortschwall.
Er hatte noch nicht mal gezuckt, als sie ihm die Ohrfeige verpasste. Nicht etwa, weil er durch Garry an sowas gewöhnt war – sondern weil er damit am allerwenigsten gerechnet hatte. Natürlich konnte seine Mutter ausrasten, das war früher oft genug geschehen, doch bei allem, was passiert war, hatte sie ihn niemals geschlagen. Wenn überhaupt, dann nur einen Klaps auf die Finger …
Vollkommen überrumpelt von ihrer Reaktion, versuchte er, ihre Worte zu erfassen. Ihr erster Vorwurf hatte schwach eine Erinnerung aufflackern lassen. Irgendwann hatte seine Mum diese wutentbrannte Frage schonmal herausgeschrien. Aber erst bei ihrem letzten Satz gelang es ihm, einigermaßen einen Zusammenhang herzustellen. Vage regte sich die Erinnerung, wie er als Fünfjähriger einen Streit zwischen seinem Vater Leo und ihr mit angehört hatte. Anscheinend hatte Leo sie damals mit einer anderen Frau betrogen, und anscheinend sah er seinem Vater nun weitaus ähnlicher, als noch vor einigen Jahren … noch dazu mit Mel an seiner Seite, die mindestens drei Jahre jünger wirkte als er.
Eines konnte er jedoch beim besten Willen nicht nachvollziehen, und das war die Anschuldigung, dass er angeblich auch ihre restliche Familie zerstört hatte. Damit konnte sie doch unmöglich Garry meinen, oder?! Unsicher betrachtete er ihre abwartende, kühle Miene.
„Was meinst du mit Familie zerstören? Ich bin hier, weil ich mit Justin reden will und … mit dir”, sein Blick senkte sich wieder zu Boden. Er hörte, wie seine Mutter tief Luft holte, spürte Melodys Daumen über seinen Handrücken streichen, obwohl seiner Freundin anzumerken war, wie sehr sie die Situation irritierte. Unwillkürlich krallte er seine Fingernägel in Mels Hand, als seine Mutter, nur mühevoll beherrscht, erklärte: „Justin ist seit einer Woche spurlos verschwunden! Er geht weder an sein Handy, noch wissen seine Klassenkameraden und seine Lehrer, wo er steckt! Ich weiß nur, dass er am Freitag nachmittags zu dir wollte, er nachts nicht nach Hause gekommen ist und am nächsten Morgen in der Zeitung stand, dass das Versteck des Schattenvolks ausgehoben wurde! Sein Schuldirektor hat mir erzählt, dass er durch dich zu zwielichtigen Kontakten gekommen ist, aber dein Bruder wollte trotzdem nicht auf mich hören!“
„Sein Schuldirektor?”, echote der Schwarzhaarige fassungslos, doch seine Mum redete sich immer mehr in Rage: „Vielleicht ist er sogar tot, und das nur durch die Flausen, die du ihm in den Kopf gesetzt hast! Also wag’ es ja nicht, auch nur einen Fuß über meine Schwelle zu setzen, Corvin Cortez!”
Ohne auch nur eine Antwort abzuwarten, schlug Lindsey Walker ihrem Sohn die Tür vor der Nase zu, so dass ihr darauffolgendes Schluchzen kaum zu vernehmen war. Schockiert riss Mel ihren Blick von der Tür los, sah zu Corvin, der nun ebenso bleich war wie seine Mutter vor wenigen Minuten. Der Klammergriff um ihre Hand hatte sich gelöst. Der Junge drehte sich um, begann plötzlich in hilfloser Wut mit der geballten Faust gegen die Wand zu hämmern.
„Caralho!”, schrie er auf. „Scheiße, Scheiße, Scheiße!!!”
„HÖR AUF!” Instinktiv umschlang Melody ihn und zog ihn fest an sich, so dass er von der Wand abließ. Sie spürte, wie er am ganzen Körper zitterte.
„Ist gut … ist gut. Wir schaffen das auch so”, flüsterte sie beruhigend auf ihn ein. „Dann geh’n wir eben dahin, wo du vorm Schattenvolk gelebt hast … Ganz egal, was für Leute da sind, solange wir uns haben!”
Corvin lachte bitter auf. Wie so oft zeigte ihr Vorschlag, dass trotz ihres Zusammenseins immer noch eine große Kluft zwischen ihm und Melody lag. Von seinem früheren Leben wusste sie nur, dass er irgendwo mit irgendwelchen Junkies in der Stadt gehaust hatte – aber nicht, dass neben Drogen dort auch mit Menschen gehandelt wurde … in sämtlichen Variationen.
Dennoch war es der einzige Platz, wo die Kinder und sie erstmal sicher sein würden – selbst wenn jemand auf die Idee kam, Schattenvolkmitglieder zwischen all den Streunern und Perversen zu suchen, so würde er wohl kaum das tatsächliche Schattenvolk von denen unterscheiden können, die nur ihrer Verarmung nach so hießen …
6
Es war nahezu stockdunkel im Zimmer. Allein der Monitor auf dem Schreibtisch warf kaltes, flirrendes Licht in den Raum. Der leise stetige Brummton, der den Raum erfüllte, schien nun auch in seinen Kopf eindringen zu wollen. Ein monotones Geräusch, das in seinem übermüdeten Zustand mehr als nur einschläfernd wirkte. Dessen ungeachtet blieben seine braunen, halb zusammengekniffenen Augen weiterhin trotzig auf den Computerbildschirm gerichtet. Unruhig fuhr er sich mit den Fingern durch die vom Gel inzwischen widerspenstigen Haare, nur um gleich wieder auf Tastatur und Maus herumzuhacken.
James hörte kaum das verhaltene Klopfen an seiner Zimmertür; ebenso wenig bemerkte er, wie diese sich öffnete. Erst, als eine Hand sachte seine Schulter berührte, zuckte er zusammen und drehte sich um.
„Jimmy!” Ein warmes, doch besorgtes Lächeln auf den Lippen, blickte seine Mutter ihn an. „Ich versteh ja deine Gefühle, aber es ist beinahe drei Uhr! Du solltest wirklich schlafen gehen!”
James senkte den Blick, seufzte und nickte schließlich. „Okay, Mum … ”
Es brachte ohnehin nichts, nach Spuren zu suchen, die nicht vorhanden waren …
„Schlaf gut, Großer.” Unwillkürlich ließ er zu, dass sie ihm übers Haar strich.
„Du auch, Mum.” Noch während sie das Zimmer verließ, ließ James den PC herunterfahren. Automatisch schob er den Drehstuhl ordentlich an den Schreibtisch, schmiss anschließend seine Hose über die Rückenlehne. T-Shirt und Shorts anbehaltend, kroch er unter seine Bettdecke. Seine Augen brannten vor Müdigkeit. Blinzelnd starrte er auf den schwachen Lichtkegel, den die Laterne von draußen durchs Fenster an die Wand warf.
Um jegliche Fragen zu vermeiden, hatte er seinen Eltern erzählt, er hätte Liebeskummer. Was ja auch irgendwie stimmte … Die Ungewissheit, was mit Leila und den anderen passiert war, quälte ihn seit Tagen. Am Schlimmsten war für ihn, dass er nichts weiter tun konnte, als sämtliche Zeitungs- und Internetberichte nach Hinweisen abzugrasen. Und wenn er mal nicht in irgendwelche Berichte vertieft war, raubten Horrorvorstellungen ihm den Schlaf oder die Konzentration bei der Arbeit. So war seinen Eltern unweigerlich aufgefallen, dass ihn irgendetwas bedrückte.
Nur, dass sein Kummer hauptsächlich aus Angst bestand, aus Angst um das Mädchen, das er liebte – und um seine Freunde. Die Zeitungen zitierten Mitarbeiter der EXASS, berichteten von möglichen Hinrichtungen und überboten sich in Verschwörungstheorien, während die Suchmaschinen im Internet zum Thema Schattenvolk Ergebnisse anzeigte, die so endlos und nichtssagend waren wie eine Rolle Klopapier. Selbst als er andere Schlagworte wie Anschlag, Terroristen, Untergrund oder Rebellen und Bray angegeben hatte, war nichts weiter dabei gewesen außer reißerischen Überschriften, die Ronans Märtyrerimage oder aber die Gerüchte über ein mögliches Todesurteil unterstützten. Alles, was er außerdem erfahren hatte, war, dass eines der Mitglieder – der Beschreibung nach Sarah – bei der Festsetzung der Bande ums Leben gekommen war. Eine Tatsache, die seine Sorge nur noch bestärkte, denn wer wusste schon, wie mit den übrigen Mitgliedern umgesprungen wurde?
Mit einem schweren Seufzer schloss James die Augen. Eine Zeitlang noch schwankte sein übermüdeter Verstand irgendwo zwischen dem spärlichen Wissen und Alptraumbildern, die fast schon ans Wahnhafte grenzten. Nur langsam gelang es dem Schlaf, den überreizten jungen Mann endgültig zur Ruhe zu zwingen.
Ruckartig fuhr James hoch. Mit klopfendem Herzen starrte er ins Halbdunkel seines Zimmers. Seiner Erschöpfung nach konnte er nicht lange geschlafen haben, und doch war er so aufgeregt, dass alle Müdigkeit vergessen war. Ein Blick auf das Leuchtzifferblatt des Weckers bestätigte ihm seine Vermutung; es war gerade mal zehn nach fünf.
Aber der Einfall, der ihm in der Sekunde seines Aufwachens gekommen war, hatte sich geradezu in seinen Kopf gebohrt. Nun hämmerte und rumorte er darin herum, schrie förmlich danach, sofort in die Tat umgesetzt zu werden.
James stand auf, schlich barfuß zum PC hinüber und drückte die Einschalttaste. Ungeduldig trommelte er mit den Fingern auf der Schreibtischplatte herum, bis der Rechner sich fertig hochgeladen hatte. Wenige Mausklicks später öffnete sich die Suchmaschine, und James tippte hektisch Schattenvolk, Ronan, Robyn ein. Innerlich verfluchte er seinen sonst so kühlen Kopf, der natürlich genau dann aussetzen musste, wenn er ihn am meisten brauchte. So eine lange Leitung hatte er bisher noch nie gehabt – wieso war ihm nicht schon früher eingefallen, noch andere Namen außer den von Bray einzugeben?!
Die Suchergebnisse waren kaum auf dem Bildschirm erschienen, als seine Wut auf sich selbst auch schon verrauchte. Die Schlagzeile, die ihm unmittelbar ins Auge sprang, stand ganz oben über den anderen Ergebnissen.
Wakefield-Tochter wieder aufgetaucht! Alicia Wakefield überlebte durch Schattenvolk Selbstmordfahrt ihres Vaters!
James klappte förmlich der Unterkiefer nach unten.
Alicia Wakefield? Ungläubig schüttelte er den Kopf, doch in Gedanken hatte er längst einen anderen Namen geformt.
Ally.
Und plötzlich zuckte ein Grinsen über seine Lippen, das triumphierend und erleichtert zugleich war. Ally war die totgeglaubte Tochter von John Wakefield, dem Gründer der gleichnamigen Modefirma – einen derartigen Skandal hatte die EXASS wahrscheinlich noch nie erlebt! Sie würden alles dransetzen müssen, dadurch nicht in schiefes Licht zu geraten. Sie würden alles dransetzen, dass Ally überlebte und nichts Schlechtes über sie verbreitete.
Tief durchatmend lehnte James sich zurück und fuhr mit dem Pfeil auf das Druckersymbol. Er hatte so eine Ahnung, dass er bald einen wichtigen Anruf bekommen würde. Alles, was er jetzt noch brauchte, war ein Quentchen mehr Geduld …
7
Ein dumpfer Schlag hallte durch den Gang, als die Tür mit voller Wucht ins Schloss geworfen wurde.
Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten und schnelle schwere Schritte ertönten. Das schummrige Licht des Korridors, welches seine Gesichtszüge in regelmäßigen Abständen aufblitzen ließ, verlieh dem jungen Mann etwas raubvogelartiges. Blanke Wut sprach aus seinem Blick, doch ansonsten war seine Miene seltsam undurchdringlich, als wäre sie in Marmor gemeißelt.
Dieser verfluchte Bastard war einfach nicht kleinzukriegen! Er war so selbstgefällig und starrsinnig wie eh und je!
Zornig knüllte Umbra die Sturmmaske zusammen und stopfte sie in die Tasche. Seine Fingernägel gruben sich in die Haut, da er vor Wut die Faust ballte. Im Laufschritt eilte er durch die Kellergänge.
Wenn er es nicht besser wüsste, hätte man annehmen können, dass dieser Hurensohn an den Märtyrerquatsch glaubte, den die Zeitungen über ihn schrieben! Aber da Ronan, oder auch Robyn, seit einer Woche weder Tageslicht, geschweige denn eine Zeitung zu sehen bekommen hatte, konnte man das wohl ausschließen …
Trotzdem schien der Bastard sich sicher zu sein, dass man ihn nicht töten würde … Wahrscheinlich, weil er einfach zu viel wusste! Doch er würde ihm noch früh genug beibringen, dass er in Wirklichkeit gerade mal so viel wert war, wie ein lästiges Stück Scheiße an seiner Schuhsohle … Oh ja, er würde dafür sorgen, dass Ronan um seinen Tod betteln würde, – und ihm diesen Wunsch trotzdem nicht erfüllen …
Das Treppenhaus betretend, hörte er augenblicklich wieder das rastlose Klingeln der Faxgeräte und Telefone. Gedämpfte, aber deutlich aufgeregte Stimmen drangen durch die geschlossenen Bürotüren zu ihm hin. Seitdem Rainey die sofortige Pressemeldung über Alicia Wakefields Wiederauftauchen in Auftrag gegeben hatte, war buchstäblich die Hölle los. Zwar war das Ausmaß des Skandals durch die offene Konfrontation mit der Presse abgeschwächt worden, doch nun riefen Reporter über Reporter an, wollten Infos und Termine. Manche waren sogar so unverschämt, dass sie sich in Begleitung ganzer Fernsehteams draußen vors Tor stellten! Im Vorbeigehen einen Blick durchs Fenster werfend, wandte Umbra sich gleich wieder kopfschüttelnd davon ab, als er einen Pförtner zu sehen bekam, der wie verrückt in sein Funkgerät hinein brüllte.
Es gab andere Dinge, um die er sich kümmern musste …
Zielstrebig schlug der junge Agent den Weg zu seinem Büro ein. Wie erwartet, fand er dort einen ganz bestimmten Kollegen aus dem Rang Epsilon vor: Imago saß am Tisch, in eine aktuelle Tageszeitung vertieft. Kaum jedoch hatte er den Älteren bemerkt, ließ er die Zeitung fallen und sprang vom Stuhl auf.
„Setz dich!”, befahl Umbra ihm scharf. „Genau deswegen”, er blieb vorm Schreibtisch stehen und tippte auf die Schlagzeile der Zeitung, „bin ich hier.”
Voller Genugtuung registrierte er aus den Augenwinkeln, wie Imagos Blick nervös das Titelblatt streifte, auf dem in großen Lettern die mögliche Hinrichtung von Ronan verkündet wurde.
„Ich frag mich … wie die darauf kommen!” Langsam, regelrecht lauernd, schritt Umbra im Halbkreis um den Jüngeren herum. „Meines Wissens wurde nichts dergleichen beschlossen, sondern lediglich darüber beraten …”
Imago hatte seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Titelseite geheftet. „Na ist doch ganz logisch -”
„Augen zu mir!!!”, donnerte Umbra ihn an.
Der Epsilon zuckte zusammen und sah erschrocken zu ihm auf.
„Weiter im Text?”, forderte der ihm übergeordnete Agent ihn mit einem dünnen Lächeln auf. Imago schluckte unsicher, da Umbras Augen sein Gesicht taxierten, als könnten sie direkt in ihn hinein sehen.
„Ich meine …“, er musste all seine Konzentration zusammennehmen, um dem stechenden Blick des Alphas nicht unbewusst auszuweichen. „Zeitungen waren schon immer die Vierte Gewalt. Sie käuen nur das wieder, worüber sich die Leser schon seit Wochen nicht einig werden. Nur, dass sie diesmal eins und eins zusammengezählt und die öffentliche Meinung auf die Politiker projiziert haben.”
Je weiter Imago redete, desto weiter wanderten Umbras Augenbrauen in die Höhe. Er musste unweigerlich zugeben, dass diese Ausführung alles andere als an den Haaren herbeigezogen klang.
„Du kleine Ratte hältst dich wohl für ganz schlau, was?”, fragte er spitz. Der Alpha begann von Neuem um den Schreibtisch herumzuwandern. „In der Tat eine ziemlich clevere Antwort, nur leider hast du was Wichtiges vergessen …”
Blitzartig wirbelte Umbra herum und spießte die Klinge seines Messers direkt zwischen Imagos Finger.
„Wie ist dein Rang, Bursche?!”
„E-Epsilon …„ Mit schreckgeweiteten Augen starrte er den Älteren an. Dieser grinste süffisant.
„Und wie ist mein Rang?”
„Alpha”, flüsterte Imago.
„Korrekt”, eine lässige Bewegung seiner Hand löste das Wurfmesser von der Tischplatte. „Und das nächste Mal”, gelassen senkte er die Klinge tiefer, ließ die Spitze langsam über Imagos Handrücken wandern. Es brannte wie Feuer. „Wird die hier ihr Ziel nicht verfehlen. Also pass besser auf deine lockere Zunge auf, wir wollen doch nicht, dass sie dir plötzlich fehlt – nicht wahr?!” Unvermittelt riss er die Klinge hoch und hinterließ einen zweiten blutigen Schnitt direkt am Kinn des Epsilons. Imago stieß einen erstickten Schrei aus und presste die Hand auf die Wunde. Ein höhnisches Lächeln umspielte Umbras Lippen. „Und wer weiß, wen sie dann noch alles trifft …”
Verstört sah Imago zu, wie der Alpha-Agent seine Waffe in der Hand kreisen und in die Scheide zurückgleiten ließ, als wäre sie ein Kinderspielzeug.
„Wir sehen uns!”, flötete Umbra ihm noch zu, bevor er das Büro wieder verließ.
Leichenblass blieb Imago am Schreibtisch sitzen. Seine Hände umklammerten krampfhaft die Armlehnen seines Drehstuhls. Obgleich ihm das Blut am Hals entlang tropfte und allmählich die verletzte Hand verschmierte, zog er es vor, erst einmal bis Fünfzehn zu zählen, ehe er sich erhob. Auf wackeligen Beinen schlich er hinüber zur Tür und sah durch einen Spalt nach draußen. Umbra schien tatsächlich weggegangen zu sein. Zögernd zog er die Tür weiter auf, trat über die Schwelle, nur um sich erneut umzublicken.
Nichts war zu sehen. Nur die Telefone, hektische Stimmen und das Piepen von Computern und anderen Geräten schallte durch die Gänge. Hastig lief Imago den Flur entlang, bis er die Männertoiletten erreichte. Ein Blick in den Spiegel sagte ihm, dass es zum Glück schlimmer schmerzte, als es eigentlich war. Nachdem er die Wunden mit fließendem, kalten Wasser gesäubert hatte, riss er einen Streifen Handtuchpapier ab, um das nachströmende Blut abzutupfen.
Seitdem er für die EXASS, die Exekutive Agentur für Staatssicherheit, arbeitete, geschah sein Handeln fast nur noch automatisch. Die Zeiten, in denen er noch versucht hatte, sich mit Verweigerung und Diskussionen aus diesem politischen Sumpf herauszuwinden, waren längst vorbei. Inzwischen hatte er begriffen, dass er nichts weiter war als ein Bauer auf dem gigantischen Schachbrett der Gesellschaft. Er war nur einer von vielen, die man problemlos beseitigen konnte, sobald sie nicht mehr von Nutzen waren. Ergo musste er sich im wahrsten Sinne des Wortes nützlich machen, wenn er das Schlimmste verhindern wollte.
Doch jetzt zeigte sein Spiegelbild ihm mehr als nur deutlich, dass er es damit wohl ein bisschen zu wörtlich genommen hatte. Was er dort sah, war nichts als ein zweibeiniges Nervenbündel.
Das instinktive Strammstehen, wenn ein Vorgesetzter den Raum betrat; das disziplinierte Anschauen und Hinhören, damit er auch ja keinen versteckten Befehl missachten konnte; seine eigenen Worte, die er im Kopf dreimal überschlug, bevor er sie auszusprechen wagte – all dies verdrängte immer mehr eine andere, bedeutend wichtigere Fähigkeit: Selbständiges Denken.
Imagos Finger zitterten, als sie behutsam über den Schnitt am Kinn fuhren. Er war so sehr auf das ihm eingebläute Verhalten fixiert gewesen, dass er die Reaktion seines Mentors noch nicht mal hatte kommen sehen!
Und doch wusste er gerade deswegen, dass mit Umbra ebenso wenig zu spaßen war, wie mit dem EXASS-Leiter Calum Rainey. Der Sicherheitschef hatte seine Drohungen schon vor Wochen wahr gemacht und ihn zu dem Alpha ‚in die Lehre’ gegeben. Und Umbra selbst hatte ihm bereits mehrfach bewiesen, dass er zu allem bereit war, wenn es darum ging, ihn und den anderen niederen Agenten absoluten Gehorsam zu lehren. Was eben im Büro passiert war, zählte in seinen Augen höchstens als Gedächtnisstütze. Wo andere einen Knoten im Taschentuch machten, hinterließ Umbra Narben – innere und äußere …
Imago atmete tief durch, versuchte, den Kloß im Hals hinunterzuwürgen. Mit der Betrachtung seines geisterhaften Ichs im Spiegel war ihm bewusst geworden, dass er so nicht mehr lange weitermachen konnte. Entweder er ging als Bauer unter, oder er musste zum Läufer werden – nur das war leichter gesagt als getan.
8
Zum unzähligsten Male durchbrach das schrille Krächzen des Modellautos die Stille im Kinderzimmer, riss den Teenager auf dem Bett wiederholt aus seiner Konzentration. Fasziniert spähte Luis über den Rand seines Buches hinweg zu dem Jungen, der bäuchlings auf dem Boden lag und unermüdlich ein Spielzeugauto nach dem anderen aufzog, um sie immer wieder auf der alten Autorennbahn entlangflitzen zu lassen.
Lucas war drei Jahre jünger als er; erst zehn, und der Anblick des im Spiel versunkenen blonden Jungen erinnerte Luis daran, dass er in diesem Alter auch noch durch so etwas zu begeistern war. Stundenlang hatte er seinen großen Bruder mit diesen Geräuschen nerven können …
Ein scharfes Huiiiiii erklang, und wieder sauste das rote Rennauto durch die Kurven und Loopings. Immer noch halb hinter dem aufgeklappten Buch verborgen, verfolgte Luis, wie Lucas nun zwei Autos gleichzeitig aufzog, die Räder mit gekrümmten Fingern vom Durchdrehen abhielt und sie direkt hintereinander auf die Bahn setzte.
Woosh – pesten beide Fahrzeuge auf einmal los.
Luis tauchte erneut hinter seinem Buch ab. Doch er sah nicht die Buchstaben, sondern Bilder von früher, an die er seit langem nicht mehr gedacht hatte.
Jeff hatte es ihm gezeigt. Wie man WIRKLICHE Rennen fahren konnte. Wie man Sprungschanzen baute, so dass die Autos mit Karacho fast ans andere Zimmerende flogen …
Aber Jeff war tot. Seit bald einem Jahr jetzt. Ein Jahr, in dem er sich solchen Kleinkinderkram restlos abgewöhnt hatte! Bis auf die Abenteuerbücher, die Jeff früher gehört hatten … Die Schatzinsel, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Die unendliche Geschichte, Robin Hood, … in allen Geschichten überlebte der Held Gefahren und siegte am Ende. Manchmal starb er am Schluss, so wie Robin Hood. So wie Jeff …
Luis kaute nervös auf seiner Unterlippe. Das immer wiederkehrende Modellautogeräusch lockte seinen Blick erneut aus Moby Dick heraus. Ein grünes und ein oranges Auto schossen durch die Plastikschienen; das grüne stürzte mitten im Looping ab. Lucas griff erneut danach und zog es auf. Diesmal warf das grüne Auto bei seinem Absturz das nachfolgende orange mit aus der Bahn.
„Mist”, zischte Lucas leise.
„Nimm das weiße.” Luis ließ sein Buch sinken. „Das ist besser. Das grüne schafft meistens nur kleinere Loopings.”
Kurz sah der kleinere Junge auf, nahm sich dann tatsächlich das weiße Auto und ließ es zusammen mit dem orangen starten. Luis grinste verhalten. Er rutschte von der Wand weg, gegen die er sich bis jetzt gelehnt hatte und legte sich nun seinerseits auf den Bauch. Suchend wanderte sein Blick über die Zeilen, bis er die Stelle gefunden hatte, an der er stehen geblieben war. Doch er kam nur bis zum Ende des Absatzes, da riss ihn erneutes Krachen aus der Geschichte.
Lucas zappelte kichernd mit den Beinen in der Luft herum. Er hatte anscheinend gerade herausgefunden, dass Karambolagen ziemlich lustig sein konnten, wenn man sie gezielt herbeiführte. Eben flitzten wieder zwei Autos, diesmal in unterschiedliche Richtungen, auf der Bahn davon – nur um Sekunden später ineinander zu rasen und sich zu überschlagen.
Romms – Huiiii – Zack – Huiiii – Krach …
Luis hatte das Kinn in beide Hände gestützt, ließ seinen Blick abwechselnd von der Rennbahn zur Verpackung schweifen, in der noch restliche Straßenschienen lagen. Ein flüchtiger Seitenblick zum Spielzeugregal genügte, und er kletterte vom Bett runter. Moby Dick ließ er achtlos mit aufgeschlagenen Seiten und dem Buchrücken nach oben auf seiner Bettdecke liegen. Stattdessen zog Luis nun einen Stapel alter Kinderbücher aus dem Regal, die allesamt dünn gebunden und breitflächig waren.
Diese Bücher stellte er direkt neben der Autorennbahn ab, was Lucas in seinem Spiel stutzen ließ. Wie selbstverständlich baute Luis die Schienen auseinander, um sie anders zusammenzusetzen. Lucas beobachtete ihn gespannt. Das Ergebnis waren zwei parallel verlaufende Straßen, die beide auf gleicher Höhe einen kleinen Looping hatten, die sich ebenfalls in geraden Strecken verliefen. Unter diese beiden Enden schob Luis nun nacheinander ein paar Bücher, so dass die Steigung etwa gleich hoch war. Anschließend holte er vom Schreibtisch zwei Bleistifte, die er links und rechts der Bahnen als Startmarker positionierte. Gleich darauf hatte er sich ein rotes Auto geschnappt, welches er aufzog und direkt mit der Schnauze zum Stift auf die Rennbahn stellte, drauf achtend, dass sie nicht über die gedachte Linie hinaus ragte. Lucas nahm sich einen blauen Rennwagen und tat es ihm gleich.
„Auf die Plätze -”
„ … fertig …”
„LOS!”, riefen beide zugleich und ließen die Modellautos losrasen. Fast im selben Moment überfuhren sie die Steigung und flogen durch die Luft, doch das rote Auto wurde ein gutes Stück weiter geschmettert.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














