
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wie ergeht es einem Jungen, der feststellen muss, dass er auf einmal eine Krähe geworden ist. Und wie lebt es sich, so als Krähe, die eigentlich ein Junge ist? Gibt es doch noch eine Möglichkeit, diese Verwandlung wieder rückgängig zu machen? Es ist eine irre Geschichte, die Barbara Kühl in „Ein irrer Vogel“ erzählt. Und eine zum Nachdenken über Menschen und Tiere. Aber auch die Geschichten „Flummi“ und von „Schlappohr“, dem geschenkten Schäferhund, über Glücksvögel im Pech, über dreizehn gerettete Krebse und Kunstreiten auf dem LPG-Schafbock sowie über eine schwarze Spinne sind lesens- und vorlesenswert. LESEPROBE: »Ach, was! Lebende Krähen liegen nicht im Bahnhof rum. Siehst du, sie ist mausetot.« Wieder schubst mich ein Schuh. »Vorsicht, das ist mein Sohn!«, zetert da mein Vater los, bückt sich, rafft mich empor, drückt mich an seinen Kittel. Gibt das ein Gelächter! »Der Krähenkadaver da — det soll Ihr Sohn sein?« Als sich mein Vater schweigend umdreht, murmelt irgendwer: »So ein Bekloppter! Der hat doch mehr als einen Vogel.« Die Fahrt zum Institut dauert kaum fünf Minuten. Der Pförtner grüßt, und schon geht’s ab in die geheiligten Räume. Dabei redet mein Vater ununterbrochen — von seinem Flug-Gen-Projekt natürlich und davon, dass heute ein besonderer Abschnitt seiner Forschungen begänne. »Deine Krähenwerdung, Robert — was für ein Glücksumstand! Ich bin sicher, durch diesen Zufall das Geheimnis um die Flugfähigkeit des Menschen enträtseln zu können. Sag nichts, Robert! Kein Wort über den Verwandlungshergang, damit ich keine falschen Schlüsse ziehe. Erst nach den Untersuchungen werde ich deine Aussagen protokollieren. Und nicht die kleinste Bemerkung zu meinem Assistenten, Robert!« »Okay, Papa!«, will ich sagen, aber es wird nur ein lang gezogenes Kra-ah. Da stutzt mein Vater. »Donnerwetter, Robert, dein Gekrächze klingt verblüffend echt. Die Sprache der Krähen entschlüsseln! Möglicherweise gelingt mir auch das.« Richtig glücklich ist mein Vater. Und plötzlich küsst er mich auf den Schnabel. »Ja, es sind deine Augen, mein Junge. Unverkennbar. Und ich ahne, dass ich kurz vor einer sensationellen Entdeckung stehe.« Eine Tür klappt. Schritte. »Oh, Herr Professor!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Barbara Kühl
Schlappohr, ein irrer Vogel und andere Tiergeschichten
ISBN 978-3-86394-675-3 (E-Book)
Die Druckausgabe von „Schlappohr und andere Erzählungen“ erschien 1990 in der Reihe „Kleine Trompeterbücher“ (Band 195), „Ein irrer Vogel“ erschien 1993, beides im Kinderbuchverlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Erika Godemann
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Ein irrer Vogel
1. KAPITEL
»Keine Widerrede, bitte! Du bringst den Brief hin. Jetzt sofort!«
»Aber Papa! Tobias kommt gleich.«
»Tobias kommt nicht.«
»Wieso?«
»Ich hab ihm abtelefoniert.«
»Was?« Ich stehe da wie bescheuert, starre meinen Vater an und denke: Mann, du spinnst wohl! Bin ich dein Dienstbote?
»Geh endlich! Es ist dringend.«
»Dann ruf doch an!«
»Dr. Servatius hat kein Telefon.«
»Mann, Papa! Ein Doktor der Wissenschaft ohne Telefon! Wer’s glaubt ...«, maule ich.
»Robert!« Mehr sagt mein Vater nicht. Gleich wird er explodieren. Nicht, dass er mir eine feuert! Das ist nicht sein Stil.
Trotzdem gehe ich auf Abstand, für alle Fälle. Wir starren uns in die Augen, schweigend. Obwohl ich größer bin als mein Vater, fühle ich mich mindestens einen halben Kilometer unter ihm. »Na gut«, lenke ich ein und streck die Hand nach dem Brief aus.
Mein Friedensangebot wird angenommen.
»Du übergibst den Brief persönlich, Robert. Doktor Servatius, Mauerstraße. Und komm auf keinen Fall ohne Antwort zurück, hörst du? Ich brauche die Antwort.«
Typisch Papa! Typisch Wissenschaftler! Wenn dem was im Kopf rumspukt, und irgendwas spukt da meistens rum, ist alles andere Nebensache. Auch das Wochenende. Und sogar Mama in ihrem Zustand.
Mauerstraße also. Da werd’ ich die U-Bahn nehmen. Hin und zurück ’ne gute Stunde, plus ein paar Minuten Fußweg, plus Palaver mit diesem Doktor Dingsbums in der Mauerstraße Nummer ..., Nummer ... Wieso steht auf dem Briefumschlag keine Hausnummer?
Wütend trete ich gegen die sich schließende Haustür und stürze die viereinhalb Treppen zurück nach oben.
In der Wohnung ist es still.
»Papa!«
Ich sprinte zum Arbeitszimmer, will die Tür aufdrücken und knalle voll mit dem Gesicht dagegen. »Aaa-ua!« Knochen knirschen, Blitze durchzucken mein Gehirn. Sekundenlang kreist mir sozusagen der Hut, dann schreie ich: »Mensch, Papa! Warum schließt du dich ein?« Keine Antwort. Aus dem Zimmer dringt kein Laut.
»Papa?«
Nichts.
»Papa! Hörst du denn nicht? Ich brauch die Hausnummer von Doktor Servatius. Mach endlich auf! Oder trag den dämlichen Brief allein in die Mauerstraße.«
Da! Ein Geräusch! Ein Stöhnen. Oder war das in meinem Kopf? Fest presse ich ihn an das Türholz. Watum, watum, watum, macht es in meinem Ohr, watum, watum. Nichts sonst ist zu hören.
Durchs Schlüsselloch sehe ich zuerst gar nichts, weil der Schlüssel steckt. Von innen.
Da! Ein Schatten, eine Bewegung. Vater. Er steht neben seinem Schreibtisch, mit dem Gesicht zur Tür, lauscht. Warum das? Hat er was zu verbergen? Wartet er, dass ich verschwinde?
»Hau ich eben ab!«, gröle ich, stampfe durch den Flur, reiße die Wohnungstür auf, werfe sie krachend zu.
Keine drei Sekunden später hänge ich wieder am Schlüsselloch. Und werde starr vor Schreck. Ganz deutlich sehe ich auf dem Schreibtisch ein Stück Zellstoff und eine Spritze liegen. Und mein Vater fummelt an seinem linken Hemdärmel rum, krempelt ihn auf, knotet um seinen Bizeps ein rotes Stück Gummischlauch, zurrt es mit den Zähnen und seiner freien Hand zusammen. Dann klatscht er mit den Fingerspitzen in die Armbeuge, reibt ein bisschen, schnappt sich die Spritze.
Halt! Tu es nicht! will ich schreien. Doch meine Stimmbänder und sämtliche Muskeln meines Körpers sind wie gelähmt. Schon dringt die Nadelspitze in die Vene, schon drückt sich mein Vater die farblose Flüssigkeit hinein, löst den Stauschlauch, taumelt plötzlich und fällt rückwärts auf die Lederliege.
Das kann doch nicht wahr sein! Mein Vater, der bekannte Genetikprofessor Reginald Ross, hängt an der Nadel. Woher hat er das Teufelszeug? »Quatsch! Alles Quatsch, Robert Ross!«, versuche ich mich lautstark zu beruhigen. Aber die Spritze war kein Quatsch, war keine Halluzination. Papa hat sich soeben einen Schuss gesetzt.
Ein Geräusch reißt mich wieder ans Schlüsselloch, Die Lederliege ist leer. Aber irgendwo im Raum ist ein Gewimmer. Da! Jetzt sehe ich Papa wieder. Was treibt der da bloß? Reibt seine Arme und Beine, kratzt sich am Kopf und am Körper. Und wimmert. Jault wie ein junger Hund. Plötzlich geht er in die Knie, knallt die Stirn auf den Fußboden, pendelt vor und zurück, presst seine Schläfen, als hätte er wahnsinnige Schmerzen. Ich muss ihm helfen, muss da rein, muss zum Telefon. Sofort! Und sei es mit der Axt!
Da fällt mir die Durchreiche ein. Also los! Natürlich bleib ich mit dem Jeanszeug hängen, ehe ich mich endlich von der Küche ins Arbeitszimmer gezwängt habe.
»Papa?«
Ganz ruhig liegt er da, mit geschlossenen Augen. Das Kinn ist weiß und spitz, das Gesicht schweißnass.
Ich wage nicht, ihn anzufassen. Zitternd steige ich über ihn hinweg, greife zum Hörer. Nein, nicht bei Tante Martha anrufen. Mama könnte vor Schreck ’ne Fehlgeburt haben. Die Polizei muss her. Nein, ein Arzt! Ein Rettungsdienst! Ich wähle ...
»Leg den Hörer auf«, sagt mein Vater. »Leg sofort den Hörer auf!«
»Mann, Papa«, stammle ich. Er sieht aus wie von den Toten auferstanden. Trotzdem bin ich froh, sehr froh sogar. Gleich wird er sich rechtfertigen, wird irgendeine Story loslassen oder alles abstreiten. Aber da ist nichts abzustreiten. Die Spritze auf dem Schreibtisch ist nicht zu übersehen.
Doch mein Vater sagt nichts. Sein Atem geht stoßweise. Wütend fauche ich: »Seit wann machst du das? Willst du dich umbringen?«
»Mir ist übel«, murmelt mein Vater und fällt in seinen Arbeitssessel.
»Ach, dir ist übel!«, schreie ich. »Aber wie mir ist, danach fragst du nicht. Ich krieg gleich das Kotzen, wenn ich dich so sehe ...«
Ich schlucke. Bloß nicht losflennen! Blitzschnell wische ich die Spritze zu Boden und trampele und stampfe darauf herum, bis das Rote vor meinen Augen verschwindet.
Mein Vater scheint sich besser zu fühlen.
»Setz dich!«, sagt er.
»Ich kann stehen.«
»Dann steh! Und hör zu! Ich bin nicht drogensüchtig, wie du vielleicht annimmst. Ich ...«
»Ja, ja, ja! Ich bin ein bisschen bescheuert und hab nichts gesehen — die Spritze nicht und auch nicht, dass du fast krepiert bist.«
»Aber du irrst dich, Robert! Du irrst dich wirklich!«
»Aha!«, sage ich nur.
»Ja, ich habe mich gespritzt. Aber nicht mit einer Droge.«
»Womit dann?«
»Mit einem Gen.«
»Mit einem — was?«
»Einem Gen, dem Träger bestimmter Merkmale und Eigenschaften, die vererbt werden können. Augenfarbe zum Beispiel, Körperbau, Intelligenz. Oder auch Krankheiten — leider! Heuschnupfen zum Beispiel.«
»Wetten, den hast du dir nicht gespritzt«, lache ich und bin mächtig erleichtert. »Ich tippe mehr auf ein Intelligenz-Gen. Dann müsstest du ja superschlau werden, stimmt’s?«
»Nein, Robert, ich nicht. Meine Nachkommen.«
»Aha«, sag ich wieder. »Und die sind dann klüger als du.«
»So ungefähr.«
»Schade«, sag ich und denke an das Baby in Mamas Bauch, »schade, dass ich nichts mehr davon habe.«
»Wovon?«, fragt mein Vater und fängt plötzlich wieder an zu zucken.
»Na, von dem zusätzlichen Intelligenz-Gen, das du jetzt in dir hast.«
Trotz der Zuckerei quält sich Papa ein Lächeln ab. »Ich hab mir ein Flug-Gen gespritzt, Robert. Ein Flug-Gen! Immer hab ich davon geträumt, es zu entdecken, es isolieren zu können. Vor ein paar Tagen ist es mir gelungen. Aus Krähenblut. Nun will ich es ausprobieren. Am Menschen. Ich bin sicher — vor Urzeiten lebten menschenähnliche Wesen, die fliegen konnten. Veränderte Umweltbedingungen haben das Gen gleichsam verschüttet. Es schlummert also noch in uns, in dir, in mir. Und muss nur aktiviert werden. Fliegen, Robert! Kannst du dir das vorstellen? Fliegen aus eigener Kraft! Ohne Treibstoff, ohne Abgase. Weißt du, was das für die Umwelt bedeutet? Für die Wirtschaft, für die Raumfahrt? Ja, der Mensch der Zukunft muss flugfähig sein. Und mir wird die Entwicklung dieser neuen Spezies gelingen. Durch Gen-Manipulation.«
Mein Vater rudert mit den Armen, düst in Kurven durch sein Arbeitszimmer. Wie ein ernsthafter Wissenschaftler sieht er dabei nicht aus. Dabei ist er sogar Mitglied des Wissenschaftsrates und fährt alle naslang zu Vorträgen ins Ausland. Trotzdem! Fliegende Menschen! Wie das wohl funktionieren soll?
Plötzlich wird mir heiß. Vererbung! zuckt es durch meinen Kopf, Nachkommen! »Papa«, stottere ich und grinse ein bisschen, »Papa, wenn sich das Flug-Gen weitervererbt, da bringt Mama vielleicht ’nen Vogel zur Welt?«
Zack! hab ich mir eine Maulschelle eingefangen.
»Robert! So etwas darfst du nicht einmal denken! Das wäre ja ein Verbrechen! Experimente mit Menschen sind unmenschlich und streng verboten.«
»Und deine Spritzerei? Was war dann das?«
»Das war ein Selbstversuch.«
»Und? Was hast du davon, wenn du sowieso nicht selbst fliegen kannst? Und wenn Mama kein Baby mit Flügeln kriegt?«
»Ach, vergiss es! Und halt um Himmels willen deinen Mund!«
»Ich will es aber wissen!«
Im Gesicht meines Vaters arbeitet es. Seine kleinen, grauen Hirnzellen laufen garantiert auf Hochtouren. Ob Wissenschaftler oder Scharlatan - ich bin jetzt sein Mitwisser. Und das stört ihn. Weil es ihn nämlich erpressbar macht. Natürlich würde ich meinen Vater nie in die Pfanne hauen! Dazu bin ich viel zu stolz auf ihn. Vielleicht gelingt sein Flug-Gen-Projekt, und er kriegt den Nobelpreis dafür.
Mein Vater gibt scheinbar nach. »Ich werde den Selbstversuch so lange wiederholen, bis das Flug-Gen in meinem Körper nachweisbar ist.«
»Ist das nicht gefährlich?«
»Ohne Risiko kein Erfolg.«
»Und dann?«
»Was — dann?«
»Na, das Flug-Gen in dir. Was machst du damit?«
»Also, ich plane Laborversuche. Im Institut. An ... an ...«
Mein Vater zögert zwei, drei Sekunden. Da weiß ich sofort: Jetzt kommt eine Lüge.
»... an weißen Mäusen natürlich, denen ich mein Blut mit dem Flug-Gen injiziere.«
Ich pruste los. »So ein Quatsch, Papa! Du willst doch keine Fledermäuse! Du willst doch fliegende Menschen. Ich weiß zwar nicht, wie, aber irgendwann züchtest du einen Homunkulus mit Flügeln, da wett ich drauf.«
»Warum hab ich dir bloß davon erzählt?«, stöhnt mein Vater. »Zu niemandem ein Wort, Robert, ich beschwöre dich! Nein, ich bitte dich!«
So klein hab ich meinen Vater noch nie gesehen. Plötzlich bin ich der King, und ich höre mich ganz cool sagen: »Okay! Für ’n Videorekorder halt ich die Klappe.«
Das Gesicht meines Vaters verfärbt sich. Er öffnet den Mund, will was sagen.
»Mama kommt!« Blitzschnell bück ich mich nach der zertretenen Spritze, sammle Kolben, Kanüle und ein paar Splitter in den Papierkorb, lass den Rest unterm Teppich verschwinden und schließe rasch die Tür auf.
Die winzige Wunde am Finger bemerke ich erst, als Papa sagt: »Du blutest ja! Hast du dich etwa an der Spritze verletzt?«
»Kann sein.«
»O mein Gott!«
»Ich werd schon keine Flügel kriegen, Papa«, spotte ich und puste auf den mit Jod betupften Finger.
»Schweig, Robert! Schweig doch, um Himmels willen!«
Mama merkt nichts von unserer Verschwörung. Aber wie sie aussieht! Käsebleich. Vorsichtig gleitet sie in einen Sessel und massiert leise stöhnend ihren starken Leib. »Ich glaube, es kommt eher«, sagt sie und streift die Schuhe von den Füßen. Wie geschwollen sie sind! Und während ich nach einem Hocker renne, höre ich meinen Vater fragen: »Soll ich den Rettungsdienst rufen?« Mama fährt nicht in die Klinik, und Papa weicht nur von ihrer Seite, um mir noch einmal den Brief für Dr. Servatius zuzustecken. Wortlos verlasse ich die Wohnung.
2. KAPITEL
»Hallo, Robert!«
»Hallo, Trixi«, antworte ich. »Du hier?«
»Wieso nicht?«
»Bogenschießen ist nichts für Weiber.«
»Keine Beleidigungen, Robert Ross!«
Wie Samt sehen Trixis Augen aus, wie superweicher, dunkelbrauner Samt. Mir wird heiß. Und mir fährt ein Kribbeln in den Bauch, dass ich nach Luft schnappen muss.
»Zeig es ihr«, sagt Herr Koopmann mitten in das Kribbeln hinein. Logisch, dass er das zu mir sagt. Und dass er mir den Bogen reicht, mir, dem besten Schützen der Gruppe.
Wortreich erkläre ich Trixi Fußstellung, Finger- und Körperhaltung, hüpfe um sie herum und komme mir ungeheuer wichtig vor.
»Angeber!«, zischt irgendwer.
Na und? Wer Spitze ist - und ich bin Spitze - darf auch damit angeben. Also stelle ich mich hinter Trixi, führe ihre rechte Hand zum Bogen, die linke zur Sehne mit dem eingelegten Pfeil. Unsere Körper sind eng beieinander. Ich spüre Trixis Wärme, spüre ihre Haare an meinem Hals. Und während wir gemeinsam den Bogen spannen, gleitet mein Handballen zufällig über Trixis Nicky. Wie eine warme Welle fährt es mir in den Bauch, summt durch den Körper, hebt mich empor, lähmt mich. Ich verreiße den Bogen, der Pfeil rauscht gegen die Turnhallendecke. Erschrocken stehe ich da und schlucke, verwirrt und mit weichen Beinen. Und plötzlich weiß ich, was mit mir los ist. Ja, ich mag sie. Ich mag sie sogar sehr.
Zu Hause suche ich in meinem Gesicht nach Männlichkeit. Keine Anzeichen? Na, aber! Dichte Augenbrauen, kräftige Nase, markiges Kinn, kein Gramm Babyspeck. Das ist doch was! Zufrieden grüße ich mein Spiegelbild. »Hello, old Boy, du Supertyp!« Rasch lasse ich Vaters Rasierer über meine Wangen schnurren. Warum nicht ein bisschen nachhelfen? Reichlich Aftershave kann auch nicht schaden, denke ich mir. Der Duft ist jedenfalls gewaltig.
Plötzlich steht meine Mutter neben mir. »Na, Filius?«, fragt sie gut gelaunt. »Irgendwelche Probleme?«
»Nö, eigentlich nicht.«
»Eigentlich? Dann ist also nicht alles in Ordnung?«
»Doch, Mama. Bloß ..., ach, das verstehst du nicht.«
Meine Mutter sieht toll aus. Rosiges Gesicht, blanke Augen, schulterlange, gepflegte Haare.
Keine Spur vom gestrigen Unwohlsein. Für zweiunddreißig noch mächtig attraktiv, meine Mutter. Und bisher war sie für mich die Größte und Schönste, bisher. Nein, ich will sie nicht traurig machen, oder eifersüchtig. Wie zufrieden sie ihren Leib umfasst! Da! Das Kleine strampelt. Ich kann es sehen durch das dünne Leinenkleid. Wehe, Papa! Wehe, Mama kriegt ein Vogelmonster!
»Mütter verstehen alles. Also keine Ausflüchte, Robert! Was ist los mit dir?«
»Aber es ist nichts, Mama! Ehrlich! Das bisschen Kribbeln ist doch normal.«
»Welches Kribbeln?«
»Das im Bauch.«
»Im Bauch? Dich kribbelt’s im Bauch? Hast du Durchfall? Ist dir übel? Und wo genau sitzen die Krämpfe?« Meine Mutter ist zwar nicht in Panik, aber sie drückt an mir rum und stellt mir hunderttausend Fragen.
»Aber Mama! Ich habe keine Krämpfe! Es ist nur so ein Kribbeln. Wie eine Welle, weißt du? Und es macht mir weiche Beine und so ...« Um sie zu beruhigen, beschreibe ich es meiner Mutter ganz genau.
Eine Weile guckt sie mich so eigenartig an. »Und wie oft hast du dieses Kribbeln?«
»Eigentlich jeden Tag«, sag ich widerwillig. »Und immer gerade dann, wenn sie ..., wenn sie ...«
»Aha«, sagt Mama, »aha.« Und grinst ein bisschen. Dann packt sie in aller Ruhe den Rasierer ein und fragt: »Und wie heißt sie?«
»Wer?«, frag ich verdattert.
»Na, das Mädchen. Oder hab ich dich falsch verstanden?«
»Trixi! Trixi Schumann. Sie ist auch beim Bogenschießen.« Mehr sag ich nicht. Mehr will meine Mutter auch nicht wissen, glaub ich. Jedenfalls tut sie so, knufft mich wie einen Kumpel und meint: »Na, dann bring Trixi nach dem Training doch mal mit.«
»Einfach so?«
»Einfach so.«
3. KAPITEL
Die Ampel zeigt Rot. Am Himmel ein Flugzeug. Und weiße Wolken wie Wattebatzen, die ihre Form ständig verändern. Muss ganz schön windig sein da oben. Da! Von einer dicken Wolke löst sich ein winziger Tupfen. Eine Babywolke, muss ich denken. Mama und das Baby. Sie schweben über mich hinweg, verschwinden Richtung Stadtzentrum. Neue quellen über den Dächern hervor. Zwei scheinen sich zu jagen, berühren sich, treiben auseinander. Trixi und ich, denke ich und verrenke mir fast den Hals. Irgendwer stößt mich an. »Eh, du Penner, grüner wird’s nicht.«
Die Ampel schaltet schneller als ich. Ran sind die Autos und hautnah an mir vorbei. Da bleibt nicht die kleinste Chance, über die Straße zu kommen. Verdammter Zweiminutentakt! Der Siebenundfünfziger Bus hat nie Verspätung. Verpasse ich ihn, sehe ich Trixi erst in der Schule. Fliegen müsste man können, denke ich und starre neidisch ein paar Krähen nach, die über die Dächer lärmen und irgendwo in den Hinterhöfen verschwinden. Sie werden bei den Mülltonnen nach Essenresten herumstochern.
Grün! Fast hätte ich’s wieder verpasst. Mein Sprint ist olympiaverdächtig. Der 57er steht schon da, blinkt an. Ich vor seiner Schnauze über die Fahrbahn. Der Fahrer droht, aber er lässt mich noch rein. Es gibt auch andere. Die sehen einen kommen und geben trotzdem Gas.
»Danke, Meister!«, keuche ich.
Er grinst bloß und manövriert den Bus in den Verkehrsstrom.
Der 57er ist wie immer rammelvoll, und es dauert, ehe ich mich an Rücken und Bäuchen und Taschen vorbei bis zur hinteren Plattform durchgezwängt habe. Hallo, Trixi, werde ich sagen und mich vor sie stellen. Und in den Kurven werde ich das Gleichgewicht verlieren und gegen sie fallen.
»Pass doch auf, Bengel!«, keift da so ein mittelalterlicher Typ.
»Entschuldigung!«
»Gelatscht ist gelatscht«, bellt der, und ich merke, der will Streit. Ich nicht. Ich will zu Trixi. Trixi ist nicht da. Nicht auf der Plattform und auch nirgendwo sonst in dem Gedränge. Einen Augenblick bin ich wie abgeschaltet.
In der Klasse ist sie auch nicht.
»Wat kiekst’n so belämmert? Ist dir wer gestorben?«
Ja, fast ist mir so, aber was geht das Tobias an? Der sitzt zwar neben Trixi, aber mehr auch nicht. Mehr nicht! Und meinetwegen brauchte er nicht mitzufahren zum Treffen der Bogenschützen. Ich will Trixis Freund sein. Ich ganz allein. Ich werde immer treffen, ich werde der Beste sein. Und Trixi wird mich bewundern, nur mich. Und abends, am Lagerfeuer vor dem Zelt ...
»Super!«, stoße ich hervor und knalle mit der Faust in die Innenfläche meiner Hand.
»Bitte, Robert, sprich deutlicher!«
Seit wann ist die Fischern im Klassenraum? Hat es denn schon geläutet?
»Na, Robert?«, klingt es fragend.
»Keine Ahnung«, stottere ich für alle Fälle, und das ist die reine Wahrheit.
»Kommt ihr nicht beide aus derselben Ecke?«
»Wer?«
Tobias stößt mich an und gröhlt: »Mann, du bist vielleicht bescheuert!«
Da begreife ich, dass es um Trixi geht. »Sie war nicht im Bus«, erkläre ich, »mehr weiß ich auch nicht.«
»Vielleicht ist sie krank?«
Bloß das nicht! Wer soll mich dann beim Bogenschießen bewundern? Nein, ohne Trixi läuft da nichts. Ohne Trixi pfeif ich auf alles.
»Vielleicht hat sie bloß den Bus verpasst.«
Na klar, so wird es sein. Und ich Chaot mach gleich in Panik.
Plötzlich ist sie da, geht zu Frau Fischer, stammelt irgendetwas, schnieft so komisch.
»Wie bitte?«, fragt Frau Fischer.
Da sagt Trixi leise: »Mein Vogel ist gestorben.«
Gibt das ein Gejohle! Prusten, Kichern, Spottfetzen, Gelächter. Und ich lache mit, lache am lautesten von allen. Ein toter Vogel! Als wenn das ein Drama wäre!
»Hast ihn wohl gleich beerdigt?«, lästere ich, als Trixi an mir vorbeigeht. »Fein säuberlich mit Vaterunser und Grabgesang?«
Da feuert sie mir eine - blitzschnell und knallhart. Und in ihren Augen ist kein bisschen Samt. Mir ist, als drückte mich jemand unter Wasser. Als das Rauschen nachlässt und ich wieder auftauche, höre ich Trixi und Tobias tuscheln. »Ich schenk ihn dir«, flüstert Tobias. »Ehrlich, ich schenk dir meinen Hamster. Kannst ihn gleich nach dem Unterricht bei mir abholen.«
»Au ja«, säuselt Trixi. »Und wie heißt er?«
»Willi.«
Willi, Willi! wüte ich in mich rein. Wie ein Tiefschlag ist das. Und ich hasse diesen Willi, hasse Tobias, der sich mit einem Hamster an Trixi ranschmeißt. Hinterhältiger Schuft!


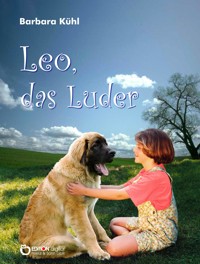
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









