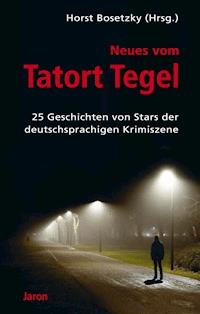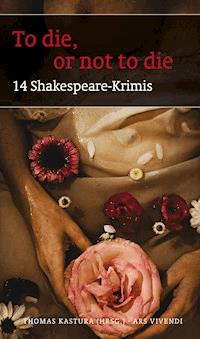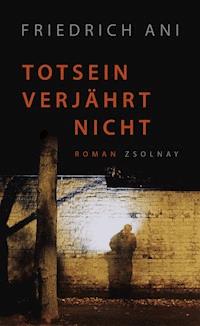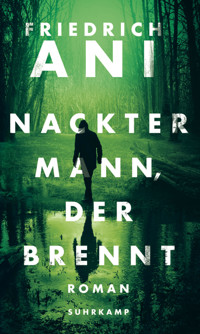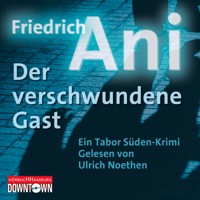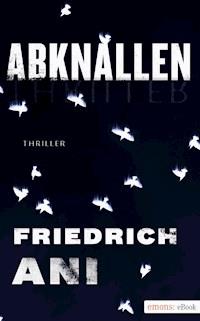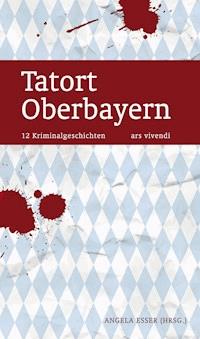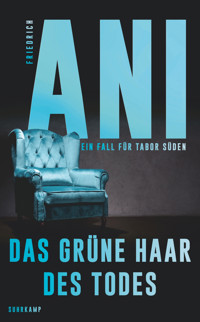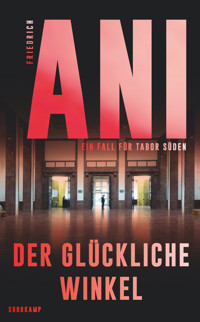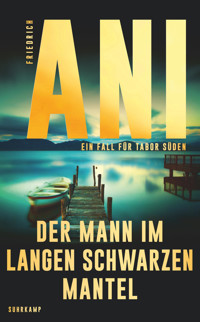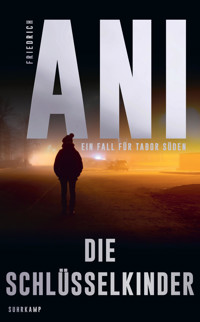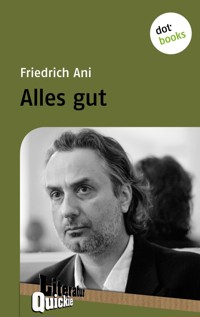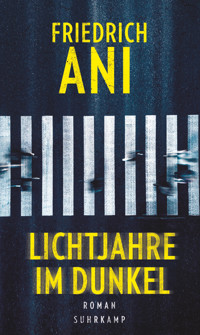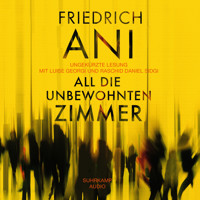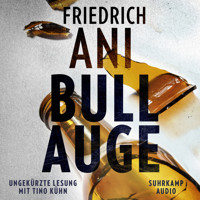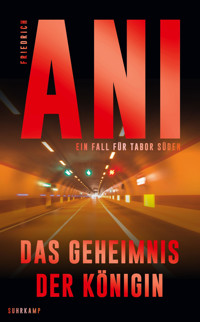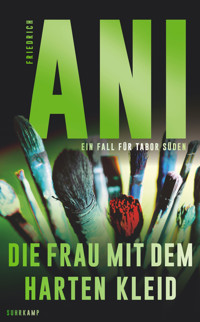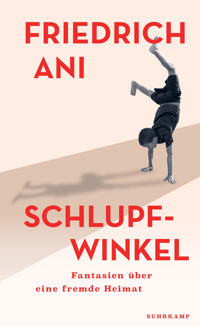
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Dorf in Bayern, Ende der 1950er Jahre: Ein Kind kommt zur Welt aus einer Verbindung, die hier niemand für möglich gehalten hätte. Die Mutter ist Schlesierin und gehört zu den »Heimatvertriebenen«, die sich ein Jahrzehnt zuvor im Ort niedergelassen haben. Der Vater ist ein Medizinstudent aus Syrien, der ins Dorf kommt, um am Goethe-Institut Deutsch zu lernen. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens hatten sie keine gemeinsame Sprache, und ihr gegenseitiges Sprechen blieb ein Leben lang brüchig. So wächst das Kind in einer Atmosphäre des Schweigens auf, sucht nach einem Schlupfwinkel für die eigene Existenz und findet ihn in der Literatur.
Schlupfwinkel beschreibt den Werdegang eines Autors, der zwar zu einer eigenen Sprache findet und damit Erfolge feiert, doch im Leben ein Verlorener bleibt. Es ist gleichzeitig ein Versuch, die Geschichte der Eltern aus der Distanz heraus zu verstehen und den Momenten nachzuspüren, wo sie vielleicht eine Chance gehabt hätten, eine ausgeglichene Familie zu werden. Und schließlich ist es eine Geschichte von Flucht und möglichem Ankommen, die sich in den »Wirtschaftswunderjahren« abgespielt hat, aber bis heute nachhallt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Friedrich Ani
SCHLUPFWINKEL
Fantasien über eine fremde Heimat
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5517.
Originalausgabe © Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagfoto: Leon JL auf Unsplash
eISBN 978-3-518-78389-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Teil I
Prolog
Aus freien Stücken
Rätselhafter Samstag
Das K-Wort
Die Spinne und der liebe Gott
Der Fremde, sein Schweigen und ich
Teil II
Im Kasten
Neuer Atem
Im Keller
Firewall aus Papier
Blut, Schweiß und Lachen
Don’t walk on grass, smoke it
Teil III
Die Welt: verrutscht
Uraltes Herz
Licht für uns alle
Wie konnte das passieren?
Die Ohrfeige
An der Quelle des Glücks
Epilog
Informationen zum Buch
SCHLUPFWINKEL
Teil I
Prolog
Der Syrer meiner Mutter tauchte Ende der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts auf und blieb bis zum Frühjahr zweitausendzwölf. Dann starb er.
Als mein Vater vor mir lag und meine Mutter neben mir stand, empfand ich nichts als Wut. Nicht auf ihn, weil er tot, und nicht auf sie, weil sie neben mir war, sondern auf mich. Weil ich wieder einmal alles zuließ. Wie seit meinem sechsten Lebensjahr. Als ich sechs war und in die Schule kam, ließ ich zu, dass meine Schultüte leer blieb.
So feige, dieses Kind.
Etwa nicht?
Da lag er, tot im Krankenhaus, und sie gab acht, dass wir keine ungenehmigten Blicke tauschten, er und ich. Wie hätten wir das schaffen sollen?
Weil er tot ist?
Wir hatten nie die Zeit zu üben.
Die Geschichte meines Vaters begann an einem Novembertag in der ostsyrischen Kleinstadt Majadin, in der heute angeblich fast siebzigtausend Menschen leben, damals aber nur zweitausendfünfhundert, weniger als in dem süddeutschen Dorf, wo er schließlich landete und seine Geschichte an einem Märztag neunundsiebzig Jahre nach seiner Geburt endete.
In meiner hin und wieder blühenden Fantasie und eingedenk der Tatsache, dass Vaters Heimatland seinerzeit unter französischem Mandat stand, verlieh ich dem bayerischen Dorf nach dem ersten Jahr Französischunterricht den Namen Le Chok. Meines Vaters erster Schock in seiner gerade beginnenden Zukunft dürfte die Nachricht einer Frau gewesen sein, sie sei von ihm schwanger. Damit hatte er garantiert nicht gerechnet. Auch der Vater der jungen Frau, ein Oberkellner, kam erst durch die Bemerkung eines Gastes auf die Idee, dass mit seiner Tochter etwas nicht stimmen könnte: Neuerdings, meinte der Mann, bevorzuge sie weit geschnittene Kleider, ob das etwas zu bedeuten habe?
Verschweigen, das lernte ich zügig, zählte zu den Grundtugenden in dieser Familie. Und ich wurde, nebenbei bemerkt, zu einem der Tugendhaftesten in unserer Sippschaft. Deren Schock folgte dem des Erzeugers auf dem Fuß, denn der Gast im Wirtshaus hatte mit seiner Vermutung Recht: Die zweitjüngste Tochter des Oberkellners und der Büffetdame trug heimlich ein Kind aus. Und zwar nicht von einem Einheimischen oder einem Mann aus der Flüchtlingscommunity, der sie selbst angehörte, sondern von einem, der freiwillig seine Scholle verlassen hatte und dorthin – so die allgemeine Hoffnung unter den betroffenen Ober- und Niederschlesiern – auch schleunigst wieder zurückkehren würde.
Schwanger von einem studierenden Araber.
Wie war das bloß möglich, fragte meine Großmutter. Interessante Frage, immerhin hatte sie fünf oder sechs Kinder geboren, von denen vier überlebten. Vielleicht ein spezieller Familienhumor. Denn sechs Jahrzehnte später stellte meine Mutter dieselbe Frage in den seligen Augenblicken, in denen die Erinnerung sich ihrer erbarmte.
Aus freien Stücken
Um das Jahr 1945 herum zogen Karawanen entwurzelter Menschen durch Europa, auf der Suche nach einer Herberge. Ihre Elternhäuser lagen in Schutt und Asche, Freunde und Angehörige hatten im Bombenhagel, an der Front, im Schützengraben ihr Leben verloren, ausländische Mächte die Kontrolle über das Land übernommen. Hunger und Elend bis zum Horizont. Was blieb ihnen übrig, als zu fliehen, mit nichts als ein paar Habseligkeiten, ohne Gedanken an die Strapazen, die auf sie warteten, Hauptsache weg, in eine ferne Freiheit.
So strandeten Abertausende dieser Kriegsopfer auch in Süddeutschland, in Oberbayern, in einem kleinen Dorf sechzig Kilometer südlich der Landeshauptstadt. Ihre letzte Station war Kufstein in Österreich gewesen, von dort wurden sie auf das Nachbarland verteilt. Ein Finger des Schicksals zeigte exakt auf den Ort am Alpenrand. Niemand hatte dort auf Schlesier oder Sudetendeutsche gewartet. Trotzdem: Häuser wurden errichtet – mehr Baracken als heimelige Wohnstätten –, in der Maschinenbaufabrik, in der Reißverschlussfabrik, in den wenigen Gasthäusern, auf den Bauernhöfen und im einen oder anderen bescheidenen Familienbetrieb standen manche der Neuankömmlinge nach einiger Zeit in Lohn und Brot.
Allmählich gewöhnte sich die Landbevölkerung an die Fremden – immerhin benutzten sie weitgehend dieselbe Sprache –, man kam sich näher, Beziehungen entstanden, Kinder erblickten das Licht der neuen Welt.
Erst einmal besuchte meine Mutter mit ihren Geschwistern die Volksschule, schloss Freundschaften, galt als halbwegs integriert. Natürlich blieb eine Schlesierin eine Schlesierin, zumal der örtliche Dialekt nie in ihrer Stimme ankam – wie übrigens auch nicht in den Stimmen aller anderen Flüchtlinge, die bis weit in die sechziger Jahre hinein immer noch Flüchtlinge hießen.
Das Wirtschaftswunder erreichte auch das Voralpenland, die Dörfler lebten vom Tourismus, sommers wie winters, neue Wirtshäuser und Pensionen mit so genannten Fremdenzimmern entstanden. Wanderwege und Seilbahnen wurden gebaut, Skilifte und Spaßbäder. Und im Windschatten all des kommerziellen Unterhaltungs- und Vergnügungstrubels eröffnete auf einem Hügel am Dorfrand ein Goethe-Institut.
Ein Goethe-Institut? In einem 4000-Einwohner-Ort? Warum? Für wen? Und wer sollte da hinkommen und … womöglich Bayerisch lernen? Wer?
Ganz einfach: Lauter »wunderbare Neger«, um den herzigen Ausdruck eines bayerischen Innenministers zu gebrauchen, oder, um ein Idiom von Peter Handke zu entfremden, lauter Andershäutige.
Und, o Wunder: Diese jungen Leute, Studenten allesamt, vornehmlich aus Afrika und dem Nahen Osten, verhielten sich tatsächlich wunderbar. Bald beherrschten sie die deutsche Sprache besser als die meisten Mitglieder der Staatspartei. Sie mischten sich ins Dorfleben ein, indem sie neben ihrem Studium in Geschäften oder Restaurants aushalfen, und viele von ihnen wohnten zur Untermiete bei örtlichen Familien. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.
Sudetendeutsche, Schlesier, Schwarze, Hellhäutige, Dunkelhäutige, ein babylonisches Sprachengewirr, das einen einzigartigen Klang erzeugte, kosmisch eingebettet ins tägliche Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirche, in die Aufmärsche der Blaskapellen und das Donnern der Gebirgsschützen. Und an einem Sonntagnachmittag im Frühjahr 1958 – im traditionsreichsten Gasthaus des Ortes wurde zum allwöchentlichen griabigen Beisammensein für Jedermann geladen – erschien der Syrer meiner Mutter auf der Tanzfläche.
Schock: Der Araber machte sich nicht, wie erwartet, aus dem Staub. Er studierte: Deutsch (in Le Chok) und Medizin (in München). Irgendwo hatte er ein kleines Zimmer und fuhr mit dem Zug jeden Tag sechzig Kilometer zur Uni. Wo genau im Dorf er sein Zimmer hatte, blieb im Dunkeln. Tatsache war, dass er nie in das ehemalige Bauernhaus zog, in dem meine Großeltern, meine Mutter und später auch ich wohnten. Ein Zimmer mit ausziehbarer Couch, wo Opa und Oma schliefen und auf den Fensterbrettern Opas Aquarien grün blinkten und die Familientreffen stattfanden. Eine Kammer, in der Mutters und mein Bett standen. Eine Küche mit Kohleofen und Waschbecken. Und ein Kalte Küche genannter Raum, früher ein Stall, in dem verderbliche Lebensmittel aufbewahrt wurden, weiters ein Schrank und eine Truhe für Klamotten, Regale voller Krimskrams – und es blieb sogar noch Platz für ein Sofa, falls eine meiner Tanten aus der Stadt zu Besuch käme.
Elektrisches Licht. Keine Heizung. Kein Bad. Die Toilette im Durchgang zum Nebenhaus mit dem Käsegeschäft. Am Rand des bullernden Ofens thronte eine weiße Kaffeekanne mit unerschöpflichem Vorrat für längst erwartete Briefträger und unverhofft hereinschneiende Nachbarinnen. Eine Oase der wohligen Zeitlosigkeit, in der sich der Araber selten niederließ – häufiger vielleicht vor meiner irdischen Zeit?
Der Syrer hatte geschwängert und die Schlesierin sich schwängern lassen.
Die Frage, wie und wo der Geschlechtsakt sich abgespielt haben mochte, wurde vermutlich, angesichts der angespannten psychologischen Gesamtsituation innerhalb der Familie, unter den Tisch gekehrt (in der Küche stand ein Tisch, auf dem gegessen, gebacken, gekartelt, der Lottoschein ausgefüllt und das Baby in einer Zinkwanne gebadet wurde).
Die Frage, wie die beiden einander relativ unbekannten sich Liebenden kommuniziert haben mochten, enthielt ein wesentlich höheres Humorpotential. Der Araber beherrschte ein wenig Schulfranzösisch und sprach ansonsten Hocharabisch, sein Deutsch steckte noch in den Kinderschuhen. Der Schlesierin, zur Zeit der Empfängnis dreiundzwanzig Jahre alt, hatten sie weder in der Schule noch außerhalb Französisch beigebracht, und in ihrer schlesischen Umgebung beherrschte kein Mensch eine orientalische Sprache. Was tun? Gerüchten zufolge verständigten sie sich anfangs auf Englisch. Fabelhafte Brücke – hatten doch weder Vater noch Mutter jemals Englischunterricht erhalten. Sie schafften es irgendwie, berichteten Ohrenzeugen. Und da ich beide schließlich kennenlernte und etliche Jahre mit ihnen verbrachte, vermute ich, dass die frühen Unterhaltungen meiner Eltern nicht allzu hürdenhaft verlaufen sein mussten: Keiner redete eine Silbe zu viel, und wenn doch, dann laut und in einer unverständlichen Sprache.
Die Liebenden könnten sich beim Kennenlernen natürlich auch ansatzlos verstanden haben, um später, als die Offenbarung nahte, in ein überfordertes Schweigen zu wechseln. In meiner Jugend verwandelte sich dieses über die Jahre konservierte Schweigen in fliegende Unterteller und Milchkännchen. Worum es bei den jeweils in der Küche unserer ersten gemeinsamen Wohnung ausgetragenen Dispute ging? Schleierhaft. Scherben sprechen nicht.
Wahrscheinlich waren die Keramik katapultierenden Worte vor meinem Verlassen des Kinderzimmers gefallen, oder die Eltern hatten beim Essen Esperanto benutzt, und ich hatte vielleicht in mich hineingelacht und war abgelenkt gewesen.
Wäre allerdings ungewöhnlich gewesen. Bis heute kann ich mich nicht erinnern, während meiner Unmündigkeit jemals gelacht zu haben.
Geweint öfter.
Geheult eher.
Kein Problem, solche Momente abzurufen. Auch jene, in denen ich meine Tränen mit Macht zurückgehalten hatte. Das passierte von meinem siebten Lebensjahr an dauerhaft. Mit vierzehn schwor ich mir, dass Mutter und Vater mich nie wieder weinen sehen würden. Ausgeheult, nach außen hin. Ohne den Showdown vorwegzunehmen: Ich habe durchgehalten.
Ob andere Besitzer meiner DNS ihren Umgang mit Tränenflüssigkeiten ähnlich organisiert hatten, wusste ich nicht, genauso wenig wie die Antwort auf die uralte Frage: Wieso halste der Araber sich ein uneheliches Kind und im Schlepptau eine ihn bei jedem Abendgebet in die Wüste schickende schlesische Familie auf, anstatt ungebunden sein Studium fortzusetzen, sich das nötige Deutsch anzueignen, zu promovieren und in die heimische Wüste zurückzukehren, ausgerüstet mit einem Doktortitel und einer quicklebendigen Muttersprache? Wieso in der Gegend eines für Neuankömmlinge unbegreiflichen Dialekts Wurzeln schlagen, dessen Sprecherinnen und Sprecher zudem einem Gott oder wenigstens einem Pfarrer huldigten, der alle Schafe außerhalb seines eigenen Geheges mit sonntags frisch gewetzten Worten zur Schlachtbank schickte?
Wieso aus freien Stücken als Moslem unter Katholiken fallen?
Schweigen versus Verschwiegenheit.
Rätselhafter Samstag
Zwei Fremde zeugten in der Fremde einen Einheimischen, mit Dialekt und Lederhose und einem Talent als Torwart.
Zumindest brauchte der Pfarrer zur Hochzeit nicht seinen Segen zu spenden. Es genügten ein Standesbeamter im Rathaus und zwei Trauzeugen.
Sagt man.
Ich war nicht anwesend. Ich saß auf der Hausbank, von Hühnern umgackert, und stellte mir Fragen. Wie war es zu erklären …
Dass die Sonne schien, obwohl es am Vortag dermaßen gegossen hatte?
Dass meine Großmutter neben mir auf der grün gestrichenen Bank lauter Sachen in einer unverständlichen Sprache erzählte?
Dass ich ein weißes, kurzärmeliges Hemd und eine schwarze Hose mit Bügelfalten trug und jemand mir einen Scheitel ins Haar gefräst hatte, obwohl ich nirgendwohin musste?
Dass meine Schuhe glänzten und meine weißen Söckchen nach Waschpulver rochen?
Dass die Nachbarin von der Dachterrasse gegenüber zu uns herunter winkte und lachte, als fände ein komisches Schauspiel statt?
Dass Zeit verging und nichts geschah?
Etwas geschah anderswo.
In Anwesenheit von Verwandten – meines Cousins, meiner Cousine, meiner Tanten A und H, meines Onkels R, meiner Eltern. Ein Ereignis internationalen Ausmaßes. Die Vermählung von Morgenland und Abendland, das Bündnis zweier Weltreisender, bis dass der Tod sie schied.
Vermutlich wurden unter den angemessenen Blicken der Zeugen außer den Ringen auch Bussis getauscht und Umarmungen improvisiert.
Umarmungen?
Umarmen zählte nicht zu den Verhaltensweisen in den Zimmern meiner Herkunft. Hände und Arme dienten eher einer geschmeidigen Form von Terrorismus bei der Erziehung eines Kindes oder zum Zerkleinern des Alltags in für Nachbarn und sonstige Gucker mundgerechte Portionen.
Hin und wieder verbrannte sich einer an den unscheinbaren Kacheln des Kohleofens die Finger – meist das Kind. Oder einer, ausgebildet in bedingungsloser Höflichkeit, hob in der Schmiede das frisch gebrannte Hufeisen vom staubigen Boden auf und versengte sich die Innenhand – immer das Kind.
Oder einer streichelte das Ferkel im Stall, mit beiden Händen und Armen, als wären die Extremitäten für nichts anderes bestimmt.
An jenem Vormittag im Juni auf der Hausbank musste ich an die Sau denken, die eine Woche zuvor geschlachtet worden war. Keine große Sache. Am Schlachttag standen die Leute Schlange in der Metzgerei, auch die Köchin des Pfarrers.
Ich saß auf der Bank und horchte vergeblich auf ein Quieken aus dem nahen Stall, wo über den Schweinen die Hühner hausten. Mich wunderte, dass der Hahn nicht auftauchte. Gewöhnlich bewachte er die Hennen mit biestigem Gehabe, und wenn ich weiße Kleidung anhatte und in seine Nähe kam, flatterte er auf mich zu und sprang an mir hoch.
Wieso das Kind weißes Zeug tragen musste, gehörte zu den unerforschten Mysterien seiner Mutter. Ich ließ es zu.
Was zulassen: meine Angewohnheit von Geburt an.
Kein Hahnenschrei an diesem Morgen, kein Grunzen, bloß das hektische Picken im Kies und die endlosen Sätze der Großmutter. Bestimmt erzählte sie aufregende Geschichten, wie abends an meinem Bett, doch ich verstand kein Wort, so sehr ich auch versuchte zuzuhören und nicht an Tiere oder Hufeisen oder Butterbrote mit frischem Schinken zu denken. Etwas stimmte nicht mit ihrer Stimme, ihr Atem roch nicht wie sonst nach Kaffee, sondern nach Zigaretten, mir wurde ein wenig schlecht.