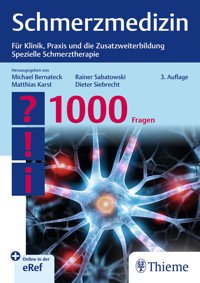
Schmerzmedizin - 1000 Fragen E-Book
97,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit Sicherheit zum Erfolg!
Das Symptom „Schmerz“ zeigt sich in zahlreichen Facetten und kann sehr viele Ursachen haben – biologische, psychische oder soziale. Als Arzt oder Ärztin müssen Sie alle Aspekte berücksichtigen und präzise diagnostizieren. Das Fragenbuch zur Zusatzweiterbildung „Spezielle Schmerztherapie“ vermittelt Ihnen alle relevanten Inhalte zur Schmerzmedizin anhand von über 1.000 Fragen. Meistern Sie die Zusatzweiterbildung souverän, indem Sie auch auf komplexe Fragen strukturierte Antworten finden und alle Fakten kompetent bewerten können.
Erfolgreiches und etabliertes Konzept
? Relevante Fragen
! Präzise Antworten
i Ausführliche Erläuterungen und nützliche Zusatzinformationen
Stressfreie und effektive Vorbereitung
- Die mehr als 1.000 Fragen sind fall- bzw. problemorientiert aufgebaut und orientieren sich am Kerncurriculum „Schmerztherapie für die Lehre“ der Deutschen Schmerzgesellschaft.
- Aktuell, evidenzbasiert, praxisorientiert: die Fragensammlung wurde von Expertinnen und Experten mit dem gemeinsamen Schwerpunkt „Spezielle Schmerztherapie“ interdisziplinär konzipiert.
- Praxisnahe Erfolgskontrolle: Durch Simulation einer möglichst realistischen Prüfungssituation werden die in der Prüfung geforderten Fähigkeiten sowie die „Prüfungsrhetorik“ aktiv trainiert.
Neu
- Alle Fragen wurden unter Berücksichtigung der anerkannten Leitlinien und dem aktuellen Wissensstand aktualisiert.
- Erweiterte Kapitel u. a. mit den neuen Themen Long-Covid, Cannabinoide und noziplastischer Schmerz.
Jederzeit zugreifen: Die Fragen und Antworten des Buches stehen Ihnen ohne weitere Kosten digital im Trainingscenter in der Wissensplattform eRef und auch offline in der eRef-App zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Schmerzmedizin – 1000 Fragen
Für Klinik, Praxis und die Zusatzweiterbildung Spezielle Schmerztherapie
Herausgegeben von
Michael Bernateck, Matthias Karst, Rainer Sabatowski, Dieter Siebrecht
Majd Adden Alkhatib, Dominik Irnich, Burkhard Jäger, Dipl.-Psych., Tareq A. Juratli, FEBNS, Johann Klein, M.S.c., Andreas Kopf, Christina Lemhöfer, Marc Merten, Stefanie Meyer, Dipl.-Psych., Paul Nilges, Henning Ohnesorge, Frank Dressler, Frank Petzke, Gesine Picksak, Esther Pogatzki-Zahn, Roman Rolke, Kai Rossen, Hans-Georg Schaible, Rüdiger Scharnagel, M.Sc., Alexander Schnabel, Ulrich S. Schuler, Benjamin Schönbach, Dipl.-Psych., Sigrid Elsenbruch, Dirk O. Stichtenoth, Rolf-Detlef Treede, Gunnar Wasner, Lena Weniger, M.Sc., Joachim Erlenwein, Michael Fischer, Charly Gaul, Martin Gleim, Gudrun Goßrau, Stefan Henniger
3., aktualisierte Auflage
23 Abbildungen
Geleitwort
Es ist schon eine beeindruckende Kontinuität, die in der dritten Auflage dieses eher schon klassischen und dabei unverändert innovativen Lehrbuchs zum Ausdruck kommt. Das Buch schafft es wieder durch Titel und Gestaltung Neugier auf die Vielfalt der Schmerzmedizin zu wecken und liefert Antworten mit Tiefgang für die praktische und kompetente Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen.
Die Gruppe der Betroffenen wird auch in aktuellen Erhebungen nicht kleiner, zunehmend wird realisiert, dass chronischer Schmerz auch eine globale Herausforderung darstellt, wie am Beispiel von Rückenschmerzen in der Erhebung zur Global Burden of Disease deutlich wird. Die Bedeutung und Richtigkeit des biopsychosozialen Modells wird durch die Integration dieses Konzepts in den ICD11 und neueste Erkenntnisse der Neurobiologie über die integrativen Leistungen und Fehleistungen des Gehirns bestätigt und bietet perspektivisch neue und weiter differenzierte Ansätze in Diagnostik und Therapie - eine Entwicklung, die dieses Buch begleitet und sicher auch in Zukunft begleiten wird.
Im Jahr dieser Auflage besteht die Deutsche Schmergesellschaft bereits 50 Jahre, die Schmerzmedizin hat sich durch das Engagement ihrer multiprofessionellen Vertreter und Vertreterinnen und deren interdisziplinärer Zusammenarbeit mit ihren „speziellen“ Kompetenzen einen festen Platz in der Versorgung erarbeitet. Die grundsätzliche Notwendigkeit und Bedeutung einer sektorenübergreifenden und abgestuften schmerzmedizinischen Versorgung wurde 2022 vom Deutschen Ärztetag breit unterstützt und eine entsprechende Weiterentwicklung gefordert. Seite Ende 2024 gibt es das BÄK-Curriculum „Schmerzmedizinische Grundversorgung“ mit dem Ziel Ärzte und Ärztinnen aller Fachgebiete in der „allgemeinen“ Schmerztherapie fortzubilden. Die ersten konkreten Kursangebote sind in Planung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die neue Auflage eine spannende und stimulierende Lektüre für zukünftige Teilnehmer- und Teilnehmerinnen sein wird.
Ist die Schmerzmedizin also nach einem halben Jahrhundert im Versorgungsalltag angekommen und in angemessenem Umfang und guter Qualität verfügbar? Ein Geleitwort ist eigentlich nicht der Ort für gesundheitspolitische Kommentare, aber die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitssystem und insbesondere in der Reform der Krankenhausstrukturen stellen das Erreichte gerade durchaus existentiell in Frage. Ich wünsche mir deshalb sehr, dass ein praktisches und an konkreten Fragen aus dem klinischen Alltag ausgerichtetes Buch wie das Vorliegende, einen eigenen Beitrag leistet, möglichst viele Interessierte für die Schmerzmedizin von „allgemein“ bis „speziell“ zu begeistern und den aktuellen Stand des Wissens in der breiten Versorgung zu verankern.
Prof. Dr. Frank Petzke
Leiter Schmerzmedizin der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin GöttingenPräsident der Deutschen Schmerzgesellschaft
Geleitwort zur 2. Auflage
Etwa 23 Mio. Deutsche berichten über chronische Schmerzen. Legt man die „Messlatte“ der Beeinträchtigung durch die Schmerzen zugrunde, so erfüllen 6 Mio. die Kriterien eines chronischen, nicht tumorbedingten, beeinträchtigenden Schmerzes, die Zahl mit starker Beeinträchtigung und assoziierten psychischen Beeinträchtigungen (Schmerzkrankheit) liegt bei 2,2 Mio.
Die demographische Entwicklung der Bevölkerung prognostiziert einerseits eine deutliche Abnahme der arbeitstätigen Jahrgänge, andererseits eine Verdopplung der über 80-Jährigen auf ca. 9 Mio. Bürger im Jahre 2060. Gleichzeitig erleben wir eine 5- bis 10-fache Zunahme der Einwanderung von Menschen mit unterschiedlichem soziokulturellen Hintergrund.
Zusätzlich zu den immensen gesellschaftlichen Herausforderungen sind chronische Schmerzerkrankungen aber auch durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren und deren Interaktionen gekennzeichnet, die von genetischen und immunologischen bis hin zu psychosozialen und soziokulturellen Bedingungen reichen. Die Kunst der schmerztherapeutisch tätigen Kolleginnen und Kollegen ist es somit, auf dem Hintergrund von allgemeinen Forschungskonzepten und der persönlichen Erfahrung jeweils die beste Behandlung für die individuelle Patientin und den individuellen Patienten in deren Lebenssituationen zu finden.
Deshalb bin ich froh, dass die Herausgeber dieses Buchs Ihnen eine äußerst gelunge Sammlung von Fachkapiteln liefern, die Ihnen einen exzellenten Überblick über die Dimensionen der Schmerztherapie geben, um für den Einzelfall den angemessenen diagnostischen und therapeutischen Weg zu finden.
Ich bin stolz zu sehen, dass der größte Teil der Autorinnen und Autoren der jeweiligen Kapitel oftmals langjährige Mitglieder der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. sind.
Denn genau das ist unser Ziel: fachliche Qualifizierung und Wissenstransfer zur Verbesserung der Krankenversorgung auf persönlicher Ebene, aber ebenso auf der Ebene der Rahmenbedingungen, die durch die Akteure der Gesundheitspolitik gesetzt werden. Die leidenden Menschen in unserem Land brauchen Sie als schmerztherapeutisch Tätige, mit Ihrem Engagement und Ihrer Expertise.
Ausdrücklich möchte ich Sie aber auch ermuntern: Mischen Sie sich mit Ihrer Expertise auch gesundheitspolitisch ein. Entweder bei uns in der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. oder im Rahmen Ihrer Möglichkeiten vor Ort. Suchen und nutzen Sie den Kontakt zu Krankenkassen, Gesundheitspolitik, Verbänden und Einrichtungen in Ihrer Nähe. Ausgestattet mit dem Wissen dieses Buchs sind Sie exzellente „Schmerzbotschafter“.
Viele Grüße,Ihr
Prof. Dr. Martin Schmelz
Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.
Geleitwort zur 1. Auflage
In den vergangenen 20 Jahren haben die Erkenntnisse in der Schmerzmedizin enorm zugenommen. Dabei ist deutlich geworden, dass insbesondere der chronische Schmerz nur mehrdimensional innerhalb des biopsychosozialen Modells verstanden werden kann. Während dem akuten Schmerz eine überlebenswichtige Funktion zukommt, ist der chronische Schmerz oft dysfunktional, entwickelt sich aber unter dem „Lerndruck“ des zu Veränderungen bereiten Nervensystems.
Chronische Schmerzen betreffen etwa 20 Prozent der europäischen Bevölkerung. In Bezug auf Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit ist chronischer Schmerz ein größerer Risikofaktor als traditionelle Faktoren wie Übergewicht, Alkoholkonsum und Rauchen. Hier besteht noch die Aufgabe, die Versorgungsstrukturen angemessen anzupassen, was die inhaltliche und formale Aufwertung der schmerzmedizinischen Expertise mit einschließt.
Chronischer Schmerz kann als eigenständige Erkrankung gelten, die durch funktionelle, biochemische und strukturelle Veränderungen im peripheren, aber vor allem auch im zentralen Nervensystem hervorgerufen wird. (Epi-)genetische und psychosoziale Faktoren beeinflussen das Risiko für Chronifizierung und Aufrechterhaltung von Schmerzen. Sozialer Schmerz wird in den gleichen Gehirnstrukturen codiert wie Schmerz, der durch einen physikalischen Reiz ausgelöst wurde.
Was ist also zu tun? Dieser Frage gehen die im Bereich der Schmerzmedizin namhaften und langjährig erfahrenen Autoren mit „1000 Fragen“ präzise, umfassend, detailgenau und anschaulich nach. Dabei werden auf bewundernswerte Art und Weise neue und neueste Erkenntnisse in diesem spannenden Fachgebiet präsentiert, sodass Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier die „1000 Antworten“ für Ihren persönlichen Erkenntnisgewinn und zur Unterstützung Ihres Umgangs mit Schmerzpatienten finden.
Prof. Dr. Wolfgang Koppert, M. A.
Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover
Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft
Vorwort
Der Schlüssel für eine gute Schmerztherapie ist die fachliche und persönliche Qualität der Schmerztherapeutin und des Schmerztherapeuten. Um schmerzmedizinisch arbeiten zu können, sind nicht nur neurobiologische Kenntnisse und klinische Fähigkeiten erforderlich, sondern vor allem Offenheit für Interdisziplinarität. Nur so kann es gelingen, die oft komplexe Situation der Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen zu verstehen, und die Betroffenen adäquat zu therapieren und zu begleiten.
Am 17.07.2012 wurde die Schmerzmedizin als Querschnittsfach 14 (QF 14) und damit als Pflichtlehr- und Prüfungsfach in die ärztliche Approbationsordnung aufgenommen. Im selben Jahr erschien bereits die erste Auflage „Schmerzmedizin 1000 Fragen“ in der populären Reihe des Thieme-Verlags. Mit großer Freude stellen wir das anhaltende Interesse an diesem Werk fest, was dazu geführt hat, dass wir Ihnen nunmehr schon die dritte, weiter verbesserte und aktualisierte Auflage vorstellen dürfen, mit der wir alle schmerzmedizinisch interessierten Personen, insbesondere Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen sowie Studentinnen und Studenten ansprechen und beim gründlichen und schnellen Wissenserwerb behilflich sein möchten.
Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen, zahlreiche renommierte Expertinnen und Experten aus Klinik und Forschung aus vielen verschiedenen Fachgebieten als Autorinnen und Autoren gewinnen zu können. Ihnen gebührt unsere tiefe Dankbarkeit und unser größter Respekt für ihre genaue und intensive Arbeit an den verschiedenen Themen, wodurch ein solches umfassendes Werk überhaupt nur entstehen kann.
Das bewährte Konzept mit der Gliederung in Frage – Antwort – Kommentar dient der schnellen und übersichtlichen Wissensvermittlung.
Alle Beiträge wurden auf den wissenschaftlich und klinisch aktuellen Stand gebracht. Die Inhalte verschiedener Leitlinien in ihren aktuellen Versionen wurden berücksichtigt. Neu aufgenommen wurden die Themen „Cannabinoide“ und „post-Covid“.
Das Stichwortverzeichnis wurde erweitert, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, gezielt bestimmte Fragestellungen bearbeiten zu können.
Weiterhin werden alle Inhalte im Online-Trainings-Center in der eRef (Hinweise siehe erste Seite im Buch) angeboten, in dem die Fragen und Antworten zusätzlich und unabhängig von der Papierversion verfügbar sind.
Tabea Jähnichen, Lena Hermann, Michael Zepf und dem ganzen Team des Thieme-Verlags gilt unser besonderer Dank für die unermüdliche und geduldige Arbeit mit den Autorinnen und Autoren und Herausgebern.
Den aufmerksamen Leserinnen und Lesern und freundlichen Begleiterinnen und Begleiter der ersten beiden Auflagen danken wir außerordentlich für Kritikpunkte, Veränderungswünsche und Anregungen, wodurch das Werk erst zu einem lebendigen „learning book“ wird.
Hannover, Dresden, Kiel, im Mai 2025
Michael BernateckMatthias KarstRainer SabatowskiDieter Siebrecht
Vorwort zur 2. Auflage
Zwanzig Jahre nach Einführung der Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ ist das Querschnittsfach Schmerzmedizin in der Medizin angekommen.
2014 hat der 117. Deutsche Ärztetag beschlossen, Maßnahmen einzuleiten, die zu einer besseren schmerzmedizinischen Versorgung beitragen, 2015 wurden Qualitätskriterien schmerzmedizinischer Einrichtungen umfassend definiert und 2016 ist das Querschnittsfach Schmerzmedizin (Q14) in die Approbationsordnung aufgenommen worden.
Um schmerzmedizinisch arbeiten zu können, sind nicht nur neurobiologische Kenntnisse und klinische Fähigkeiten erforderlich, sondern vor allem Offenheit für Interdisziplinarität. Nur so kann es gelingen, die oft komplexe Situation der Patienten mit chronischen Schmerzen zu verstehen, und sie adäquat zu therapieren und zu begleiten.
Dankbar und erfreut stellen wir das große Interesse an den 1000 Fragen der Schmerzmedizin fest, das dazu geführt hat, dass nur fünf Jahre nach dem ersten Erscheinen dieses Lehrbuches wir Ihnen hiermit die zweite, verbesserte und erweiterte Auflage vorstellen dürfen.
Das bewährte Konzept mit der Gliederung in Frage – Antwort – Kommentar dient der schnellen und übersichtlichen Wissensvermittlung.
Neu aufgenommen wurden thematisch eingebundene Kasuistiken, die die Bedeutung der aktuellen Erkenntnisse der Grundlagenforschung für den klinischen Alltag hervorheben.
Alle Beiträge wurden auf den wissenschaftlich und klinisch aktuellsten Stand gebracht. Die Inhalte verschiedener Leitlinien in ihren aktuellsten Versionen wurden berücksichtigt.
Ergänzt wurde ein Stichwortverzeichnis, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, gezielt bestimmte Fragestellungen bearbeiten zu können. Darüber hinaus wurde ein Online-Trainings-Center in der eRef (Hinweise siehe erste Seite im Buch) entwickelt, in dem die Fragen und Antworten zusätzlich und unabhängig von der Papierversion verfügbar sind.
Neu ist auch der erweiterte Titel: „Für Klinik, Praxis und die Zusatzweiterbildung Spezielle Schmerztherapie.“ Damit möchten wir alle schmerzmedizinisch interessierten Ärzte, Psychologen und Studenten ansprechen und beim gründlichen und schnellen Wissenserwerb behilflich sein.
Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen, zahlreiche renommierte Kollegen aus Klinik und Forschung aus den verschiedenen Fachgebieten (Physiologie, Neurologie, Anästhesiologie, Psychosomatik, Pädiatrie, Rehabilitationsmedizin, Klinische Pharmakologie u. a.) als Autoren gewinnen zu können. Ihnen gebührt unser Dank und Respekt für ihre genaue und intensive Arbeit an den verschiedenen Themen, wodurch ein solches Werk überhaupt nur entstehen kann.
Laura Bohnert und Konrad Seidel und dem ganzen Team des Thieme-Verlags gilt unser besonderer Dank für die unermüdliche und geduldige Arbeit mit den Autoren und Herausgebern.
Den aufmerksamen Lesern und freundlichen Begleitern der ersten Auflage danken wir außerordentlich für Kritikpunkte, Veränderungswünsche und Anregungen, wodurch das Werk erst zu einem „learning book“ wurde.
Hannover, Dresden, Kiel, im Januar 2017
Michael Bernateck
Matthias Karst
Rainer Sabatowski
Dieter Siebrecht
Vorwort zur 1. Auflage
Wir freuen uns, dass der Thieme Verlag uns die Möglichkeit gegeben hat, in dem bereits etablierten Format „1000 Fragen“ Ihnen nun auch das komplexe Gebiet der Schmerzmedizin auf diese Art näherbringen zu können.
Erfreulicherweise ist es uns gelungen, zahlreiche renommierte Kollegen aus Klinik und Forschung aus den verschiedenen Fachgebieten (Physiologie, Neurologie, Anästhesiologie, Psychosomatik, Pädiatrie, Rehabilitationsmedizin, Klinische Pharmakologie u. a.) als Autoren für dieses interessante Buchprojekt gewinnen zu können, da Schmerzmedizin nur im interdisziplinären Kontext erfolgreich und vor allem nachhaltig betrieben werden kann.
Indem akuter Schmerz durch intelligente Kombination verschiedener Verfahren zeitnah behandelt wird, können Sensibilisierungsprozesse verhindert werden. Ist es zu einer Schmerzchronifizierung gekommen, liegt eine eigenständige Erkrankung vor, bei deren Entstehung somatische, psychologische und soziale Faktoren in gleichberechtigter Verwobenheit eine bedeutsame Rolle spielen. Deshalb ist eine sorgfältige, interdisziplinäre Evaluation des Zusammenspiels dieser Faktoren der entscheidende Schritt für eine erfolgreiche Therapie. In welcher Weise Diagnostik und Therapie in interdisziplinärem und multimodalem Ansatz nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gelingen können, ist Gegenstand dieses Buchs.
Das bewährte Konzept mit der Gliederung in Frage – Antwort – Kommentar dient der schnellen und übersichtlichen Wissensvermittlung und ergänzt die bereits etablierten Schmerztherapie-Lehrbücher. Dabei bringen thematisch eingebundene Kasuistiken die aktuellen Erkenntnisse der Grundlagenforschung in den klinischen Alltag.
Unser neues Lehrbuch soll nicht nur dem Facharzt als Kompass für die Prüfung zur Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ dienen, es wendet sich gleichfalls an die Medizinstudenten im Hörsaal und auch an die schmerztherapeutisch interessierten Ärzte und Psychologen in Klinik und Praxis.
Hannover, Dresden, Kiel, im Mai 2012
Michael BernateckMatthias KarstRainer SabatowskiDieter Siebrecht
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Geleitwort
Geleitwort zur 2. Auflage
Geleitwort zur 1. Auflage
Vorwort
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I Allgemeiner Teil
1 Grundlagen
1.1 Die Bedeutung des Fachs
1.2 Grundsätze der Diagnostik
1.3 Grundsätze der Behandlung
2 Was ist Schmerz?
2.1 Definition
2.2 Physiologie
3 Psychologie von Schmerzen
3.1 Affektive Faktoren
3.2 Soziale Faktoren
3.3 Kognitive und Verhaltensfaktoren
3.4 Psychische Komorbidität
3.5 Placebo/Nocebo
3.6 Psychologische Chronifizierungsfaktoren
4 Klassifikation von Schmerzen
4.1 Akuter versus chronischer Schmerz
4.2 Nozizeptiver versus neuropathischer versus noziplastischer Schmerz
5 Befunderhebung
5.1 Anamnese
5.2 Körperliche Untersuchung
5.3 Apparative Diagnostik
6 Messinstrumente
6.1 Skalen
6.2 Fragebögen
6.3 Tagebücher
7 Pharmakologische Schmerztherapie
7.1 Opioide und Cannabinoide
7.2 Nichtopioide
7.3 Koanalgetika
7.4 Adjuvante Therapien
7.5 Medikamenteninteraktionen
7.6 Verordnung von Opioiden und Cannabinoiden
8 Nicht pharmakologische Schmerztherapie
8.1 Physiotherapie
8.1.1 Physikalische Therapie und Rehabilitation bei Gonarthrose
8.1.2 Physikalische Medizin und Rehabilitation bei myofaszialem Schmerzsyndrom
8.1.3 Physikalische Therapie und Rehabilitation bei chronischen Schmerzen
8.1.4 Physikalisch-medizinische Verfahren und Therapieformen
8.1.5 Manualmedizin bei schmerzhaften Funktionsstörungen
8.2 Gegenirritationsverfahren
8.3 Entspannungsverfahren und kognitive Verhaltenstherapie
8.3.1 Entspannungsverfahren
8.3.2 Kognitive Verhaltenstherapie bei Schmerzen
9 Therapiekonzepte
9.1 Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie und Schmerzassessment
9.2 Interventionelle Schmerztherapie
9.3 Neurochirurgische Verfahren
9.3.1 Rückenschmerzen, Extremitätenschmerzen, Neurostimulation
9.3.2 Kopf- und Gesichtsschmerzen
9.3.3 Tiefe Hirnstimulation zur Schmerztherapie
9.3.4 Intrathekale Medikamentenapplikation
Teil II Spezieller Teil
10 Perioperative Schmerztherapie
10.1 Grundprinzipien der perioperativen Schmerztherapie
10.2 Konzepte der perioperativen Schmerztherapie
10.3 Chronifizierungsrisiken
11 Schmerzmedizinische Notfälle
12 Tumorschmerz
13 Neuropathischer Schmerz
13.1 Polyneuropathie
13.2 Zosterneuralgie
13.3 CRPS
13.4 Phantomschmerz
13.5 Zentrale Schmerzen
13.6 HIV-Neuropathie
14 Chronischer nicht spezifischer Rückenschmerz
15 Gelenk- und Muskelschmerz
16 Viszerale Schmerzen
17 Kopf- und Gesichtsschmerzen
17.1 Primärer Kopfschmerz und seine Differenzialdiagnosen
17.2 Gesichtsschmerz
17.3 Sekundärer Kopfschmerz
18 Borreliose
19 Somatische, nicht klassifizierbare Schmerzstörung
19.1 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (F45.41)
19.2 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung (F45.40)
19.3 Fibromyalgiesyndrom
19.4 post-COVID
20 Spezielle Therapiesituationen
20.1 Kinder
20.2 Alter und Demenz
20.3 Schwangerschaft und Stillzeit
20.4 Medikamentenentzug
Teil III Kerncurriculum Schmerztherapie
21 Kerncurriculum Schmerztherapie
21.1 Kerncurriculum Schmerztherapie für die Lehre für das Querschnittfach 14 Schmerztherapie nach der neuen Approbationsordnung
21.1.1 Vorbemerkung
21.1.2 Strukturvorschlag für das Querschnittfach 14 Schmerztherapie
21.1.3 Gliederung Kerncurriculum Schmerztherapie für die Lehre
21.1.4 Lernziele
Teil IV Weiterführende Literatur
22 Literatur und weiterführende Informationen
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Access Code
Wichtige Hinweise
Alle Inhalte jetzt kostenlos auch im Internet nutzen !
Schnellzugriff zum Buch
Impressum
Teil I Allgemeiner Teil
1 Grundlagen
2 Was ist Schmerz?
3 Psychologie von Schmerzen
4 Klassifikation von Schmerzen
5 Befunderhebung
6 Messinstrumente
7 Pharmakologische Schmerztherapie
8 Nicht pharmakologische Schmerztherapie
9 Therapiekonzepte
1 Grundlagen
1.1 Die Bedeutung des Fachs
Matthias Karst
Frage 1
Warum gibt es akute Schmerzen?
Akute Schmerzen garantieren im Sinne einer Warnfunktion das Überleben.
Menschen, die aufgrund eines genetischen Defekts keine Schmerzen empfinden können, bemerken schmerzhafte Verletzungs- und Krankheitssymptome nur spät oder gar nicht, weshalb bei ihnen die Lebenserwartung herabgesetzt ist.
Frage 2
Warum gibt es chronische Schmerzen?
Es gibt eine Vielzahl von chronischen Erkrankungen, die nicht ursächlich behandelbar sind und die mit Schmerzen einhergehen können. Chronische Schmerzen können durch neurobiologisch verankerte Lernvorgänge zu einer eigenständigen Erkrankung werden.
Sowohl akuter Schmerz als auch Lernen sind überlebensnotwendige Mechanismen. In Abhängigkeit von somatischen, psychologischen und sozialen Faktoren kann in der Kombination aus akutem Schmerz und Lernen ein chronischer Schmerz resultieren, der oft keine erkennbare Funktion aufweist. Die Entstehung chronischer Schmerzen lässt sich durch frühzeitige therapeutische Maßnahmen verhindern oder verlangsamen.
Frage 3
Wie häufig treten chronische Schmerzen auf?
Die Punktprävalenz liegt in Deutschland bei 17%, europaweit bei 19%. Das sind in Europa 129 Mio. Menschen, in Deutschland 12 Mio.
Mehr als 80% der Deutschen klagen mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen. Eine feinere epidemiologische Aufschlüsselung, die 2014 publiziert worden ist, ergab für Deutschland 27% (23 Mio.) mit „einfachen“ Schmerzen (allein zeitliche Dimension), 7,4% (6 Mio.) mit hoher Beeinträchtigung und 2,8% (2,2 Mio.) mit starker emotionaler Beteiligung.
Frage 4
Was kosten Schmerzen?
Schmerzen kosten nicht nur Lebensqualität, sondern auch viel Geld. Die USA geben jährlich mehr als 210 Mrd. Dollar hierfür aus.
In Deutschland werden die Kosten für Rückenschmerzen auf jährlich ca. 50 Mrd. EUR geschätzt, 72% davon bedingt durch Arbeitsausfälle und frühzeitige Berentung. Schmerzen kosten auch das Leben. Das Selbstmordrisiko von Patienten mit chronischen Schmerzen ist mindestens doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt.
Frage 5
Wie sieht die Versorgungssituation von Patienten mit chronischen Schmerzen in Deutschland aus?
70% aller Patienten mit chronischen Schmerzen werden von ihrem Hausarzt betreut. 27% sind in der Behandlung eines Orthopäden. Nur 2% sind schmerzmedizinisch betreut.
In Deutschland stehen den etwa 2–3 Mio. Patienten mit schweren chronischen Schmerzen und starker emotionaler Beeinträchtigung, bei denen der Schmerz selbst zur Erkrankung geworden ist, nur knapp 1200 Schmerzmediziner gegenüber, sodass nur etwa jeder achte Patient versorgt werden kann. Es wird von einer Unterversorgung in der Größenordnung von etwa 2500 Einrichtungen ausgegangen. Es gibt in Deutschland keinen Facharzt für Schmerzmedizin. Das Fach Schmerzmedizin ist als Querschnittsfach 14 erst 2012 in den Fächerkanon des Medizinstudiums aufgenommen worden. Ab 2016 kann der letzte Abschnitt des Medizinstudiums, das Praktische Jahr, nur absolviert werden, wenn zuvor das Querschnittsfach Schmerzmedizin durchlaufen worden ist.
Frage 6
Wie werden Schmerzen diagnostisch kategorisiert?
In der ICD-10 werden chronische Schmerzsyndrome entsprechend ihrer Lokalisation oder ihrer Kausalität fragmentiert der jeweiligen Kategorie zugeordnet – z.B. werden Schmerzen in der Lumbalregion mit der Ziffer M54.5 und psychogene Schmerzen mit der Ziffer F45.40 ausgewiesen und „andernorts nicht klassifizierte“ Schmerzen unter R52.- kategorisiert. Dadurch bleiben Schmerzsyndrome relativ unsichtbar. Insbesondere die Erfassung von Daten zur Epidemiologie chronischer Schmerzen und der damit verbundenen direkten und indirekten Kosten und die Entwicklung und Implementierung von neuen Therapieansätzen werden dadurch erschwert.
Vor allem aus diesen Gründen wurde in der neu erarbeiteten ICD-11 ein eigenes Kapitel über chronische Schmerzen eingeführt, in dem chronische primäre und sekundäre Schmerzsyndrome aufgeführt und definiert werden. Dies stärkt die Einschätzung chronischer Schmerzen als eigenständige Erkrankung. Dadurch kann es zu mehr Erkenntnisgewinn und zu besseren Therapieangeboten kommen. Der hier verfolgte pragmatische Ansatz kann auch als ein Auftrag verstanden werden, weiter darüber zu reflektieren, welche Merkmale erfüllt sein müssen, damit von einer Krankheit gesprochen werden kann.
1.2 Grundsätze der Diagnostik
Matthias Karst
Frage 7
Wie lassen sich Schmerzen erfassen?
Die Anamnese von Schmerzen soll Auskunft geben über Lokalisation, Qualität, Quantität, Beginn und Dauer (zeitlicher Verlauf), Provokationsfähigkeit sowie Beeinflussbarkeit des Schmerzverlaufs.
Die exakte Diagnostik von Schmerzen ist die entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche Therapieansätze. Die wesentliche Tätigkeit eines Arztes für Schmerzmedizin besteht in diagnostischer Aktivität. Deshalb sollte man nicht von „Schmerztherapie“ sprechen, sondern von „Schmerzmedizin“.
Frage 8
Was ist das Besondere einer Schmerzanamnese?
Die Schmerzanamnese orientiert sich an dem biopsychosozialen Modell.
Während die biomedizinische Vorgehensweise nach den mit dem Schmerz verbundenen strukturellen Veränderungen fragt, orientiert sich die biopsychosoziale Vorgehensweise vor allem an der Frage nach der betroffenen Person. Also nicht nur „Um was für Schmerzen handelt es sich?“, sondern auch „Wer hat diese Schmerzen?“. Das biopsychosoziale Modell wurde erstmals von L. Engel in Science 1977; 196: 129–136 vorgestellt.
Frage 9
Wer hat Schmerzen?
Personen haben Schmerzen – jemand mit kognitiven, emotionalen und praktischen Handlungen, intentionalen Beziehungen zur Umgebung, kommunikativen Beziehungen, jemand mit einer einzigartigen Geschichte. Dieser Jemand zeichnet sich durch ein leibliches In-der-Welt-Sein aus, das sich in der Individualentwicklung durch die Interaktion mit Bezugspersonen im Sinne eines „minding the body“ entwickelt.
Die Gefahr der Schmerzerfahrung liegt in der Störung der Beziehung zum Körper, des Selbstverständnisses von sich als Ganzem, des Verhältnisses zur Umwelt und der Beziehung zu den Mitmenschen. Die Schmerzerfahrung wirkt isolierend. Gleichzeitig ist (früher) sozialer Stress der Haupttreiber für die Entwicklung chronischer Schmerzen.
Frage 10
Welche Hilfsmittel werden bei einer Schmerzanamnese zusätzlich eingesetzt?
Psychometrische Testverfahren
Dabei handelt es sich um Skalen und Fragebögen, die Aussagen zur Schmerzausprägung, psychiatrischen Störungen und Funktionalität liefern. Hierzu gehören auch die numerische Ratingskala (NRS) und visuelle Analgoskala (VAS), mit der die Schmerzintensität erfasst wird. Die erste NRS der Menschheit hatte in der griechischen Mythologie der blinde Seher Teireisias benutzt, als er von den Göttern gefragt wurde, wer von den beiden Geschlechtern mehr sexuelle Lust empfindet. Seine Antwort: Mann NRS 1, Frau NRS 9.
Eine Skala, die Begriffe enthält, wie die verbale Ratingskala, und gleichzeitig nach der Funktionalität fragt, z.B. die Functional Pain Scale (FPS), hat den Vorteil, die Bedeutung des Schmerzes für den Betroffenen zu erfassen. Dies ist deshalb wesentlich, weil die Therapie von chronischen Schmerzen hauptsächlich auf die Funktionsverbesserung abzielt.
Frage 11
Warum ist es so wichtig, den Umgang des Patienten mit seinem chronischen Schmerz zu erfassen?
Schmerzen sind nicht nur ein Produkt nozizeptiver Vorgänge, sondern auch davon abhängig, was der Betroffene glaubt und erwartet, also wie er die Situation interpretiert.
Selbst bei überwiegend körperlich begründeten Schmerzen kommt es zu umfassenden psychosozialen Wechselwirkungen, Veränderungen des Lebensstils und einer Interpretation der Situation durch den Patienten abhängig von seinen Überzeugungen. Ein Sprichwort hierzu lautet: „Pain is a basic Fact. Misery is an Option.“ Untersuchungen aus der funktionellen Bildgebung haben gezeigt, dass vor allem das mesolimbische System am emotionalen Lernen von chronischen Schmerzen beteiligt ist.
Frage 12
Worin liegt das Hauptproblem im Umgang mit funktionellen Schmerzstörungen?
Bei nicht ausreichender Reflexion kann es zu Enttäuschungen in der Arzt-Patienten-Beziehung kommen.
Auf dem Boden der überwiegend schematischen biomedizinischen Ausbildungserfahrung mit traditionell strikter Trennung somatischer und psychischer Krankheiten und Störungen kann der Gedanke in den Vordergrund gelangen, dass der Patient die Symptome willentlich hervorruft und der Therapeut Opfer eines Betrugs ist. Im Gegensatz zu Personen mit simulierten Störungen leiden Patienten mit funktionellen Störungen genauso stark – wenn nicht sogar mehr – wie Patienten, die ein eindeutig somatisch oder psychisch definiertes Störungsbild zeigen.
1.3 Grundsätze der Behandlung
Matthias Karst
Frage 13
Was ist die entscheidende Strategie bei der Behandlung akuter Schmerzen?
Schnelle und effektive Schmerzlinderung
Diese Vorgehensweise ist nicht nur ethisch, sondern vor allem auch medizinisch geboten. Eine erfolgreiche Schmerzlinderung reduziert Komplikationen (z.B. Lungenentzündung) und hilft Sensibilisierungs- und Chronifizierungsprozesse zu verhindern.
Frage 14
Was ist die wichtigste Strategie bei der Behandlung chronischer Schmerzen?
Entscheidend ist das Erstellen einer exakten Schmerzdiagnostik.
Nur die genaue Diagnosestellung mit Darstellung und Gewichtung aller Facetten des Krankheitsbilds kann zu einem erfolgreichen Therapieergebnis führen. Der Patient muss sich „erkannt“ fühlen. Bei der Therapie sollten Präferenzen des Patienten und des Behandlers Berücksichtigung finden. Gegenseitige Überzeugungen, das Richtige zu tun, ist ein wichtiges Therapieprinzip.
Frage 15
Was ist die wichtigste Strategie bei chronischen Schmerzen mit hohem funktionellem Anteil (was für die meisten chronischen Schmerzen zutrifft)?
Die entscheidende Intervention ist die effektive Kommunikation.
Entsprechend beginnt mit dem Erstgespräch die Therapie, indem folgende Interventionen zum Einsatz kommen:
interpersonale Intervention (den Schmerz und den Patienten annehmen)
edukative Intervention (Ringen um die Krankheitssicht)
motivationale Intervention (die Selbstwirksamkeit steigern)
Die Reduktion des Schmerzes ist dabei oft nur Mittel zum Zweck: Entscheidend ist der Wechsel der Sichtweise von einem rein kurativen oder symptomatischen Ansatz zu einem eigenverantwortlichen rehabilitativen Ansatz. Emotionale Faktoren spielen eine wichtige Rolle und sollten in der Therapie Berücksichtigung finden. Aus der Behandlung der arteriellen Hypertonie ist bekannt: Für eine erfolgreiche, compliante Behandlung ist eine Übereinstimmung von mindestens 20% zwischen der Krankheitssicht des Patienten und der des Arztes notwendig.
Frage 16
Wie sollte man chronische Schmerzstörungen behandeln?
Durch eine interdisziplinäre multimodale Therapie, die die Aktivität des Patienten fördert
Schon der griechische Philosoph Platon wies darauf hin, dass der Mangel an Aktivität die Kondition jedes Menschen zerstört, während Bewegung und systematische Körperübungen die Kondition sichern und bewahren. Aktivität ist vor allem auch auf der psychischen Ebene zu fordern. Es muss etwas Neues gelernt werden, damit das Alte (der Schmerz) verblassen kann (Re-Learning).
Frage 17
Was zeichnet die interdisziplinäre multimodale Therapie bei chronischen Schmerzpatienten aus?
Vor allem eine hohe Behandlungsintensität von mehr als 100h
Günstig sind strukturierte Programme mit explizit interdisziplinärem und integrativem Ansatz verbunden mit Teamsitzungen, zudem das Fokussieren auf die Wiederherstellung der körperlichen und sozialen Funktionsfähigkeit sowie die Nutzung verhaltens- und psychotherapeutischer Prinzipien. Im Zusammenhang mit tagesklinischen Ansätzen ist auch die therapeutische Wiederholungswoche 10 Wochen nach Abschluss der Behandlung zu empfehlen (Booster-Behandlung).
3 Psychologie von Schmerzen
3.1 Affektive Faktoren
Stefan Henniger, Stefanie Meyer, Burkard Jäger
Frage 55
Besteht eine Verbindung zwischen körperlichem Schmerz und emotionalem Erleben?
Ausdrücklich ja: Schmerz ist mit vielen aversiven, sehr selten aber auch mit positiven Gefühlen verbunden.
Der persönliche Freiheitsgrad wird durch körperliche Schmerzen reduziert. Das Gestalten von beruflichen, familiären und freundschaftlichen Aktivitäten kann wesentlich erschwert sein. Im Extremfall engen Schmerzen den sozialen Bewegungsradius auf ein Minimum ein – mit entsprechend negativen Konsequenzen für das seelische Gleichgewicht. Verluste und Enttäuschungen können Gefühle von Trauer sowie Reizbarkeit und Ärger entstehen lassen. Im Verlauf chronischer Schmerzerkrankungen steigt die depressive Komorbidität auf rund zwei Drittel.
Ferner kann chronischer Schmerz nachvollziehbare Sorgen und Ängste auslösen, z.B. vor dem Verlust von Hobbys, Belastung von Beziehungen, Bedrohung von beruflichen Möglichkeiten, finanziellen Verlusten, sozialem Abstieg etc. Diese Ängste können den Schweregrad von Angsterkrankungen dann erreichen, wenn sie übersteigert, i.S. eines Katastrophisierens auftreten und sich auch auf nicht betroffene Lebensbereiche ausdehnen.
Anhaltender Ärger, Gereiztheit und andrängende Ängste können über die Aktivierung des N. sympathicus mit erhöhtem muskulärem Ruhetonus auch zu einer Schmerzverstärkung führen. Eine depressive Stimmungslage fördert negative kognitive Bewertungen des Schmerzes und führt nachweislich zur Intensivierung der Schmerzwahrnehmung. Es kann ein Teufelskreis entstehen, der zur Chronifizierung beitragen kann.
In deutlich selteneren Fällen kann Schmerz auch mit positiven Gefühlen verbunden sein, der zumeist als masochistisch geprägte Selbstwertstabilisierung verstanden werden kann. Für eine langfristig erfolgreiche und befriedigende Lebensbewältigung sind solche und ähnliche Mechanismen aber natürlich als sehr problematisch zu beurteilen.
Frage 56
Gibt es auch wissenschaftliche Belege für eine Verbindung zwischen Schmerzwahrnehmung und negativen psychischen Erfahrungen wie Verlusterlebnissen oder Zurückweisung?
Ja: Schmerz und emotionales Erleben von sozialer Zurückweisung und Verlust zeigen in ihrer Verarbeitung und Regulation eine gemeinsame neuroanatomische Grundlage.
Die individuelle Empfindlichkeit für einen mechanischen Schmerzreiz korreliert mit der Empfindlichkeit für das Ausgeschlossenwerden aus einer sozialen Gemeinschaft. Probanden, die einer Ablehnungs-/Verlustsituation ausgesetzt sind, zeigen eine höhere Schmerzempfindlichkeit bei peripheren Schmerzreizen. Ferner konnte in einem viel beachteten Experiment eine deutliche neurofunktionelle Erregung der zentralen Schmerzbahn im Zusammenhang mit einer experimentell erzeugten sozialen Verlust- bzw. Ablehnungssituation nachgewiesen werden.
Frage 57
Welche Erklärung findet die Wissenschaft für diese Verknüpfung?
Der aversive Schmerzreiz macht uns auf Belastungsgrenzen und Verletzungen unseres Körpers aufmerksam und ermöglicht Selbstfürsorge und Selbstschutz.
Kinder, die aufgrund eines seltenen Gendefekts ohne Schmerzwahrnehmung geboren werden, sind kaum überlebensfähig und müssen körperliche Gefahren rein kognitiv-vorausschauend erkennen, da ihnen die Fähigkeit fehlt, körperliche Belastungsgrenzen physiologisch zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Vermutet wird, dass der aversive Schmerzreiz evolutionär eine zusätzliche Funktion erhielt: Neben der Bewahrung der körperlichen Unversehrtheit scheint er auch zur Bewahrung der sozialen Integration bedeutsam zu sein – Überleben und Fortpflanzungsfähigkeit sind unter schwierigen Umweltbedingungen nur im Schutz einer Gemeinschaft wahrscheinlich.
Frage 58
In welcher Weise sind Schmerzpatienten in ihrer Selbstwahrnehmung beeinträchtigt?
Die Selbstwahrnehmung kann sich im Verlauf einer Schmerzerkrankung auf den als schmerzhaft erlebten Körper einengen. Ein differenziertes Erleben der eigenen (und fremder) Gefühle, Stimmungen und Bedürfnisse kann hierunter verloren gehen.
Viele Patienten mit starken chronischen Schmerzen berichten uns, dass sie nichts anderes mehr spüren als ihren Schmerz. Häufig beschreiben diese Patienten einen anhaltenden Ganzkörperschmerz, der wie eine laute Sirene alle weiteren Gefühle übertönt. Positive Gefühle und Lebensbereiche, die Kraft, Motivation und positive Ablenkung geben könnten, gehen oft genug verloren.
Problematisch dabei: Wer den Kontakt zu seinen Gefühlen verliert, verliert den Kontakt zu den Dingen, die guttun und auch zu denen, die nicht guttun; die handlungsleitende Funktion differenzierter Gefühlswahrnehmung geht verloren. Immer wieder erlahmt im Verlauf einer Schmerzerkrankung die Fähigkeit zur Selbstfürsorge und die Fähigkeit, eigene Ressourcen zu nutzen und daraus Lebenskraft zu schöpfen. Der schmerzhafte Körper wird zum alleinigen Universum des Patienten, aus dem es für ihn subjektiv kein Entrinnen zu geben scheint. Diese Einengung aufzulösen, ein neues und differenziertes „Sich-Spüren“ mit dem Erkennen von Handlungsalternativen herzustellen, ist eine der primären Herausforderungen in der Psychotherapie von Schmerzpatienten.
Parallel zum Verlust der Selbstwahrnehmung kann auch die Fähigkeit zum Kontakt mit Mitmenschen, die sogenannte Fremd- oder Objektwahrnehmung, erschwert sein. Hierdurch lassen sich die nicht selten ausgeprägten interaktionellen Störungen erklären, die im sozialen Raum oder im klinischen Kontext beobachtbar sind.
Frage 59
Wie können soziale Faktoren in den Gesamtbehandlungsplan integriert werden?
Die medizinische Behandlung muss nicht nur die körperliche Integrität, sondern auch die soziale Integration erhalten bzw. wiederherstellen.
Im Verlauf einer chronischen Schmerzerkrankung gehen in vielen Bereichen Beziehungen verloren: Hobbys und sportliche Aktivitäten werden aufgrund der körperlichen Einschränkungen unmöglich, die Krankschreibung zieht den Verlust von Beziehungen am Arbeitsplatz nach sich. Häufig kommt es auch im privaten Bereich zu einer Einengung des sozialen Raums. Diesem Rückzug ist von Seiten der Heilberufe entgegenzuwirken, denn er wirkt potenziell schmerzverstärkend! Dies ist auch ein Grund, warum eine rasche und suffiziente symptomatische analgetische Therapie gerade zu Beginn der Schmerzerkrankung viele negative Folgen lindern bzw. verhindern kann.
Im Verlauf schwerer chronischer Schmerzerkrankungen beobachten wir häufig eine Einengung der sozialen Kontakte auf den Kreis der Behandler: Ärzte, Physiotherapeuten, Praxispersonal etc. erhalten den Stellenwert wesentlicher, unverzichtbarer Bezugspersonen. Eine Behandlung der Schmerzerkrankung sollte es sich zur Aufgabe machen, soziale Alternativen aufzubauen. Hierzu können Angebote wie Reha-Sport, Gruppenpsychotherapie und Selbsthilfegruppen, aber auch neue „soziale“ Hobbys hilfreich sein.
Fazit: Bei chronifizierten Schmerzen mit Einengung des sozialen Raums ist es wichtig, unter Nutzung aller verbliebenen Ressourcen soziale Alternativen zu entwickeln.
Frage 60
Zeigen Schmerzpatienten eine besondere Neigung zur Selbstüberforderung?
Es ist auffällig, dass sich ein nicht unerheblicher Anteil der Schmerzpatienten einer Selbstüberforderung aussetzt.
Eine Subgruppe von Schmerzpatienten ist dadurch charakterisiert, dass diese sich in den verschiedenen Bereichen ihres Lebens kompensatorisch sehr leistungsbereit gibt und dabei nicht selten die Grenze zur (chronischen) Selbstüberforderung überschreitet („Endurance-Muster“, s.u.). Umso höher die Leistungsideale und das Bedürfnis nach Autonomie und Autarkie im Zustand der Gesundheit sind, desto schwerer fällt oft die Anpassung an die mit der Erkrankung verbundenen körperlichen, aber auch mentalen Leistungseinbußen und die Akzeptanz von Unterstützung. Das Selbstwerterleben wird erschüttert, Scham- und Schuldgefühle können die depressive Dynamik weiter verstärken oder führen kompensatorisch zu noch weiterer Selbstüberforderung.
Frage 61
Was bedeutet „primärer Krankheitsgewinn“?
Intrapsychische Entlastung durch krankheitsbedingte Reduktion seelischer Spannungszustände
Unter dem Begriff „primärer Krankheitsgewinn“ verstehen wir diejenige seelische Entlastung, die nicht durch (äußere) Faktoren, z.B. Abnahme von Verantwortung/Arbeit etc. entsteht (dies bezeichnen wir als sekundären Krankheitsgewinn), sondern die durch eine (innere) Entlastung von schwierigen Gefühlen oder von unbewussten Konflikten im Alltag entsteht. Es ist eine der Aufgaben einer Psychotherapie, den primären Krankheitsgewinn bewusst werden zu lassen und Alternativen aufzubauen. Tief verankerte Neigungen zur Selbstbestrafung (masochistischer Gewinn) oder eine höhere Akzeptanz für invasive oder sogar fragwürdige medizinische Maßnahmen bis hin zur sogenannten „Operationssucht“ werden im Rahmen des primären Krankheitsgewinnes verständlich. Das Erkennen und die Behandlung eines derartigen primären Krankheitsgewinnes sind entsprechend schwierig, aber erkennbar außerordentlich wichtig.
Frage 62
Welche Funktion hat der primäre Krankheitsgewinn bei Schmerzpatienten?
Schmerz entlastet nicht selten das fragile Selbstbild und dient damit der Regulation des Selbstwerterlebens.
Immer wieder erleben Psychotherapeuten im Verlauf der Behandlung von Schmerzpatienten eindrückliche Momente: Viele Patienten beginnen, sich mit ihrem Bild von sich selbst ausführlich auseinanderzusetzen. Häufig werden hohe, aber bisher subjektiv nicht erreichte Ideale sichtbar – ausgeprägte Selbstabwertungen, Schamgefühle und Schuldzuschreibungen werden benannt. Der chronische Schmerz fungiert nicht selten als „Stütze“ im Selbstbild: „Ich schaffe es nicht, meine hohen Ziele zu erreichen, es ist mein Schmerz, der dies nicht zulässt.“ Nicht selten erleben sich Schmerzpatienten anderen Menschen gegenüber schuldig, weil sie glauben, sie könnten deren Erwartungen nicht erfüllen. Im Verlauf einer psychotherapeutischen Behandlung lassen sich diese zunächst oft unbewussten Überzeugungen einer rationalen Überprüfung und Bearbeitung zugänglich machen und realistischere Selbsterwartungen formulieren.
Chronischer Schmerz kann aber auch ganz allgemein spannungsreiche aversive Gefühle wie Unlust, Aggression oder Trauer überdecken.
Frage 63
Schmerz und Schuldgefühle: Kann chronischer Schmerz auch mit Motiven der Selbstbestrafung erklärt werden?
In manchen Fällen leider ja!
Früher gehörte körperliche Bestrafung in Form von Schlägen zum Erziehungsrepertoire. In einigen religiösen Riten der Weltreligionen verbindet sich Schmerz mit Buße oder Selbsterhöhung. Schmerz ist bis heute für viele Menschen eng mit dem Erleben von Schuld und Sühne verbunden. In wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Schuldgefühle ließ sich feststellen, dass körperlicher Schmerz das Gewissen entlasten kann. Schuldgefühle unter Schmerzen lassen sich in experimentellen Designs leichter aushalten als ohne Schmerz – schließlich hat man seine „gerechte Strafe“ schon erhalten.
Frage 64
Mit welchem emotionalen Ausdruck des Schmerzpatienten werden Sie als Behandler häufig konfrontiert?
Ärger (bzw. Groll oder Verbitterung)
Viele Schmerzpatienten sind durch ihre oftmals langjährige „Schmerz-Karriere“ enttäuscht und frustriert vom medizinischen System und zeigen dadurch häufig Ärger, Groll oder Verbitterung. Auch bei fremdverschuldeten Unfällen zeigt sich häufig Wut auf denjenigen, der „Schuld an dem Schicksal des Patienten“ hat. Grundsätzlich sind diese Gefühle in vielen Fällen nachvollziehbar, sie erschweren jedoch die Schmerzbewältigung, wenn der Ärger sich über lange Zeit festsetzt und wenig beeinflussbar ist.
Frage 65
Blick auf die Behandler: Welche Gefühle, die sich im therapeutischen Kontakt mit Schmerzpatienten häufig einstellen, können meine Arbeit als Arzt oder Therapeut erschweren oder behindern?





























