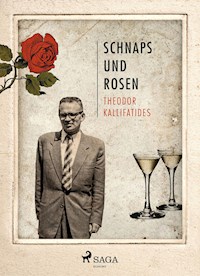
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Telefonanruf, den ich seit Achzehn Jahren fürchtete, kam am Abend des fünfzehnten Februars 1982." Vor vielen Jahren ist Alkis aus Griechenland nach Schweden emigriert. In Schweden lebt und arbeitet er als Schriftsteller. Er schreibt in Schwedisch. Als der Vater in Griechenland stirbt, fliegt Alkis aus Schweden zurück in die alte Heimat, zurück in seine Kindheit, seine Liebe zum fernen, schweigsamen, ihm wenigbekannten Vater, dessen Leben er erst jetzt in den Tagebüchern des Vaters nachlesen kann. Am Ende steht Alkis zwar am Grab des "Alten" aber sein Vater ist für ihn keine unbekannte Größe mehr. Ein Sohn arbeitet die Beziehung zu seinem Vater auf, und er tut dies. ohne irgendwo pathetisch oder larmoyant zu werden. Was diesen Roman so fesselnd und anrührend macht, ist die Tatsache, dass die Geschichte vom Tod eines Menschen nicht im Trauergewand daherkommt, sondern leicht und melancholisch beschwingt erzählt wird. Theodor Kallifatides erzählt eine greifende, humoristische und ganz unsentimentale Geschichte .. AUTORENPORTRÄT Theodor Kallifatides wurde 1938 in Griechenland geboren. 1963 emigrierte er nach Schweden. Bevor er an der Universität von Stockholm Philosophie zu studieren begann, schlug er sich als Tellerwäscher, Postbote und Nachtportier durch. In der Zeit von 1972 bis 1976 war er Herausgeber der angesehenen Literaturzeitschrift "Bonnier Literary Magazine". Sein eigener literarischer Durchbruch gelang ihm mit einer autobiographischen Trilogie. Es folgten Romane, Erzählungen, Gedichte und ein Kinderbuch. Er erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, seine Werke liegen in mehrere Sprachen übersetzt vor. REZENSION von 'Die Sieben Stunden im Paradies' "Wie immer stellt Kallifatides das Problem der Moral mit Leichtigkeit und Scharfsinn in den Mittelpunkt; so dass das Lesen dieses Romans zu einem Genuss wird." - Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet REZENSION von Der Kalte Blick Theodor Kallifatides schreibt eine moderne Version der griechischen Tragödie und einen literarischen Krimi der Spitzenklasse
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Kallifatides
Schnaps und Rosen
Saga
Zur Erinnerungan einen alten Mann
Es gibt nichts, wofür man sterben müßte, und ich würde gerne sterben, ohne meine Fehler zu erkennen.
Nokolai Bucharin
1
Der Telefonanruf, den ich seit achtzehn Jahren fürchtete, kam am Abend des fünfzehnten Februars 1982.
Es war ein Montag – unmittelbar nach der Wetterkarte. Meine Frau und ich saßen ein wenig apathisch vor dem Fernsehschirm und verschnauften. Unser Sohn Vittorio Monarka – er trug den Nachnamen seiner Mutter – war eben zu Bett gegangen und wühlte sich mit dem Daumen im Mund energisch in einen von Träumen erfüllten und hoffentlich friedlichen Schlaf.
Er hatte gerade eine seiner schweren Stunden hinter sich gebracht. Er wurde immer sehr unruhig, wenn das Wetter umschlug, sein Asthma quälte ihn, er kämpfte verzweifelt dagegen an, er wollte seine Medizin nicht nehmen, bevor es absolut notwendig war. Vittorio ist ein tapferer junger Mann von zehn Jahren und überhaupt nicht wie ich.
Ich ließ das Telefon ein paarmal läuten und erhob mich dann widerwillig. Vor dem großen Panoramafenster blieb ich kurz stehen, ehe ich den Hörer abhob. Es schneite ununterbrochen. Der Garten sah aus wie ein weißhaariger, müder Greis.
Dann hörte ich die Stimme meines Bruders und wußte Bescheid. Aber er wollte nicht sofort zur Sache kommen. Er ließ sich nicht abhalten, über das Wetter zu reden. Na ja, in Huddinge war es kalt und naß, um null Grad, worauf er in den Hörer pfiff und mir mitteilte, daß es in Athen fünfzehn Grad warm sei, einer dieser wehmütigen Tage, glänzend wie der Rücken eines Delphins, mit hohem Himmel und klarer Luft.
Die Sehnsucht landete wie ein linker Haken in meiner Magengrube, aber im Lauf der Jahre habe ich davon viele eingesteckt. Deshalb parierte ich.
«Es geht um Papa, nicht wahr?» fragte ich.
«Er ist sehr krank.»
«Ich nehme morgen früh die erste Maschine.»
«Das ist nicht nötig. Du kannst warten, bis ich wieder anrufe, halte dich aber bereit!»
Dann bat er mich, meine Frau, die er beharrlich «meine schöne Braut Isabella» nannte, von ihm zu grüßen. Meine Frau Isabella mochte es überhaupt nicht, Isabella genannt zu werden. Sie wollte kurz und knapp Bella genannt werden, und ich muß ihr recht geben. Sie ist eine ungewöhnlich schöne Frau.
Nachdem mein Bruder aufgelegt hatte, kehrte ich nicht gleich zum Sofa zurück. Ich wollte meinem Herzen, das stark klopfte, Zeit geben, sich zu erholen, aber meine ungewöhnlich schöne Frau Bella fragte gereizt:
«Wer war es?»
«Mein Vater ist krank!» antwortete ich und bemerkte zu meiner Verwunderung, daß ich kurz davor war, in Tränen auszubrechen.
«Sehr krank?»
Bella sah schon selbst ein, wie dumm die Frage war. Wenn man über neunzig ist und krank wird, ist man immer sehr krank.
«Schlaganfall!» Es gelang mir, im letzten Augenblick die Tränen zurückzuhalten, und ich setzte mich neben sie.
«Bella...» flüsterte ich und wollte noch mehr sagen, konnte aber nicht. Ich wiederholte nur ihren Namen.
«Bella...»
Sie wurde weich. Sie legte Vittorios Fußballdress zur Seite, auf den sie gerade die Ziffer I heften wollte. Vittorio träumte davon, ein großer und berühmter Torwart zu werden. Ich habe einmal davon geträumt, ein gefürchteter Linksaußen zu werden, und ich vergiftete Vittorio mit dem unausgelebten Geheul meiner verlorenen Jugend. Wenn er zu Hause im Wohnzimmer trainierte, war es praktisch unmöglich für andere, sich dort aufzuhalten.
«Was willst du tun?» erkundigte sich Bella mit einer vor Anteilnahme etwas unsicheren Stimme.
«Ich fliege natürlich hin... Aber nicht morgen. Mein Bruder meint, ich könnte warten, bis er wieder anruft.»
Ich muß zugeben, daß ich den Aufschub mit einer gewissen Erleichterung aufnahm. Ich hatte einiges zu erledigen. Ich hatte eine wichtige Verabredung mit einem Repräsentanten des Staates – seit mein Einkommen zu steigen beginnt, habe ich eine solche Verabredung mindestens einmal pro Jahr.
Vor genau drei Tagen habe ich einen großen Literaturpreis bekommen, ich bin also Schriftsteller. Ich stand vor ein paar Hundert Journalisten und Kritikern, habe mir angehört, wie man mein Werk lobte, und dann hat man mir eine Urkunde und einen Scheck überreicht, was zwei unmittelbare Folgen hatte. Zum einen begann Vittorio sofort, nach einem neuen Game-and-Watch-Spiel zu schreien, zum andern erhielt ich einen eiligen Anruf vom Finanzamt.
Ich war jedenfalls glücklich. Am selben Abend rief ich von meiner Wohnung in Huddinge aus in Athen an, und nach den einleitenden Begrüßungsworten mit meiner Mutter bat ich, mit meinem Vater sprechen zu dürfen. Der Alte kam auch gleich ans Telefon.
«Hallo, alter Gauner», brüllte ich in den Apparat, weil sein Gehör nicht mehr das beste ist.
«Dein Sohn ist ein berühmter Mann geworden!»
«Was hast du gesagt?» fragte der Alte, der nur einzelne Laute mitbekommen hatte.
«Ich habe einen großen Preis bekommen!»
Der Alte wandte sich an sein ihm seit fünfundfünfzig Jahren treues Eheweib.
«Hast du das gehört, Frau? Unser Sohn ist verrückt geworden! Er hat eine Geiß bekommen!»
«Nein, keine Geiß, einen Preis!» schrie ich wieder. Ich war ein berühmter Mann geworden, aber plötzlich kam mir der Gedanke, daß das alles ein bißchen lächerlich war.
Aber der Alte verstand mich auch diesmal nicht. Er überließ seiner Frau den Hörer mit den Worten:
«Was sagt unser Sohn? Ich kann nichts verstehen!»
«Ich habe dir schon hunderttausendmal gesagt, daß du dir einen Hörapparat anschaffen mußt! Aber nein, deine Sturheit ist schlimmer als bei einem Esel!» schimpfte meine Mutter.
Ein Streit schien sich anzubahnen, und so teilte ich die erfreuliche Nachricht schnell meiner kleinen Mama mit, die natürlich zuerst ein wenig weinte, dann den alten Mann noch einmal zurechtwies, um danach den Sohn, das heißt mich, darauf hinzuweisen, noch lauter zu schreien. Und der Sohn schrie noch lauter, denn wenn jemand unbedingt von seinem Triumph erfahren mußte, dann war dieser Jemand sein Vater.
Warum?
Schließlich begriff der alte Mann, was der Sohn ihm mitteilen wollte, und es entstand ein langes Schweigen zwischen Huddinge und Athen. Der Sohn hatte den Eindruck, als murmelte der Alte etwas.
«Was hast du gesagt?»
«Hörst du auch schlecht?» zeterte mein Vater.
«Ich habe nichts verstanden!»
«Ich habe gesagt, daß ich jetzt sterben kann!» brüllte mein Vater ergrimmt. Der Alte ertrug es nicht, daß er alt geworden war, er ertrug es nicht, zu erfahren, daß er schlecht hörte und die Augen schwach und die Beine müde waren. Er ertrug es nicht, über neunzig Jahre alt zu sein.
«Du wirst überhaupt nicht sterben!» scherzte der Sohn. «Ich habe dich jetzt unsterblich gemacht!»
«Leck mich am Arsch!» antwortete dieser dröhnend lachende, ehemalige Volksschullehrer, und sicherheitshalber wiederholte er es.
«Leck mich am Arsch!» und damit überließ er den Hörer endgültig seiner Frau, um zu seiner zerlesenen Zeitung zurückzukehren und sich dahinter versteckt seine Brille zu wischen und vielleicht auch seine Augen.
Der Sohn und die Mutter sprachen noch ein Weilchen. Die Mutter Antonia und der Sohn Alexandros, Alekos, Alekakis und endlich von allen Alkis gerufen außer von seinem Gott.
«Bekommst du viel Geld?» wollte meine Mutter wissen.
Ich überschlug die Summe rasch im Kopf. In schwedischer Währung war sie nicht sonderlich imponierend, deshalb beschloß ich, sie in griechischen Drachmen umzurechnen. So wurde es viel Geld. Aber vorsichtshalber fügte ich hinzu:
«Es ist nicht sehr viel Geld, Mama! Es geht um die Ehre, die Auszeichnung!»
Das verstand sie ohne weiteres, und im übrigen war sie keineswegs erstaunt darüber, daß ihr Sohn ein berühmter Mann geworden ist.
Wenn mein Vater eher zurückhaltend war, so war meine Mama um so gesprächiger. Deshalb fuhr sie fort:
«Ich habe das schon gewußt, seit du ein kleiner Knirps warst! Erinnerst du dich noch an Tante Chrisi? Die aus dem Kaffeesatz die Zukunft lesen konnte?»
Meine Mama wartete auf keine Antwort.
«Sie sah es oft in der Kaffeetasse, weißt du. Sie sagte immer zu mir: ‹Antonia, dein Jüngster wird einmal in der ganzen Welt bekannt werden!› Sie hatte recht. Sie hatte in allem recht, aber über Geld hat sie nicht viel gesagt!»
«Es ist nicht sehr viel Geld, Mama!»
«Aha... Du glaubst wohl, wir wollen dich anpumpen!»
«So habe ich es nicht gemeint, Mama!»
Aber die Mutter hörte nicht zu.
«Arme Chrisi! Gott erbarme sich ihrer Seele! Sie war eine gute Frau, sie gönnte es mir, daß ich einen Sohn mit Siegerkranz bekommen habe! ‹Antonia›, hat sie gesagt, ‹dein Jüngster ist mit einem Glorienschein um seinen Dickschädel geboren worden! Mach dir wegen ihm keine Sorgen!› Und ich habe mir nie Sorgen gemacht wegen dir, auch damals nicht, als du allein ins Krankenhaus gegangen bist und sie dir die Mandeln herausgenommen haben! Kannst du dich erinnern?»
Sicher konnte ich mich daran erinnern!
«Nein, jetzt haben wir genug geredet!» erklärte meine Mama. «Obwohl du mit deinem Preis genug Geld hast, jede Telefonrechnung zu bezahlen. Möge Gott auf deiner Seite sein, mein Junge, mein lieber kleiner Sohn!»
Und meine Mama begann ernsthaft zu weinen. Sie verließ sich nie darauf, daß ich auf der Seite Gottes sein sollte. Aber bald fing sie sich und kam endgültig zum Schluß.
«Jetzt werde ich zu deinem Vater gehen und ihm mal was erzählen! Er sagt immer, daß ich ungebildet bin und unbelehrbar wie ein Esel, aber woher kommt es dann, daß so ein Esel wie ich einen solchen Sohn bekommen hat? Kannst du mir das erklären, alter Besserwisser? werde ich ihn fragen. Nein! Das kannst du nicht!»
Damit war das Schicksal meines Vaters für diesen Abend besiegelt. Er würde seine Zeitung nicht in Frieden lesen können.
Ich legte auf und war ein wenig benommen, wie immer nach einem Gespräch mit meiner Mama. Sie vergaß wirklich nichts.
Sie war der Museumsvorsteher der Familie und dessen Wärter gleichzeitig. Sie konnte alle Krankheiten der Kinder aufzählen, deren Liebesgeschichten und Stärken und Schwächen in der Schule; sie kannte die umfangreiche und mit den Jahren stark dezimierte Verwandtschaft meines Vaters weit besser als er selbst, und sie wußte die Namen aller Freunde ihrer Söhne, übrigens nicht nur die Namen, sondern auch die Kosenamen und die Spitznamen sowie eine charakteristische Eigenschaft, wenn eine bestand.
Meine Mama sagte nie: «Thanassis ist heute nachmittag vorbeigekommen», sondern: «Der verrückte Hund Thanassis mit seinem flachen Schädel kam schlauerweise genau in dem Augenblick vorbei, in dem ich die Spinatpastete aus dem Ofen geholt habe, und er hat die Hälfte davon aufgegessen!»
Für meine Mutter existierten keine Abstraktionen; ein Name bedeutete nichts! Ihre Warmherzigkeit machten die Welt und die Menschen konkret. Die Liebe lebt und stirbt mit den Details, das wußte sie.
Ich habe den Sinn meiner Mutter für Details geerbt. Ich erinnere mich an die honigsüße Tante Chrisi, wie sie mit hellseherischem, scharf konzentriertem und forschendem Blick den Kaffeesatz betrachtete. Ich erinnere mich an ihre demütige Geste, wenn sie die Kaffeetasse umdrehte, als würde sie an der Weltachse drehen. Sie war dann erfüllt von einer Kraft, die sie gelassen hinnahm. Umgekehrt hatten die dunklen Mächte keine Geheimnisse vor ihr, sie zeichneten alle ihre Rätsel in phantasievollen Mustern in den Kaffeesatz, ein Werk des Zufalls mit allen Anzeichen göttlicher Vorsehung.
Nun ist die honigsüße Tante Chrisi seit zehn Jahren tot, möge Gott ihrer allumfassenden Seele gnädig sein! Aber sie hat so lange gelebt, bis ihre Söhne verheiratet waren, «und was kann man sich mehr wünschen?»
Ich erinnere mich sehr gut an Tante Chrisi, und ebensogut erinnere ich mich an die sanften Nachmittage in Athen, wenn die Frauen des Viertels zusammen ihren Kaffee tranken, nachdem die Männer wieder an ihre Arbeit gegangen waren. Sie saßen in einem eigenen Kreis, manchmal umgeben vom Lärm und Geschrei der Kinder, und lauschten andächtig, was Tante Chrisi im Kommenden las. Die Sonne fiel schräg auf ihre müden Gesichter, während der Siesta der Männer hatten die Frauen abgespült, genäht, gebügelt und das Essen vorbereitet, aber diese Nachmittagsstunde mit dem Kaffee und der Zukunft gehörte ihnen und der Königin der dunklen Mächte, Tante Chrisi! Aber jetzt war die honigsüße Tante Chrisi seit mindestens zehn Jahren tot. Der Tod hat sich meinem Kreis genähert und war ein eigensinniger Gast, der nie wegging, ehe ihn der Gastgeber zur Tür geleitet hatte, die hinausführte aus der Welt und zu den dunklen Mächten.
Das war vor drei Tagen, und jetzt war mein Vater krank. Der Tod hatte sich noch näher an meinen Kreis herangeschlichen.
2
Ich habe den Sinn meiner Mutter für Details geerbt, aber habe ich auch ihre Warmherzigkeit geerbt?
Das wußte ich nicht. Manchmal erlebte ich meine Erinnerung als eine Art unabhängige Perversität, eine Art dritter Arm, mit dem ich zupacken, aber nicht streicheln konnte.
Nach dem Telefongespräch mit meinem Bruder setzte ich mich zu meiner Ehefrau Bella. Sie legte Vittorios Fußballdress zur Seite und nahm theatralisch meinen Kopf in ihre Hände.
«Warum fährst du nicht morgen?»
«Ich muß mich ja mit dem Steuerprüfer treffen!»
«Er kann warten...»
«Er schon, aber ich nicht. Das kann mich zwischen 30 und 40 000 kosten. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, mich zu schätzen.»
«Woher weißt du das?»
«Nach den Briefen zu urteilen, ist sie scharf auf eine Schätzung.»
«Ach so», sagte Bella. «Es ist eine Sie!»
«Weiß ich nicht sicher. Ihr Name kann sowohl männlich wie weiblich sein. Sie heißt Inge Tamej. Sie scheint mit einem Ausländer verheiratet zu sein...»
«Oder ist von einem geschieden!»
«Genau!»
«Du weißt nicht das Alter?»
«Über neunzig...»
«Ich meine die Steuerprüferin.»
«Woher soll ich das wissen?»
«Ich dachte nur, ob...»
«Was ist los? Glaubst du, ich will dich mit einer Steuerprüferin betrügen?»
«Nein! So weit gehst du nicht, nehme ich an!» lachte Bella hart. Ich war mir nicht so sicher, wie weit ich gerade hier gehen würde. Ich küßte Bellas Ohrläppchen, das die merkwürdige Eigenschaft besaß, sich zusammenzurollen und in die Ohrmuschel zu drücken, und ich biß in die Ohrringe, die ich ihr vor einigen Jahren zu Weihnachten geschenkt habe.
Ich dachte daran, welche Intimität wir uns durch Dinge schaffen, das sind die Intimitäten und die gemeinsamen Erfahrungen der neuen Zeit: «Weißt du noch, wann wir dies oder das gekauft haben?»
Die Intimität meines Vaters und meiner Mutter war anderer Art. Wann hatte Vater im Gefängnis gesessen, oder wann ist der jüngste Sohn allein in das Krankenhaus gegangen, um sich die Mandeln herausnehmen zu lassen, die aussahen wie gebrannte Kastanien. Daran erinnerten sich die Menschen, und ihre Intimität bezog sich nicht auf Dinge, sondern auf ihr Zusammensein.
Ich küßte meine Frau noch einmal und verwarf den Gedanken. Gleichzeitig versetzte mir Bella einen scherzhaft gemeinten Rippenstoß:
«Dein Vater liegt im Sterben, und du hast nur schlechte Gedanken!» kokettierte sie.
Ich antwortete nicht. Mein Vater lag nicht im Sterben, mein Vater war unsterblich. Mir fiel nur ein, daß auch wir andere gemeinsame Erfahrungen hatten. Ich habe gesehen, wie sich ihr Schoß wie eine fleischfressende Pflanze öffnete, aber nicht, um Leben zu nehmen, sondern um es zu geben.
Ich küßte Bella erneut, und ich kroch mit den Lippen über ihren Nacken – ich wußte, daß sie da nicht widerstehen kann –, da läutete wieder das Telefon. Diesmal war es eine Journalistin der Zeitung Expressen, die zu dieser relativ späten Stunde wissen wollte, was ich zur Situation der modernen Frau meinte.
Auf meine Frage, warum gerade ich irgend etwas zu diesem heiklen Problem meinen sollte, antwortete sie, daß man von einem Literaturpreisträger erwarte, über alles eine Meinung zu haben.
Diese Antwort, vorgebracht von einer intelligenten und zugleich einschmeichelnden Stimme, gefiel mir, und ich erklärte mich bereit, die Frage am nächsten Tag nach elf Uhr umfassend in meinem Arbeitszimmer zu beantworten.
«Aber ich brauche die Antwort heute!»
«Heute können Sie überhaupt keine Antworten bekommen! Ich bin völlig damit beschäftigt, meine Frau zu verführen», flüsterte ich in ihr Ohr. Die Journalistin lachte und gab nach. Sie würde sich dann morgen wieder melden.
Währenddessen hatte Bella meine Küsse mit einer Kopfbewegung abgeschüttelt und war in das eheliche Schlafgemach gegangen, das in den letzten Jahren mehr und mehr zum Übernachtungsraum geworden war. Ich stellte mir vor, wie sie sich entkleidete, wie sie den Bademantel überzog und mit geheimnisvoller Miene im Bad verschwand. Ich wußte, daß sie im Bett liegend auf mich warten würde, den neuesten feministischen Roman vor der Nase.
Ihre «Entpuppung» dauerte bereits einige Zeit an. Ich war einst verliebt in ein zwanzigjähriges Mädchen, das durch seine schüchterne Lebensfreude daran gehindert wurde, mit dem Studium zurechtzukommen, das sich aber nach zehn Jahren ehelichen Zusammenlebens in eine äußerst effektive Chefsekretärin in irgendeiner staatlichen Institution verwandelt hatte.
Inzwischen hatten wir uns ein Kind zugelegt, den dunkelhaarigen, dunkeläugigen und ziemlich hysterischen Sohn. Er ist während eines Besuches bei ihren Verwandten in der neureichen Stadt nördlich von Mailand entstanden. Dort hatten italienische Mafiosi einen von Polizisten unberührten Zufluchtsort, wo sie sich ungestört damit beschäftigen konnten, ihre Kinder und Kindeskinder zu verheiraten und zu Gott zu beten.
Eines Nachmittags machten Bella und ich einen Spaziergang – ich brauchte nach so vielen frommen Gangstern um mich herum frische Luft –, und wir gingen hinauf in die Berge in ein Dorf mit dem seltsamen Namen Latona. Wir waren kaum angekommen, als ein gewaltiges alpines Unwetter einsetzte. Der Wind pfiff, Schneeflocken wirbelten um uns, und Bellas kunstvolle Frisur ging zum Teufel. Wir waren gezwungen, in Latona in einem elenden, kalten Hotel zu übernachten. Es war so kalt im Zimmer, daß wir die ganze Nacht nicht schlafen konnten, und wenn man außerdem frisch verheiratet ist und einen vortrefflichen französischen Cognac neben dem Bett stehen hat, dann dürfte klar sein, was wir alles angestellt haben, um uns warm zu halten.
Neun Monate später wurde Bella im Danderyds-Krankenhaus von unserem Vittorio entbunden. Vittorio scheint seine Anlagen weder von mir noch von Bella geerbt zu haben, sondern eher von dem alpinen Sturm, in dessen Winden er konzipiert wurde, und vom ersten Augenblick an konnte er mich nicht leiden.
Ich war natürlich dabei, als er an das Licht der Welt gezogen wurde, und sein markerschütternder Schrei war so fürchterlich, daß ich die ganze Zeit Bella ansehen mußte, die mit rotem Gesicht und Schweiß auf der Stirn auf dem Entbindungstisch lag, um mir zu versichern, daß das, was sie gebar, ein Kind war.
Später, als Vittorio auf Bellas Brust lag und zufrieden schnorchelte, brüllte er jedesmal, wenn ich in seine Nähe kam. Bella zwang ihren Sohn, mich anzusehen, aber der dunkle, wäßrige Blick des Kindes verfluchte mich ein für allemal. Er brüllte noch mehr und beruhigte sich erst, als ich den Raum verlassen hatte.
Meine Schwiegermutter, die fromme Gangsterfrau Sofia Monarka, bekreuzigte sich und murmelte unzusammenhängende Tiraden auf Latein. Doch mein Schwiegervater Cosimo M. Monarka, der sich noch nicht in das Zimmer gewagt hatte und auf dem Flur in der alten Männern typischen Art mit den jungen finnischen Hilfsschwestern flirtete, tröstete mich.
«Alle gesunden Söhne hassen ihre Väter!» erklärte er mir und betrachtete kritisch einen schwesterlichen Hintern, der auf klappernden Holzschuhen vorbeiging. Und dann fuhr er fort:
«Als Vittorio Emanuele Kronprinz war, versäumte er es nie, seinen Vater, den König, anzupinkeln, wenn er auf seinem Schoß saß. Oh, ich weiß es noch, als sei es gestern gewesen, es stand in allen Zeitungen!»
Und er würde tagelang seine Königsgeschichten fortspinnen – sein Entsetzen vor dem Zimmer mit den Frauen war größer als der Wunsch, seinen Enkel zu sehen –, wenn nicht meine Schwiegermutter, eine hochgewachsene, norditalienische Gräfin, die ihren Mann so mitleidig, ach so mitleidig verachtete, daß ihm Tränen in die Augen stiegen, wenn er daran dachte, herausgekommen wäre und ihn an das Lager der Tochter, die in ihrem Bett thronte und vor Glück heulte, gezogen hätte. Ich kenne niemanden, weder unter den Lebenden noch unter den Toten, der eine solche Vorliebe für heruntergekommene Adelige und königliche Hoheiten im Exil hat wie mein Schwiegervater. Er verließ Italien, als Mussolini die Macht übernahm, nicht aus Protest gegen den Faschismus – Faschist war er von Geburt, durch die Erziehung und aus alter Gewohnheit –, sondern deshalb, weil Mussolini sich seines Vittorio Emanuele entledigt hatte.
Cosimo M. Monarka irrte quer durch Europa auf der Suche nach dem Land, wo ihn die Behörden am wenigsten verfolgten, das war die eine Bedingung, die andere war, einen sicher auf seinem Thron sitzenden König zu finden. Den gab es nur in Norwegen und Schweden, und er entschied sich für Schweden, dessen König Archäologe war und in Italien Ausgrabungen machte.
Cosimo M. Monarka hatte genug Geld. Er begann seine Laufbahn in dem schmutzigen süditalienischen Dorf San Domenico unter seinem richtigen Namen Cosimo Vighliaco, und mit dreißig Jahren war er Bankier in Mailand und frisch verheiratet mit der verarmten Gräfin Sofia Medici, die in einem Schloß wohnte und tagaus, tagein Spaghetti aß.
Niemand wußte, wie ihm das so schnell geglückt war, alle sprachen sie von seinen Verbindungen zur Mafia, aber keiner wußte oder sagte Genaueres. Von sich aus erzählte er niemandem etwas, am wenigsten seiner Ehefrau, aber ich habe ab und zu beobachtet, wie junge, dunkelhaarige Männer sein unscheinbares Büro in Gamla Stan (Altstadt von Stockholm) aufsuchten, wo er Antiquitäten per Post verkaufte. Alle küßten ihm die Hand und nannten ihn «nonno».
Ich redete ihn mit seinem Vornamen Cosimo an, obwohl er gerne von mir als «Papa» tituliert worden wäre. Doch er ertrug meine Unart, das einzige, was er nicht vertragen konnte, war, wenn ich Fragen stellte nach dem mystischen Buchstaben zwischen dem Vor- und dem Nachnamen. Er nannte sich ja Cosimo M. Monarka.
Einmal fragte ich seine Tochter, also meine Frau Bella, was dieses «M» bedeuten solle. Es stand für Medici, dem Namen der Gräfin, und mein Mafioso von Schwiegervater strebte nach dem adeligen Namen, aber so weit zu gehen, den Namen seiner Frau anzunehmen, wagte er nicht.
Dabei bestand eine verblüffende Ähnlichkeit zu Cosimo Medici, dem großen florentinischen Bankier und Mäzen, der Henrik Tikkanen zufolge «die Schönheit überall außer im Spiegel» sehen konnte. Mein Schwiegervater war ganz einfach ungewöhnlich häßlich. Sein Gesicht war rund wie eine Wassermelone, die Augen waren schmutziggrau, klein und so eng beieinander, wie bei einem Schwein; die Augenbrauen waren breit und buschig, und mitten in dem Ganzen thronte die Nase wie ein Felsvorsprung, zu dessen Füßen sich zwei tiefe, dunkle Höhlen auftaten: die Nasenlöcher, voller weißgrauer Haarbüschel, die sich bewegten, wenn er den Rauch seiner stinkenden Zigarren ausblies.
Der Oberkörper war lang und kräftig, doch die Beine waren kurz und krumm. Wenn er ging, erinnerte er an die Broadwaymaschinen, mit denen man die Trottoirs sauberhält. Aber seine Anzüge waren maßgeschneidert in Florenz, seine Schuhe entweder Murati oder Bally, und seine Hemden kamen in Dutzendpackungen von Madame Rinaldi aus Ravenna. Nur Seide durfte die Teile seines Körpers berühren, die nicht von dem ewigen Wollunterhemd bedeckt waren, eine Angewohnheit aus den kalten sardischen Nächten, als er nicht nur einmal unter freiem Himmel übernachtete.
«Wer ein Bauerntölpel ist, bleibt einer!» gackerte er, wenn seine Frau oder seine Tochter versuchten, ihm das Unterhemd abzugewöhnen. Aber mir pflegte er Lektionen zu erteilen in der Kunst, sich elegant zu kleiden.
«Ein Hemd muß so lang sein, daß man es unter den Arsch schieben kann!» schrie er am Mittagstisch. Er verabscheute kurze Hemden, weite Jacken und enge Hosen.
«Ein Sakko darf nicht wie eine Trainingsjacke aussehen!» stellte er fest und, «enge Hosen sind für Schwule», und er zwang mich, ständig teurere Kleidung zu kaufen.
Seine Methode war ebenso einfach wie wirksam. Er kippte ganz einfach Tinte oder Ketchup auf die Anzüge, die sein Mißfallen erregten. Dann lachte er und entschuldigte sich mit einem Augenzwinkern.
Seine Tochter drohte, ihn von den gemeinsamen Sonntagsessen der Familie auszuschließen, aber der alte Mafioso wußte es besser. Wir lebten gut dank seines Geldes, und durch das Geld regierte er über seine Familie wie ein russischer Großfürst über seine leibeigenen Bauern. Vittorio, unser Sohn und Cosimos Enkel, verehrte ihn, und was Vittorio haben wollte, bekam er, sowohl von seiner Mutter wie von mir. Aber il pappo gegenüber benahm er sich wie ein Engel. Umgekehrt war der alte Cosimo sehr angetan von seinem Tochtersohn, und er wiegelte ihn heimlich auf gegen uns, seine wankelmütigen Eltern.
Cosimo und Vittorio waren sich in vielen Punkten einig, besonders aber in einem: Vittorio wollte Geschwister und Cosimo mehr Enkel.
«Ein Kind ist kein Kind», polterte Cosimo. Seine Frau Sofia sagte nichts, sie hatte es auch nicht besser gemacht.
«Dann bin ich wohl kein Kind?» beschwerte sich Bella.
«Du bist sogar nur ein Mädchen!» antwortete Cosimo ungerührt, und Bella wurde wütend.
Vittorio hatte sich frühzeitig gemerkt, wo seine Mutter ihre Pille versteckt hatte und ich meine Präservative. Einmal ertappte ich ihn auf frischer Tat, als er mit einem Hammer auf dem harten Boden im Bad Antibabypillen zerschlug und dabei ergrimmt flüsterte:
«Verfluchte Mörder! Verfluchte Mörder!»
Obwohl es eigentlich überflüssig war, fragte ich ihn, was er treibe, und er zögerte nicht mit der Antwort. Mit triumphierendem Lachen und blitzenden Augen rief er:
«Ich will einen kleinen Bruder haben!»
«Und was glaubst du, was wir sind? Eine Gebärfabrik?» Ich mußte mich offensichtlich jedesmal mit Vittorio streiten.
«Il pappo hat gesagt, daß ihr soviel Kinder bekommen könnt, wie ihr wollt!»





























