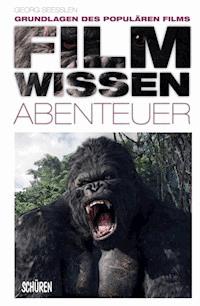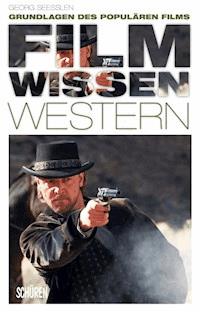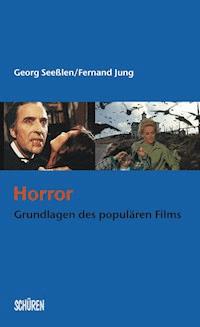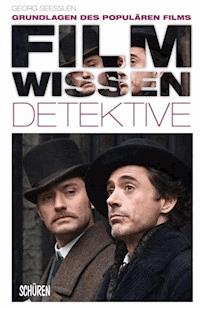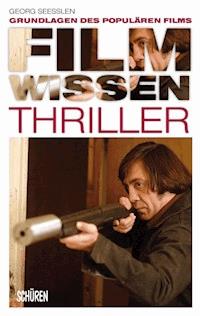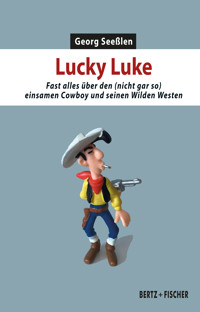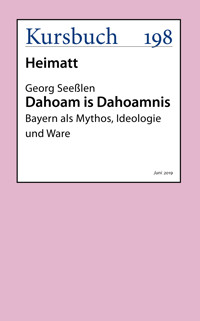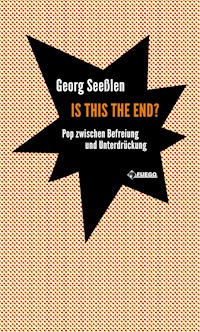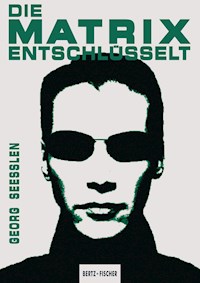Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unter den Bedingungen eines digitalisierten Kapitalismus bzw. einer kapitalistischen Digitalisierung findet derzeit ein radikaler Umbau des Menschen, seiner Individualität, seiner Gesellschaftlichkeit, seiner Seele, seiner Kultur statt. Dieser Umbau wird alle Bereiche des Lebens verändern: Geburt, Liebe, Tod, Arbeit, Kommunikation, Gemeinwesen, Politik, Krieg – nichts bleibt unberührt von den unaufhaltsamen Umwälzungen. Markus Metz und Georg Seeßlen haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese fortwährend sich beschleunigenden Veränderungen beschreibend zu begleiten. So führen sie in dieser gleichermaßen faszinierenden und bunten wie erschreckenden Studie durch die Welt der Wearables und Drohnen, der künstlichen Intelligenz und des Internets der Dinge, Big Data und des digitalen Brainwashing namens E-Learning, der Quantifizierung des Sozialen und der Bodyfitness – nicht um Schrecken zu erzeugen oder moralisch den Zeigefinger zu erheben, sondern um ans Licht zu bringen, was sich im Alltäglichen, Selbstverständlichen und Unabänderlichen verbirgt. Denn "nicht, dass sich etwas ändert, ist das Schreckliche, sondern dass sich die Dinge ändern, ohne dass sich zugleich das Bewusstsein ändert".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARKUS METZGEORG SEEßLEN
Schnittstelle Körper
INHALT
Vorwort
Einleitung
Backstory: Was bisher geschah
Kurze Geschichte der Computerisierung des Alltags
Kurze Geschichte des Dings und seines Gebrauchs
Und eine kurze Geschichte von Körper und Seele
Momentaufnahme: I sing the body electric. Die Einführung der Apple Watch
Mein wunderbarer Digitalalltag
Mein Kaffeeautomat denkt mit, oder: Wie sich die Küche in einen digitalen Bedeutungsraum verwandelt
Die innere Akustik: Der Kopfhörer
Die elektronische Befreiungskontrolle: Die Technologie in der Mode zwischen Fitness und Datenraub
Gamification of the World: Die Datenbrille
Immer und überall alles: Das Smartphone
Die Thermifee, oder die Rückkehr der Seele in die digitalisierte Küche
Unterwegs! Digitalisiertes Jogging, Bildschirmshoppen: Hin oder fort vom Körper und seinem Begehren?
Drohnen für alle! Superwaffen und Minispielzeug
Kulturtechniken Reloaded
Die Paradoxien der künstlichen Intelligenz
Das Internet der Dinge
Demokratie digital
Self-Quantifying, Digital Health und andere Gesundheitsmaßnahmen
Industrie 4.0, oder: Schöne neue Arbeitswelt
Der Geldmensch, oder: Onkel Dagobert lebt hier nicht mehr
Digital Brainwashing: Vom E-Book zum E-Learning und darüber hinaus
Mein nigelnagelneues selbst fahrendes, mit allem verbundenes und mich perfekt unterhaltendes E-Mobil
Mein Heim, meine elektronische Festung, mein … was?
Maschinensprache: Plaudern Sie mit Ihrem Roboter!
Wirklichkeit 4.0
Das Ding an meinem Körper frisst mich auf: Ein kritischer Abschluss
Der Krieg zwischen Pop, Politik und Technologie
Kawaii: Die Kultur der Niedlichkeit als Schnittstelle zwischen digitalem Alltag und künstlicher Intelligenz
Das Selfie – und wie es die Welt sah
Big Data – Little Helper
Big Data als Wiederkehr des Laplaceschen Dämons
Annäherungen zwischen Mensch und Maschine: Cyborgs und Social Bots
Der kultivierte Cyborg, der unsterbliche Popstar und die lebende Wand des Wallpaper-TV
Das absehbare Ende der freien Marktwirtschaft: Transformationen von Macht, Kapital und Konsum
Künstliche Intelligenz und wie sie uns zu Leibe rückt
Der Subjektkapitalismus
Ein vorläufiges Resümee
Wie weiter? Der digitalisierte (Schein-)Körper, der virtuelle Raum und die möglicherweise rettende Kritik
VORWORT
Wie alle unsere Bücher ist auch dieses ein mehr oder weniger unmöglicher Versuch, die Bedingungen des Lebens, Arbeitens, Begehrens, Schöpfens, Wahrnehmens, Denkens und sogar des Sterbens im Zeichen des digitalen Weltkapitalismus zu beschreiben, also ohne die Vorzüge eines verlässlichen räumlichen, zeitlichen, begrifflichen, methodischen oder auch nur persönlichen Abstands. Mittendrin und währenddessen.
Nicht um das Sichere, sondern um das Offene kann es da nur gehen. Wie wird man leben (können) unter den Umständen eines radikalen Umbaus des Menschen, als Individuum wie als Gemeinschaft, als Seele wie als Kultur, im Zuge einer kapitalistischen Digitalisierung bzw. eines digitalisierten Kapitalismus? Die Veränderungen betreffen nicht nur die großen Zusammenhänge von Arbeit, Krieg und sozialen Strukturen, sondern auch Alltag, Empfindung und Kommunikation. Uns interessieren hier die »kleinen« Veränderungen: die Auswirkungen all dieser selbstverständlichen, nützlichen und erschwinglichen Technologien, die wir in den Händen oder sonst wo am Körper mit uns herumtragen, die unser Leben so bequem und sicher machen wollen, die uns »fit machen« sollen für den Wettbewerb und uns immerwährenden Spaß versprechen. Kulturpessimismus und Nostalgie, das kann vorweggesagt werden, ist nicht unser Ding, noch weniger Konsumgier und Affirmation. Uns liegt vielmehr daran, kritisch auf etwas hinzuweisen, denn es geschieht etwas mit uns durch diese Verwandlung unserer Umwelt, so viel ist sicher. Was da geschieht, ist allerdings im Alltäglichen, Selbstverständlichen und Unabänderlichen verborgen. Das Schreckliche ist also nicht, dass sich etwas ändert, sondern dass sich die Dinge ändern, ohne dass sich zugleich das Bewusstsein von ihnen verändert.
So folgen wir nun den Spuren dieser Veränderungen, weder um sie zu verdammen noch um sie zu rechtfertigen, sondern um ein kritisches Bewusstsein von ihnen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt dieser Suche steht der Mensch als körperliches Wesen und seine Beziehung zu seinen maschinellen Schöpfungen. Nicht die großen Dramen werden entfaltet, die Science-Fiction-Mythen vom Kampf der Roboter gegen die Menschen oder vom Leben in einer Matrix der Illusionen und Simulationen, sondern die Episoden der Gewöhnung und Anpassung, die von jedem von uns, mal früher, mal später, erwartet werden. Die digitale Revolution verändert das Leben aller Menschen auf dieser Welt, keine Insel und keine Festung wird dagegen bestehen. Aber natürlich verändert sie das Leben der Reichen anders als das Leben der Armen, das Leben der Nutzer anders als das der Benutzten. Als Schlüssel muss uns dienen, was uns am nächsten ist: das Leben des weder besonders reichen noch besonders armen Kleinbürgertums in den Postindustrienationen: Hier bietet die Konsum-Avantgarde ein großes Experimentierfeld. Motor, Rohstoff und Produkt, aber auch Abfall, Verbrauch und Ermattung – alles wird hier zum digitalen Habitus. Was hier ankommt (im doppelten Sinn), wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Rest der Welt durchsetzen, und so entfernt eine Favela-Hütte über Rio und ein Smart Home im Speckgürtel der deutschen Großstadt auch sein mögen, so verbunden sind beide doch auch schon durch das allgemeine Gebot der Connectedness, durch Mechanismen von Kontrolle und Überwachung in Kommunikation und Entertainment und durch die Allgegenwart der Traumbilder von einer schönen neuen Welt der smarten Dinge. Sie versprechen uns Sorgenfreiheit, Bequemlichkeit, Sicherheit, Verbesserung, Glück, und ja, wenn man einmal eines von diesen smarten Dingen hat, sei’s das Smartphone, sei’s das spracherkennende, vollautomatische Haus, dann fällt es einem sehr bald schwer, sich vorzustellen, wie es war, als man dieses Ding noch nicht hatte. Digitale Askese mag dem einen oder der anderen eine Atempause, eine Zeit der Besinnung verschaffen: die Lösung für das Unbehagen, das sich unweigerlich selbst bei den anfänglich Begeisterten irgendwann bildet, ist sie nicht. Stattdessen müssen wir uns wohl angewöhnen, nach der Menschlichkeit in den intelligenten Dingen zu fragen, nicht nur ihren Funktionen, sondern auch danach, wozu und wem sie dienen. Wer nach der Technologie fragt und der Art und Weise, wie sie den Menschen verändert, der darf von der Ökonomie nicht schweigen.
Was wir also unternehmen, ist eine Kritik der digitalen Alltagsökonomie. Das ist nicht immer angenehm, denn wir sind bereits Teil dessen, was wir kritisieren. Und wir wollen nicht zurück in eine vordigitale Zeit, sondern vorwärts in eine Zeit, in der digitale Technik wirklich der Entfaltung der Menschlichkeit dient, der Demokratie, der Aufklärung, der Geschwisterlichkeit, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Das ist, unter den Bedingungen, die wir nun beschreiben werden, nicht unbedingt absehbar. Unmöglich aber ist es nicht.
EINLEITUNG
1
Im März 2015 fragte die Zeitschrift Rolling Stone noch: »Ob es das Modewort des Jahres wird? Der Kunstbegriff ›Wearable‹, also etwa ›Anziehteil‹, ist in Tech-Kreisen seit Langem ein heißes Thema.«1 Es wurde mehr als nur ein Modewort, nämlich ein neuer Impuls für die elektronische Branche, ein neues Supergeschäft: Etwas mehr als vier Milliarden Dollar Umsatz nach verschiedenen Schätzungen im Jahr 2015, Tendenz kräftig steigend. Für das Jahr 2018 ist vom »Statistik-Portal« im September 2014 das Überschreiten der 9-Milliarden-Grenze anvisiert.2 Auf der IFA-Messe »Consumer Electronics Unlimited« 2015 in Berlin wurde für das Jahr 2019 geschätzt, dass dann 126 Millionen am Körper tragbare Computer auf dem Markt seien.3 Ein lukrativer Zweig der Industrie ist entstanden: »Fitness-Armbänder wie Fitbit, Jawbone oder das Nike+ Fuelband sind derzeit die Verkaufsschlager in einem wachsenden Markt. Pro Armband verlangen die Hersteller rund 100 Euro. Schon im Jahr 2018 könnten die Wearable Technologies einen Wert von über 50 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 38 Milliarden Euro) erreichen, prognostiziert die Schweizer Großbank Credit Suisse – das Zehnfache der Summe von 2013. ›Ein Mega Trend‹, prophezeit das Institut.«4 Gewiss machte ein kommender, nahezu unerschöpflicher Markt den Herstellern wie den Investoren glänzende Augen und schien noch einmal Vitalität, Innovation, Wachstum, Kreativität und all das, was eine prosperierende digitale Wirtschaft eben so braucht, zu versprechen. Ein Antidot gegen das unabänderliche Gesetz vom Fall der Profitraten schien gefunden. Geht doch! Dass unter den vielen, vielen Angeboten auch etliches purer Blödsinn, manches sogar eher gefährliches Spielzeug ist – das liegt eben in der Natur der Sache.
Das Phänomen der Wearables muss von verschiedenen Seiten in den Blick genommen werden. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Konsumschwall, sondern auch um einen Wandel in der Subjekt-Repräsentation in der neuen Gesellschaft des digitalen Kapitalismus; außerdem stellt es eine neue, besonders verführerische Kontroll- und Datensammelmaschine dar; und schließlich natürlich auch einen Teil des neuen Körpergefühls. Wearables sind, seit dem Beginn ihrer Einführung in den frühen Zehnerjahren, doch etwas mehr geworden als ein ökonomisch belebender Trend der Fit- und Fun-Gesellschaft. Sie verändern unser Leben (schon wieder), wobei manche Veränderung dabei nicht so toll ist, wie es uns Werbung und »Style«-Propaganda vormachen wollen.
Wearable Technology wird, jedenfalls auf den ersten Blick, auf dem heitersten der vier großen Felder eingesetzt, auf denen sich die Verschmelzung von digitaler Technologie (einschließlich dessen, was man sich »Künstliche Intelligenz« (KI) zu nennen angewöhnt hat) mit dem Menschen beobachten lässt: die Arbeit, der Krieg, die Medizin und – das Entertainment. Wearable Technology hebt die Grenzen zwischen Alltag und Unterhaltung, zwischen erster und zweiter Wirklichkeit mählich auf; sie verknüpft aber auch Arbeit, Freizeit und »leere Zeit« dazwischen, Kommunikation und Abschottung, individuelle Aufrüstung und allgemeines Mainstreaming. Mit Wearable Technology kann man die äußere Welt zugleich ausschalten und öffnen, sie zugleich kontrollieren und sich von ihr kontrollieren lassen. Nur ist das, was man ausschaltet, und das, was man sich hereinholt, bis in die eigene Wahrnehmung, in den eigenen Körper, beileibe nicht dasselbe. Was da passiert, wirkt wie ein schlechtes, zugleich aber unwiderstehliches Tauschangebot. Die äußere Wirklichkeit wird durch Wearable Technology verändert, und zwar sowohl im Empfinden des Subjekts als auch in der Struktur von Sprachen, Ordnungen und Befehlen. Sie schafft eine neue Form der Person im (nun nicht mehr so) öffentlichen Raum. Und sie schafft eine neue Form von Macht.
Die drei Hauptinstrumente der Wearable Technology im Alltags- und Freizeitbereich sind:
a. die Sport- und Fitnessarmbänder (mindestens mit integrierter Uhr und Netzanschluss), aus denen sich das Allround-Instrument der Smartwatch entwickelte;
b. die Datenbrillen, die zum Schluss ein neues, »verbessertes« Bild der Welt ergeben; und
c. die Kopfhörer, mit denen sich mehr oder weniger beliebig eine akustische Mauer zwischen der inneren, digitalen und der äußeren, analogen Kommunikation ihrer Träger errichten lässt.
Dazu kommen die Cybergloves, Handschuhe, mit denen man seine haptischen Fähigkeiten verbessern oder in den virtuellen Raum verlängern kann, und alle erdenklichen Gadgets und Apps, mit denen man seine kleinen elektronischen Geräte zur Orientierung in der realen wie in der virtuellen Welt aufrüsten kann, ganz abgesehen von den Bildschirmen, mitsamt ihren dreidimensionalen Erweiterungen, von den Spielen und den Informationen, die die User mit der Welt verbinden, soweit sie entsprechend verbindbar und in Daten zu überführen ist. Alle Sinne sind betroffen, und vom Schrittzähler der Gesundheits-App bis zur Virtual Reality sind die zwei Welten, die analoge und die digitale, miteinander verbunden, nicht mehr nur in der Maschine, sondern eben auch am Körper. Nicht nur die Welt, sondern auch das Subjekt wird verdoppelt. Es entsteht eine Kommunikation über Kreuz.
Den Schlüssel zu alledem hält der Mensch unserer Zeit buchstäblich in seiner Hand. Es ist das »Smartphone«: das digitale Allzweckgerät, der elektronische Zauberstab, mit dem wir uns unsere Welt zu regeln angewöhnt haben und mit dem wir uns von ihr regeln lassen. Für die Beziehung, die ein Mensch mit seiner Umwelt durch sein Smartphone hat, gibt es noch keinen Begriff, nicht einmal eine nennenswerte Beschreibung, nur Taumeln zwischen Begeisterung und Entsetzen: Wearable Technology verbindet nicht nur den Körper des Einzelnen mit dem Wissen der Vielen (einst Aufgabe von Kirche und Schule, Militär und Wissenschaft – und von diesen findet sich reichlich in Smartphones und Wearable Technology), sondern realisiert auch auf direkteste Weise ein neues Verhältnis von Freiheit und Kontrolle. Sehen, Hören, Fühlen; Träumen, Wissen, Reisen: Der digital aufgerüstete Körper wird zur Schnittstelle mit einer Welt, die vielleicht vor allem aus lauter genauso aufgerüsteten Menschenkörpern besteht, vielleicht aber auch aus etwas ganz anderem.
Wearable Technology kann sich freilich nur entfalten, wenn auch die Dingwelt sich digitalisiert. Connectedness als Ideal meint nicht nur die Verbindung von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Institution, vom Menschen zu seiner kleinen Technologie am Körper, sondern auch zu mehr oder weniger allen seinen Dingen, zu seinen Lampen, Radios, Türen, Kühlschränken, Fernsehern, Klobrillen, Rasierapparaten usw. Und am Ende, wir werden es im Verlauf unserer kleinen Reise durch die Alltagstechnologie erleben, vielleicht vor allem die Connectedness der Dinge selber.
Dies ist ein Buch über elektronisch aufgerüstete Armbänder, Brillen und Kopfhörer, ein Buch über smarte Häuser und intelligente Zahnbürsten, aber es ist auch eines über die mögliche Zukunft des Menschen.
2
Verkauft werden diese schönen neuen Dinge des elektronischen Konsumismus natürlich zunächst mit dem Hinweis auf den Gewinn von Freiheit, Erfahrung und Abenteuer für den Freizeit- und Kommunikationsbereich. Damit stehen sie ganz und gar in der Tradition der schönen neuen Dinge der Warenwelt, die immer zwei Dinge zugleich versprechen, nämlich eine Erleichterung des individuellen Lebens und eine Erneuerung der Lebenspraxis. Das technische Ding nimmt nicht nur dem Subjekt eine Arbeit ab, sondern arbeitet auch mit am Subjekt-Werden. So hat einst die Waschmaschine der »Hausfrau« Arbeit abgenommen, um zugleich einen neuen Druck in Haushalt und Arbeitswelt zu schaffen. Befreiung scheint immer nur die taktische Etappe zu sein. Befreiung wozu und wohin? Mit dem neuen Ding will man auch selber irgendwie »neu« werden, nach einem verpatzten Beginn der Biografie womöglich. Zugleich wird nicht verheimlicht, dass man mit diesem Ding, das zuerst der Selbstkontrolle und damit der »Selbstoptimierung« dient, auch Daten generiert, Informationen, die »irgendwo« gesammelt, abgeglichen und algorithmisch in Reaktionen von Markt und Politik übersetzt werden. So ist auch hier eine Technik der Individualisierung zugleich eine Technik der Kollektivierung, eine Technik der Befreiung zugleich eine der Überwachung. Und deshalb wird digitale Wearable Technology zu einem Schlüssel in der Entwicklung der Transparenz- und Kontrollgesellschaft.
Im weitesten Sinne geht es um Fitness, um die Selbstaufrüstung im alltäglichen Wettbewerb. Verdächtig schnell sind da aber auch die »Office-Funktionen« ins Gespräch gekommen. Neben der Verbesserung der Selbstkontrollen im Fitness- und Gesundheitsbereich durch die Herstellung von Connectedness noch an den intimsten Orten (man kann es nicht weniger drastisch sagen als mit dem Hinweis darauf, dass mit gewissen Accessoires auch die Verdauungsfunktionen nicht nur kontrolliert, sondern sogleich auch an entsprechende Datensammelstellen weitergegeben werden können – oder müssen), dienen die kleinen Maschinen der elektronischen Körpererweiterung immer auch der Verlängerung des Arbeitslebens in die erodierende Privatsphäre, die durch Laptop, Smartphone und iPad sowieso längst perforiert ist. Während der eigene Körper und die Umwelt vom Träger der Wearable Technology unterworfen werden, unterwirft sich dieser wiederum der Verfügungsmacht von »Arbeitgebern« und der »Leistungskontrolle«. Um es metaphorisch zu sagen: Mit Datenbrille, Fitnessarmband und Kopfhörer läuft dieser Mensch dem Gefängnis seiner Biografie und seines Körpers davon – direkt in sein Verderben. Er trägt das neue Gefängnis am eigenen Körper mit sich herum. Als hätte er sich (elektronische) Fußfessel, Dunkelhaft und Akustikterror freiwillig auferlegt, für das Versprechen einer wachsenden Potenz, für die Ausblendung sozialer Konflikte, für die Fiktion einer »neuen Geburt« und für Wettbewerbsvorteile. Soweit der dystopische Effekt. Doch das Metagebot der Coolness verlangt nach einer Gegenposition: Die meisten Menschen sind nicht so dumm, sich blindlings den Gefahren ihrer neuen Spielzeuge auszusetzen. Sie werden Techniken entwickeln, die Kontrollfunktionen auszutricksen, aus den Optimierungsverfahren in kreative Nebenwelten zu flüchten. Sie werden Fantasie einsetzen, um die Dinge »subversiv«, zumindest anders als in politischen und ökonomischen Zentren gedacht, zu nutzen. Sie werden im Desaster das Emanzipative finden. Oder?
Neben den technischen und semantischen Aspekten (der Veränderung der Wahrnehmung und der Aktionen in der ersten Wirklichkeit) und neben den sozialen Aspekten (eine neue, digitale Vernetzung tritt an die Stelle der alten analogen Gesellschaft, in der man voneinander zu lernen und aufeinander Rücksicht zu nehmen hatte) gibt es auch Aspekte der Kognition und des subjektiven Wissens, die mit der Wearable Technology verbunden sind, vor allem dort, wo sie nicht allein User und User, User und Provider, Subjekt und »Community« miteinander vernetzt, sondern wo sie auch mit einer Form der künstlichen Intelligenz, nicht nur mit Daten, sondern auch mit ihrer »intelligenten« Verarbeitung verknüpft ist. Diese Technik greift nicht nur auf den Körper zu, sondern auch auf den Geist. Und am Ende auch auf das, was man Seele genannt hat. Wearable Technology will nicht nur immer weiter hinaus in die zweite Wirklichkeit der Datenströme. Sie will zugleich immer tiefer in die Innenarchitektur eines Subjekts, einer Person, eines Individuums. Was stellt sie dort an? Es ist, scheint es einmal mehr, schneller geschehen als verstanden.
Daher sind die modischen Accessoires der Wearable Technology nicht unabhängig zu denken von jener anderen Entwicklung von elektronischen Devices, die weniger der sichtbaren Aufrüstung des Subjekts als seiner verborgenen Ergänzung dienen, eine Technologie, die nicht allein am Körper, sondern bereits im Körper selber wirkt. Denn nur auf den ersten Blick scheint sich diese Technologie auf den medizinischen Bereich der therapeutischen Hilfsmittel wie Hörgeräte, Herzschrittmacher oder intelligente Prothesen zu beschränken. Längst ist es keine Science-Fiction mehr, aus solchen therapeutischen Hilfsmitteln einen »verbesserten« Menschen zu machen, und wirklich wundern kann es uns nicht mehr, dass sich insbesondere das Militär für einen solchen digital verbesserten Menschen interessiert.
Während die Menschen, wieder einmal gepackt an den Schwachpunkten ihrer Autonomie, der Dialektik von Freiheit und Kontrolle, sich digital aufrüsten lassen, werden die Maschinen »menschlicher« gemacht. So ist auch Wearable Technology nicht so sehr ein Angebot von »kleinen Maschinen«, die der Mensch beherrschen konnte wie die Küchenhilfen, Schreibmaschinen und Automobile der analogen Zeit. Vielmehr handelt es sich dabei um Schnittstellen zwischen Körpern und Maschinen, deren eigentliches Wesen weder in den Anleitungen noch in den Praktiken der kleinen elektronischen Helfer und Kontrolleure zur Erleichterung des Alltagslebens liegt. Die Technik, die in aller Regel (noch) an die Smartphones als Steuerungs- und Verarbeitungseinheiten gebunden ist, agiert nicht zuletzt als weiterer Datenschwamm, der immer neue Funktionen (das Öffnen von Hotelzimmern und das Bezahlen von Tickets und Cocktails eingeschlossen) mit immer neuen Transformationen und Steuerungen verbindet. Doch ihr Rückkopplungseffekt ermöglicht mehr als das: Der technologisch verstärkte Körper fühlt sich zugleich stärker und schwächer. Es entsteht eine Form der Abhängigkeit, der man nur schwer wieder entkommt, so wie man es vordem durch die neuen Formen der Abhängigkeit von Laptops, Smartphones oder Tablets erlebt hat. Es ist nicht so sehr die Frage, ob ein Leben ohne die Devices möglich wäre, sondern ob es ohne sie noch vorstellbar ist.
Wie alle Konsumobjekte, die stets mehr als »Gebrauchsgegenstände« sind, nämlich auch Spiegelung und Porträt des Besitzers oder der Besitzerin, hat auch die Wearable Technology, da sie ebenso in einer Geschichte der Moden wie in einer Geschichte der Technologien steht, eine Innen- und eine Außenwirkung. Man will mit diesen Devices nicht nur etwas in sich selbst bewirken (eine neue Erzählung seiner selbst kreieren), sondern auch seiner Umwelt etwas mitteilen. Wearable Technology entwickelt sich daher in Wellen zwischen Miniaturisierung und »Protz«, zwischen Verbergen und Ausstellen, Aggression und Rückzug. Denn auch hier gilt der unauflösbare Widerspruch von Dabeisein und Anderssein, Anpassung und Wettbewerb. Dem folgt auch eine Dramaturgie des Wechsels von Infantilisierung (»Es ist doch nur Spielzeug …«) und ernsthafter Distinktion (»Dies ist der Porsche unter den Kopfhörern« und Ähnliches ist in der einschlägigen Presse zu lesen), und während sich etwa die Technologie von Smartphones beliebig preiswert gestalten lässt – das regelt der Markt, wie man so sagt –, lässt sich das Gehäuse auch beliebig »gentrifizieren« (wenn es sein muss durch Edelsteinbesatz oder, wie beim Poseidon von 8848 aus China, mit einer Hülle aus Krokodilleder und einer Schweizer Präzisionsuhr, von Kari Voutilainen designt, mit denen ein solches Gerät auf einen Verkaufspreis von rund 4000 Euro kommt). Wearable Technology verrät, was im textilen Code schon nicht mehr so einfach ist, beinahe alles über ein Subjekt: ein Konzept, einen Status und einen Geschmack (oder eben den offensiven Mangel daran).
Wearable Technology verknüpft zwei soziale Steuerungsmodelle des Begehrens, nämlich das nach der technischen und das nach der modischen Teilhabe. Es ist nicht nur die Lust am Haben und Benutzen, sondern auch die am »Drinsein«, die diese digitale Aufrüstung des Körpers so attraktiv macht, selbst wenn man gelegentlich durchaus zweifeln mag, ob man nun den neuesten heißen Scheiß auf dem elektronischen Zubehörmarkt wirklich braucht. Weder der reine Nutzen (der vielerorts wesentlich geringer und wesentlich weniger breit gefächert ist, als man zunächst vermuten mag, weshalb auch so dringlich die digitale Jubelpresse benötigt wird, deren glorreiches Wirken uns für dieses Buch gute Dienste leistete) noch die reine Dekoration des Selbstbildnisses, sondern eine vergleichbar komplexe Verknüpfung von beidem macht den Reiz von diesen neuen magischen Dingen aus, ohne die sich möglicherweise die nächste Generation nicht mehr in den öffentlichen Raum trauen wird, so wenig wie die gegenwärtige ohne ihr Smartphone. Wearable Technology geht nie im reinen »Zeigen« auf (wie der Besitz einer sündhaft teuren Armbanduhr), sondern ist immer in eine gesamte Performance einbezogen. So drückt sich konsequent Dynamik aus. Das Ding wird nie zum reinen Besitz und Fetisch, und es setzt ganz gewiss keine Patina an. Man wird es gewiss nicht »vererben«. Es ist ausschließlich auf den subjektiven Gebrauch bezogen: eine Narzissmus-Maschine. Während des Gebrauchs korrespondieren der Nutzer und die Wearable Technology. Sie sprechen miteinander, und das ist gelegentlich durchaus wörtlich zu nehmen. Man gibt einander Befehle, Empfehlungen oder Ratschläge. Der Kopfhörer sagt »5, 4, 3, 2, 1 – los« und schaltet dann auf iTunes-Musik. Dann mahnt »er« – beliebter indes ist eine Frauenstimme –, dass man zu langsam sei. Man könne das besser, andernfalls werde man seine Zielzeit verfehlen. (So jedenfalls macht das der Fitnesskopfhörer Sport Pulse Wireless von Jabra.) Dieser Kopfhörer ist zugleich Partner, Trainer, Zuschauer und, wenn es sein muss, Tröster. »Macht nichts, beim nächsten Mal wird es besser.« Das Headset ist dabei freilich auch ein medizinischer Begleiter: Es misst die Herzfrequenz im Ohr und achtet darauf, dass es der Sportsfreund nicht übertreibt. Die fordernde ist immer zugleich eine fürsorgliche Maschine, wenn sie dem Subjekt unterworfen scheint und das Subjekt unterwirft.
Ob die Menschen ihre Maschinen oder nicht doch die Maschinen die Menschen beherrschen, ist als Frage so alt wie es Maschinen sind, die nach getaner Arbeit nicht einfach verschwinden wollen. Durch die »unendliche« Vernetzung, durch das Wirken der weltumspannenden Datenkraken à la Google und Facebook und schließlich durch das, was man mit dem etwas aus der Mode gekommenen Begriff der »Künstlichen Intelligenz« belegt hat, erhält sie freilich eine neue Dringlichkeit. Neuerlich »verschmelzen« Menschen mit ihren Maschinen, so wie sie es in ihrer Geschichte schon mehrfach erprobten, und so wie sie immer wieder an die Grenzen von Subjekt und Objekt gelangten und sie neu ziehen mussten. Neuerlich hat das eben nicht nur praktische und semantische, sondern auch psychologische und philosophische Folgen. Das mit Wearable Technology ausgestattete Subjekt ist ein anderes als das vorherige, so wie die in den Netzen verbundene Wahrnehmung der Welt eine andere ist als die vorherige, und so wie das soziale Verhalten mit »intelligenter«, vernetzter, digitaler Technik am und im Körper ein anderes ist als das vorherige. Wenn wir, was sich noch nicht ganz vermeiden lässt, auf die analoge Wahrnehmung unserer Umwelt zurückschalten, erschrecken wir nicht selten vor dem asozialen, blinden und verwirrten Verhalten unserer Mitmenschen und vor der »wirklichen« Verwahrlosung unserer Welt, die unsere kleinen, magischen Instrumente so gekonnt ausblenden.
3
Was den ideal »funktionierenden« Menschen dieser Zeit ausmacht: Eigenverantwortung, Initiative, Performance, Kreativität, Produktivität, Beweglichkeit, Frustrationstoleranz, »positives Denken«, Ausdauer. Die Belohnungen für die Entfaltung dieser Tugenden sind: Erfolg, Gewinn, Privilegierung, Bewunderung und, nicht zuletzt, eine besondere Form von Freiheit. »Alte« Tugenden, die außerhalb dieses Kanons liegen, werden nicht nur nicht geschätzt, sondern als heftiges Hemmnis auf dem Weg nach oben, ins Freie empfunden. Jemand, dem man ein Wissen, eine Weisheit gar, erst abverlangen müsste, wird eher wegen seiner Verweigerung verachtet als für seine Zurückhaltung geschätzt. Und Zöllner, die jemandem eine Weisheit abverlangen könnten, waren schon zu Brechts Zeiten rar, sie sind derzeit nicht einmal mehr vorstellbar, auch und schon gar nicht in Gestalt von Fernsehmoderatoren.
Die Eigenschaften des idealen Menschen in der neoliberalen Phase des Kapitalismus generieren zwar ein subjektives, marktgerechtes Empfinden von individueller Freiheit, lassen sich aber sehr viel konkreter als Techniken der Kontrolle beschreiben, bei denen nicht mehr so leicht anzugeben ist, ob der »Locus of Control« intern oder extern zu finden ist: Er liegt zugleich tief in der Seele des Subjekts und weit draußen in den Informations- und Bilderströmen der elektronischen Netze. Dieses Empfinden, dass man gleichsam zweimal lebt (aber beide Male allenfalls halb), einmal in der analogen, einmal in der digitalen Welt, scheint auch weniger Technologie-kritische Zeitgenossen zu erfassen. Vor den Gefahren, nach Besuchen der Virtual Reality nicht mehr vollständig in die erste Wirklichkeit zurückkehren zu können, warnt zum Beispiel die Deutsche Welle in einer Folge ihrer Sendereihe »Shift« zur digitalen Technologie.5 Aber was ist das »Wirkliche« und was der Schatten? Wearable Technology drückt ein großes Versprechen aus, nämlich diese beiden Leben wieder zusammenzubringen, die Spaltung des Menschen in einen Körper und in einen Datenschatten rückgängig zu machen. Der Schatten wird aus der digitalen Welt zurückgeholt, aber gleichzeitig wird auch der Körper unwiderstehlich in den digitalen Raum gesogen.
Es versteht sich, dass der ideale Mensch des Neoliberalismus, fit, frei und kreativ, alles begrüßt, was seine positiven Eigenschaften zu verstärken und ihn von Hemmnissen dabei zu befreien verspricht. Die Oszillation des Locus of Control spielt dabei eine bedeutende Rolle: Positive Rückmeldungen entstehen durch Transferprozesse zwischen dem individuellen und dem allgemeinen Ort der Kontrolle. In den Exzessen der Selbstkontrolle wird der lustvolle Kurzschluss zwischen Anforderung und Wunsch genossen. Welch Triumph des Subjekts, nicht nur zu wollen, was man soll, sondern es gleichsam auch selbst erzeugt zu haben! Und welch ein Triumph der Macht, dass sich ihre Objekte selbst erzeugen!
Die Eigenschaften des idealen Menschen im Neoliberalismus zeichnen sich durch gemeinsame Parameter aus: Sie sind (maschinell) messbar (oder sollen es doch gemacht werden), sie sind technisch, chemisch oder organisch verstärkbar, sie sind abbildbar (gleichsam Material für »bildgebende Verfahren« der sozialen Performance), sie sind »transparent« und dynamisch. Wenn nur das Messbare am Menschen akzeptiert wird, ist das Dogma vom »messbaren Menschen« natürlich leicht zu belegen: Möglicherweise arbeitet die Wissenschaft seit geraumer Zeit nicht mehr daran, den Menschen der Wirklichkeit anzupassen, sondern die Wirklichkeit dem Menschen (dem Homo oeconomicus, um genau zu sein). Der Wert eines Subjekts ist Ergebnis des Wettbewerbs, so wie umgekehrt die Eigenschaften dieses Subjekts auf seine Wettbewerbsfähigkeit konzentriert sind. Eigenschaften, die nicht (direkt oder indirekt) dem Wettbewerb dienen, sind mehr oder weniger irrelevant (oder wenigstens »Privatsache«, insofern sie einem Genuss von Privilegien entsprechen wie für den Manager, der nicht aus seiner Haut kann, der Himalaya-Aufenthalt, der ihm unter der Hand schon wieder zum Wettbewerb wird). Das marktkonforme Subjekt hat marktförmige Eigenschaften.
Umgekehrt sind auch die Mittel, mit denen dieses Subjekt seine »positiven« Eigenschaften verstärkt, konsequent marktförmig. Der Mensch, der sich auf dem Markt kreativ und dynamisch selbst zu verwirklichen trachtet, muss auf der einen Seite radikaler als je zuvor auf sich selbst zurückgeworfen sein – er ist sozusagen sozial nackt und kennt anstelle von Solidarität nur Möglichkeiten taktischer und strategischer Allianzen –, auf der anderen Seite sollte er sich für eine technische Aufrüstung interessieren (für innere Panzerungen und Außenskelette, kurz: für einen Umbau der Leib-Geist-Seele-Einheit. Dieser Mensch ist also eine Kreuzung aus einem molluskenhaften Nerd und einem fitnessversessenen »Macher«.
Das Subjekt im Wettbewerb ist in der Tat insofern »frei«, als es keinem äußeren Normierungszwang unterliegt, sondern eher einem soften Mainstreaming. Nicht, was die Gesellschaft von dir verlangt, ist entscheidend, sondern was auf dem Markt ankommt. Mit Gehorsam und Anpassung allein ist somit kein erfolgreiches Leben (was immer das ist) zu garantieren. Im Gegenteil: Eigenverantwortung, Kreativität und Beweglichkeit erfordern eine Freiheit des Subjekts, die zwar nichts mit einer demokratischen Selbst- und Mitbestimmung zu tun hat, aber doch »eigene Wege« zur Aufgabenerfüllung verlangt. Das offensichtlich sado-masochistische Verhältnis der Menschen zu ihrer Wearable Technology im Freizeit- und Fitnessbereich hat ja »Belohnungen« zu bieten: Leistungssteigerung, Gesundheit, einen Körper, »der sich sehen lassen kann«, soziale Anerkennung, aber auch, um ein mythisches Wort zu zitieren, »Selbsterfahrung«. Ständig ist in diesen Kulten davon die Rede, man wolle seine eigenen Grenzen austesten (als gäbe es einen göttlichen oder natürlichen Auftrag an den Menschen: »Gehe nicht mehr an die Grenzen der Welt, gehe an die Grenzen deiner selbst!«). Die Maschinen am Körper ersetzen ihn keineswegs, sondern erschaffen ihn im Gegenteil noch einmal neu. Der Weg zur eigenen Körperlichkeit führt den Menschen im digitalen Zeitalter durch seine Maschinen und Netze. Die Grenzen meines Selbst bedeuten die Grenzen meiner Welt, muss dieses neue Subjekt erkennen. Es ist, jedenfalls wenn wir unseren dystopischen Narrativen der Art von Ready Player One6 glauben wollen, in sich selbst vereinsamt, allmächtig im eigenen Kosmos, der durch das Begehren und sein Echo erschaffen wurde, das in den Netzsystematiken von Clouds, Quantifizierungen und Algorithmen widerhallt, ganz im Sinne der Profit- und Machtinteressen der Oligopole und Postdemokratien. Dieses neue Subjekt ist ohnmächtig gegenüber allem anderen, dem Fremden, dem Zukünftigen, dem »Natürlichen«. So wie der Freudsche »Todestrieb« den Menschen unsterblich macht, indem er ihn panzert, versteinert und verstummen lässt, so formt der digitale Kapitalismus den Übermenschen aus seinem Verzicht auf Freiheit, Geschichte und Welt. Wir haben kein Wort für die Existenz in dieser neuen (alten) Religion – »Leben« im eigentlichen Sinne ist es jedenfalls nicht.
Entgegen der Bilder, die die Science-Fiction erzeugt hat, führt die elektronische Aufrüstung, die »Cyborgisierung« des Menschen, nicht zu einer totalen technischen Uniformierung (keine Klonkrieger à la Star Wars, auch wenn Menschen sich in gewissen polizeilichen und militärischen Situationen in sehr ähnliche, posthumane Wesen zu verwandeln scheinen), sondern zu einem Ineinander von Individualisierung und Mainstreaming, das wir aus den Objekten von Mode, Freizeit und Geschmack kennen. Wenn die digitale Auf- und Umrüstung des Menschen marktförmig geschehen soll, muss sie zugleich Möglichkeiten des Einschreibens und der Differenzgewinne bieten. Daher steht die digitale Aufrüstung durchaus in einem dialektischen Verhältnis zu einem anderen Extrembild: dem »nackten« Menschen. Das Science-Fiction-Bild einer zur dystopischen Zukunft verdammten Gesellschaft zeigt eine »brutale« Trennung zwischen Maschinenmenschen und nackten Barbaren. Wearable Technology macht hingegen deutlich, dass diese Extreme nicht unbedingt einen Widerspruch bilden müssen. Der Körper wird weder zum Verschwinden gebracht noch sich selbst überlassen. Eher entsteht etwas, was man eine kontrollierte Nacktheit nennen könnte. (In anderem Zusammenhang, nebenbei bemerkt, heißt so etwas »Pornografie«.)
Diese Aufrüstung, die sich ganz besonders in jenen Accessoires ausdrückt, die wir als Wearable Technology in diesem Buch beschreiben, hat ein Doppelgesicht. Sie ist einerseits, überdeutlich, Instrument des Wettbewerbsvorteils, andererseits aber auch ein Versprechen auf »ausgleichende Gerechtigkeit«: Wettbewerbsnachteile etwa könnten mit ihr ausgeglichen werden. In dieser Janusköpfigkeit liegt die Tücke des neuen Objekts: Wearable Technology ist eine Waffe im sozialen und ökonomischen Aufstiegskampf, sie ist aber auch Versprechen einer Abmilderung dieses Wettbewerbs. Sie lässt die brutale Fantasie des robusten, allseits technisch erweiterten Übermenschen auf dem Markt der Eigenschaften zu, aber auch die Fantasie einer Kultur, in der »Behinderung«, körperliche oder geistige Benachteiligung sowie eine Ungleichheit der Chancen technisch überwunden werden können. (Den Rest regelt die politische Ökonomie.)
4
Die Geräte, die unter dem Stichwort der »Wearables« angeboten werden, die Pulsmesser, Datenbrillen, Kopfhörer, Smartphones und -watches, zeichnen sich in ihrer großen Mehrzahl dadurch aus, dass sie Schnickschnack sind, albern, oft ein bisschen infantil, größtenteils überflüssig und eher selten ihren Preis wert. Was aber, wenn genau diese Albernheit, Infantilität und Nutzlosigkeit gerade den Reiz der Wearables ausmachen, die in Wirklichkeit viel eher der Einübung digital-sozialer Praktiken und Performances dienen als einem »ernsthaften« Nutzen? Es ist Spielzeug, aber gerade in seiner Spielzeughaftigkeit ist es so bedeutsam. Niemand muss Angst vor Spielzeug haben, jeder weiß, dass man Spielzeug beherrschen kann.
So würde Wearable Technology zum Pendant des »niedlichen« Roboters, der mit kindlichem Gesicht und rührender Stimme den Menschen nach seinem Begehr fragt und allerlei Schabernack treibt, Fußball spielen oder Bilder kopieren kann. Wenn Wearable Technology die digitale Vernetzung mit einem mehr oder weniger neuen Körpergefühl versöhnen soll, dann versöhnt der niedliche Roboter die maschinelle Produktivität mit dem sozialen Verhalten. Beides dient sowohl der Konstruktion eines gemeinsamen Raumes für menschliche und maschinelle Steuerungen als auch der Verschleierung neuer Techniken und Regelkreise der Kontrolle.
Im Herbst 2015 stellte die Firma Sharp auf der großen japanischen Elektronikmesse CEATEC den ersten Miniroboter mit dem Innenleben eines Smartphones vor. Das niedliche, kleine Kerlchen, das wie eine Kreuzung aus Micky Maus, Butler und Playmobil-Figur erscheint, reagiert auf Sprache und Bewegung, kann sowohl fotografieren als auch gespeicherte Fotos mittels Minibeamer zeigen, und natürlich mit anderen Teilnehmern der elektronischen Welt kommunizieren. Dieser »Robohon« (Größe 19,5 cm) erscheint im Herkunftsland durchaus nicht als bloßes Spielzeug, sondern als treuer und nützlicher Begleiter. Wenn Robohon Anrufe entgegennimmt, dann simuliert er Mimiken und Gestiken der menschlichen Adressaten. Und er kann sozusagen die Gestalt wechseln: Unter anderem kann er die Form eines klassischen Telefons annehmen, um sich dann, ganz Transformers-mäßig, wieder in seine Roboterlein-Gestalt zurückzuverwandeln. Die Wearable Technology nimmt hier also auch räumlich und haptisch eine Erweiterung des menschlichen Aktionsraumes vor. Sie passt sich den Bedürfnissen des Besitzers an und macht sich dann auch wieder an die selbstständige Erledigung von Aufgaben. Sie erscheint in der Kultur der Niedlichkeit, die wir aus Japan unter dem Begriff »Kawaii« kennen, und ist doch viel, viel mehr als ein Spielzeug. Sie ist ganz und gar Maschine und dann wieder ganz und gar »Wesen«.
Der Mensch hegt drei große Befürchtungen gegenüber einer neuen künstlichen, maschinellen Intelligenz. Zunächst ist das die Befürchtung, der neuen Maschine körperlich unterlegen zu sein, was sich zweifellos im Arbeitsalltag an den unterschiedlichsten Stellen längst bestätigt hat und was sich als Fitnesssimulation mit der Wearable Technology bis zu einem gewissen Grad aufhebt: Mensch und Maschine sind ja nicht nur »Team«, sondern sie sind eins, ein gemeinsames Subjekt. Zum Zweiten ist das die Befürchtung, der neuen Maschine geistig unterlegen zu sein, mit der künstlichen Intelligenz, und sei es in Form sekundenschneller algorithmischer Bewegung auf den Finanzmärkten, in Verwaltungs- und Überwachungstechnologien oder bei Schachweltmeisterschaften nicht mithalten zu können, weshalb jedes symbolische Spiel willkommen ist, das den Menschen als »Herrn« und die Maschine als »Sklave« bestätigt. Wearable Technology ist die unterwürfigste Form der Herrschaft. Die Maschine schmeichelt dem Körper und belohnt ihn so lange, bis er seine eigene Maschinenförmigkeit lustvoll akzeptiert. Und drittens fürchtet der Mensch, der Maschine sozial unterlegen zu sein, besonders in Bezug auf eine Weitsicht und ein Beziehungsreichtum, welche das menschliche Subjekt nicht mehr aufbringen kann. In ihrer Erscheinung als Social Bots sind die Maschinen fürsorglicher, barmherziger und hilfsbereiter als die Menschen. Ob ihre Empathie simuliert, durch kognitive Reize ausgelöst oder, irgendwann einmal, »echt« ist, wird an einem Punkt – den uns der fiktive Roboterjunge in Steven Spielbergs A.I. mit seiner wahrhaft grenzenlosen Mutterliebe eindringlich beschreibt – mehr oder weniger gleichgültig, zumal man zur gleichen Zeit etwa in der Neurobiologie und anderen Life Sciences fieberhaft daran arbeitet, auch dem Menschen die Fähigkeit zu »echten Gefühlen« wie zu »freien Entscheidungen« abzusprechen.
Diese drei Befürchtungen des Menschen gegenüber der überlegenen Parallelschöpfung der Maschinen und ihrer künstlichen Intelligenz führen in der populären Mythologie zu einem unabwendbaren »Krieg« zwischen Menschen und Maschinen. Es ist der historisch unabdingbare Aufstand der »Sklaven« gegen ihre einstigen Herren, der mit den Mitteln der Waffentechnologie (Terminator) ebenso geführt werden kann wie mit den Mitteln der Illusionserzeugung (Matrix), denn die Frage, ob es zu einer Herrschaft über die Innenwelt kommen wird oder zu einer Herrschaft über die Außenwelt, ist noch nicht geklärt. Übrigens ist in beiden Fällen die Frage, ob die Maschinen in ihrer künstlichen Intelligenz etwas entwickeln, was die Menschen »Bewusstsein« nennen, höchstens am Rande interessant. Die Maschine mit einem Bewusstsein (I, Robot) erzeugt eher Mitleid als Furcht, ebenso wie das tragische Mischwesen (Robocop).
Die Fantasie vom »Krieg« zwischen Menschen und KI-Maschinen bebildert nur auf die genrehaft drastische Art einen Konflikt, dem sich das derzeit herrschende Gesellschaftsmodell des entfesselten Kapitalismus überhaupt nicht stellen kann. Denn jede Art von künstlicher Intelligenz, Produktivität, Kreativität, Organisationsfähigkeit usw. entfaltet sich unter diesen Bedingungen nur unter zwei Maßgaben: der Profiterzeugung und, damit eng verbunden, dem militärischen Droh- und Zerstörungspotenzial. Die technologische Entwicklung unterliegt außerdem dem kapitalistischen Prinzip der Vernichtung der eigenen Ressourcen: Die Maschine nimmt dem Menschen nie nur Arbeit ab, sondern immer auch die mit ihr verbundene Macht zur Selbstentfaltung. Der von der Arbeit befreite Mensch wird daher alles andere tun, als sich der Philosophie und der Lyrik zuzuwenden, wie es einst verheißen ward; Philosophie und Lyrik werden noch vor dem Mistsammeln maschinisiert. Anders gesagt: Das neue digitale Subjekt des Maschinenwesens ist dem »alten« Menschen nicht nur körperlich, geistig und sozial voraus, sondern setzt auch auf ein eigenes kulturelles Wirken. Es hat, bevor es zu einem der imaginierten Dramen kommt, schon längst alles aus der Kultur eliminiert, was nicht maschinenkompatibel und marktkonform ist.
Dass sich also die künstliche Intelligenz und die digitale Technologie zum »Segen der Menschheit« entwickeln könnten, zur Abschaffung von Hunger, Krankheit, Leid und vielleicht sogar Tod, ist extrem unwahrscheinlich. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass soziale Konkurrenz, die Produktion von Gewinnern und Verlierern, Post- und Antidemokratisierung, neomerkantilistisch bedingte Kriege, die Erzeugung von Hunger als Kehrseite des Reichtums, die Herrschaft von Geheimdiensten als Staat im Staat, Illusions- und Manipulationstechniken des Konsums und der Medienbeeinflussung, die globale Macht von Super-Konzernen, hegemoniale Formen von Herrschaft durch Ausschließung und damit die Entstehung von »Endzeitwelten«, in denen menschliches Leben kaum noch möglich ist und menschenwürdiges schon gar nicht, die digitale Version von Polizeistaat – kurz: dass alle Tendenzen, die wir im Neoliberalismus unserer Tage beobachten, weiter technologisch verschärft werden. So nimmt es vielleicht nicht wunder, dass eine Rebellion der Maschinenwesen (Blade Runner) nicht nur gefürchtet, sondern auch ersehnt wird. Es ist, als wären erst die Maschinen zu jener radikalen Veränderung der Verhältnisse fähig, zu der die Menschen selber sich nicht mehr aufraffen können, weil sie zu erschöpft, zu verblödet und zu verroht sind. Davon handeln schon die Kinder-Träume im Kino wie WALL·E, die Geschichte vom tapferen kleinen Roboter, der den Müll beseitigt, und den verblödeten Menschen, die nur noch in den TV glotzen und Fast Food schlucken können. Die Tücke unserer populären Kultur besteht darin, dass sie nicht einmal darüber lügen muss, was auf uns zukommt.
Aber wie es scheint, ist die Zeit solcher »großen« eschatologischen Erzählungen von Mensch und Maschine auch schon wieder vorbei. Die Felder der Wahrnehmung und des Narrativen differenzieren sich weiter und weiter aus. Überall setzen Gewohnheits- und Trivialisierungseffekte ein. (Einer der etwas alltäglicheren Effekte besteht zum Beispiel darin, dass das Wort »Cyber«, das in allen möglichen Zusammenhängen benutzt wurde und eine Zeit lang als Schlüssel für das Schöne wie das Schreckliche der neuen Welt galt, mittlerweile selbst als »nostalgisch« betrachtet wird.) Wer könnte sich noch wirklich aufregen über das autistische Gebaren von Smartphone-Benutzern im öffentlichen Raum, über die Gleichzeitigkeit der Siegeszüge von Drohnen im »Krieg gegen den Terror«, in der Logistik und auf dem Spielplatz? Tut es doch jemand, kann man nur lächeln, wie man es tut, wenn eine deutsche Kanzlerin das Internet als »Neuland« bezeichnet. Aber was ist mit der Fehleranfälligkeit der Systeme, zu schweigen von allfälligen Hacker-Angriffen und schlichten Betrugsabsichten? Hat nicht das Beispiel der manipulierten Software zur Schadstoffmessung bei VW und anderen Autoherstellern gezeigt, wie die Computerisierung von Systemen, die eigentlich der Verbesserung unserer Lebensqualität oder der Sicherung unserer Umwelt dienen sollen, zum genauen Gegenteil eingesetzt werden kann? Statistisch gesehen enthalten derzeit 1000 Zeilen Computercode zwei bis drei Fehler.7 Das sind vielleicht weniger als bei den Menschen, dafür aber ist es wesentlich schwieriger, diese Fehler zu entdecken. (Wenn es wirklich kompliziert wird, waren ohnehin »russische Hacker« oder »ausländische Geheimdienste« am Werk.) Immer, wenn uns die digitale Welt über den Kopf wächst, wird ein Rückfall ins Analoge propagiert. Je komplexer die digitale Aufrüstung einer Gesellschaft, desto infantiler und zweifellos »blöder« ihre Welt- und Feindbilder.
Natürlich gibt es, auch und gerade unter Jugendlichen, neben digitaler Boheme oder digitaler Subversion, auch eine Form der digitalen Verweigerung. Das stört nicht weiter, zumal es neue Märkte für retromanische Waren eröffnet. Das (temporäre) Bewohnen einer vor-digitalen Welt ist ein Luxus, den man sich, so oder so, leisten können muss. Behaglich erklärt der gestresste Manager, dass er im Urlaub nicht einmal sein Smartphone, geschweige denn irgendeine andere seiner elektronischen Waffen benutze; egal, ob diese Aussage stimmt oder nicht (meistens eher nicht), es wird deutlich gemacht: Der Verzicht auf die Connectedness ist eine luxuriöse Belohnung für ein Leben unter Dauerdruck. Die Mainstream-Strategien, unterhalb der technologischen Avantgarde und noch nicht vollkommen durchdrungen von der »kalifornischen Ideologie« (der Verbindung von Anarcho-Kapitalismus, Hippie-Gewohnheiten, positivem Denken und Technikaffinität), sehen etwas anderes vor, nämlich eine Lösung der »großen« Konflikte in kleinen Schritten und auf partiellen Sektoren. Man macht nicht mehr »Ferien vom Ich«, sondern Ferien von seinen Datenmaschinen. Nein, man macht es dann eben doch nicht. Ein Strand im Jahr 2017 ist eine gewaltige Telefonzentrale für Menschen, die sich eigentlich vorgenommen hatten, im Urlaub »abzuschalten«.
So schließt sich ein Kreis von den »harmlosen« alltäglichen Praktiken im mikrosozialen Bereich zu den fundamentalen Veränderungen von Arbeit, Macht und Gesellschaft durch die digitalen Technologien und die künstliche Intelligenz. Wir wollen versuchen, etwas von den Verbindungen zwischen beiden zu klären, verfolgen, wohin Einübungen, Gewohnheiten und Veränderungen durch den Gebrauch der Wearable Technology führen können, und untersuchen, wie sich die zwei scheinbar so entfernten Felder von Freizeit- und Fitnesstechnologie und künstliche Intelligenz zueinander verhalten.
Backstory: Was bisher geschah
Kurze Geschichte der Computerisierung des Alltags
Im Januar 1982 kam ein interessantes, brotkastenförmiges Gerät auf den Markt, das endlich versprach, das Computerzeitalter, das für die Wissenschaft, für die Geheimdienste und für die Science-Fiction längst angebrochen war, in jedes Haus zu bringen. Mit dem Commodore 64 (C64) konnte man einen ersten Blick in die digitale Welt werfen, die sich damals noch sehr naiv, sehr abstrakt und sehr zweidimensional offenbarte. Das Gerät war die erste und zugleich eine perfekte Erfüllung des Versprechens, das ab 1961 mit der Entwicklung der integrierten Schaltkreise durch Robert Noyce auf die Veränderung der Welt zielte und das 1971 mit der Vorstellung des Mikrochips erneuert wurde: die Ersetzung der Gutenberg-Galaxis durch die digitale Kosmologie. Es kündigte die Nachfolge der Monster-Computer in geheimen Schaltzentralen durch kleine, handliche Geräte für jedermann und jederfrau an. Der Heimcomputer war zuerst ein Spielgerät, dann ein Schreibgerät; Bilder und Texte suchten einen Weg zueinander, das Fenster in die Parallelwelt war zwar groß, der Blick aber doch noch recht begrenzt. Man sah auf dem Bildschirm, der an das Gerät angeschlossen war, gleichsam die Kindheit, die Morgenröte des digitalen Zeitalters.
Das System war noch differenziert in überschaubare und rationale Elemente: ein Eingabegerät, ein Bildschirm und ein Speichergerät (mit anfänglich ausgesprochen begrenzter Kapazität). Die starre Form der Eingabe in einem streng linearen Code der Tastatur mit Reaktion auf dem Bildschirm wurde bald überwunden: Der »Lightpen« erlaubte eine erste Form der direkten Interaktion, der Joystick übersetzte Haptik in Bildkontrolle. Die Maus wurde erfunden, um Eingaben zu beschleunigen und bequemer zu machen. Es folgten Paddles und Grafiktabletts. Schon Mitte der Achtzigerjahre war eine Sprache zwischen der analogen und der digitalen Welt entstanden, die sich aus der eindeutigen Form der Text-Tastatur und aus den organischen, körperlichen Bewegungen von zusätzlichen Eingabegeräten wie Joystick, Maus und Paddle zusammensetzte. Der Weg ging mithin auch hier schon von einer abstrakten Form von Eingabe und Kommunikation zu immer mehr Körpereinsatz beim Nutzer und zugleich zu immer mehr »körpernahen« Abbildern und Reaktionen der Maschinen.
Gewiss hätte damals noch niemand davon gesprochen, dass es von nun an zwei Welten geben würde, in denen man leben könnte und müsste: die analoge Welt der gewohnten Wirklichkeit mit ihren Subjekten und sozialen Interaktionen, mit der »Natur« als Hintergrund, den Codes der Wahrnehmung, die man sich durch Erfahrung und Erziehung aneignen musste; und die digitale Welt, in der man immer mehr »unterwegs« sein konnte, sei es als »Ego-Shooter« (damals natürlich noch in einer zweidimensionalen Form etwa einer am unteren Bildrand befindlichen Abwehrkanone gegen »Space Invaders«), sei es als »Konstrukteur« von Bild- und Text-Elementen, sei es als Suchender in damals zweifellos begrenzten Informationsspeichern. Und schon gar nicht konnte man sich vorstellen, dass das »Unterwegs-Sein« in der zweiten, digitalen Welt unauflösliche Spuren hinterlassen würde. Damals bedeutete weg noch weg; wer seinem C64 den Strom abstellte, der machte ihn auch vergessen, und eine physische Vernichtung eines Magnetbands war so was von endgültig.
Einen weiteren großen Schritt dazu, das Fenster in die digitale Welt zu vergrößern und die kollektive Schöpfung dieser zweiten Welt voranzutreiben, bedeutete 1986 das Betriebssystem GEOS (Graphic Environment Operating System) mit einer neuen grafischen Oberfläche. Die digitale Welt wurde komplexer und vielfältiger. Vor allem begann eine ästhetische Annäherung an die analoge Welt.
Am C64 lernte man – er war ja zugleich Spielzeug für die Kinder des kommenden Computerzeitalters und Einstiegshilfe für die Kleinbürger-Prosumer – eine Ordnung der Welt: Zentraleinheit und »Peripherie«. In den Betriebsanleitungen und im Jargon bürgerten sich die Worte »Master« und »Slave« ein. Man hatte nur ein Gerät, das anschafft und seine Befehle über eine Schnittstelle an mehr oder weniger mechanische Geräte weitergibt, die sie ausführen, ohne zu denken oder gar einen Widerstand zu leisten. Viel wurde erdacht und programmiert, bis diese einfache Ordnung überwunden wurde und man von einer »intelligenten Peripherie« sprechen konnte. Das Verhältnis von (digitalem) Master und (mechanischem) Slave löste sich ebenso auf wie das hierarchische Prinzip der Programmteile. Schnittstellen würden eigenständige digitale oder mechanische Einheiten miteinander verbinden, eines Tages. Die Schnittstellen würden selbst »intelligent«. Zugleich übertraf wiederum die »intelligente Schnittstelle« die Fähigkeiten der analogen Mechanik. Die elektronischen Sklaven begannen schon da den Aufstand.
Im Laufe des Jahrzehnts löste der »Heimcomputer« den Personal Computer ab; GEOS wuchs gewissermaßen mit der Kapazität der Rechner, und es wuchsen auch Ausmaß und Differenzierung in der zweiten Welt, in der nun Texte und Spiele gelagert werden konnten, in der sich linearer und visueller Code überlagerten, und die nach und nach, natürlich zuerst als literarisches Science-Fiction-Gedankenspiel im »Cyberpunk«, auch als solche erkannt wurde. Es entstand eine dritte Wirklichkeit, nach der ersten von Alltag und Geschichte und der zweiten von Mythos und Medium. Eine Wirklichkeit, die die ersten beiden Wirklichkeiten überdecken, verknüpfen und transzendieren konnte. Schon relativ früh war klar, dass sich in dieser digitalen Welt die Verhältnisse von »Basis« und »Überbau« nicht auf die gewohnte Weise würden erhalten lassen, nicht einmal die von Wirklichkeit und Abbildung. Schon am Computergebrauch im Kinderzimmer zeichnete sich ab, wie schwer es sein würde, das Erwünschte (das computergestützte Lernspiel, die Logik des Programmierens), das Geduldete (die abstrakten Ballerspiele) und das Verbotene (politische und sexuelle Obszönität) voneinander zu trennen. Von den »Big Brother«-Effekten ganz zu schweigen. Im Februar 2017 mussten die Behörden in Deutschland den Einzelhandel dazu zwingen, die elektronisch aufgepimpte Puppe mit dem Namen My Friend Cayla aus den Regalen zu entfernen, da sie, mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet, zwar mit ihren kleinen Besitzern mehr oder weniger harmlose Gespräche führen konnte, zugleich aber über einen Bluetooth-Anschluss mit jedem Smartphone verbunden werden konnte und so zum Spionieren im Kinderzimmer einlud.
Der Umweg des Computers über das Kinderzimmer war nicht nur notwendig gewesen, um das digitale Design der Welt in den Alltag zu verpflanzen und das Gerät, das vordem als militärische und wissenschaftliche Drohung gegolten haben mochte, freundlich zu machen (immer wieder würde sich dieser Vorgang des Freundlich-Machens wiederholen, bis hin zur Entwicklung der Parallelschöpfung des digitalen Roboters). Es verschmolz schließlich all das zu einer neuen Form der Sozialisation. So entstand die Idee der »Digital Natives«, die Vorstellung von Menschen, die in diese dritte Wirklichkeit (nach »Realität« und »Erzählung« der Medien) hineingeboren worden waren. Doch mit der Vorstellung von Digital Natives ging zwangsläufig auch die von »Fremdlingen« einher, und das waren nicht unbedingt die Eltern und Großeltern, die sich so dumm anstellten beim Gebrauch von Tastatur und Maus.
Die Kontrolle über die digitale Welt war da noch vollständig. Sie glich ein wenig den alten kulturellen Techniken: Schreiben, Zeichnen, Spielen, Musizieren (bald bekam man mit MIDI einen Standard, mit dem Musizieren auf dem C64 möglich wurde – und einige der damaligen »Elektronik-Rocker« ebenso wie Avantgardisten der »ernsten Musik« benutzten ihn gerne), Konstruieren und natürlich Rechnen. Die große Aufgabe war es, die Erzeugnisse der zweiten Welt zu erhalten. Sie setzten sich zusammen aus eigenen Produktionen (das Programmieren in der höchst einsichtigen Sprache BASIC versprach eine Schöpfer-Herrschaft über die zweite Welt für beinahe jedermann und jederfrau) und aus fertigen Programmen zur Unterhaltung und zur Bildung. Natürlich gab es auch damals schon »schlechte« oder »böse« Programme, aber sie gingen selten über eine grafisch-textliche Äquivalenz von obszönen Witzen oder »pubertären« Fantasien hinaus. Ansonsten versprach der Heimcomputer nichts als kreative Unterhaltung und neue Lernmöglichkeiten.
Natürlich waren es in erster Linie die Spiele, die den Absatz der Heimcomputer befeuerten; sie gelangten, wenngleich in vereinfachter Form, aus den »Arcaden« der kommerziellen Spielautomaten auf den heimischen Bildschirm.8Donkey Kong, Pac Man oder Super Mario etablierten die Fress- bzw. Jump & Run-Spiele. Schon in dieser Pionierphase der Computerspiele entstand das erste Crossover zwischen den Erzählmaschinen der populären Kultur und der zweiten Welt der digitalen Bilder. Superman und Batman, Donald Duck und Micky Maus, Popeye und Tarzan wurden zu elektronischen Spielfiguren. Mindestens genauso bedeutend war es, historische und zeitgeschichtliche Themen als Spielmotive für den Heimcomputer zu benutzen. Zum ersten Mal wurden Elemente der analogen Wirklichkeit als Narrativ in die zweite Welt übertragen. Neben den einfachen Jump & Run-Spielen entwickelte sich das Text-Abenteuer zu einem zweiten Zweig des Entertainments für Heimcomputer. Detektiv- und Schauergeschichten wurden in eine »literarische« Herausforderung zwischen Mensch und Maschine eingebettet. In den Achtzigerjahren wurden allein für den C64 mehr als 15 000 kommerzielle Spiele entwickelt und auf den Markt gebracht. Ein neuer Zweig der digitalen Industrie war entstanden. Heute ist er der mächtigste Zweig der Unterhaltungsindustrie und hat selbst die Traumfabrik Hollywood ökonomisch übertrumpft.
Der Computer aber wurde auch in seiner kleinen Form erwachsener. Der PC war zunächst vor allem ein Arbeitsgerät. So wie der Heimcomputer von der Arcade in die heimische Wohnung kam, kam der Personal Computer aus dem Büro. Er brachte die Arbeit mit ins Haus, und in seiner klobigen Gestalt wollte er auch gar nicht in einer gewöhnlichen Wohnsituation verschwinden. Zu seinem Wesen gehörte es, dass er Arbeitsgerät und Speicher in einem war. Natürlich wurden auch sehr schnell Spiele, und zwar »bessere« Spiele, für den PC entwickelt, aber das durfte nicht das Hauptargument für seine Anschaffung sein. Es kam vielmehr wohl meistens darauf an, dass der PC ein heimisches »Büro« errichtete (ein schamanisches Zauberding im Wechsel von Form und Inhalt der Arbeit an sich). Es war ein wesentlicher Schritt in die Richtung der Subjektivierung von Arbeit und Kapital (eine Investition im Mittelschichthaushalt, die sich nur in Konkurrenz mit anderen realisieren ließ) und die Option auf Verbindung mit einer digitalen Weltseele, die man im Werden sah. Der PC veränderte drastisch die Ordnung in einem Kleinbürgerhaushalt.
Der Heimcomputer wirkte wie ein Spielzeug, das man sorgfältig aufbewahren und einigermaßen rituell aufbauen konnte. Man musste ihn, wenn es keinen eigenen Bildschirm gab, gleichsam in den Fernsehpausen der Familie nutzen. (Natürlich war er auch ein Argument für die Anschaffung eines Zweitfernsehers.) Im Unterschied zu dessen einigermaßen eingeschränkter Mobilität war der PC ganz und gar stationär. Er musste sich nicht Raum suchen, sondern Raum musste für ihn geschaffen werden. Den verbesserten Blick in die digitale Parallelwelt bezahlte man darum zwar mit einer besonderen Form der Raumbesetzung. Noch immer aber konnte man glauben, die zweite Welt sei nichts anderes als eine besonders bequeme und umfangreiche Sammlung der Informations- und Objektwelten, die man aus der analogen Welt kannte: ein bisschen Spielesammlung, ein bisschen Bibliothek, ein bisschen »Abfragen« und ein bisschen Bildergalerie. Vor allem aber bot sie zeitgemäße Beschäftigung. Kaum etwas an der Entstehung dieser zweiten Welt schien bedrohlich. Wenn überhaupt entstanden die Gefahren im Umgang mit den neuen Geräten: Kinder, die zu viel Zeit mit ihrem neuen Spielzeug verbrachten. Eine Abstraktion der Gewalt, Reduktion des ästhetischen Empfindens, Verlust der Lesefreude und Ähnliches. Höchstens langsam bekam man auch Sorgen, man sei in Versuchung, zu viel Arbeit zu Hause zu erledigen; je nach der Lebenssituation war diese Sorge aber auch der Vorschein einer großen Hoffnung, nämlich Familienleben und Arbeit unter einen Hut bringen zu können. Der Personal Computer würde auch einen Beitrag zur ökonomischen Emanzipation der Frauen leisten. Und weil die Beziehung zwischen Mensch und Maschine bilateral war, wurde fürsorglich arggewöhnt, man könne dort vor dem Bildschirm »vereinsamen«. Ganz langsam dämmerte die Erkenntnis, dass man nicht nur alltägliche Gefahren im Umgang mit der neuen Technologie zu bewältigen hatte, sondern dass noch viel größere Gefahren in den Tiefen dieser Technologie lauerten.
Allerdings erwiesen sich in der Tat schon sehr bald besonders brutale Spiele als soziales und pädagogisches Problem. Es war eine neue Erfahrung, dass man vor dem Bildschirm »Menschen« in der zweiten, digitalen Welt sterben lassen konnte. Diese Menschen waren nicht mehr nur Abstraktionen wie Spielsteine oder gelbe Grinsegesichter auf Gespensterjagd, sondern wurden in Spielen wie Commando Libya für damalige Verhältnisse schon recht realistisch dargestellt. Dann kamen die ersten »verbotenen Spiele«, und sie beschränkten sich nicht mehr auf obszöne Handlungen von Strichmännchen. Am Ende der Achtzigerjahre hatten schließlich auch neofaschistische Gruppen das Medium Computerspiel entdeckt und es entstanden Spiele wie KZ Manager oder Türkenjagd. Spätestens mit diesen Titeln merkte man hierzulande, dass es Gefahren gab, die aus dieser zweiten Welt kamen, dass sie bereits in dieser Phase ihrer Entstehung vergiftet war.
Auch andere destruktive Elemente schlichen sich in das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine ein und es gab die ersten Angriffe auf das System. Aber das System entwickelte auch selbst destruktive Elemente wie den berüchtigten Commodore-Eingabebefehl in BASIC:
PRINT 0+""+−0
Die Eingabe dieses Befehles hatte einen totalen und irreparablen Systemabsturz zur Folge. In der Szene kursierte das Gerücht, dass ein POKE-Befehl, also die Ablage einer Information an einer bestimmten Stelle im Arbeitsspeicher, im Zusammenhang mit einem bestimmten Befehl zum Durchbrennen einer Diode führen würde. Das war zwar eine Legende, aber es illustriert sehr genau, wie sich zwischen diesen beiden Welten ein aggressives Potenzial bildete. Die dritte Wirklichkeit warf Falten.
Von da an ging alles sehr schnell und von wesentlich weniger Aufregung begleitet. Der Laptop ergänzte und begleitete den PC und brachte den Computergebrauch in viele Räume, die ihm vorher verschlossen waren. Während sich Spiel und Arbeit dabei entgrenzten und kein Mensch, der sich in einer Karriere wähnte, lange darauf verzichten konnte, sich im ICE, im Flughafen, im Café oder auf der Parkbank mit seinem tragbaren Computer zu beschäftigen, entfaltete sich auch eine neue Art des Designs. Zuvor hatte der Computer mit seiner Form vor allem seinem Benutzer Versprechungen gemacht; der Laptop aber wurde zum Statussymbol; der Nutzer »verschwindet« zugleich hinter ihm, wie er sich durch ihn zeigt. Nahezu jeder Raum lässt sich mit einem Laptop oder, eleganter, einem »Notebook« besetzen. Zur inneren kam die äußere Mobilität, und schon hier zeigte sich, dass sich das technologische Ding mit einem modischen Accessoire verknüpfen ließ. Die Marke spielte nun eine wichtige Rolle, und eine Parallelgeschichte der Digitalisierung begann: Der »Siegeszug« von Apple, der im Übrigen damit begann, dass sich die Meinung durchsetzte, die Geräte dieser Marke seien ganz besonders von »kreativen« und grafisch orientierten Nutzern geschätzt, verknüpft sehr offensichtlich Technik mit Stilfragen.
Immer noch freilich war der Computer ein »Gerät«, das eine sehr genaue und lineare Beziehung zwischen dem Menschen und der Maschine definierte. Mittlerweile war aber das »Herz« des Computers, der »Chip«, längst in die verschiedensten Lebensbereiche gelangt und machte Vorgänge wie das Wäschewaschen, das Rasieren, das Telefonieren etc. »intelligent«. Die Digitalisierung der Welt vollzog sich nun auf zwei Ebenen, nämlich auf einer offenen und performativen Ebene, dem öffentlichen Gebrauch von manifesten Computern mit ihrem urtümlichen Charakter der Verknüpfung von Schreibgerät und Bildermaschine, Kontrolle und Ausführung, und auf der verdeckten Ebene, der Chip-Steuerung der Technologien von Aufzügen, Ampeln und Beleuchtungen, eine im Selbstverständlichen verborgene Form der Digitalisierung. Etwa zu dieser Zeit begann auch die Marktreife des mobilen Telefons, in Deutschland »Handy« genannt, das zunächst (in noch recht wuchtiger Gestalt) zum Statussymbol für besonders agile Geschäftsleute wurde – in einem Film wie Wall Street ist es nachgerade das Emblem des boomenden Finanzkapitalismus –, bis es schließlich, in nun wirklich handlicher Form, zu einem selbstverständlichen Kommunikationsgerät für mehr oder weniger alle wurde. Der Gebrauch wurde nach und nach nicht nur erleichtert (durch Größe, Preis und Handhabung), sondern auch gleichsam erzwungen (nur zum Beispiel wurden mancherorts die SOS-Telefone an den Autobahnen abgeschafft, weil man voraussetzte, dass alle Verkehrsteilnehmer ein mobiles Telefon besitzen; Buchungen und Bestellungen wurden nur möglich anhand von Mobiltelefonnummern, das Online-Banking setzte eine Übertragung von TAN-Codes auf das Handy voraus – Transaktionsnummern, die einen Buchungsvorgang personalisiert sichern, usw.). Zu Beginn des neuen Jahrtausends war ein Leben ohne Mobiltelefon bald nur noch denkbar schwer vorzustellen.
Nun begann eine weitere Welle der Aufrüstung und der fortschreitenden digitalen Erweiterung der Möglichkeiten, von der Fotografie über Rechenfunktionen, Landkarten und Internetanschluss – bis schließlich dem Smartphone, das uns nun als Schlüsselelement der Wearable Technology begegnet, ironisch nachgesagt wurde, man könne mit ihm »sogar telefonieren«. Im Hybrid des Tablets als Mini-Computer, Musik- und Bildermaschine entstand eine zweite Produktlinie des digitalen Mehrzweck- und beinahe schon Allzweckgerätes. Beiden gemeinsam war es, dass sie nun nicht mehr allein äußere Geräte mit abstrakten Bedienungen waren, sondern auch mit dem Leben, mit den Biografien und Körpern ihrer Benutzer immer intensiver verschmolzen. Aus einem »Kasten«, in den der Mensch »hineingeht«, um in seine zweite, digitale Wirklichkeit zu gelangen, war das tragbare und intelligente Mini-Objekt geworden, das den genau umgekehrten Weg vorschrieb: Die zweite, digitale Wirklichkeit eroberte sich immer weitere Areale der materiellen, der wirklichen, der natürlichen und der öffentlichen Welt. Die alten haptischen und akustischen Kommunikationsformen, die ihrerseits nie vollkommen »privat« geblieben waren, verbanden sich mit den neuen Kommunikationsformen der Sprach- und Bildübertragung im SMS- und Internetgebrauch. Beide Geräte waren nahezu überall einsetzbar, beide wiesen einen hohen Grad an sozialer Performance auf. Wearable Technology war entstanden. Die Glocke, der Außenpanzer, die Vernetzung, kurz: eine neue Einheit von Menschenkörper und digitaler Technologie, die den großen Vorzug hatte, zugleich auch »modisch«, »angesagt«, »dekorativ« und »persönlich« sein zu können. Mit Wearable Technology zeigt sich der Mensch des 21. Jahrhunderts nicht nur gern in der Öffentlichkeit, er zeigt sich auch durch sie. Das Smartphone übernimmt schließlich, etwa in der Eisenbahn, auch Aufgaben der Bezahlung, der Identifikation, des Belegs, des ökonomischen Verkehrs. Man spricht nicht nur unterwegs, man »bankt« auch unterwegs, man weist sich aus, man bestellt, man orientiert sich in der Stadt und auf dem Land. Und höchstens kleine Kinder tun es noch mit einem gewissen Staunen und triumphaler Freude – wir anderen tun es »mit der größten Selbstverständlichkeit«. Anders als beim Heimcomputer, beim PC und noch beim Laptop oder Notebook ist die digitale Kommunikation keine Unterbrechung des alltäglichen Geschehens mehr, keine Tätigkeit mit festgelegten Dramaturgien (wie etwa einem Ein- und Ausschalten, einem Platznehmen und dem Augenblick der Konzentration), sondern beiläufiger Bestandteil dieses Alltagslebens, für den man weder den Spaziergang noch den Einkauf oder die sportliche Betätigung unterbrechen muss. Umgekehrt aber hat das Gerät zu alledem etwas beizusteuern. Mit dem Smartphone beginnt die digitale Kommunikation ganz und gar körperlich zu werden; so wie es den Raum bejaht, bejaht es auch den Körper. Scheinbar.
Kurze Geschichte des Dings und seines Gebrauchs
Mit dem Ding, das man besaß, drückte man einst seine feste Beziehung in Zeit und Raum aus: Es war das, was den Wohnraum definierte, und es war das, was man seinen Kindern vererbte, so wie man es schon von seinen Eltern übernommen hatte. Dieses Ding war wertvoll durch seine Stabilität, aber auch durch sein Alter selbst. Die Patina legitimierte den Besitz als Ausdruck von Genealogie und Tradition. »Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!«, heißt es im Faust. Es war eine Konstruktion von Wert, die in dieser Beziehung steckte. Das Ding verlieh Würde, so wie man umgekehrt seine Würde im Umgang mit dem Ding beweisen musste. Noch der nomadische Cowboy hat selten etwas Wertvolleres als die Uhr, die er vom Vater, und den Ring, den er von der Mutter bekommen hat. Dazu die Pistole und den Sattel, die ihn erst zu dem machen, was er ist, und die er ums Leben nicht herzugeben bereit ist. Es gibt eine Geschichte der magischen Dinge, von Dingen, die eine besondere Einheit mit ihren Besitzern bilden, und vielleicht bilden die Wearables ein neues Kapitel in dieser Geschichte.
Das Ding hatte aber noch eine andere Funktion. Es war Teil einer bedeutenden Ordnung des Hauses, die Aristoteles die »oikonomia« nannte. Daraus entwickelte sich, weniger geradlinig als man denken mag, das, was mittlerweile als Ökonomie gilt. Die oikonomia aber beschrieb, wie jedes Ding (und jeder Mensch) in einem wohlgeführten Haushalt an seinem rechten Platz war, bereit für den Gebrauch, aber auch nach einer gewissen Ästhetik geordnet. Der Besitz von Dingen ist nur sinnvoll innerhalb einer solchen oikonomia, die begrenzt wird auf der einen Seite von einem luxuriösen Überfluss (zu viele Dinge in einem Haushalt stören die oikonomia ebenso wie es die falschen Dinge tun) und von einem spürbaren Mangel (eine Unordnung der Armut und der Obdachlosigkeit als Extrem, wobei das Fehlen eines Dings an seinem ordentlichen Platz so sehr von pekuniären wie von semantischen Defiziten künden kann). Entscheidend ist: Die Dinge, die ein Haus und seine Bewohner besitzen, sind nicht nur Ausdruck einer oikonomia